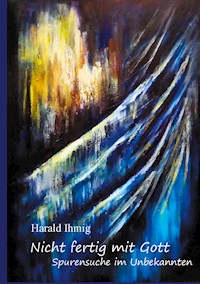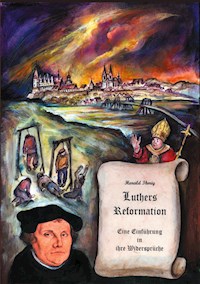Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wollen wir leben - wie wollen wir arbeiten? Diesen Fragen geht die im Dialog mit Studierenden entstandene Studien nach. Sie analysiert im Ausgang von A. Smith die Aporien der marktgesellschaftlichen Assimilierung von Lebensweisen und Sozialer Arbeit und setzt ihr die Orientierung an einem Eigen-Sinn entgegen. Sie aktualisiert dabei Traditionen, die das Lebensinteresse nicht auf ökonomische Bedarfsdeckung, unbegrenzten Erwert und Akkumulation von Wert - Geld und Geldung - reduzieren. Im Anschluß an Aristoteles gilt ihr Soziale Arbeit nicht als Handwerk, Dienstleistung, Management, nicht einmal als Arbeit, sondern als - dialogische - Praxis, dh. als Tätigkeit, in der das Beste in uns zur Vorschein kommt und wir mit Muße präsent sind in dem, was wir tun. Eine weitere Herausforderung sind christliche Formen, dem Lebenssinn Liebe Gestalt zu geben. Die Zuwendung zu (Rand-)Personen wird zum Kampf gegen das Unrecht verschärft und zur Perspektive eines "Gemeinwesens Erde" erweitert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Hinführung
1.1 Was ist Ethik?
1.2. Braucht Soziale Arbeit eine Berufsethik?
Von der Ethik zur Ökonomie – Lebensdevisen in einer Marktgesellschaft
2.1. Adam Smith und das natürliche System der Interessen
2.1.1. Die Verheißung: Produktion von Wohlstand
2.1.2. Die Marktverteilung: Lohnarmut und Kapitalreichtum
2.1.3. Produktive Arbeit und Kapitalakkumulation.
2.1.4. Ökonomische Rationalität und Logik des Marktes.
2.1.5. Wohlstand der Nationen - Theorie der ethischen Gefühle.
2.1.6. Das Vermächtnis einer kommerziellen Gesellschaft
2.1.7. Entwicklungslinien
2.2. Wertschätzung in der Marktgesellschaft
2.2.1. Wertschätzung als Verwertungsinteresse
2.2.2. Marktwert und Selbstwert – Aneignungsprobleme
2.2.3. Wert und Würde, Wert und Sinn
Ökonomisierung als ethisches Problem.
3.1. Ökonomisierung der Gesellschaft
3.1.1. Gesellschaft als marktgesteuertes System der Interessen
3.1.2. „Unternehmen Hamburg“ – die Übernahme des Staates.
3.2. Ökonomisierung Sozialer Arbeit
3.2.1. Motive der Einführung des ökonomischen Modells
3.2.2. Instrumentarium und „Philosophie“
3.3. Ökonomische Leitbegriffe und Eigen-Sinn Sozialer Arbeit
3.3.1. Erster Streitpunkt: Wertschätzung der Adressaten
3.3.2. Zweiter Streitpunkt: Effizienz und Muße
3.3.3. Dritter Streitpunkt: Qualität von Produkten und Miteinander
3.3.4. Vierter Streitpunkt: Dienstleistung und Diensterweisung
Ethische Grundzüge Sozialer Arbeit
4.1. Die Kategorie „Für“
4.2. Die Kategorie „Mit“
4.3 Vorläufiges Resümee
4.4. Bedarf und Sinn - geschichtliche Alternativen.
Wie wird das Leben gut? - Die unbequemen Prüfungen des Sokrates
5.1. Polis und Bios - wie soll man leben?
5.2. Sokrates-Bild und -Quellen
5.3. In der Polis zu Hause
5.4. Philosophieren als Lebensweise
5.5. Güter, das Gute und das Glück
5.6. Prüfen und Gewissheit, Reflexion und Intuition
5.7. Der Prozess gegen Sokrates
5.8. Kurzfassung und Merkposten
Ethik der Selbstverwirklichung - Aristoteles
6.1. Wirtschaft als Werkzeug zum Leben
6.1.1 Die natürliche Erwerbskunst
6.1.2. Die Chrematistik als widernatürliche Erwerbskunst
6.1.3. Finanzwirtschaft als widernatürlichster Gelderwerb
6.1.4. Die Tragweite der aristotelischen Ökonomiekritik
6.2. Das gute Leben
6.2.1. Ziel des Lebens – das Glück
6.2.2. Selbstverwirklichung – Grundzug der Natur
6.2.3. Der Raum des guten Lebens – die Polis
6.2.5. Glück als Tätigkeit in Bestform
6.2.6. Tätigkeit und Genuss
6.3. Schwachstellen der aristotelischen Ethik
6.3.1. Glück und Pech - Schattenseiten des guten Lebens
6.3.2. Machbarkeit und Kontingenz des Glücks
6.3.3. Autarkie-Ideal und wirtschaftliche Verhältnisse Athens
6.4. Merkposten der aristotelischen Ethik für den Lebens-Sinn
6.4.1. Unbegrenzter Erwerb und verfehlter Sinn
6.4.2 Lebensfreude und Vergnügen
6.5. Soziale Arbeit als Praxis – Ertrag der arist. Ethik
6.5.1. Abgrenzung von Arbeit und Produktion
6.5.2. Soziale Praxis als Selbstverwirklichung und Selbstertüchtigung
6.5.3. Soziale Praxis als Selbsttätigkeit in Muße
6.5.4. Notfunktion und politische Dimension
6.5.5. Soziale Praxis als sinnvolle Tätigkeit
6.5.6. Soziale Praxis als Zuwendung - Vorblick auf christliche Tradition
6.6. Capability Ansatz – eine arist. Weiterentwicklung
Ethik der Zuwendung – biblisch-christliche Tradition
7.1. Anknüpfung und Hinführung
7.2. Nächstenliebe und Gottesliebe – alttestamentliches Erbe
7.2.1. Nächstenliebe nach Lev 19
7.2.2.Das Gottesverhältnis als Lebens-Beziehung
7.2.3. Das Gottesverhältnis als Liebesbeziehung
7.2.4. Gottes Liebe als Impuls der Nächstenliebe
7.2.5 Exkurs: Liebe und Ehe
7.3. Lebenssinn Liebe im frühen Christentum
7.3.1. Die Liebe und die Ordnungen – ein Blick voraus
7.3.2. Nächster werden - nach Lk 10, 25-37
7.3.3. Liebe als Lebenssinn -Weiterentwicklung
7.3.4. In der Liebe sein – die andere Seite der Liebe
7.3.5. Ein Hoheslied auf die Liebe - Paulus
7.4. Liebe leben - Praxis der Liebe im frühen Christentum
7.4.1. Kirche als Lebensfeld der Liebe
7.4.2. Liebe institutionell: die Werke der Barmherzigkeit
7.5. Liebe und Ökonomie im frühen Christentum
7.5.1. Selig die Armen - wehe euch Reichen!
7.5.2. Die Lebensverhältnisse der frühen Christen
7.5.3. Gütergemeinschaft – die Jerusalemer Urgemeinde
7.6.4. Armut und Versorgung
7.5.5. Symbiose von Armen und Reichen – die weitere Entwicklung
7.5.6. Einstellung des frühen Christentums zu Arbeit und Erwerb
7.5.7. Begründung und Begrenzung von Arbeit und Erwerb
7.5.8. Der kirchliche "Dienst"
7.6. Praxis und Zuwendung
7.7. Die Freigebigkeit der Liebe – Martin Luther
7.8.1. Luthers Frontstellung
7.7.2. Werterwerb oder Liebe - die Ausrichtung der Personen
7.7.3. Wucher oder Leben gratis - die Verhältnisse und das Verhalten
7.7.4. Exkurs: Kampf gegen Wucher und schimpflichen Gewinn
7.7.5. System der Interessen und Leitmotiv der Liebe – M. Luther versus A. Smith
7.8.6. Blinde Flecken in Werterwerb und Nächstenliebe
Brückenschläge zur Sozialen Arbeit.
8.1. Wohltätigkeit und etwas darüber hinaus
8.2. Ist Wohltätigkeit demütigend?
8.3. Das Leben herauslesen aus den Menschen - für Gott eine Unterkunft suchen. Etty Hillesum
8.4. Soziale Arbeit als dialogische Praxis – Martin Buber
8.4.1. Es-Welt und Du-Welt
8.4.2. Theologische Aspekte bei M. Buber
8.4.3. Rückbiegung oder Ausgehen zum Du
8.4.4. Zwischenmenschliches und ewiges Du
8.4.5. Kritische Anmerkungen
8.4.6. Berufliches Routinehandeln und dialogisches Prinzip
Sinn-Perspektiven Sozialer Arbeit
9.1. Sinn als Besinnung
9.2. eupraxia – Wohlergehen und Lebensführung
9.3. Soziale Arbeit als Kampf um Menschenrechte
9.3.1. Zur Rekonstruktion des Modells
9.3.2. Kommentar zu den Menschenrechten und ihrer Verwirklichung
9.3.3. Menschenrechte und Gemeinwesenarbeit (GWA)
9.4. Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben - Albert Schweitzer
9.4.1. Hinführung
9.4.2. Verantwortung gegenüber allem, was lebt
9.4.3. Menschen und Tiere
9.4.4. Universaler Wille zum Leben – theologisch interpretiert
9.5. Der größere Sinn – Gemeinwesen Erde
Von Fall zu Fall - ethische Perspektiven in der Fallarbeit
10.1. Fälle als Konstrukte
10.2. Sinn-Optionen in der Fallarbeit
10.2.1. Ethische Aspekte bei der Problemstellung
10.2.2. Ethische Fragen bei der Fallbearbeitung
10.2.3. Ethische Fragen bei der Auswertung
10.2.4. Einzel-Fälle
10.3. Abschluss und Ausblick
Literaturverzeichnis
Vorwort
Dieser Streifzug durch die Ethik wurde von den Studierenden der berufsbegleitenden Studiengänge am Institut für Soziale Praxis des Rauhen Hauses und an der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit &Diakonie herausgefordert. Ich danke für Geduld und Zutrauen auf ungewohnten Wegen und die Bereitschaft, eigene Gedanken mit meinen zu verbinden. Der dialogische Charakter dieses Unternehmens musste leider der Buchform geopfert werden.
Entstanden ist kein Handbuch der Ethik, auch keine Revision aktueller sozialpädagogischer Debatten. Ich hoffe, dass das Buch für diesen Mangel durch einen ungewöhnlichen Vorzug entschädigt: es stellt die Soziale Arbeit in den Zusammenhang der die abendländische Tradition prägenden Ethiken von griechischer Philosophie und christlicher Theologie. Dadurch erhalten dieselben eine konkrete Zuspitzung und die Soziale Arbeit einen stark erweiterten Kontext. Der verbindende rote Faden ist die Kritik der herrschenden Ökonomisierung, und der erweiterte Rahmen ermöglicht es, diese Kritik und ihren Gegenpol, eine konsequente Ausrichtung Sozialer Arbeit an ihrem Eigen-Sinn, zu einer fundamentalen ethischen Umorientierung zu erweitern und zu verschärfen Wie wollen wir in einer ökonomisch geprägten Gesellschaft leben?
Dass meine Partner die Geduld aufbrachten, einen weit gespannten Bogen mitzugehen, und die Fähigkeit, ihn in ihren eigenen Arbeiten und Voten zu „erden“, hat mich dazu ermutigt, diesen Versuch trotz mancherlei Bedenken auch anderen Lesern zum Nachdenken vorzulegen – als „Impuls“ aus der Werkstatt unserer Hochschule.
Behandelt werden zunächst ethische Grundfragen (Grundlagen-Phase), dann ethisch geprägte Modelle Sozialer Arbeit (Modell-Phase), schließlich ausgewählte spezielle Fragen derselben (Fall-Phase). Dazu möchte ich den in Sozialer Arbeit Tätigen einen Zugang zu den „klassischen“ griechisch-philosophischen und christlich-religiösen Antworten auf die Fragen „wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten“ eröffnen. Entgegen ihrer üblichen Systematisierung, in der ökonomische Aspekte nur marginal vorkommen, suche ich diese Traditionen, die menschliches Leben und Handeln an seinem Sinn orientierten statt an Erwerb und Gewinn, als grundlegende Gegenpole zur ökonomischen Dominanz zu erschließen und zu aktualisieren. Das Tagewerk und die Sache Sozialer Arbeit in diesem ungewohnt weiten Sinnzusammenhang zu sehen und zu bedenken, verfolgt also die Absicht, Alternativen zu der gegenwärtig vorherrschenden Ökonomisierung ihrer Profession und der Invasion marktgesellschaftlicher Denk- und Handlungsmuster wach zu rufen und ihren Eigen-Sinn zu profilieren.
Im Ausgang von Adam Smith wird die Ablösung von Ethik durch Ökonomie charakterisiert Wiewohl das „System der natürlichen Interessen“ allgemeinen Wohlstand verheißt, sorgt die „natürliche Ordnung“ seiner Verteilung – der Markt - tatsächlich dafür, dass sich das Einkommen der Unterschicht in der Regel um das Existenzminimum herum einpendelt. Und während Smith in der Arbeit in der arbeitsteiligen Mehrwertproduktion die Quelle des Wohlstands sieht und dem durch Fleiß und Sparsamkeit stetig gemehrten Kapital nur eine dienende Funktion zuschreibenmöchte, ist die Kapitalakkumulation und nicht die Förderung von Arbeit und Arbeitern tatsächlich das dominante Motiv und eigentlicher Zweck der Systems. Weil das Wirtschaftssystem sich kraft seiner expansiven Dynamik ins Zentrum der Gesellschaft setzt und seine Logik dem Zusammenleben insgesamt aufprägt, wird aus der Marktwirtschaft eine Marktgesellschaft. Die Relation der Marktpersonen hat Smith auf die brillante Kurzformel gebracht, die Eigenliebe des anderen zu seinen eigenen Gunsten zu interessieren. So stellt sich aus den puren (Aneignungs-) Interessen und ihrer Verschränkung ganz von selbst „das einfache und einsichtige System der natürlichen Freiheit“ her. Vernunft wird zu ökonomischer Rationalität, der Mensch von einem politischen Wesen zu einem homo oeconomicus mit dominantem Interesse an Gelderwerb und Kapitalbildung. Die Theorie – bei Aristoteles die erhabene Anschauung des Ewigen in Muße - wird zur Hilfswissenshaft der Geschäfte, des business. Als Eigentümer seiner selbst steht es ihm frei, seinem eigenen Vorteil und seinen selbstbezogenen Interessen nachzugehen, die wesentlich Aneignungsinteressen sind. Zwar will der Ethiker Smith im engeren Umkreis die Sympathie als Überschreitung des natürlichen Eigeninteresses aufrechterhalten, aber das Wohlwollen, als zu schwach in der menschlichen Natur verankert, kann Gesellschaft nicht konstituieren entgegen den stärksten Antrieben der Selbstliebe und bleibt der Fürsorge der Gottheit überlassen, die das Universum optimal geschaffen hat. Ethik im traditionellen Sinne einer Liebe, die sich anderer annimmt, ist in diesem kommerziellen System überflüssig und exterritorial. Mit dem selbstregulativen System der Eigeninteressen, das die von Gott konstruierte kosmische Glückmaschinerie abbildet, ist Ökonomie der Ethik aus dem Ruder gelaufen.
Wie diese Entwicklung von Kaufleuten, die wir alle sind, zu Schaustellern ihrer selbst fortschritt, die sich auf Märkten und Bühnen selbst inszenieren und möglichst gut zu verkaufen suchen, wird in einer eigenen Untersuchung der Wandlung zwischenmenschlicher Wertschätzung zur Verwertung weiterverfolgt. Seit der Frühphase kapitalistischer Marktwirtschaft wurde diese Wert-Schätzung von Waren – ihrer Nutzbarkeit (Gebrauchswert) oder ihres Tauschwerts – auf Personen übertragen. Sie war mit dem Aufkommen eines Arbeitsmarktes gegeben, auf dem sich freie Arbeiter, die nur über sich selbst, nicht aber ihre Produktionsmittel verfügten und ihre Arbeitskraft zu Markte tragen mussten, damit für andere verwertbar machten. Mit der Erweiterung zum Persönlichkeitsmarkt, auf dem individuelle Eigenschaften abgefordert und zur Schau gestellt werden, scheint so etwas wie Selbstwert über den Marktwert erwerbbar zu sein, sei er in Geld bemessen, in Geltung, Status oder Prestige. „Die Jagd auf den Wert“ (Marx) wird zur zentralen Dynamik der Marktgesellschaft. Meine Kritik ist, dass nicht nur die Hoffnung auf Aneignung von Selbstwert illusorisch ist, weil in sich widersprüchlich, sondern auch Liebe, Würde und Sinn unterminiert werden. Sie basiert darauf, dass Wert unentrinnbar Verwertbarkeit impliziert.
In diesen Rahmen der Ökonomisierung der Gesellschaft wird die Assimilierung der Sozialarbeit gestellt, In 5 Streitpunkten werden Leitbegriffe ethisch problematisiert. Der Kundenorientierung wird das andersartige Erbe der Menschenfreundlichkeit konfrontiert, der Effizienz die Muße, der Qualität von Produkten das gelingende Miteinander, der Dienstleistung die Diensterweisung, der Differenz zwischen Unternehmen und Nutzern die Teilhabe. Die dabei vorgenommene Profilierung des Eigen-Sinns Sozialer Arbeit wird weitergeführt in einer Präzisierung der Grundkategorien „für“ und „mit“. Damit findet die Auseinandersetzung zwischen Ökonomisierung und Ethik einen ersten Abschluss, und die Frage nach dem Sinn von Leben und Arbeit kann unter Aufnahme prägender ethischer Traditionen vertieft werden. Als Grundzug der Ökonomisierung stellt sich heraus, dass das Leben von seinem Bedarf her gelebt wird und das Lebensinteresse sich logischerweise auf wachsende Bedarfsdeckung und unbegrenzten Erwerb richtet, bis schließlich die wilde Jagd auf den Wert den Hauptteil des Lebens selbst ausmacht.
Diesem Trend hat unsere abendländische Tradition zwei klassische Gegenbilder entgegengesetzt, die das Leben nicht an seinem Bedarf, sondern an einer bestimmten Auffassung von seinem Sinn orientieren wollen und die Bedarfsdeckung, sprich Ökonomie, begrenzten, um dem eigentlichen Leben Raum zu geben. Diesen Traditionen – griechischer Philosophie und Christentum – wird im Folgenden für eine Ethik Sozialer Arbeit ungewöhnlich große Aufmerksamkeit gegeben, weil, so meine ich, Kritik allein kaum einen Ausweg aus den Aporien von Marktwirtschaft und Marktgesellschaft bahnen wird, wenn uns nicht der Sinn für einen anderen Sinn von Leben von ihr abbringt.
Quer zu den Hauptmotiven einer Marktgesellschaft, dem Wettkampf um Geld, Geltung und Macht, insistiert Sokrates auf der eigentlich menschlichen Aufgabe herauszufinden, was das Leben, dh. unsere eigene Lebendigkeit gut macht. Der Erwerb von Gütern ist es nicht, weder bei solchen, denen das im Überfluss gelingt, noch bei denen, die dabei zu kurz kommen. Was dem Leben Sinn gibt, ist nicht traditionell vorgegeben, nicht in gesellschaftlichen Karrieren entschieden und nicht der Meinung überlassen, es lässt sich auch nicht deduzieren. Es muss in der dialogischen Überprüfung der Lebensdevisen und vor allem der eigenen Ansichten ermittelt werden. Bei dem grenzenlosen Versuch, unser Leben anzureichern, notwendige oder zusätzliche Bedarfe zu decken, bleibt eine Dimension brach liegen: die Suche nach dem, was uns selbst in Bestform (arete) bringt, die „Besserung für unsere Seelen“.
Die Ethik des Aristoteles stelle ich, wiewohl das nicht üblich ist, von der Ökonomiekritik her dar, denn sie ist zentral darauf bezogen. Ich sehe sie unter dem Leitmotiv: Versorgung oder Erwerb - der Kampf für das gute Leben gegen das Ausufern der Ökonomie. Aus der aristotelischen Ethik der Selbstverwirklichung und Selbstertüchtigung lässt sich ein Verständnis Sozialer Arbeit gewinnen, das nicht in Erwerb, Verwaltung oder Dienstleistung, nicht in Produktion oder Management besteht, ja genau genommen nicht einmal Arbeit ist, sondern Praxis. Praxis bedeutet Tätigkeit (Energeia), in der wir uns selbst gewinnen und engagieren, „ins Werk setzen.“ Sie ist Handeln, bei dem das Beste in uns zum Vorschein kommt und wir mit Muße präsent sind in dem, was wir tun. Dieser ethischen Aufgabe ist auch die Polis gewidmet, das Gemeinwesens, das dafür zu sorgen hat, dass „kein Bürger an Lebensunterhalt Mangel leide.“
Mit Martha Nussbaum wird der Begriff der Fähigkeit/Tugend zu Kompetenz weiterentwickelt, der die Voraussetzungen einschließt, die gegeben sein müssen, damit sie ausgeübt werden können.
Das Verständnis von Praxis als einer dialogischen wird an späterer Stelle mit Martin Buber profiliert. Er trifft mit seiner Kritik an der „Rückbiegung“ einen durchgängigen neuzeitlichen Trend und stellt ihm das „Ausgehen zum ‚Du“ entgegen. Die theologische Verankerung hält den Eigen-Sinn der in der Ding-Welt gefährdeten „Begegnung“ wach,
Als zweiter Gegenpol gegen die aktuelle ökonomische Dominanz wird die christliche Tradition als Ethik der Zuwendung für die Sinnorientierung Sozialer Arbeit bedacht. In ihr steht Praxis nicht mehr als eine der Tugendhaften und Privilegierten unter der Dominanz von Selbstertüchtigung und -verwirklichung und schließt die nicht mehr aus, die dem Wohlergehen am fernsten stehen. In alttestamentlicher Tradition hat Liebe praktischen Charakter, ist mehr als Wohlwollen, nämlich Wohltun, und steht denen bei, die Beistand brauchen, den Armen, Mühseligen und Beladenen, den Personen minderen Recht; also jenen gesellschaftlichen Randpersonen, die in der philosophischen Ethik gar nicht vorkamen. Sie besteht darin – in einer alttestamentlichen Wendung – „jemand sein Herz zuzuwenden“. In dieser Linie tauchen dann tatsächlich Frühformen von so etwas wie Sozialer Arbeit auf, die Versorgung von Bedürftigen n den Gemeinden und in neuen Institutionen wie den Herbergen, Hospitälern und Klöstern. Die Muße/Kontemplation muss sich nicht wie bei Aristoteles den höchsten Dingen über uns widmen, sondern kann sich auch auf das Angesicht des anderen richten. Die Liebe ist aber noch mehr als zwischenmenschliches Verhalten, sie ist auch etwas, was uns entgegenkommt und worin wir sein können, Zuwendung Gottes, ja sein Wesen, und damit das Beste, was wir in die Welt bringen können. Die Liebe ist der Sinn des Lebens. Durch diese Besinnung zieht sich die Frage, ob Liebe Leitmotiv Sozialer Arbeit sein kann.
Betty Hillesums feinsinnige Spurenlese, die Suche nach einer Unterkunft für Gott in einer grausamen Gegenwart und die Versuche, das Leben herauszulesen aus den verängstigten Menschen, ist eine eindrückliche Verwirklichung dieser Verbindung von Gottes- und Menschenliebe. Sie erinnert zugleich Soziale Arbeit daran, dass sie über Wohltun hinaus noch mehr im Sinn haben kann.
Martin Luthers kaum beachteter Kampf gegen die Kommerzialisierung des Lebens und sein Insistieren auf der Freigebigkeit der Liebe lässt sich aufschlussreich mit A. Smith’s System der Interessen konfrontieren.
Im Schlussteil der Studie wird der Ertrag dieser ethischen Reflexionen für Sinn-Perspektiven Sozialer Arbeit zusammengefasst und konkretisiert und um das Modell einer Menschenrechtsprofession erweitert. Mit Albert Schweitzers universaler Ethik wird der Einsatz für das Gemeinwesen Erde anvisiert, dem Lebensfeld aller Lebewesen.
1. Hinführung
In den folgenden Überlegungen wird der zurzeit dominanten ökonomischen Prägung von Lebensdevisen und Berufsauffassung eine ethische Besinnung entgegengesetzt. Was ist damit gemeint?
1.1 Was ist Ethik?
Das Wort Ethik hat sich eingebürgert als Bezeichnung einer philosophischen oder auch theologischen Disziplin, seitdem drei Schriften des Philosophen Aristoteles (384-322 v. Chr.) den Titel „äthiká“ trugen; die sog. Nikomachische, die Eudemische und die Große Ethik. Diese Schriften hießen so, weil sie sich mit den äthä befassten, den Sitten, Bräuchen, Gewohnheiten, die das Leben von Menschen prägen; aber so, dass diese nicht einfach ethnographisch beschrieben werden, sondern dass geklärt wird, worum es darin Menschen geht und was sie mit Recht leiten kann, was ihr „äthos“, ihre Haltung, ihre Sinnesart, ihren Charakter, bestimmen sollte.
Diese Schriften des Aristoteles wurden im 4. Jahrhundert v. Chr. verfasst, seitdem ist eine fast unübersehbare Vielfalt von Ethiken entstanden, die sich keineswegs darin einig sind, was Ethik ist. Geht es in der Ethik um Gebote, Normen, Regeln, die wir einhalten sollen, oder geht es um Güter, Werte, Ziele, die wir anstreben sollten? Geht es um die Motive des Handelns und die Gesinnung, oder geht es um die Folgen des Handelns, seine Wirkungen? Geht es um die Pflicht, das Recht, oder geht es um das Glück? All das sind Varianten, die von Ethikern vertreten werden. Ich werde keine bloße Übersicht über dieses Panorama geben oder mit einer eigenen Vorentscheidung beginnen, sondern möchte auf eine möglichst einfache Weise in das ethische Denken hineinführen. Gibt es in der Vielfalt der Antworten vielleicht eine gemeinsame Frage, womit sich die Ethiken beschäftigen?
Von Immanuel Kant stammt eine klassische, viel zitierte Formulierung. In seiner Kritik der reinen Vernunft schreibt er;
„Alles Interesse meiner Vernunft (das spekulative sowohl als das praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen:
1. Was kann ich wissen?
2. Was soll ich tun?
3. Was darf ich hoffen?“1
Was kann ich wissen? Das prüft er kritisch in eben diesem Werk. Was darf ich hoffen? Dies erwägt er in seiner philosophischen Kritik, aber auch Erschließung der Religion (Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793). Die praktische oder ethische Frage lautet nach ihm: Was soll ich tun?
Ich möchte diese Formulierung etwas modifizieren im Rückgang darauf, wie die alten Griechen die ethische Frage gut 2200 Jahre vor Kant formuliert haben, auch schon vor Aristoteles, in der sog. sophistischen Aufklärung. Sie lautete: „wie soll man leben (pos dei zen)?“. Ich stelle also das Tun oder Handeln in den größeren Zusammenhang des Lebens.
Diese ethische Grundfrage „wie soll man leben?“ hatte bestimmte Voraussetzungen. Sie wurde erst gestellt, als für einen Teil der Menschen, Bürger der Polis, des griechischen Stadtstaates, nicht mehr einfach durch das Herkommen, durch den Stand, durch Armut oder Zwang entschieden war, wie man zu leben hatte, sondern die Lebensweise (gr. bios) wählbar geworden war. Wer als Kind von Unfreien geboren wurde, als Sohn eines Bauern oder Handwerkers in einer Ständeordnung, wer ans Haus und die Haushaltung (gr. Ökonomie) gebunden war, hatte keine Wahl, es war vorgezeichnet, wie sein Leben zu verlaufen hatte. Die ethische Frage war ursprünglich die Frage von freien Bürgern, die wählen konnten, konkret von Bürger einer Polis, und zwar der Stadt Athen, dem Urbild eines Gemeinwesens.
Wie sie haben auch wir das Privileg, uns diese Frage zu stellen, und das ist gut so, aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass es auch heute Menschen gibt, die keine Wahl haben oder kaum eine, keine Option auf Lebensweise, und wir werden uns auch zu fragen haben, wie bezieht sich die von uns gewählte Lebensweise auf sie.
Wie wollen wir leben? Das soll also Leitfrage der folgenden Überlegungen sein. Und das schließt die Frage ein, wie wir nicht leben wollen.
Ethik meint also, dass wir nicht einfach dahinleben und wir auch nicht gelebt werden, sondern dass wir unser Leben führen und ihm deshalb eine Orientierung geben. Ethik ist – in einem weiten Sinne – Orientierung unseres Lebens. Sie versucht zu klären, wie wir leben sollen bzw. wollen.
Sollen oder wollen? Dass wir etwas sollen, stößt uns heutzutage eher ab, und entgegen einer langen Tradition, in der das Wollen übergangen oder unterdrückt wurde, betone ich, dass es in der Ethik darum geht, wie wir leben wollen. Ethik handelt nicht von Dingen, die uns irgendjemand oktroyiert, sondern die wir selber wollen. Aber wenn wir etwas wirklich und nachhaltig wollen, müssen wir davon auch überzeugt sein, muss das, was wir wollen, uns auch überzeugen: was beliebig wäre, könnte uns nicht leiten. Es genügt nicht, darauf zu insistieren, dass wir selbst über unser Leben bestimmen wollen; dabei bleibt offen, was uns denn dabei bestimmt. Dies, woran wir uns orientieren und was uns dann auch auf eine gewisse Weise verpflichtet, nenne ich nicht Normen, Werte, Ziele, sondern weiter und gründlicher: Sinn. Wir betreten das Glatteis der Ethik, wenn wir unserem Leben abverlangen, dass es einen Sinn habe bzw. dass das, was wir tun, sinnvoll sei.
Ethik ist demnach Sinn-Orientierung unseres Lebens.
Geht es im Leben darum, dass wir es geregelt kriegen, dass wir es gut versorgen und ausstatten, uns behaupten und in Szene setzen? Oder soll in unserem Leben etwas gelingen, zutage treten, in die Welt kommen, soll es so etwas wie ein Thema haben, einen Inhalt, einen Sinn? Sollen wir nicht nur möglichst lange und gut leben, sondern etwas leben? Und das mit Leidenschaft? Soll etwas durch uns aufleuchten, wofür wir Feuer und Flamme sind?
Nun visieren wir aber in diesem Streifzug durch die Ethik etwas Begrenzteres an, eine Berufsethik Sozialer Arbeit. Es gibt jedoch gute Gründe, das Thema nicht so eng zu fassen. Zum einen sind die repräsentativen und kontroversen ethischen Positionen nicht in der Sozialarbeit entstanden und meist nur am Rand auf sie bezogen, wenn überhaupt. Sie befassen sich nicht mit der Orientierung dieses Berufs, sondern mit der Orientierung des Lebens schlechthin. Dennoch wäre es ein großer Verlust an Sinn-Reflexion, nicht wenigstens einige grundlegende Züge von ihnen zu kennen. Sie eignen sich nicht als Kursbücher, wohl aber als unterschiedliche Weg-Markierungen, die uns beim Nachdenken begleiten; mit denen wir uns auseinandersetzen können; nicht nur einmal, sondern immer wieder, um unseren eigenen Weg im Dialog abzustecken. Die Schritte werden wir allemal selber wagen müssen. Ich möchte deshalb mit zwei ethischen Traditionen näher bekannt machen, die – so meine ich – in der fortschreitenden Ökonomisierung unseres Lebens neue Bedeutung bekommen haben: mit der klassischen griechischen Philosophie und dem Christentum, beides in Auswahl. Inhaltlich bedeutet das: mit einer Ethik der Selbstverwirklichung und einer Ethik der Liebe. Daran werden sich einige ebenfalls weit gespannte Ethiken aus unserer Zeit anschließen.
Ein weiterer Grund, warum die Beschränkung auf Berufsethik nicht sinnvoll wäre, ist, dass wir dann der so wichtigen Fragen ausweichen würden, was denn eigentlich unser Beruf mit unserem Leben zu tun hat. Ist er nur die Einkommensquelle, die wir brauchen, um unser Leben zu bestreiten; oder wollen wir in ihm etwas von dem verwirklichen, worum es uns im Leben überhaupt geht? Ich habe also vor, mit Ethik als Sinn-Orientierung des Lebens anzufangen und nach und nach immer stärker Fragen der beruflichen Orientierung einzubeziehen. Aber
1.2. Braucht Soziale Arbeit eine Berufsethik?
Bestimmte Auffassungen von Sozialer Arbeit kommen ohne Frage nach dem Sinn aus. Ich führe 2 Positionen an, die Sinn-Orientierung durch andere Steuerungsmechanismen ersetzen.
1973 hat der Soziologie Niklas Luhmann in einem Aufsatz zu „Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen“ ein Modell von Sozialer Arbeit und für Soziale Arbeit vorgestellt, dass ich als Verwaltungsmodell2 bezeichne. Danach exekutieren Sozialarbeiter in ihren Organisationen spezifische Konditionalprogramme, d.h. vorgegebene Anweisungen, wie in bestimmten Fällen zu verfahren ist.
„In diesem Rahmen ist die Entscheidung zu helfen oder nicht zu helfen, nicht Sache des Herzens, der Moral oder der Gegenseitigkeit, sondern eine Frage der methodischen Schulung und der Auslegung des Programms, mit dessen Durchführung man während einer begrenzten Arbeitszeit beschäftigt ist. …Individuelle Motive sind insoweit entbehrlich…“
Sich an Nächstenliebe, an sozialer Gerechtigkeit oder auch nur am „Anblick der Not“ zu orientieren, so etwas wie eine eigene Berufsauffassung wäre im System organisierter Sozialarbeit überflüssig, möglicherweise sogar störend. Organisationsprogramme haben die Steuerung übernommen, und das auf sie hin geschulte Personal wird durch „die Vorteile der Mitgliedschaft in Arbeitsorganisationen motiviert“, d.h. Einkommen, Karriere und Prestige.
In der Verwaltung selbst und in der Folge auch in der Sozialen Arbeit wurde dieses bürokratisch gefärbte Modell seit den 90er Jahren der Kritik ausgesetzt, es sei innovationsfeindlich und ineffizient, hieß es, nicht zuletzt zu teuer, und so wurde es seitdem auf breiter Front verdrängt durch ein „Neues Steuerungsmodell“.3 Aus der Wirtschaft, speziell der Autoindustrie, wurde ein angebliches Erfolgsmodell in die Soziale Arbeit eingeführt, die nun auf dem Markt als Dienstleistungsunternehmen mit ihren Produkten um Kunden konkurrieren soll und dem „kategorischen Imperativ“ unterstellt ist, größtmögliche Wirkung bei geringst möglichem Mitteleinsatz zu gewährleisten. Soziale Arbeit bemisst sich an kontrollierbarer Effizienz. Der Typ des Konditionalprogramms wird zurückgedrängt durch den Typ des Zweckprogramms, gestaltendes Management tritt an die Stelle von ausführender Verwaltung, aber auch von Beziehungsarbeit und traditionellen Qualitäten wie Zuwendung oder Solidarität. Gelernt werden Techniken, Sprache und Philosophie von betriebswirtschaftlichen Modellen, die in den Non-Profit-Bereich übertragen wurden.
Nach beiden Modellen kann sich Soziale Arbeit Ethik abschminken, sie kommen ohne eine Eigenorientierung, eine eigene Berufsauffassung aus. Nach dem Verwaltungsmodell geht es um korrekte Anwendung von Regeln, nach dem Managementmodell um Erfolg. Entsprechend sind die Kontrollmechanismen eine Regelkontrolle bzw. eine Erfolgskontrolle. Probleme ergeben sich bei dem einen Modell dadurch, dass Personen zu Fällen zurechtgestutzt werden müssen, Sozialarbeit es aber anders als andere Berufe gleichwohl unmittelbar mit Personen zu tun bekommt. Beim zweiten Modell erweist sich die übernommene Produktionslogik als unpassend: etwaige Erfolge bei den sog. Nutzern sind keine Produkte, weil das Verhältnis zwischen ihnen und den Sozialarbeitern interaktiv ist, wechselseitig und nicht kausal, und wenn die Leistungserbringung nur auf die Angebote oder den Aufwand bezogen und so messbar gemacht wird, bleibt unklar, ob sie wirklich dem sog. Klientennutzen dient.
Der angebliche Fortschritt derartiger Steuerungen nach Maßgabe sozialstaatlicher Programme oder Marktchancen bekommt Schönheitsflecken, wenn man darauf blickt, wohin sie die Soziale Arbeit steuern. Im Falle des Verwaltungsmodells handelt es sich um Abarbeitung von Programmen an mehr oder weniger lästigen Problemfällen, die es - in Begriffen Luhmanns - auf die eine oder andere Art zu „beseitigen“ gilt. Im Falle des Managementmodells werden die so genannten Nutzer zur Profilierung der eigenen Person und Organisation gegenüber dem eigentlichen Kunden genutzt, nämlich dem Geldgeber. Kunde ist bekanntlich nur, wer zahlt, und den scheinbar zu Kunden avancierten Klienten fehlt ja gerade das, was den Wert von Kunden ausmacht: ihre Kaufkraft.
Verwaltung und Dienstleistung haben darüber hinaus einen weiteren Defekt, den Luhmann dankenswert deutlich formuliert hat:
Die Organisationen sozialer Hilfe „arbeiten an der Beseitigung von Problemfällen, die sich aus der Verwirklichung der vorherrschenden Strukturen und Verteilungsmuster immer neu ergeben. Es ist nicht ihre Sache, und überhaupt nicht Sache von Hilfe, sich eine Änderung der Strukturen zu überlegen, die konkrete Formen der Hilfsbedürftigkeit erzeugen“.
Die Frage ist, ob diese Modelle adäquat die Realität beruflicher sozialer Arbeit beschreiben und die eigene Berufsauffassung sich mit der in ihnen vorgenommenen Rollenzuweisung deckt. Ist Hilfe, die nicht zu Abhilfe werden will, noch Hilfe? Üben Helfer, die vornehmlich Helfersdienste für das bestehende staatliche und wirtschaftliche System leisten, noch einen helfenden Beruf aus? Sieht Soziale Arbeit in ihren Adressaten nur Problemfälle, und wieso sollten in einem Marktmodell Kunden, die nicht zahlen, zählen?
Es ist vielleicht doch nicht so überflüssig, dass wir nach einem eigenen Sinn von Sozialer Arbeit fragen, den sie sich weder vom Staat noch von der Wirtschaft vorschreiben lassen kann.
Dies ist meine erste Antwort, warum Soziale Arbeit Ethik braucht: um Eigen-Sinn zu entwickeln; um ihren Eigen-Sinn zu klären und zu festigen, so dass sie ihm nach Möglichkeit folgt in dem politischen und ökonomischen System, in dem sie operiert. Soziale Arbeit braucht Ethik, um Eigen-Sinn zu wahren und sich nicht fugenlos dem gesellschaftlichen Gefüge zu fügen.
1 KrV B 832f
2 Einschlägige Zitate in IHMIG (2019,) S. 159-162, 243-249.
3 SCHWARZ (1992). Zu Entstehung und Charakteristik näher IHMIG (1996), S. 102ff.
2. Von der Ethik zur Ökonomie – Lebensdevisen in einer Marktgesellschaft
Die Frage, wie wir leben wollen, hat sich durch die Jahrhunderte hindurch gezogen. Aber sie wurde in verschiedenen Kontexten gestellt, und dementsprechend haben sich auch die Antworten verändert. Auf den ursprünglichen Kontext bei den Griechen gehen wir später ein. Was ist unser Kontext?
In der Ballade vom angenehmen Leben in B. Brechts Dreigroschenoper heißt es:
„Das simple Leben lebe, wer da mag!
Ich habe (unter uns) genug davon.
Kein Vögelchen von hier bis Babylon
Vertrüge diese Kost nur einen Tag.
Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem.
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm!
Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem:
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm!“
In Armut leben – wer mag das schon? Immerhin gibt es markante Vorbilder, die darin nicht das Hauptproblem gesehen haben, ja in einem „simplen Leben“ ihre Weise des Glücklichseins entdeckt haben. Ich nenne nur Buddha, Sokrates und Jesus. Ihre Stimmen wurden längst übertönt durch den Refrain dieser Ballade – mit einem wichtigen Zusatz: Glück durch Wohlstand, und Wohlstand durch Ökonomie. Wohlstand – wohl kaum für alle, aber jedenfalls für viele – das war von Anfang an das Versprechen der freien Marktwirtschaft, die unser Leben prägt. Bisher hat sie es allerdings nur zu Wohlstandsinseln in einem Meer von Armut gebracht, und auch auf diesen Inseln stellt sich das Glück nicht so automatisch her. Hier sind ganze Industrien der Werbung entstanden, die darauf angelegt sind, uns zu suggerieren, dass wir mit den käuflichen Waren das Glück selbst, die Schönheit, den Wert, das Ansehen, den Erfolg mit einkaufen können. Hat uns die Verheißung des Wohlstands das Glück gebraucht oder nicht eher die Überwucherung unseres Lebens durch die Ökonomie?
2.1. Adam Smith und das natürliche System der Interessen.
Charakteristische Züge der Gesellschaft, in der wir leben, sind bereits von einem Theoretiker des 18. Jahrhunderts markiert worden. Und bei ihm zeichnet sich sozusagen in Person der Wandel ab, der von der traditionellen Ethik zur Ökonomie geführt hat und dazu, dass die Ökonomie der Ethik aus dem Ruder lief.Weil dieser Wandel bis heute den Rahmen abgibt, in dem Ethik noch oder wieder betrieben wird, und die Herausforderung, der sie sich stellen muss, sei er den ethischen Systemen vorangestellt.
Adam Smith (1723-1790), einer der Begründer der Nationalökonomie, war zugleich Philosoph und Ethiker. Der schottische Professor für Logik und Moralphilosophie in Glasgow macht in seinem zum Klassiker gewordenen Werk den Wohlstand der Nationen zum Thema4 Worin besteht er, und woher kommt er, wie kommt es, dass viele Gesellschaften in Armut und Mangel an Gütern, die anderen in Reichtum und einem Überfluss an Warenangebot (supply) leben?
2.1.1. Die Verheißung: Produktion von Wohlstand
Schon die Fragestellung ist bezeichnend. Die Untersuchung von A. Smith richtet sich nicht wie die der griechischen Philosophie auf das gute Leben oder wie die Schriften der Christen auf das Heil, beides Kategorien des Wohl-seins, sondern auf den Wohl-stand, d.h. die Verfügbarkeit nicht nur einer begrenzten Menge notwendiger Dinge, sondern einer unbegrenzt erweiterbaren Fülle von angenehmen Dingen (conveniences).
Das Tor ist geöffnet für den Übergang vom Wohlsein zum Wohlstand und dessen permanenter Steigerung durch Wirtschaftswachstum. der Übergang bahnt sich an von der Versorgung zum Erwerb. Produktion und Konsum von Gütern rücken mit der Wirtschaft selbst ins Zentrum des gesellschaftlichen Lebens als ihre bestimmende Dynamik. A. Smith ist noch zu sehr durch die ethische Tradition geprägt, als dass er die Mehrung des Wohlstands umstandslos mit dem Glück gleichgesetzt hätte, aber für seine Bewertung der Gesellschaftsformen wird doch die Wohlstandsproduktion zum maßgeblichen, ja einzigen Kriterium.
Was hier produziert wird, sind keine haltbaren Gegenstände, die eine dauerhafte Welt für das flüchtige menschliche Dasein konstituieren5, sondern zum jährlichen Verbrauch bestimmte Güter. So beginnt A. Smith sein Werk mit dem Satz: „Die jährliche Arbeit eines Volkes ist die Quelle, aus der es ursprünglich mit allen notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens versorgt wird, die es im Jahr über verbraucht“.
Als Quelle des Wohlstands gilt die Arbeit.6 Diese Arbeit ist nicht mehr wie bei den Griechen als aufgenötigte Sklavenarbeit verstanden oder wie bei den Christen als freiwilliger Dienst für Gott und den bedürftigen Nächsten, sondern als Produktion; genauer noch als Überschussproduktion und als Produktivität, die es zu steigern gilt. Wohlstand beruht nämlich auf der Steigerung der Produktivität der Arbeit, und das wird durch zunehmende Arbeitsteilung mit der damit verbundenen Spezialisierung, Mechanisierung und Beschleunigung ermöglicht sowie durch einen Markt, der die arbeitsteilig produzierten Güter in Umlauf und Austausch bringt. Arbeit ist also nicht mehr Eigenarbeit zur Selbstversorgung oder Sklavenarbeit zur Versorgung einer Herrschaft, sie endet nicht, sobald das Versorgungsziel erreicht ist, sondern ist Produktion für einen Markt, auf dem die Produkte getauscht bzw. verkauft werden. Die Menge dieser auf den Markt gebrachten Verbrauchsgüter macht den eigentlichen Wohlstand einer Nation aus, das Reichliche über das ärmlich Zureichende hinaus. Und wenn man so tut, als gehöre dieser volkswirtschaftlich produzierte Reichtum dem Volk, kann man sagen, es breite sich allgemeiner Wohlstand aus.
„Dieses ungeheure Anwachsen der Produktion in allen Gewerben, als Folge der Arbeitsteilung, führt in einem gut regierten Staat zu allgemeinem Wohlstand, der selbst in den untersten Schichten der Bevölkerung spürbar wird“7.
„Gut regiert“ heißt für Smith, dass der Staat sich seinen drei Aufgaben der Verteidigung, des Rechtsschutzes und der Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, die privat nicht gewinnbringend betrieben werden können, widmet und sich des Eingriffs in die Wirtschaftsprozesse selbst enthält. Das Neue am Versprechen dieses Systems ist, dass nicht nur partieller Wohlstand durch ungleiche Verteilung, man kann auch sagen: durch Raub zustande kommen soll, sondern allgemeiner Wohlstand produziert wird. Allgemeiner Wohlstand ist also die Verheißung dieses neuen, permanent die Produktivität steigernden Systems.
2.1.2. Die Marktverteilung: Lohnarmut und Kapitalreichtum
Sieht man genauer hin, und das tut Smith denn doch auch, so ist die Verteilung freilich alles andere als gleich. Während sich die Löhne um das Existenzminimum herum einpendeln, sammelt sich der Reichtum in den Händen der Eigentümer der Produktionsmittel an. Die Macht von Arbeitern und Unternehmern, ihre jeweilige Angewiesenheit auf einander und die Möglichkeiten des Zusammenschlusses sind sehr ungleich, das sieht A. Smith realistisch, und staatliche Verbote für Dienstboten, Arbeiter und Gesellen, sich zu organisieren, taten zur damaligen Zeit das Ihre dazu8. Nur unter günstigen Umständen gelingt es Arbeitern, einen Lohn durchzusetzen, der beträchtlich über dem niedrigsten Satz liegt, „der eben noch mit unserer Vorstellung von Humanität vereinbar ist“9. Höhere Löhne sieht A.Smith auf die Phase des Aufschwungs beschränkt, während „das Los der ärmeren Arbeiter und damit der Masse der Bevölkerung“ hart sei „in einer stationären und erbärmlich in einer schrumpfenden Wirtschaft“. Die Selbstregulierung des Arbeitsmarktes, die dafür sorgt, dass der Arbeitslohn sich um die fürs Überleben notwendige Höhe herum einpendelt, geht wortwörtlich über Leichen: die meisten der Arbeiterkinder sterben. „Auf solche Art reguliert die Nachfrage nach Arbeitskräften, wie bei jeder anderen Ware, das Wachstum der Bevölkerung“.10
Jean Baptiste Say, französischer Ökonom in den Fußstapfen von A. Smith, hat die menschlichen Kosten dieser Selbstregulierung des Marktes noch deutlicher zum Ausdruck gebracht: „Wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften hinter der Zahl der Arbeitssuchenden zurückbleibt, fallen die Löhne auf ein Niveau zurück, das nicht ausreicht, damit die Klasse der Armen sich vollzählig erhalten kann. Die Familien, die mit allzu vielen Kindern und Krankheiten geschlagen sind, gehen unter: nun verringert sich das Angebot von Arbeitskräften. Infolgedessen steigt deren Preis.“
Dass Löhne und Kapitalgewinne auseinanderklaffen, blieb den Verfechtern des Systems der Wohlstandsproduktion nicht verborgen. Ihre moralische Missbilligung der krassen Ungleichverteilung hielt sich aber schon zu Anfang in den Grenzen eines gesamtwirtschaftlichen Optimismus, und die Lehre von der Arbeit als Quelle aller notwendigen und angenehmen Dinge des Lebens billigte den Arbeitern selbst doch kaum mehr als das zum Leben Nötige zu:
„Es ist zudem nicht mehr als recht und billig, wenn diejenigen, die alle ernähren, kleiden und mit Wohnung versorgen, soviel vom Ertrag der eigenen Arbeit bekommen sollen, dass sie sich selbst richtig ernähren, ordentlich kleiden und anständig wohnen können“11
Der Maßstab für den „Wohlstand“ der Habenichtse ist nicht der neue Reichtum der Besitzenden, sondern ihre alte Misere. Sie müssen sich damit abfinden, dass sie früher noch weniger hatten, sie also vom „allgemeinen Wohlstand“ auch etwas abbekommen.
Die tatsächliche Verteilung, die „natürliche Ordnung“, nach der sich der „Ertrag auf die einzelnen Schichten der Bevölkerung verteilt“12, konterkariert das Wohlstandspathos des neuen Systems. Die „natürliche Ordnung“ verwaltet der Markt. Der Lohn ist abhängig von der Nachfrage nach Arbeitskräften auf einem Arbeitsmarkt, auf dem sie selbst als Ware gehandelt werden. Der Markt sorgt automatisch für ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage, allerdings verteilt er weder die Güter gleich oder nach Bedarf, noch schert er sich um das Problem der zu Arbeitern gewordenen Menschen, sich ohne Nachfrage nichtmehr am Leben halten zu können. Die Konjunkturen des Marktes entscheiden über Lebenschancen und -schicksale. Ursprung und Verteilung des Wohlstands stehen also in einem auffälligen Missverhältnis.
2.1.3. Produktive Arbeit und Kapitalakkumulation.
Wie hat A. Smith selbst das Verhältnis von Arbeit und dem, was dem System den Namen geben sollte, dem Kapital, gesehen? Quelle von Wohlstand ist für ihn nicht jedwede Arbeit, sondern nur „produktive Arbeit“. „Überfluss und Mangel an Gütern dürfte vorwiegend von der Produktivität der Arbeit abhängen“13. Produktiv ist nur Arbeit, die einen Wert (value) hervorbringt. „Es gibt eine Art Arbeit, die den Wert eines Gegenstandes, auf den sie verwandt wird, erhöht, und es gibt eine andere, die diese Wirkung nicht hat. Jene kann als produktiv bezeichnet werden, da sie einen Wert hervorbringt, diese hingegen als unproduktiv"14.Wertbildung, Bildung von Mehrwert (additional value) ist Kriterium und Ziel produktiver Arbeit. Arbeiten, die im selben Augenblick untergehen, in dem sie vollbracht werden, „ohne eine Spur oder einen Wert zu hinterlassen, mit dem man später wieder eine entsprechende Leistung kaufen könnte“ wie die des Dienstboten, Dienstleistungen überhaupt, gelten als unproduktiv. Dagegen „manifestiert sich die Arbeit des Fabrikarbeiters in einem einzelnen Werkstück oder einer käuflichen Ware, so dass sie auch noch eine Zeitlang nach der Bearbeitung fortbesteht."
Nach diesem Kriterium gelten nun auch so angesehene Berufsstände wie Herrscher, Justiz, Militär, Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte, Schriftsteller, Schauspieler, Künstler als unproduktiv, sie werden ökonomisch abgewertet: "Sie alle bringen selbst nichts hervor, leben daher vom Ertrag aus anderer Leute Arbeit"15.
Nachwirkungen dieser Bevorzugung produktiver Arbeit erleben wir noch heute, wenn etwa Sozialarbeit ihre Dienstleistungen als Produktion zu deklarieren und ihre Interaktionen als Produkte zu verkaufen sucht, so sinnwidrig das auch ist.
A. Smith hat diese Unterscheidung von produktiven und unproduktiven Tätigkeiten aus der französischen, von F. Quesnay (16941774) begründeten Schule der Physiokraten übernommen und charakteristisch abgewandelt16 .Wie der Gegenbegriff "steril" zeigt, ist "produktiv" hier von der natürlichen Fruchtbarkeit abgeleitet. Diese erste nationalökonomische Schule war agrarisch orientiert und ließ nur die in der Landwirtschaft Tätigen - Grundeigentümer, Landwirte, Pächter, Landarbeiter - als classe productive gelten und wertete alle anderweitig Tätigen - Hausgesinde, Handwerker, Gewerbetreibende, Fabrikanten, Kaufleute - als classe stérile ab. Für A. Smith ist es dagegen entscheidend, ob sich die Arbeit in einer verkäuflichen Ware niederschlägt, und da Landwirtschaft sich durch Arbeitsteilung und Maschinen weniger steigern lässt als die einfacheren Verrichtungen in Handwerk und Gewerbe, erhalten diese Wirtschaftszweige bei ihm sogar den Vorrang.17
Produktivität wird dabei noch an gegenständlicher Produktion gemessen, nicht an Marktgängigkeit als solcher. Zwar beziehen sich Produktion und Wohlstand für A. Smith noch auf Verbrauchsgüter18, jedoch liegen Sinn und Auszeichnung der gegenständlichen Produktion keineswegs im augenblicklichen Konsum, sondern darin, dass sie Medium der Speicherung von Arbeit und der Erzeugung von Mehrwert ist: "Dadurch wird es möglich, eine bestimmte Menge Arbeit gleichsam anzusammeln und zu speichern, um sie, falls erforderlich, bei anderer Gelegenheit wieder zu verwenden“19 Was vom Ertrag produktiver Arbeit nicht als Einkommen, des Arbeiters oder des Kapitaleigners, verzehrt wird, wird dem Kapital zugeschlagen, d.h. es wird investiert, um wiederum produktive Arbeit zu ermöglichen. Produktive Arbeit bildet und mehrt also Kapital, und Kapital wird zu seiner eigenen Mehrung wieder in produktive Arbeit investiert. Genusssucht und Verschwendung stehen dieser fortschreitenden Akkumulation von Wert und Kapital im Wege. Nun erscheint "jeder Verschwender als Feind der Allgemeinheit, jeder sparsame Mensch dagegen als ihr Wohltäter"20. Der Grund: Sparsamkeit fördert das „Anwachsen des Kapital bestandes“. "Kapital wird durch Sparsamkeit erhöht und durch Verschwendung und Misswirtschaft vermindert".21
Das menschliche Motiv zum Sparen sieht A. Smith „in dem Wunsch, die Lebensbedingungen zu verbessern“ und zu diesem Zweck auf augenblicklichen Genuss zu verzichten. Dass die Sparsamkeit der Lohnempfänger weniger diesem Motiv folgt, sondern ihnen durch die Spärlichkeit des Lohnes aufgenötigt ist, geht in dieser Spartheorie unter. „Das gleichmäßige, fortwährende und ununterbrochene Streben der Menschen nach besseren Lebensbedingungen“ wird als gleichsam allgemeine humane Grundlage dieses auf Akkumulation of Capital ausgerichteten Systems in Anspruch genommen22.
Produktive Arbeit, d.h. Arbeit, die Mehrwert erzeugt, mündet in Mehrung des Kapitals, das wiederum in produktive Arbeit investiert wird zum Zwecke seiner weiteren Vermehrung. Damit ist der moderne Begriff des Kapitals umschrieben: es ist nicht Geld, das gehortet oder ausgegeben wird, sondern das investiert wird und vermehrt zurückkehrt, um wieder investiert zu werden. Es ist sich permanent verwertender Wert.23
Obwohl sich somit die Akkumulation des Kapitals als eigentlicher Zweck des Systems enthüllt, will A. Smith dem Kapital eine dienende Funktion gegenüber der Arbeit zuschreiben: "Alles Kapital dient nur zum Unterhalt produktiver Arbeit"24. Damit stellt er ihr wirkliches Verhältnis, wie er es selbst beschreibt, auf den Kopf und unterschlägt in einer harmonischen Zuordnung von Kapital und Arbeit ihren Konflikt. Wenn er formuliert: "das nationale Jahresprodukt aus Boden und Arbeit kann an Wert lediglich dann zunehmen, wenn die Zahl der produktiv Beschäftigten oder deren Produktivkraft erhöht wird"25, so hat er zwar die Steigerung der
Produktivität durch Einsatz von Maschinen und effizientere Arbeitsorganisation im Blick, unterschlägt aber, dass dadurch die Beschäftigung unterminiert wird. Ebenso wenig lässt sich die Güter und Wohlstandsproduktion als Zweck behaupten, wenn die Agenten des Kapitals seine Verwertung und nicht die Versorgung oder das angenehme Leben im Sinn haben und befördern, was A. Smith durchaus sieht:
"Die Erzielung eines eigenen Gewinnes ist das einzige Motiv, welches den Besitzer eines Kapitals leitet...Niemals macht er sich Gedanken darüber, wie viele Arbeitskräfte das Kapital zum Einsatz bringen könnte und wie viel es zum Ertrag aus Boden und Arbeit eines Landes im Jahre beiträgt, je nachdem, ob es auf diese oder eine andere Art und Weise investiert wird"26.
„Die ständige Ansammlung von Kapital“ schützt „ein sehr mächtiges Prinzip, nämlich das einfache und augenfällige Interesse jedes einzelnen, dem ein Teil davon gehören wird“. So frei ist jedoch nicht einmal dieses Interesse, sondern es vollzieht eine systembedingte Notwendigkeit: „Nichts von diesen Kapitalien kann späterhin jemals zu anderen als zu produktiven Zwecken verwandt werden, da jeder, der es auf solche Weise seiner eigentlichen Bestimmung entzieht (nämlich Kapital als Einkommen missbraucht), einen erheblichen Verlust erleiden wird“27.
Diese Verwandlung des Interesses in eine Nötigung hat K. Marx später so beschrieben: „...die Konkurrenz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur vermittelst progressiver Akkumulation.“ „Die Akkumulation oder Produktion auf erweiterter Stufenleiter, die als Mittel zu stets ausgedehnterer Produktion von Mehrwert, daher Bereicherung des Kapitalisten, als persönlicher Zweck des letzteren erscheint, und eingeschlossen ist in die allgemeine Tendenz der kapitalistischen Produktion, wird aber weiter ... durch ihre Entwicklung eine Notwendigkeit für jeden individuellen Kapitalisten. Die stete Vergrößerung seines Kapitals wird Bedingung der Erhaltung desselben“.28
Der harmonistischen Gesamtsicht von Smith entgeht, dass die einmal in Gang gesetzte Kapitalakkumulation ihrer eigenen Dynamik folgt und sich nicht an von außen gesetzten Kriterien ausrichtet, weder einer gerechten Verteilung noch des angenehmen oder gar des guten Lebens. Dem Streben nach dem angenehmen Leben entgleitet vielmehr die eingebildete Führungsrolle, es gibt sie an die Eigendynamik eines ökonomischen Systems ab, für das wachsender Wohlstand nur ein eventueller Begleiteffekt einer unablässigen Kapitalverwertung ist, die ihre eigene Notwendigkeit schafft und sich keiner höheren Zwecksetzung dienend fügt.
2.1.4. Ökonomische Rationalität und Logik des Marktes.
Thema ist hier allerdings nicht, wie ein ökonomisches System funktioniert, wie Produktion, Waren- und Geldverkehr und Kapitalbildung ablaufen, sondern wie in einem solchen System die Personen selbst in Verhältnis zueinander treten. Wir müssen, um in dieser Fragestellung voranzukommen, eingehender verfolgen, wie sich hier menschliche Interessen zu einem System der Interessen verbinden.
Adam Smith führt das Merkmal des von ihm beschriebenen Systems, Produktivität durch Arbeitsteilung ständig zu steigern, auf „eine natürliche Neigung des Menschen zurück, zu handeln und Dinge auszutauschen“.Der Anklang an Aristoteles, dass diese Neigung eine Folge der menschlichen Fähigkeit zu denken und zu sprechen sein könne, macht gerade die Differenz deutlich. Dass der Mensch ein zoon logon echon ist, ein Lebewesen, das Vernunft/Sprache hat, begründet für Aristoteles, dass er sich mit anderen in gemeinsamen Vorstellungen treffen und Vereinbarungen treffen, somit das Zusammenleben ordnen kann. Das gilt sowohl für das Haus, vor allem aber doch in der Polis als einer Rechtsordnung, in der Menschen die politische Tugend der Gerechtigkeit ausbilden und praktizieren können und wo auch die höchste, theoretische Betätigung der Vernunft im Kreis der gebildeten Freunde ihren Raum erhält. Bei A. Smith dagegen bezieht sich die vernünftige Vereinbarung auf Tauschverhältnisse, der wechselseitige Bedarfsausgleich wird zum Wesensmerkmal des Menschen, das ihn vom Tier unterscheidet. Vernunft wird zu ökonomischer Rationalität, der Mensch von einem politischen (zoon politikon) zu einem ökonomischen Wesen (homo oeconomicus).
Welcher Art aber ist nun diese ökonomische Rationalität, die Logik der Tauschverhältnisse, d.h. die Logik des Marktes? Sie beruht darauf, dass jeder sein eigenes Interesse wahrnimmt. „Nicht vom Wohlwollen (benevolence) des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen“29.
Die Marktstrategie verfährt allerdings nicht einfach so, dass jeder versucht, sein Interesse gegen das andere durchzusetzen, sondern verschränkt die durchaus gegensätzlichen Interessen auf eine eigenartige Weise. A. Smith hat diese Marktlogik auf eine brillante Kurzformel gebracht: man hat eher Erfolg, wenn man „die Eigenliebe der andren zu seinen eigenen Gunsten interessieren kann und ihnen zeigt, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, das für einen zu tun, was man von ihnen wünscht“. Es wird also um das Eigeninteresse des anderen geworben, um es dem eigenen Interesse dienstbar zu machen.
Wer etwas vom anderen haben will, appelliert nicht an dessen Wohlwollen oder Menschenliebe (humanity), sondern an dessen Eigenliebe (self-love). Erfolgversprechender als der Appell an das Wohlwollen anderer ist eine andere Strategie: “He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and show them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them “.30 Das Eigeninteresse, das dynamische Motiv des Systems, ist also auf Aneignung gerichtet, es hat possessiven
Charakter.31 Die Marktpersonen, ob Arbeiter oder Unternehmer, sind frei, keine Sklaven, sondern - wie J. Locke es formulierte - Eigentümer ihrer selbst. C.B.MacPherson hat den „possessiven Individualismus“ oder „Besitzindividualismus“ als Wurzel der Marktgesellschaft und des liberal-demokratischen Staates identifiziert und bis ins 17. Jahrhundert zurück verfolgt.32 Er charakterisiert ihn wie folgt: „since the freedom, and therefore the humanity, of the individual depend on his freedom to enter into self-interested relations with other individuals, und since his ty to enter into such relations depends on his having exclusive control of (rights in) his own person and capacities, und since proprietorship is the generalized form of such exclusive control, the individual is essentially the proprietor of his own person and capacities“. Gesellschaft konstituiert sich im Ausgang von diesen Eigentümern ihrer selbst eben aus deren „self-interested relations with other individuals“: „Human society consists of a series of market relations“33.
Marktbeziehungen werden durch Erwerbsinteressen dominiert. Dabei erhält das Geld, das zunächst nur als Tauschmittel verwandt wurde, eine neue, zentrale Bedeutung: als das haltbarste Wertaufbewahrungsmittel, als allgemeines Wertmaß und als unbegrenzt vermehrbarer Wert wird es der vorzügliche Gegenstand des Aneignungsinteresses. Gelderwerb und Kapitalbildung sind das eigentliche Geschäft des Interesses.
Der Markt verschränkt nach A. Smith zwanglos die Eigeninteressen miteinander zu einem System völliger Freiheit, das, überlässt man es nur sich selbst, das Beste für alle, allgemeinen Wohlstand produziert, ohne dass jemand mehr als das Eigeninteresse im Sinne hätte. "Gibt man daher alle Systeme der Begünstigung und Beschränkung auf, so stellt sich ganz von selbst das einsichtige und einfache System der natürlichen Freiheit her. Solange der einzelne nicht die Gesetze verlässt, lässt man ihm völlige Freiheit, damit er das eigene Interesse auf seine Weise verfolgen kann und seinen Erwerbsfleiß und sein Kapital im Wettbewerb mit jedem anderen oder einem anderen Stand entwickeln oder einsetzen kann“34.
Jeder strebt nur nach eigenem Gewinn und verfolgt dabei nur das eigene Interesse, aber wird “von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat“, nämlich das Wohl der Allgemeinheit35.
Wer sich ohne die Heuchelei, dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen, zu diesem wirklichen Motiv bekennt, dem eigenen Gewinn, ist ein echter Kaufmann, - und das sind oder werden wir nach A. Smith alle.
Ausgehend von der Ökonomie wird Gesellschaft zum „System der natürlichen Freiheit“, d.h. zum System der freigelassenen (Eigen-) Interessen. Schon A. Smith hat vorausgesehen, dass das Wirtschaftssystem sich kraft seiner expansiven Dynamik ins Zentrum der Gesellschaft setzen und seine Logik dem Zusammenleben insgesamt aufprägen wird, dass also aus der Marktwirtschaft eine Marktgesellschaft wird:
„So lebt jeder vom Tausch, oder er wird in gewissem Maße ein Kaufmann, und die Gesellschaft selbst entwickelt sich dahin, was eigentlich eine kommerzielle Gesellschaft ist“36.
Hinzuzufügen ist der frühen Prognose von A. Smith nur, dass der Kaufmann, weil er inzwischen nicht nur etwas, sondern sich selbst verkauft, zugleich in die Rolle des Schauspielers geschlüpft ist. Als kommerzielle Showfigur sucht er sich auf Märkten und Bühnen selbst zu inszenieren und möglichst gut zu „verkaufen“.
Damit ist das eingetreten, was Aristoteles befürchtet und bekämpft hatte, die Überwucherung des Lebens durch seine Ökonomie, einschließlich dessen, was er als gutes Leben vor ihr zu schützen suchte, und die Verwandlung der Menschen in Kaufleute. Dass Menschen,mit Logos - Vernunft und Sprache – begabte, handelnde Wesen sind, verwandelt sich aus einer auf das politische Gemeinwesen bezogenen Kategorie in eine auf den Markt bezogene kommerzielle. Die Theorie wird aus der erhabenen Anschauung in Muße zur Hilfswissenschaft der Geschäfte, die Vernunft zur ökonomischen Rationalität.
Somit hat sich ein epochaler Wandel in der Auffassung von Leben und Zusammenleben vollzogen. Die mittelalterliche Gesellschaft hatte ein Bild von sich als einem großen Lebewesen, einem corpus christianum, überliefert, das organisch gegliedert ist in gestufte (gradus) Stände (ordines) mit ihren jeweiligen Pflichten (officia) und insgesamt ausgerichtet ist auf das Heil, das ewige Leben. Das zeitliche Leben untersteht dem regnum, das ewige vermittelt sich über das sacerdotium - hierarchische, heilsgeschichtliche Institionen - und wird schon vorbereitend gelebt in Formen eines „geistlichen Lebens“. Das Leben in Gesellschaft differenziert sich nach dem Schema des triplex ordo - des dreifachen Standes - in orantes, bellantes, laborantes, in Betende, Kriegführende und Arbeitende, und ihre Würde wächst mit der Nähe zur Besorgung des ewigen und nimmt ab in der Richtung auf Besorgung des zeitlichen Lebens. Diese Skizze mag vorerst als Kontrast genügen, um den Strukturwandel des Lebens in Gesellschaft anzudeuten, der von dem mittelalterlichen Ordnungsgefüge, in dem sich die christliche Liebe verwirklichen sollte, zu einem System der Interessen führte, dass wir heute Marktgesellschaft nennen.
Bei Adam Smith stoßen wir auf ein ganz anderes Modell von Gesellschaft. Die unterste Etage der Laboranten etabliert sich sozusagen zur Kerngesellschaft, sie drängt die „unproduktiven“ Stände an die Peripherie einer Arbeitsgesellschaft, die durch systematische Arbeitsteilung und daraus resultierende Produktivitätssteigerung wachsenden Wohlstand produziert. Der Staat sichert dieses „System der natürlichen Freiheit“ militärisch, rechtlich und infrastrukturell ab, greift aber nicht in es ein, sondern lässt jeden „das eigene Interesse auf seine Weise verfolgen“ im Wettbewerb mit anderen. Während die mittelalterliche Grundherrschaft zwar keine Sklaverei, aber vielfältige Formen von Unfreiheit kannte, indem sie die Person mittelbar über den Boden erfasste, ist jeder Teilnehmer an diesem neuen System frei, ist Eigentümer seiner selbst, und es steht ihm frei, seinen eigenen Interessen nachzugehen. Er ist nicht nur nicht zu Wohlwollen und Wohlverhalten anderen gegenüber verpflichtet, sondern der Markt funktioniert als ein System der Verschränkung von Laboranten aus self-love, als Verschränkung selbstbezogener Aneignungsstrategien (Erwerb von Eigentum). Freilich haben diese freien Subjekte durchaus nicht die gleichen Ausgangspositionen, und der Wettbewerb der Interessen stellt keine Gleichheit des Besitzstandes her, sondern wie im Mittelalter Grund und Boden nicht Eigentum derer war, die ihn bebauten, so sind auch hier die Produktionsmittel nicht Eigentum derer, die mit ihnen arbeiten.
Wir haben gesehen, dass A. Smith den Wohlstand einer Nation in der Menge der produzierten Gebrauchsgüter sieht und das „ungeheure Anwachsen der Produktion“ als Folge der Arbeitsteilung. Diese Arbeitsteilung möchte er auf eine „natürliche Neigung des Menschen, zu handeln und Dinge gegeneinander auszutauschen“ (to truck, barter and exchange) zurückführen, aus der sie zwangsläufig, wenn auch nur schrittweise hervorgehe. Immer noch wird, in der griechischen Tradition, der Mensch als ein zoon logon echon begriffen, als ein Lebewesen, das Vernunft/Sprache hat, aber diese Vernunft äußert sich nicht primär im Handeln im Sinne von Praxis, sondern als Handeln im Sinne von Tauschen. Vernunft wird zu ökonomischer Rationalität, der Mensch von einem politischen zu einem ökonomischen Wesen, der wechselseitige Bedarfsausgleich wird zum Wesensmerkmal des Menschen, das ihn vom Tier unterscheidet.
Das ist das eine Kennzeichen des neuen ökonomischen Prinzips, die anthropologische Verankerung der Ökonomie, vielleicht ihre Priorität.
Das zweite ist die Logik der Tauschverhältnisse oder die Logik des Marktes. Der Markt ist das Korrelat zur Arbeitsteilung. Wenn arbeitsteilig produziert wird und damit keine rundum Selbstversorgung mehr stattfindet, können und müssen die Produkte getauscht werden, und der konkrete oder abstrakte Ort, wo Angebot von und Nachfrage nach Gütern aufeinandertreffen, ist eben der Markt. Dem schlichten Beispiel des Einkaufs bei Metzger, Brauer oder Bäcker entnimmt Adam Smith, dass jeder der am Markt agierenden Personen seinen eigenen Vorteil (advantage) sucht und sein eigenes Interesse verfolgt. Wer etwas vom anderen haben will, appelliert nicht an dessen Wohlwollen oder Menschenliebe (Humanité), sondern an seine Eigenliebe. Mehr Erfolg als der Appell an das Wohlwollen anderer verspricht die Strategie: die Eigenliebe der anderen zu seinen eigenen Gunsten zu interessieren und ihnen vorzumachen, dass es ihrem eigenen Vorteil dient, was man von ihnen haben will.
Wenn derzeit im Zuge einer Ökonomisierung der Sozialarbeit Klienten zu Kunden aufgewertet werden sollen, sollte man sich an diese Kurzformel der Marktlogik erinnern. Der Kunde ist keineswegs König, sondern sein Interesse wird immer nur berücksichtigt nach Maßgabe des eigenen. Ob nun auch Sozialarbeiter nach dieser Logik mit Menschen verfahren wollen, sollten sie sich gut überlegen.
Das Problem für die zwischenmenschliche Beziehung liegt aber nicht nur in dieser übergeordneten Zwecksetzung, sondern schon in der Eigenart des Interesses selbst. Das Wort kann man ja doppeldeutig verwenden. ‘Ich habe ein Interesse an etwas oder an jemand’ kann entweder heißen ‘ich will es/ihn haben’ oder ‘ich wende mich ihm aufmerksam zu’. In einem Fall will ich mir etwas aneignen, so dass es mir - und nur mir - gehört und ich meinen Vorteil davon habe. Im anderen Fall bleibt die Selbständigkeit des anderen gewahrt, und er/sie/es wird in dieser Selbständigkeit beachtet und geschätzt. Das Eigeninteresse, das nach A. Smith dem Marktgeschehen zugrunde liegt, ist ein Aneignungsinteresse und hat, auch wenn vom „Wert“ des anderen die Rede ist, seine Verwertung im Sinn.
2.1.5. Wohlstand der Nationen - Theorie der ethischen Gefühle.
Wie sich diese Herauslösung der Interessen und des ökonomischen Systems der Interessen aus der traditionellen Ethik vollzog, lässt sich bei A. Smith selber verfolgen. Als Professor für Moralphilosophie in Glasgow hat er 1759 Jahre sein grundlegendes Werk über Theorie der ethischen Gefühle veröffentlicht, 17 Jahre vor dem Erscheinen seines ökonomischen Hauptwerks. Dass es 2 Jahre zuvor zum 4. Mal und in den Jahren danach noch zweimal aufgelegt wurde, schließt aus, dass der Autor beide Werke in Widerspruch sah. Wie aber erklärt sich dann die offensichtliche Differenz einer ethischen Theorie, die an Sympathie und allgemeiner Glückseligkeit orientiert ist, zu der Rechtfertigung einer ökonomischen Struktur, die auf Eigenliebe und Eigeninteresse basiert?
Die Schrift setzt durchaus nicht beim natürlichen Egoismus an, sondern an anderen Prinzipien in der Natur des Menschen, die ihn dazu bestimmen, „an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein“.37 Dies ist vor allem die Sympathie, nämlich die Fähigkeit, sich in die Situation anderer Menschen zu versetzen, hineinzudenken und sich vorzustellen, was man selbst in ihr empfinden würde. Dabei werden nicht nur die Verhältnisse, sondern auch die Person und die Rolle mit dem anderen getauscht, Kummer oder Freude werden dann nicht um der eigenen Person willen, sondern um des anderen willen empfunden. Smith insistiert darauf, dass Sympathie in keinem Sinne als ein egoistisches Prinzip betrachtet werden könne38. Er bezieht damit Stellung gegen Mandeville, der jedwede Bevorzugung des allgemeinen vor dem persönlichen Interesse als Täuschung und Betrug zu entlarven suchte und auf egoistische Beweggründe, insbesondere Eitelkeit und Bedürfnis nach Anerkennung, zurückführte.
Auch das Universum als Ganzes favorisiert nicht die egoistischen Motive, sondern ist von der Gottheit als wohlwollendem und allweisem Wesen auf die Glückseligkeit aller seiner Bewohner angelegt.39 Somit sind sie dazu bestimmt, als Mitarbeiter der Gottheit die Pläne der Vorsehung der Verwirklichung näher zu bringen; wenn sie hingegen anders handeln und den Plan des Schöpfers der Natur durchkreuzen, können sie als „Feinde Gottes“ gelten.40 Welcher Weg führt von dieser starken ethischen Orientierung am Allgemeinwohl dennoch zur Freistellung und Systembildung des Eigeninteresses?
Zunächst wird die Ausrichtung des Universums durch eine Rangordnung, gleichsam eine metaphysische Arbeitsteilung, gebrochen: „die Sorge für die allgemeine Glückseligkeit aller vernünftigen und fühlenden Wesen ist indessen das Geschäft Gottes und nicht das des Menschen“, ihm ist ein „weit niedrigerer Arbeitsbezirk zu verwiesen, nämlich die Sorge für seine eigene Glückseligkeit, die seiner Familie, Grunde und seines Landes“41Während für die autarke Gottheit Wohlwollen das einzige Prinzip des Handelns sein mag, muss ein bedürftiges Wesen wie der Mensch vor allem für sich selber sorgen. Damit widerspricht Smith der alten christlichen Tradition und seinem eigenen Lehrer Hutcheson42, die nur das uninteressierte Wohlwollen als Tugend gelten lassen wollten. Seine Argumente dafür sind zum einen die Schwäche des Wohlwollens in Empfindung und Handeln gegenüber der Übermacht egoistischen Antriebe, zum anderen die Hochschätzung bestimmter auf den eigenen Vorteil ausgerichteter Handlungsprinzipien wie Wirtschaftlichkeit, Fleiß, Umsicht Aufmerksamkeit, geistige Regsamkeit, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft kultiviert wurden. „Der schwache Funke von Wohlwollen, den die Natur im menschlichen Herzen entzündet hat“, ist nicht imstande „den stärksten Antrieben der Selbstliebe entgegenzuwirken“.43 Jeder fühlt seine eigene Lust und seinen eigenen Schmerz viel lebhafter als die eines anderen. Letztere sind sympathetische Bilder und Schatten des wirklichen Dings.
Drastisches Beispiel dafür ist, dass der drohende Verlust eines kleinen Fingers einen Menschen um den Schlaf brächte, während der Untergang von hundert Millionen seiner Brüder ihn mit der tiefsten Seelenruhe schnarchen lassen würde44.
Die Abwertung des Wohlwollens geht mit einer Aufwertung der Selbstliebe einher. Sie kann „häufig auch ein tugendhafter Beweggrund des Handelns sein“. Zu tadeln ist nicht die Selbstliebe als solche, sondern nur übermäßige Selbstliebe. Die Rücksicht auf unser eigenes Glück und auf unseren persönlichen Vorteil erscheinen in zahlreichen Fällen auch als ein sehr lobenswertes Prinzip des Handelns, auch wenn sie in der bürgerlichen Gesellschaft aus eigennützigen Beweggründen gepflegt werden. Die
Aufwertung des Egoismus und die Degradierung des Altruismus sind Brücken des ethischen Systems zum ökonomischen.
Die Abweichung von einer fundamentalen Kategorie antiker und christlicher Ethik, dem Wohlwollen, verdient es, deutlicher markiert zumerken. In seiner Ethik gilt das Wohlwollen nun als schwacher Funke, in seiner Analyse der Marktlogik gar als deplatziert.