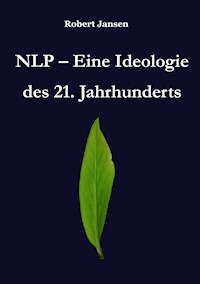
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In dem vorliegenden Buch wird der Versuch unternommen, einem Phänomen auf die Spur zu kommen, welches im öffentlichen Diskurs bislang gerade einmal als Randthema in Erscheinung tritt, dem Neurolinguistischen Programmieren. Der Autor geht in seinem Buch zum einen der Frage nach, was hinter den drei Buchstaben dieses NLP eigentlich steckt, aber auch, wie dessen stillschweigender Siegeszug, vorbei an den zahlreichen gesellschaftlichen Debatten, zustande kommen konnte. Anhand einiger entscheidender Punkte wird sowohl das manipulative Wesen des NLP offengelegt, als auch seine ideologische Struktur diskutiert und damit der Versuch unternommen, den Bürger für die kritische Auseinandersetzung mit dem NLP zu sensibilisieren und ihn gleichzeitig aufzufordern, in diesem Zusammenhang sowohl seiner Intuition als auch seinem gesunden Menschenverstand zu vertrauen, um die wirkliche Strategie hinter den modernen Kommunikationsmethoden zu erkennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Im Zeitalter der extrinsischen Motivation 7
Ein neuer Stern am Psychomarkt
Über das Selbstverständnis der NLP–Szene
Das Vokabular und das Menschenbild
NLP und der Radikale Konstruktivismus
Wenn man Kritik übt
Etwas über die Ursprünge
Pawlowsche Hunde
Legitimierungsversuche
Die gesellschaftliche Relevanz
Fazit
Quellenverzeichnis
1. Im Zeitalter der extrinsischen Motivation
Die Gesellschaft hat sich verändert. Diesen Satz hörte ich in den letzten Jahren recht häufig. Zumeist war dieser weniger wohlwollend gemeint, sondern eher von einem leichten Seufzer begleitet. Diejenigen, denen er entglitt, zeigten sich frustriert über die Doppelbödigkeit ihrer Mitmenschen, die einerseits eine unverfängliche Leichtigkeit ausstrahlten, andererseits aber auf eine abweisende Art wiederum sehr kompromisslos erschienen. Wie Mehltau hatte sich eine Seichtigkeit auf die Seelen der Menschen gelegt, die ihnen jene nonchalante Unnahbarkeit verlieh. Und so erinnere ich mich an unzählige Gespräche mit Freunden, die mir diese Entwicklungen schilderten und beschrieben, Diskussionen über die möglichen Ursachen und das schlussendliche Achselzucken, begleitet von einem wachen Blick und dem Gefühl, dass wir wohl aus einer Nische heraus ein seltsames neuartiges Phänomen bestaunten.
Was an diesem neuartigen Menschentypus besonders auffiel, war diese professionelle Freundlichkeit, die nicht aus einer Stimmung oder einer spontan empfundenen Sympathie herausquoll, sondern einfach da zu sein schien, wie auf Knopfdruck. Es gab auch andere Veränderungen. Studenten trugen kurze gegelte Haare und Firmenmitarbeiter ihre Namensschilder auch dann noch am Revers, wenn sie das Betriebsgelände längst verlassen hatten. Bestimmte Begriffe schienen die Menschen plötzlich wie selbstverständlich zu verwenden, denen sie bis dahin höchstens ein müdes Lächeln abgewinnen konnten: funktionieren, kommunizieren, Feedback tauchten immer häufiger und immer öfter ohne gedachte Anführungszeichen in der Alltagssprache auf. Und hieß es früher, dass Sätze, die im Passiv formuliert werden, unpersönlich klängen, erfreute sich die Stilblüte „Es wurde schlecht kommuniziert“ immer größerer Beliebtheit, obwohl es eine solche transitive Form des Verbs „kommunizieren“ in der deutschen Sprache überhaupt nicht gibt. Erzählte man Menschen früher von seinen Sorgen, hörten sie oft einfach nur zu, plötzlich erteilten sie nun die abenteuerlichsten Ratschläge, mit einem freundlichen aber doch auch fordernden Unterton. Auch vor sich selbst machten sie dabei nicht halt. So mussten manche an sich „arbeiten“, um ihre Beziehungen zu retten. Andere wollten positiver denken und glorifizierten ihren eigenen neuentdeckten Optimismus. Doch letzterer wirkte dabei stets mehr wie eine Aufgabe, wie ein guter Vorsatz, den man sich immer wieder von neuem einreden musste, er war wie eine Pille, die man dreimal täglich nach dem Essen einnahm. Könnte man dies alles als ein Zeitphänomen abtun? Sicher, wir leben heute Anfang des 21. Jh. in Zeiten der extrinsischen Motivation, der Antreiber, Positivdenker, derer, welche den Menschen in ihrer Umgebung beständig zurufen, dass sie alles schaffen können, was ihnen beliebt. Doch auch wer seine persönlichen Probleme mit einem anderen Menschen nur kurz ansprechen möchte, hört sie oft, die Durchhalteparolen, die Binsenweisheiten, die Mutmachsprüche. Man nickt sie ab, um sie anschließend behände zur Seite zu legen. Doch sie verbleiben im Gedächtnis. Und dann, sobald man selbst in die Lage gerät, einem anderen Menschen einen wichtigen Rat geben zu müssen, scheint nichts leichter, als einen dieser Sätze über die Lippen zu bringen, denn schaden wird es ihm wohl kaum, zumindest, so hofft man.
Auf diesem aphoristischen Wege haben sich auch die Smileys einen festen Platz in der Alltagssprache erobert, sind Euphemismen an die Stelle von klaren Worten gerückt, was sich wiederum auf das Denken der Menschen selbst auswirkt. Doch wie mag es gekommen sein, dass man sich so bereitwillig zum Motivator seiner Mitmenschen machen lässt, ohne sich zu fragen, ob solcherart gutes Zureden nicht möglicherweise sogar verstörend wirkt oder man seinen Gesprächspartner damit gar verärgert? Das positive Denken und die positive Sprache gehen Hand in Hand, und die Erwartungshaltungen liegen nicht nur gerichtet durch unsere Mitmenschen auf uns, sondern auch wir selbst haben eine derartige, welche wie eine Verpflichtung über uns gekommen zu sein scheint. Doch wie man spürt, bröckelt diese Fassade leicht, sobald es kein vertrauter Mensch, sondern ein Fremder ist, der seine Contenance nur solange über genau dieselben positiven Phrasen aufrecht erhält, wie er sich etwas von seinem Gegenüber verspricht. Hier zeigt sich, dass man Empathie nicht erlernen kann, sie nicht auswendig büffeln und nicht trainieren. Ohne Zweifel, seit Mitte der 2000er Jahre hat sich eine körperlich fühlbare Veränderung innerhalb der Gesellschaft vollzogen, die positive Sprache ist eines ihrer Symptome, doch wo liegt der Ursprung dieser Entwicklung? Man stellt sich eine solche Frage, doch mangels einer befriedigenden Antwort verdrängt man sie schnell wieder. Machen wir es uns nicht so leicht!
Andere Veränderungen waren sogar noch offensichtlicher. Jeder neue Besuch in einem beliebigen Buchladen bestätigt seit Jahren den durchweg steten Trend zu esoterischer Literatur. Fanden sich vor dem Millennium diese Titel in einer verstaubten Nische, so nehmen sie mittlerweile einen so breiten Raum ein, dass man beinahe fürchten muss, in ein paar Jahren kein Platz mehr für naturwissenschaftliche Publikationen mehr bleibt. Und täglich sieht man vor allem jüngere Frauen in der U–Bahn mit Büchern über das Bewusstsein, ein bewussteres Leben, bewusstes Kochen und bewusste Ernährung. Ältere Semester bevorzugen kiloschwere Fantasyliteratur mit güldenen Lettern auf dem Einband, welche sie in fremde Welten begleiten zu erfundenen Orten, eingezeichnet auf sonderbaren Landkarten, gehalten in mittelalterlicher Aufmachung. Doch viel häufiger erblickt man Titel, versehen mit provokanten Fragen: Wie wird man charismatisch, wie erarbeitet man sich mehr Ausstrahlung, wie zieht man das Glück an? Positiv soll man denken und in froher Erwartung leben, auch wenn erst dadurch die Enttäuschung über das reale Leben in seiner ab und an erbarmungslosen Kargheit den positivistischen Phantasten erst richtig zu fassen bekommt. Nein, auch dann noch soll man das Positive suchen, sich in die Keimzelle neuer Hoffnung träumen. Doch mich deucht, wer einer erstickenden persönlichen Niederlage mit grenzenlosem Optimismus ins Auge blickt, wird dabei in der Folge innerlich stets härter und abgeklärter werden müssen. Und erkennt man erst einmal die manipulativen Momente seiner Sinnestäuschung, verharrt man nicht mehr versunken in aufgesetzter Fröhlichkeit, sondern verliert möglicherweise sein Grundvertrauen in die Welt. Doch ging die Bedeutung des eigenen Lebens nicht bereits verloren, während man bereits zuvor in der ziellosen Schlafwandlerei des Positivismus verharrte? Alles dies weist auf einen heimlichen Paradigmenwechsel hin, den deshalb keiner so richtig bemerkte, weil allzu viele Menschen sich bereitwillig dem seichten Trend fügten. Vielleicht sind einige von uns im Laufe der Zeit vorsichtiger geworden, was den Umgang mit den bekannten Sekten angeht, doch auch deren Lehren zirkulieren indes munter weiter. So haben die Sektenkritiker einen fundamentalen Fehler begangen, als sie die finanzielle Schröpfung und die gesellschaftliche Isolation als Hauptmerkmale dieser Institutionen herausgestellt haben, vielleicht einfach aufgrund dessen, dass man die Befindlichkeiten derjenigen nicht stören wollte, die der angeblichen Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit wohlwollend gegenüberstanden. So waren die Argumente gegen Sekten immer von ihrer Exklusivität und ihrem ökonomischen Wirken im Hintergrund geprägt. Doch belastet nicht der Staat auch die Menschen mit seinen Steuern und verbringen unzählige Menschen jeden Tag mit Überstunden in einem exklusiven Unternehmen? Das Eigentümliche an Sekten ist jedoch vor allem ihre Ideologie, ihr Konzept von der Welt. Die Einschränkung des Menschen beginnt hier mit Denkverboten, welche über eine erst sanfte, dann immer strengere Gehirnwäsche den Einzelnen aus seiner individuellen Freiheit herausreißt. Diese Maßregelungen unterscheiden sich mitunter sehr deutlich, sie können vom ritualisierten Alltag über weltanschauliche Fragen bis zur körperlichen und seelischen Erniedrigung reichen.
Die Frage aber, welcher in diesem Buch nachgegangen werden soll, ist eine andere, nämlich ob es nicht vielleicht eine Ideologie geben kann und gibt, welche ohne all diese festen Strukturen und ohne zu offensichtlich sektentypische Eigenarten die Gemüter faszinieren kann. Ist es möglich, eine Ideologie zu verbreiten, die ganz auf jede politische Richtung und ein übersinnliches oder extraterrestrisches Konstrukt verzichtet, und würden einige Menschen die Indoktrination dann vielleicht gar nicht bemerken?
2. Ein neuer Stern am Psychomarkt
Erste Kontakte in eine Parallelwelt
Es war im Februar des Jahres 2006, da entdeckte ich beim Stöbern im Internet zufällig eine Anzeige. Eine Frau wollte ihr Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr hier in Berlin online verkaufen. Nur eine Woche sei es alt, sie veranschlagte den halben Preis, der am Schalter fällig werden würde, und da mein eigenes wenige Tage zuvor erst abgelaufen war, schrieb ich ihr und erhielt eine Antwort mit der Einladung, bei ihr vorbeizukommen. Ich irrte ein wenig durch den Schöneberger Norden in der Gegend um den Nollendorfplatz, fand endlich die Adresse, klingelte, wurde eingelassen. Es war eine dieser typischen Berliner Zwei–Zimmer–Wohnungen mit leicht antikem Charme, abgeschliffenen Dielen, weißen Wänden, und hohen Fenstern zur Südseite. Ich traf auf eine gut gelaunte Mittdreißigerin, etwa eins sechzig, schlank und redselig und höflicher Attitüde.
Den angebotenen Tee nahm ich gern an, während sie mir eröffnete, dass wir noch auf einen weiteren Besucher warten müssten, der sich für ihre Umzugkartons interessierte. Wir saßen also beim Tee in der Küche, eine Frage ergab die nächste und so landeten wir fast unmerklich bei einem Thema, dass sie sehr zu begeistern schien. In dem selben Haus wohnte, wie sie mir erklärte, einer der bekanntesten NLP–Trainer Berlins, ein gewisser Chris Mulzer, von dem sie so fasziniert wirkte, dass ich bereits auf ein körperliches Interesse schloss, was aber nach ihrer Aussage nicht der Fall wäre, schließlich scheiterte ein solches auch an dessen sexueller Orientierung. Nein, die Faszination lag hier auf einer Methode, die dieser Mann propagierte und damit nach ihrer Aussage viele Menschen glücklich machte. Während ich mich fragte, warum ich auf den anderen Käufer warten musste, erklärte mir meine Gastgeberin, dass dieses NLP ihr Leben gründlich verändert habe.
So habe sie beispielsweise während eines Seminars das sogenannte Ankern erlernt. Sie begann damit, mir sehr anschaulich zu erklären, wie man Gefühle über Pawlowsche Reflexe hervorrufen kann, indem man sich selbst auf den Ellenbogen drückt und dabei an eine Gefühlsregung denkt, so dass beides hernach miteinander verknüpft sei. Dies zeige sich dann augenblicklich, sobald jemand wieder auf diesen Punkt seinen Finger legte. Was wie kindliche Spielerei klingt, schien mir im Grunde als nichts anderes als ein unverantwortliches Eingreifen in die Biologie der körpereigenen Signale, ebenso in das mentale Selbstempfinden, was zwangsläufig in einer gewissen Veränderung der Interpretation derselben mündet, so dachte ich bei mir. Die ursprünglichen Reflexe haben doch einen Grund, sie sind evolutionär bedingt und helfen dem Menschen in bestimmten Situationen, in dem sie Angst, Freude, Vorsicht oder Euphorie wecken, andererseits sind diese Gefühle auch ein Ausdruck unserer Psyche, welche mit dem Körper in einem Gleichgewicht steht.
Ich schwieg also zu ihren Ausführungen, aber ich hatte auch gar keine Wahl, denn sie redete und redete, sprach weiter ohne Unterlass, und ich traute mich zu keinem offenen Widerspruch. Am Ende würde ich mein Monatsticket noch abschreiben müssen, wenn ich hier leise Zweifel äußern würde. Als sie dann doch einen Moment innehielt, nutzte ich die Gelegenheit, auf den Gegenstand meines Besuchs zurückzukommen. Sie erwähnte daraufhin, dass sie das Ticket nicht mehr brauchen würde, weil sie eine Geschäftsreise nach China unternehmen würde, was sie häufiger täte. Aber über das Reich der Mitte gab es von ihrer Seite nur wenig Erzählenswertes, obschon mich dies viel mehr interessiert hätte als ihre Erfahrungen mit einem Scharlatan in einem schlechten Hypnoseseminar.
Kurze Zeit darauf erschien endlich doch noch der zweite Käufer, wie sich herausstellte ein Fernsehjournalist. Es entspann sich nun ein Gespräch, welches zunehmend von den beiden geführt wurde, ich selbst arrangierte mich mit der Rolle des Zuhörers und nahm intensiv Notiz davon, wie man sich über die Vorteile neurolinguistischen Programmierens austauschte. Denn auch er kannte sich bereits damit aus, war aber noch nicht involviert. So berichtete er von Partys, auf denen er darüber gehört hatte und dass es in bestimmten Kreisen ja üblich sei, sich mit dem NLP zu beschäftigen. Er selbst sei im Medienbetrieb bloß ein kleines Rädchen im Getriebe. Auf meine Frage, was er denn in seinem durchaus spannend klingenden Beruf mache, seufzte er ein wenig über die schlechte Bezahlung und die Aufgabe, für einen großen Luxemburgischen Privatsender Nachbarschaftsstreitigkeiten zu Skandalen ausschlachten zu müssen, indem man zwei Parteien gegeneinander auszuspielen hätte. Er habe darin bereits Erfahrung, man müsse den einen Nachbarn, der den Bösen zu spielen habe, einfach nur zur Unzeit überraschen, damit er entsprechend reagiere, während man den anderen in einem guten Licht darzustellen habe. Der Job sei nervig und es wiederhole sich alles immer wieder, letztlich sei es nur mehr Routine. Um beim Fernsehen aufzusteigen, sei ein NLP–Training wohl aber nicht die schlechteste Einscheidung, meinte er, um sich wieder unserer Gastgeberin zuzuwenden.
Sie pflichtete ihm bei. Immer wieder erwähnte sie auch während unseres Besuchs, dass man die Lehre nicht einfach so erklären könne. Der Anschein des Geheimnisvollen weckte bei mir aber aufgrund ihrer Erzählungen allerdings mehr und mehr eine skeptische Haltung. Andererseits musste ich ab und an achtgeben, nicht urplötzlich schmunzeln zu müssen. Die aufgesetzte Begeisterung wirkte zu verstörend. Unfreiwillig in einer Werbeveranstaltung gelandet, nickte ich mit großen Augen alles ab, ungeduldig wartend auf die Herausgabe meines Fahrscheins.
Der Journalist sprach derweil offen mit ihr und meinte, dass er doch mehr über die Geheimnisse des NLP erfahren wolle und verwies abermals darauf, dass man diese Dinge wohl heutzutage brauche, um beruflich aufzusteigen. Sie stimmte ihm zu und erwähnte dabei auch wiederholt ihre regelmäßigen Geschäftsreisen nach China, leider ohne näher darauf einzugehen, was sie dort eigentlich machte. Immer wieder fielen die Begriffe, die mir damals weder geläufig, noch inhaltlich einordbar waren.
Fast wie selbstverständlich kamen diese technisch konnotierten Worte aus ihrem Mund, wenn sie darüber sprach. Und auch ihre Begeisterung nahm einfach kein Ende. Wenn eine solche Psychomethode derart auf die Menschen wirkte, dachte ich bei mir, ist natürlich Vorsicht geboten. Seelenfänger stehen schließlich an jeder Straßenecke, seien es Mormonen oder die Zeugen Jehovas. Dagegen erschien mir dieses NLP natürlich als weitaus simpler gestrickt und nicht annähernd so schillernd wie diese. Vielleicht lag es daran, dass ich bis dahin noch nie etwas vom NLP gehört hatte und es mir schier belanglos und weltfremd vorkam, was ich hier zu hören bekam.
Doch irgendwie war es auch beängstigend, wie sehr diese beiden jauchzenden NLP–Fans dieser Psychomethode eine überbordende Bedeutung zuerkannten und dabei von jeder Ernsthaftigkeit oder Sachlichkeit entfernt waren. Wie sehr sie von ihrem missionarischen Eifer elektrisiert war, meinte ich in diesen Momenten schon beinahe körperlich zu spüren. Ein Verhalten des „Spiegelns“ von anderen sei auch sehr wichtig. Selbiges werde zudem auch mit dem Anglizismus „Pacing“ umschrieben. Man ginge auf den anderen ein, indem man seine Körpersignale und seine Stimmung aufnehme, um sich dem anderen damit anzunähern, anzugleichen. So ging es noch eine ganze Weile, bis wir irgendwann endlich zu dem eigentlichen Zweck des Besuchs kamen, zumindest dem, für welchen ich den Weg nach Schöneberg auf mich genommen hatte. Als ich an diesem Tage zu Hause ankam, war es bereits dunkel, spät, dennoch bemühte ich das Internet, um zumindest den Begriff des „Pacing“ näher zu verstehen. Es war seltsam, aber über leo.org fand ich dort kein „Spiegeln“, auch keinen „Spiegel“ oder eine „Verspiegelung“, nein, rein gar nichts dergleichen. Stattdessen las ich sechs verschiedene Übersetzungen, die allesamt einen technischen Unterton aufwiesen:
„pacing [tech.] die Frequenzstimulation, [...] (adj.) schreitend, [...] [med.] die Schrittmachertherapie, [...] die Schrittsteuerung, [...] [tech.] die Stufensteuerung, [...] Tempo der Durchführung“1
Ging es hier aber nicht um einen Begriff aus dem weiten Feld der Psychologie? Und hatte die Frau aus Schöneberg nicht erwähnt, dass man sich beim „Pacing“ seinem Gegenüber anpasste, also ihm etwas gleichtäte? Was hatte das alles mit „Schreiten“ zu tun? Meine Skepsis war geweckt, doch meine Aufmerksamkeit immer noch auf mein damals noch nicht abgeschlossenes Studium und meine Diplomarbeit konzentriert.
Eines hatte ich jedoch an diesem Nachmittag deutlich gespürt. Mit ihrer offenen und zwei ihr vollkommen fremden Personen entgegengebrachten Werbung für das NLP entlarvte diese Frau dasselbe faktisch bereits als Verhandlungsstrategie, welche sich dann auch im Privaten wiederfindet, um hier eventuell einen klassischen Wertewandel zu unterstützen. Der private Dialog wird so schnell zur Verkaufsdebatte eigener Vorstellungen, die wiederum von den Gedanken des NLP beeinflusst sind. Es verwundert also kaum, dass es nicht allein die Verhaltenskonzepte sind, welche übernommen werden, sondern vielmehr die Strukturen dieser Anschauung letztlich Meinungen und Standpunkte des Anhängers verändern.
Man wird somit als Gesprächspartner gewissermaßen überrumpelt, so man diese Verhaltensweisen nicht versteht, ebenso die Absicht des Gegenübers. Damals ahnte ich es dunkel, doch ich wusste noch nichts über die Strukturen des NLP und seiner Anhänger. Doch bemerkte ich bereits, dass man sich einer bestimmten Wortwahl bedient und ein gespieltes Entgegenkommen zeigt, die Gefühlslage des anderen ausnutzt, um an sein Ziel zu kommen, etwas zu verkaufen oder jemanden zu überreden.
Andererseits gibt es auch weitere Gründe für einen heftigen Widerspruch. Über das Wirken der Körpersprache gibt es schließlich reichlich Literatur. Und der bekannteste Experte in diesem Bereich ist wohl der Autor Samy Molcho, welcher im Hinblick auf die subjektive Einschätzung dieser in einem seiner Bücher schrieb:
„Bewegungen des Körpers sind wie jede Art von Informationen auslegbar. Die Neigung unserer Zeit, alles objektivieren zu wollen, sollte im Umgang mit Körpersprache zurückgedrängt werden.“2
In einem Interview mit dem Fernsehsender 3sat erklärte er zum anderen auch, dass der Mensch sich automatisch bewege, sobald er etwas empfinde und der Körper sich über die innere Einstellung des Menschen nach außen mitteile. Nur dann, wenn der Mensch nicht involviert ist, keine Empfindung zu einem Thema hat, dann werde die Körpersprache unerheblich. Auch meinte Molcho, dass einstudierte Gestiken den Geist blockieren können, einige solcher fände man beispielsweise bei Politikern, und diese erschienen ihm „geklebt“, eine „Montage“. Viel wichtiger ist aber seine Antwort auf die Frage, ob die Körpersprache auch eine Rückwirkung auf die Persönlichkeit des Agierenden haben könnte. Dem stimmte er zu, indem er ausführte, dass die Körpersprache den Menschen aufgrund dessen, er auf eine bestimmte Weise handele, auch beeinflusse.3
Für Samy Molcho ist die Körpersprache der Ausdruck unseres Selbst, eine Unterstreichung der eigenen Persönlichkeit. Zwei Menschen mit völlig unterschiedlichem Temperament können sich schlecht einander in ihrer Körpersprache anpassen, ohne dabei Gefahr zu laufen, ihre Persönlichkeit zu verändern. Tritt dies dennoch ein, ist die intuitive Annäherung beider bereits im Gange, sie ist eine Folge einer empathischen Verständigung, die Körpersprache nur die Folge dessen, die sichtbare, die symptomatische Konsequenz. Wird also beim sogenannten „Pacing“ nicht der Karren vors Pferd gespannt? Wird durch eine mutwillige Veränderung der Körpersprache der Mensch aber nicht rückwirkend zu einer Sympathiebekundung animiert, ohne dass eine ausreichende zwischenmenschliche Basis geschaffen wurde?
Der Schnupperkurs
Ein weiteres Erlebnis ähnlicher Art ereilte mich einige Jahre später. Ich war zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Bowling war angesagt und anschließend ein zwangloses Picknick im Park neben der Bowlinghalle.
Als Single geoutet, empfahl mir einer der Gäste sein eigenes Flirttraining, zu welchen ich an einem Schnupperabend vorbeikommen könne. Die ersten zwei Stunden seien kostenlos.
Durchaus interessiert daran, was mich erwarten würde, machte ich mich an dem besagten Samstagabend auf den Weg in den Stadtteil der alleinerziehenden Milchkaffeeschlürferinnen, Berlin–Prenzlberg. Wie damals schon bei meinem Erlebnis in Schöneberg stand ich wieder vor einem der typischen Gründerzeithäuser und wartete noch ein paar Minuten, bis die anderen Seminarteilnehmer eintrafen, insgesamt sechs männliche Personen. Die beiden Coachs kamen schließlich auch und uns wurde die Tür in eine zu Schulungsräumen umgebaute Erdgeschosswohnung geöffnet. Eine jugendliche Sekretärin saß im Vorraum und bearbeitete diverse Papiere. Die strahlend weiß gestrichenen Wände, die luftige Atmosphäre und der Duft eines ausklingenden lauen Sommerabends vermischten sich mit der Neugier auf das zu offenbarende Geheimnis der nächsten Stunden.
Wir wurden in ein Zimmer gebeten und setzen uns auf die bereitgestellten Stühle. Jedem wurde Schokolade angeboten, und im Hintergrund lief leise Musik aus den 80er und 90er Jahren. Ich war immer noch angespannt. Was erwartete mich bei diesem Flirttraining? Meine Erwartungen gingen etwa in die Richtung, dass ich vermutete, man würde seine Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig erläutern, worin seine eigenen Erfolge und Misserfolge lagen, diese gegenseitig beurteilen und versuchen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.
Tatsächlich begann der Kurs aber zunächst mit einem Statement zu NLP. Warum sei NLP Scientology überlegen und wieso gelten die NLP– Regeln nicht nur beim Flirten, sondern generell, waren die ersten Bemerkungen, welche an diesem Abend fielen. Die Musik im Hintergrund wurde gedrosselt und die beiden Coachs erklärten freimütig, wie erfolgreich sie beim anderen Geschlecht geworden seien, seitdem sie sich an die Vorgaben des NLP hielten.
Alsbald wurde es dann auch konkreter. Man müsse, um sich einer Frau anzunähern, diese in ihrem Wesen nachahmen, was wieder als „Spiegeln“ bezeichnet wurde, das erste Déjà–vu. Die Vorzüge dieses Verhaltens wurden nachdrücklich hervorgehoben. Es sei schließlich ein Zeichen der Zuneigung und der Ähnlichkeit zwischen zwei Menschen, wenn man, in einem Café sitzend, zur selben Zeit zum Glas greifen würde oder einfach nur gemeinsam lächelte.
Anschließend wurden die Teilnehmer aufgefordert, diverse Punkte zusammenzutragen, mit denen man eine potentielle Partnerin kopieren könne, so die Körperhaltung, der Grad der Hektik oder Ausgeglichenheit, der Sprachrhythmus, die Höhe der Stimmlage, Gesten, die Art zu Sitzen etc.
All diese Aussagen wurden auf einem Flipchart notiert, bevor es nahtlos weiterging mit einem Spiel, zu welchem sich jeweils drei Personen in Form eines Dreiecks gegeneinander postieren sollten, während einer von ihnen den anderen den Rücken zuwandte. Es ging darum, diesem Teilnehmer in seinen Bewegungen zu folgen. Sobald dieser seine Führungsrolle temporär aufgeben wollte, sollte er sich einem der anderen Teilnehmer zuwenden. Daraufhin drehten sich die anderen beiden zusammen mit ihm um. Derjenige, welcher jetzt an der Spitze des Dreiecks stand und von den anderen beiden fortschaute, gab daraufhin die Bewegung vor. Dieses „Spiel“, so wurde hinterher erklärt, zeige, wie man führt und geführt wird.
Danach folgte ein weiteres ähnlicher Art. Diesmal wurden zwei der Teilnehmer – darunter auch ich – nach draußen geführt und alle Beteiligten mit einer speziellen Aufgabe betraut. Die beiden uneingeweihten und damit unbedarften Neuzugänge bekamen den Auftrag, zehn Minuten lang vor zwei anderen, die ihnen gegenübersaßen, über irgendein Thema zu reden. Was die beiden anderen derweil zu tun hatten, wurde uns zweien indes nicht gesagt.
Wir betraten den Schulungsraum erneut, und ich setzte mich meinen beiden Zuhörern gegenüber und fing an, über dieses und jenes zu reden. Während ich nun ohne Unterlass sprach, fragte ich mich unentwegt, was die beiden nun tun sollten. Der eine schien gelangweilt und zeigte reges Desinteresse an meinen Ausführungen, der andere war hingegen überhektisch und gestikulierte, ohne dabei ein Wort zusagen. Selbstverständlich versuchte ich gerade den gelangweilten, von meinem Vortrag zu begeistern, was meine Gegenüber nur noch mehr in die ihnen aufgetragenen Rollen drängte. Beide empfand ich damals als unhöflich und auf jeweils ihre Art provokant. Nach etwa fünf Minuten schloss jemand ein Fenster, dass während wir beide draußen gewartet hatten, geöffnet worden war. Daraufhin drehte sich das Bild, beide Zuhörer wechselten ihre Rollen.
Nach etwa zehn Minuten war der Spuk vorbei. Doch folgte nach diesem Redemarathon keineswegs eine verdiente Pause. Denn gleich darauf wurden wir, die beiden unfreiwilligen Akteure, gefragt, was wir während des Prozederes nun bemerkt hätten. Mein Leidensgenosse wies pflichtbewusst auf die Unterschiede zwischen den beiden Zuhörenden hin, während ich provokativ darauf insistierte, kaum einen Unterschied bemerkt zu haben. Schließlich waren mir beide aufgrund ihres unnatürlichen Verhaltens suspekt erschienen, warum sollte ich also zuerst die Unterschiede betonen, wo sie mir doch vielmehr durch ihre aufgesetzte Art auffielen und dabei gleichsam unempathisch wirkten?
Insgeheim hatte ich auf eine hemdsärmliche Erklärung gehofft, eine Entzauberung der Affektiertheit, einen Moment der Ehrlichkeit, der alles erklären würde. Ein Hauch verschworener Verschmitztheit hätte mein aufgewühltes Gemüt vielleicht schon etwas zu trösten vermocht, doch dies war nicht Teil der Übung, die an dieser Stelle eben noch nicht beendet war. Dieser Abschnitt gehörte freilich noch zu dem Spiel, ebenso der künstliche Tonfall unserer Gastgeber.
So gab einer der Coachs sich demonstrativ überrascht, als er nun mit verblüffter Miene bemerkte, dass unsere Gegenüber während der Prozedur schlichtweg nur zuhören sollten, nichts anderes. Danach herrschte für einen Moment Stille, bis er doch noch hinzufügte, dass es doch noch eine weitere Aufgabe gegeben habe, der eine jeweils versuchen sollte, den Erzählenden nachzuahmen, während der andere sich diesem entsprechend so unähnlich wie möglich zu verhalten habe. Das war es wieder, das „Pacing“, welches im Falle des Gelingens mit dem Begriff „Matchen“ beschrieben wurde. Der zweite „Zuhörer“ war derweilen damit beauftragt, sämtliche Verhaltensweisen seines Gegenübers in ihr offensichtliches Gegenteil zu verkehren, ihn zu „mismatchen“. Wofür diese eigentümliche Sprache nötig war, wurde selbstverständlich übergangen. Auch fragte niemand nach, wie auch, hier ging es um Indoktrination, nicht etwa darum, zu verstehen, was mit den Teilnehmern gerade geschieht.
Anschließend wurde doch noch einmal das Thema des Abends aufgegriffen: das Flirten. Der Bezug zu den anfangs notierten Begriffen wurde abermals aufgebaut und nun das Prinzip des „Pacings“ und „Leadings“ anhand der vorgeblich geglückten Experimente gerechtfertigt.
Das „Spiegeln“ würde also Vertrauen wecken, in etwa so, wie der merkwürdige Hektiker mir hätte sympathisch sein sollen. Dann könne man irgendwann die andere Person führen oder, falls man das unverfängliche englische Wort lieber mochte, ins „Leading“ übergehen. Hier gab es wohl eine Assoziation zu dem Dreiecksspiel zu Beginn der Veranstaltung. Die Theorie schien klar, hier ging es nicht darum zu ergründen, wer wen warum anziehend findet oder welcher Partner für einen selbst geeignet wäre, sondern um etwas ganz anderes.
Die zwei Stunden vergingen und nur wenige Worte waren zum Thema Flirten oder Frauen gefallen. Das Seminar war beherrscht vom Gedanken des NLP. Auf dem Heimweg fuhr ich noch wenige Stationen mit einem der Teilnehmer zusammen, einem schlanken, etwa Ende Dreißigjährigen, der sich nach eigener Aussage wirklich hierdurch mehr Erfolg bei Frauen erhoffte.
Ich fragte mich derweil, wie ehrlich ein solches Vorgehen sein könne und welche Konsequenzen dies für eine Beziehung haben müsse. Mit Romantik haben diese Spielchen wenig zu schaffen, das tiefe Verstehen für das Gegenüber kann mit aufgesetztem Handeln nur simuliert, aber nichts wirklich empfunden werden, da man stets auf sein Agieren und Reagieren zu achten habe. Ist die Liebe selbst nicht etwa geprägt von einer erfüllenden Behaglichkeit, von einer wohltuenden inneren Freude? Wo kann da Platz sein für das deformierende Verdrehen der eigenen Befindlichkeit?
Einige Wochen später traf ich den einen der beiden Trainer wieder auf einer Hochzeitsfeier. Er fragte mich, ob ich mich weiterhin mit diesen Methoden beschäftigt hätte. Ich entgegnete, dass ich nun schon etwas darüber im Internet gelesen hätte und mich damit auseinander setzte. Bestürzt antwortete er, ich solle es anwenden und nicht darüber irgendwelche Texte lesen. Zu einer Vertiefung des Gesprächs kam es nicht mehr. Wie bei solchen Feiern üblich, lief im Hintergrund derweil dahinplätschernde Musik aus einer Anlage. Mein Gesprächspartner wirkte plötzlich irritiert. Er meinte, er könne sich gerade nicht konzentrieren, da das gerade gespielte Lied einer seiner älteren „Anker“ sei. Tatsächlich spürte ich, dass seine Gedanken abschweiften. Ich fragte mich, was passieren würde, wenn ein Radiosender diesen mir völlig unbekannten Titel zufällig spielen würde und mein Gegenüber, anstatt auf einer Hochzeitsgesellschaft, vor dem Steuer eines Wagens säße und mit 150 km/h auf der stark befahrenden A9 unterwegs wäre. Die Vorstellung erschrak mich, und vielleicht war es dieser Moment, der mein Interesse an einer weiteren Auseinandersetzung mit der Thematik erst richtig weckte.
Die Weiterbildung
Ein drittes Erlebnis dieser Art ereilte mich dann allerdings erst wieder einige Jahre später. Zwar hatte ich mir ein paar Dinge zum Thema NLP angelesen und mich davon überzeugt, dass es keine gute Idee gewesen wäre, sich demselben unkritisch zu nähern, aber ich war immer noch davon überzeugt, dass man als Mensch diesen drei Buchstaben problemlos aus dem Weg gehen könne, wenn man nur wollte. Es schien mir so, als wäre das NLP eine Nische und seine Anhänger nur mehr Adepten einer eigentümlichen Weltanschauung, wie Keynesianer oder Marxisten auch, Menschen, die zuviel in die Bücher ihrer Idole hineininterpretierten, um sich am Ende nur um so mehr über letztere zu täuschen. Eine echte Debatte um das NLP mit seinen Anhängern, glaubte ich allerdings damals schon, könnte in jedem Falle nur wenig fruchtbar sein, da eine Diskussion, welche das Für und Wider abgleichen würde, mit denen nicht zu führen war, da mir bislang nur stets ihre impulsive Überredungstaktik zuteil wurde. Manch einer wird sich noch aus Schulzeiten an die Geschichte erinnern, welches Schicksal den griechischen Philosophen Sokrates ereilt hatte, nachdem er darauf bestanden hatte, den Sophisten entgegenzuhalten, keine wirklichen Argumente vorzubringen, sondern schlicht auf gekünstelte Überredungstricks zu setzen, wohlklingende Termini höher einzustufen als offene Worte.
Mir wurde nun in einem dritten Fall eines direkten Kontakts das zweifelhafte Glück zuteil, mehr oder minder unfreiwillig in einen Kommunikationskurs zu geraten, welcher meine obigen Erfahrungen eindrucksvoll bestätigte. Gleich zu Beginn zeigte sich in der Person des Dozenten ein freudig gestimmter Motivationstrainer, kein Lehrer im herkömmlichen, konventionellen Sinne, sondern ein Spaßmacher, ein Unterhalter. Lustige Überschriften in farbenfroher Manier zierten den Flipchart, eines der liebsten Utensilien der Motivationsdozenten. Mit laxer Fröhlichkeit suchte er sein Auditorium überraschen, und dazu gehören nun einmal auch kreativ gewählte Titel der abzuhandelnden Abschnitte seines Unterrichts in lustigen Farbnuancen mit einem Edding auf das Papier des Flipcharts oder eine sogenannte „Moderationskarte“ gekritzelt.
Er hielt uns Teilnehmer auch körperlich auf Trab, so wechselten wir gleich dreimal den Schulungsraum, ohne dass dies für die jeweiligen Übungen nötig gewesen wäre. Hinterher herrschte dann ein Gefühl der Leere, da der betriebene Aufwand zu Beginn auf eine größere Anstrengung schließen ließ. Es war beispielsweise kaum verständlich, sich im Treppenhaus des Nachbargebäudes zu versammeln, um dort dann gemeinschaftlich feststellen zu dürfen, dass man mit einem an vier Stricken befestigten Stift, gehalten und bewegt von jeweils vier verschiedenen Personen auf einem liegenden Blatt Papier, keinen runden Kreis zeichnen kann. Zumindest schien es nicht möglich zu sein, während man dabei schwieg. Und so reihte sich eine Übung an die nächste. Ob nun der Dozent auf den hinteren Bänken verteilte Fotos mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken nach deren Sympathie auswählen ließ, um dies einen „Bilderspaziergang“ zu nennen oder die Teilnehmer zu peinlichen Versuchen animierte, die Sprecherin einer Nachrichtensendung im Fernsehen zu imitieren, was bei mir ein sofortiges Fremdschämen verursachte, da ich derartige Anmaßungen generell als unangebracht empfinde, der Kurs entpuppte sich letztlich als lose Aufeinanderfolge langweiliger Partyspiele, deren Gehalt auf groteske Weise überhöht wurde.
Das signifikanteste Beispiel innerhalb des Kurses war aber ein reichlich zwielichtiger Test zu einer gewissen Augenbewegungsmustertheorie. Die drei männlichen Teilnehmer (darunter logischerweise auch ich) wurden zunächst ohne eine Ankündigung, was nun passieren würde, genötigt, den Raum kurz zu verlassen, um hernach diverse Fragen zu beantworten, während die beiden weiblichen Kursteilnehmer anschließend auch zusammen mit denen, die das Prozedere schon durchlaufen hatten, die Pupillenbewegungen des jeweiligen Probanden in der Zeit vor dem Antworten beurteilen sollten.
Als ich an der Reihe war, wusste ich demnach nicht, was mir blühte. Die erste Frage war, welche Farbe das Auto hatte, mit dem ich zum ersten Mal in meinem Leben gefahren sei. Mein Blick huschte zum Fenster, draußen war ein Parkplatz. Allerdings konnte ich diesen von meinem Stuhl aus nicht sehen, schaute derweil lieber in die Gesichter meiner Kollegen, die erkennbar auf eine Antwort warteten. Eine Teilnehmerin war belustigt, andere blickten mich aufmerksam an. Mehrere solcher Fragen folgten, während mir der Sinn hinter dem Experiment einfach nicht klar werden wollte. Zuletzt war es nicht einmal mehr eine Frage, sondern einfach eine Anweisung. Ich sollte mir den Geruch von Ammoniak vorstellen. Den beißenden Geruch hatte ich seit meiner Ausbildung noch in der Nase, nickte also entsprechend und sah dem Fragesteller dabei direkt in seine Augen. Doch aus irgendeinem Grund erhielt ich die Anweisung insgesamt dreimal.
Im Anschluss an dieses merkwürdige Experiment folgte die Auflösung. Der Dozent erklärte, dass die Richtung, in welche man schaute, etwas über die Form der Gedanken verraten würde, über ihr sinnliches Hauptmerkmal. Die Augen des Menschen würden infolge der Struktur einer Sequenz innerhalb der Erinnerung oder ob einer Vorstellung des Menschen automatisch zu bestimmten, universell zu beobachtenden und bei jedem Individuum wiederzufindenden Bewegungen ausführen. So könne man erkennen, ob sein Gesprächspartner gerade an ein Bild dächte, wenn er nach oben schaute, wiederum bei einer taktilen, Geruchs– oder Geschmacksempfindung nach unten und schließlich zur Seite, so der momentane Gedanke wesentlich von einem Geräusch geprägt worden war. Dazu kam, dass sich man bei einem Blick nach rechts gedanklich im Bereich des Fiktionalen und bei einem Blick nach links dem der wirklichen Erinnerung aufhalte.
Zunächst war ich verdutzt, doch sofort keimte Skepsis in mir auf. Der Mensch sucht während eines Gesprächs nach Fixpunkten und seine Umgebung nach Inspirationen ab sowie in den Gesichten der ihn umgebenden Personen nach spontanen Reaktionen. All dies steht innerhalb einer konkreten Situation in einem unmittelbaren Wechselspiel. Die Blickrichtung wechselt dabei häufig, ordnet sich der Analyse unseres Umfeldes unter und ist kein Lackmustest der inneren Befindlichkeit. Natürlich kann ein Blick nach unten Frust und Traurigkeit bedeuten, doch die Gedanken in solch einem Moment mögen ebenso klare Bilder und Töne enthalten wie der Blick nach oben.
Was mir ebenfalls merkwürdig erschien, war die Fokussierung auf nur eine Form der Sinneswahrnehmung. Bestehen die Erinnerungen des Menschen nicht aus Szenerien, die sämtliche äußere Eindrücke vereinen? Und auch warum man die Gedanken an fünf Sinne schlussendlich nur an einem einzelnen ablesen können sollte, wurde von diesem Dozenten nicht verraten, meine Ohren hatte ich jedenfalls nicht bewegt.
Natürlich war es ein Trick. Da man sich selbst gar nicht beobachten kann, muss man auf die Aussagen der anderen vertrauen. Und natürlich, während sie nachdenken, bewegen viele Menschen unwillkürlich ihre Augen. Aber ob man zunächst nach unten, oben oder zur Seite blickt, hat aber entgegen dieser Theorie allerdings nichts mit einem bestimmten Denken zu tun, genauso wenig zeigen sich in seitlichen Bewegungen der Augen andere Denkmuster, welche reproduzierbar ausgewertet werden können. Vielmehr findet vermittels dieser Verlautbarungen des Dozenten, also schlichter Behauptungen auf der Grundlage eines theoretischen Modells, eine Konditionierung statt. Da er nämlich zusätzlich anmerkte, dass der Mensch aufgrund dieser universellen Muster bei einer bewussten Augenbewegung in die vorgegebene Richtung sich besser auf die jeweiligen Sinne konzentrieren könne, wurde den Seminarteilnehmern auch gleichsam empfohlen, sich dieser angeblich so unabänderlichen Tatsache zu stellen und sie gewissermaßen für die eigenen Denkabläufe gewinnbringend zu nutzen. Gegenüber den nach dem Experiment noch verunsicherten Probanden war dies natürlich eine Ungeheuerlichkeit.
Der Dozent wollte damit fraglos erreichen, dass sämtliche Teilnehmer dieses Kurses im Anschluss darauf vertrauten, dass jeder Bewegung der Augen die von ihm beschriebene Regelmäßigkeit zu Grunde läge und man sich von nun an daran zu orientieren habe. Man übernähme somit nicht bloß ein Verhalten, sondern eine innere Einstellung, welches aber erst durch den intensiven Glauben daran legitimiert würde. Dazu kam dieser unangenehme Gedanke, dass man von einem diesbezüglich geschulten Menschen ja missverstanden würde, so man sich nicht an diese Prinzipien hielt.
In den Gesprächen während der anschließenden Pause nach dem Experiment hatte ich dann die Gelegenheit, mit meinen Kommilitonen darüber zu reden. Und tatsächlich schien sich der Glaube an dieses Modell bereits unter den Teilnehmern durchgesetzt zu haben, obwohl es – wie ich noch herausfinden sollte – gerade in diesem Kurs bereits Belege gegen diese Theorie gab.
Als ich dann später innerhalb des Seminars fragte, ob dies alles nicht etwa ein manipulatives Spiel sei, reagierte der Coach, welcher sich als Dozent einer gewissen Autorität bewusst war, erwartungsgemäß freundlich. In Hinblick auf die anderen Zuhörer versuchte er es entsprechend der gerade eben noch von ihm und den anderen Kursteilnehmern bei mir festgestellten Bewegungen meiner Pupillen mit einer Geschichte, welche Bilder und Gegenstände beinhaltete, zumal ich während der Befragung zunächst nach oben und wenige Sekunden darauf nach unten schaute. Dies hatte den unspektakulären Grund, dass ich hin und wieder genervt nach oben und dann zur Entspannung der Augen in die entgegengesetzte Richtung, also nach unten, blickte, was natürlich von den anderen Teilnehmern registriert wurde.
Eigens zur weiteren Stimulation der übrigen Teilnehmer demonstrierte er nun an mir das zu erwartende Exempel, einen Versuch der Überredung, in welchem ich mehr oder weniger nur Objekt und kein agierender Gesprächspartner war. Und schon aus dem denkbar einfachsten Grund heraus widersprach ich irgendwann nicht mehr, da ich schließlich nicht dauerhaft den Spielverderber und damit auch den querulantischen Zeitplanverzögerer geben konnte, was wiederum zwangsläufig dazu führte, dass er in der gleichen fröhlichen Manier munter fortfahren durfte. Doch war dies offenkundig selbst Teil seines Konzeptes und des gesamten Prozederes. Denn es war keineswegs so, dass er mich persönlich mit seiner Eloquenz zu überzeugen trachtete, vielmehr ging es ihm zuerst um die Masse, welche den Störenfried schließlich durch ihr Verhalten, ihre Zustimmung zur Haltung des Coachs beschwichtigen und die Zwischenrufe als unpassende Abschweifung innerlich geißeln soll.
Dennoch hätten eigentlich alle direkt an einem der Teilnehmer ablesen können, dass hier ein Schwindler am Werk war. Denn da war einer unter uns, dessen Blick tatsächlich während des Gesprächs mit ihm ständig zur Seite schweifte und dem schließlich nach Ansicht des Dozenten eine „auditive“ Persönlichkeit attestiert wurde. Als wenige Wochen später ein anderer Kurs mit einem anderen Dozenten begann, saß ich direkt neben jenem „auditiven“ Teilnehmer des ersten Kurses. Die Lehrinhalte hier wurden gestreckt, die Pausen überzogen, die Anwesenden langweilten sich. Während mein Mitstreiter zur Linken kopfschüttelnd leise protestierte und ich die aktuellen Nachrichten in den Onlineportalen diverser Zeitungen nachlas, googelte mein Kollege zur Rechten fleißig nach thematisch verwertbarem Kursmaterial, allerdings per Bildersuche. Mehr als alle anderen Teilnehmer war er auf „visuelle“ Eindrücke fixiert. Der ihm eigene Gesichtsausdruck hatte sich nicht verändert, weiterhin schaute er meist zur Seite, nicht nach oben oder nach unten. Im vorangegangenen Kurs hätten dies auch die beiden erkennen können, welche dort links und rechts neben ihm saßen. Aber der Coach hatte wohl mehr Ausstrahlung als solch ein simpler Widerspruch innerhalb der von ihm vertretenen Theorie.
Das gesamte Coachingintermezzo hatte nur drei Tage insgesamt angedauert und wohl bei einigen Teilnehmern einen positiven Eindruck hinterlassen, obschon in dieser Zeit ausschließlich Behauptungen aufgestellt wurden, nichts belegt oder gar bewiesen wurde.
Abschließend hatte uns allen der Coach noch einige Bogen in die Hand gedrückt, auf diesen selbst diverse Redewendungen und einige lapidare Floskeln standen, Termini, welche in visuelle, auditive, olfaktorische Metaphern eingeteilt waren. Diese galten als Anhaltspunkte zur zukünftigen Gesprächsführung, so solle man zuvor sein Gegenüber auf seine Augenbewegungen hin antesten, um hernach seine eigene Sprache darauf einzustellen. An diese Versatzstücke solle man sich nach Aussage des Coachs aber ausschließlich nur dann halten, wenn es auch dem eigenen Stil entspräche, wenn selbige generell dem persönlichen Wortschatz entspringen könnten. So wurde es uns zumindest augenzwinkernd eingeflüstert, gleichsam angemerkt, dies auch wirklich nur „im Notfall“ zu tun, wobei unklar blieb, als was ein solcher „Notfall“ dann zu gelten habe. Diese Floskeln, welche allegorisch auf eine bestimmte Sinneswahrnehmung anspielten, sollten dann mit voller Absicht gewählt werden, da der Gesprächspartner schließlich aufgrund seiner Augenbewegung gerade auf eine bestimmte Form der Wahrnehmung konzentriert sei. Man kann sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn sich eine große Zahl an Menschen an solche Ratschläge hält. Viele an sich gebräuchliche Redewendungen verlieren ihren argumentativen Beiklang, ihren gehaltvollen Wert, sie sollen den Gesprächspartner nur mehr blenden, inhaltslos nachklingen und seine Gefühle beeinflussen. Ist man über eine solche Möglichkeit einer eventuellen Vorgehensweise seiner Mitmenschen aber erst einmal informiert, ist es dann nicht notwendigerweise so, dass man urplötzlich ein reges Misstrauen aufbaut, welches sich gegen die Verwendung sämtlicher geflügelter Worte richtet? Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass all dies nur auf der ominösen Augenbewegungstheorie basierte, auf einem Schema, das uns wie ein unumstößliches Dogma verkündet wurde, an dessen prinzipieller Richtigkeit es von Seiten des Dozenten nichts zu rütteln gab.
Aber nehmen wir nun einmal das Bild, welches der Dozent auf dem Flipchart skizzierte. Es demonstriert diese sogenannten „Augenbewegungsmuster“, welche man bei seinem Gesprächspartner zu beobachten und sich rhetorisch auf diese einzustellen habe. Obgleich man hierzu seine natürliche Empathie oder auch nur sein normales menschliches Verständnis zurückstellen muss, bis es irgendwann von diesen Praktiken ganz verdrängt oder marginalisiert ist, wurde selbiges als der Weg zum Begreifen anderer Menschen dogmatisch und unmissverständlich vorgestellt, ohne dabei auf die beschwingte entertainmentlastige Verführung zu verzichten, welche für die Motivationstrainer notwendig erscheint, um den Menschen von seiner Ratio zu entfernen, ihn loszulösen von seinen Erfahrungen und seine Beurteilungskriterien schonungslos in allgemeingültige, genormte Kategorien einzupfropfen. Die folgende Skizze wurde einem Foto 4 aus dem Kursmaterial nachgestaltet, welches sich in meinem Besitz befindet, selbst aber nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden darf:
Woher stammte aber nun dieses Prinzip, welches hier als allgemeingültige Wahrheit dargestellt wurde und sowohl in Hinblick auf seine generelle Richtigkeit als auch seine Ablehnung individueller Persönlichkeitsunterschiede eine Verstümmelung eines jeden persönlichen Gesprächs bedingen musste?
Vergleichbare Bilder findet man tatsächlich zuhauf im Netz, unter anderen auf den einschlägigen NLP–Homepages.5 Und zum Ursprung dieser Systematik wird dazu auf wiederum einer dieser zahlreichen Seiten erklärt:
„Wer mit NLP vertraut ist, der kennt die Augenzugangshinweise (eye accessing cues). Richard Bandler, einer der Gründer von NLP, hat vor Jahrzehnten erkannt, dass Menschen ihre Augen unbewusst auf sehr systematische Weise bewegen, je nachdem, welche Art von Informationen sie gerade verarbeiten. Wenn sie etwas visuell erinnern schauen sie nach oben links, wenn sie etwas akustisch erinnern schauen sie nach links zur Seite, usw.“6
Es geht aber immer noch eine Spur direkter. Auf der Website des NLP Training Weil findet sich folgende Zusammenfassung:
„Die Begründer von NLP haben festgestellt, dass zwischen den Augenbewegungsmustern und den inneren Denkvorgängen strukturelle Zusammenhänge bestehen. Wenn man diese Bewegungen aufmerksam verfolgt, so kann man erkennen, ob der Gegenüber hauptsächlich visuell orientiert ist, d.h. Bilder ‚denkt’, ob er auditiv orientiert ist, d.h. in akustischen Dimensionen ‚denkt’ oder ob er gerade einen inneren Dialog führt oder seinen Gefühlen nachhängt.“7
Tatsächlich hatte die Augenbewegungstheorie ihren Anfang beim NLP genommen. Dies lässt sich zweifelsfrei recherchieren.8 Anhand der Aussagen von Bandler und Grinder, nach welchen ihre gesamte Lehre eigentlich auf Lügen basiert und eine übergeordnete Wahrheit von ihnen nicht akzeptiert wird, folgt auch unmittelbar, dass jede Aussage des Dozenten nur dessen Zielen zweckdienlich und keineswegs inhaltlich richtig zu sein braucht, was wiederum auf seine Intension und damit verbundenen Verhaltensweisen eindeutige Rückschlüsse erlaubt. Wenn dem so ist, lässt sich folgende Behauptung auch leicht erklären.
So wurde von ihm auf Nachfrage eines der Teilnehmer ein angeblicher Erfinder selbiger Augenbewegungsmustertheorie genannt. Er verwies auf einen gewissen José Silva, seines Zeichens amerikanischer Parapsychologe, wobei es der Dozent allerdings dabei beließ, ihn als Psychologen auszugeben und dessen richtigen „Beruf“ nicht zu benennen, obschon das „Para“ auch bei Wikipedia nachzulesen ist. Nun könnte ein geneigter Kursteilnehmer, dem das NLP komplett unbekannt ist, meinen, dass besagter Herr Silva wirklich der Erfinder dieser Augenbewegungsmustertheorie sei. Indes muss man hierzu nur kurzerhand Google bemühen und findet die ernüchternde Wahrheit:
„Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage – „José Silva“ „Augenbewegungsmuster“ – übereinstimmenden Dokumente gefunden.“9
Das gleiche Ergebnis erhielt ich, als ich anschließend „José Silva“ und Augenzugangshinweise eingab. Damit handelte es sich bei der Behauptung des Dozenten in Bezug auf den Erfinder der Theorie somit genau genommen um eine Lüge. Der Parapsychologe Silva ist nur eine falsche Fährte, auf die man gelockt wird, wahrscheinlich, weil man sowohl den Vornamen als auch den Nachnamen, wenn beide genuschelt werden, schlecht versteht. Und da den meisten Menschen von dieser Person noch nie zuvor gehört haben dürften, konnte hier darauf spekuliert werden, dass kaum jemand unter den Teilnehmern weitergehende Recherchen anstellen würde.
Aber unabhängig von diesen Verwirrungen um eine NLP– Erfindung, welche einem Parapsychologen angedichtet wurde, handelte es sich bei diesen „Augenbewegungsmustern“ keineswegs um ein wissenschaftliches Faktum. Ein Kurs an einer Weiterbildungsinstitution sollte sich aber auf wissenschaftliche Fakten stützen und dieser, an welchem ich hier teilnahm, natürlich auch. Das Ärgerliche daran war, dass es derartige „Kommunikationsseminare“ in Reinform schließlich bereits tausendfach gab und gibt, was jedem die Möglichkeit eröffnete, sich genau dort einzuschreiben. Doch wurden seit einiger Zeit deren Inhalte noch zusätzlich in bereits bestehende Kurse eingebaut, in Weiter– und Fortbildungen aller Art, sogar solche, welche ein im weitesten Sinne naturwissenschaftliches Thema behandeln sollten. Hier geht es also nicht mehr darum, inwieweit man sich freiwillig diesem Manipulationsirrsinn aussetzen möchte, sondern wie stark selbiger die Gesellschaft als große Gemeinschaft aller Menschen durch gegenseitige Übertragung und indirekte Weitergabe prägen kann in Form eines unmittelbaren Kontakts während eines zuvor beliebig ausgewählten Kurses. Spätestens jetzt wurde mir wirklich bewusst, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn es nicht irgendwo eine erkennbare Opposition gäbe, eine offen diskutierbare Gegenmeinung und damit auch das Recht, eine solche auszusprechen. Man würde sonst die Gefahren des NLP und der sublimalen Beeinflussungsstrategien als Auswüchse parapsychologischer Dünnbrettbohrer kleinreden. Doch auch wenn es dünne Bretter wären, blieben doch Späne zurück.





























