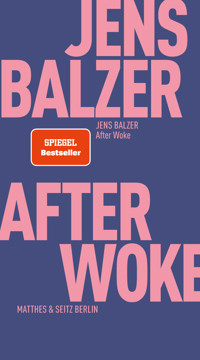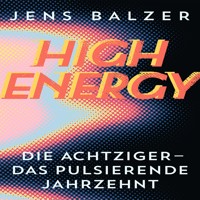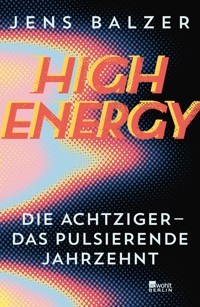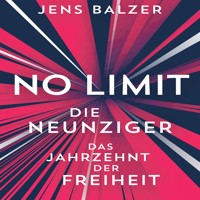
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es gibt keine Grenzen mehr: Das glaubt man jedenfalls am Beginn der Neunzigerjahre. Die Berliner Mauer fällt, die Welt rückt zusammen, und sie vernetzt sich. Die ersten Knoten des World Wide Web werden geknüpft, die ersten Suchmaschinen programmiert. In Berlin wird Techno zum Soundtrack der Wiedervereinigung, Neonfarben beherrschen das Bild, Piercings und Tätowierungen erobern den Mainstream, das Arschgeweih gerät zum stilistischen Symbol der Dekade. Aber unter der heiteren Oberfläche brechen alte Konflikte auf, Gespenster aus der Vergangenheit kehren zurück. Im Osten Deutschlands, aber nicht nur dort, entsteht eine rechte Jugendkultur bislang ungekannten Ausmaßes. Im zerfallenden Jugoslawien geschieht das Unfassbare: der erste Krieg in Europa seit 1945. Der politische Islam wird zur globalen Bedrohung, und das lange Jahrzehnt endet am 11. September 2001 mit dem Anschlag auf das World Trade Center, das auch ein Symbol der spielerischen, globalisierten Postmoderne gewesen ist. In einem großen, farbigen Panorama erzählt Jens Balzer von einem Jahrzehnt, in dem man an die Zukunft glaubte und ans «anything goes» – und in dem doch auch ein neues Zeitalter der Grenzen, der Identitäten und der Kämpfe beginnt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jens Balzer
No Limit
Über dieses Buch
Es gibt keine Grenzen mehr: Das glaubt man jedenfalls am Beginn der Neunzigerjahre. Die Berliner Mauer fällt, die Welt rückt zusammen, und sie vernetzt sich. Die ersten Knoten des World Wide Web werden geknüpft, die ersten Suchmaschinen programmiert. In Berlin wird Techno zum Soundtrack der Wiedervereinigung, Neonfarben beherrschen das Bild, Piercings und Tätowierungen erobern den Mainstream, das Arschgeweih gerät zum stilistischen Symbol der Dekade. Aber unter der heiteren Oberfläche brechen alte Konflikte auf, Gespenster aus der Vergangenheit kehren zurück. Im Osten Deutschlands, aber nicht nur dort, entsteht eine rechte Jugendkultur bislang ungekannten Ausmaßes. Im zerfallenden Jugoslawien geschieht das Unfassbare: der erste Krieg in Europa seit 1945. Der politische Islam wird zur globalen Bedrohung, und das lange Jahrzehnt endet am 11. September 2001 mit dem Anschlag auf das World Trade Center, das auch ein Symbol der spielerischen, globalisierten Postmoderne gewesen ist.
In einem großen, farbigen Panorama erzählt Jens Balzer von einem Jahrzehnt, in dem man an die Zukunft glaubte und ans «anything goes» – und in dem doch auch ein neues Zeitalter der Grenzen, der Identitäten und der Kämpfe beginnt.
Vita
Jens Balzer, geboren 1969, ist Autor und Kolumnist, u.a. für die «Zeit», «Rolling Stone», den Deutschlandfunk und radioeins. Er war stellvertretender Feuilletonchef der «Berliner Zeitung» und kuratiert den Popsalon am Deutschen Theater. 2019 erschien «Das entfesselte Jahrzehnt», seine vielgelobte Geschichte der Siebzigerjahre; 2021 folgte «High Energy», eine Gesamtschau der Achtzigerjahre und das «Charakterporträt eines Zeitalters» (FAZ). Nun setzt Jens Balzer mit «No Limit» seine große Kultur- und Mentalitätsgeschichte der Gegenwart fort.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung iStock
ISBN 978-3-644-01645-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung Der Fall der Mauer und das Ende der Geschichte
Wahnsinn! Freiheit! Wahnsinn! Der Jubel kennt keine Grenzen, als der Mann mit der Dauerwellenfrisur sich im Arbeitskorb eines Krans über die Mauer heben lässt, um minutenlang über den Köpfen der Menschen zu schweben. Zu Hunderttausenden verfolgen sie, wie er zu einer schütteren musikalischen Begleitung, die von Tonband abgespielt wird, sein Lied «Looking for Freedom» singt, zu Deutsch etwa: auf der Suche nach Freiheit. «I’ve been looking for freedom», heißt es darin, «I’ve been looking so long / I’ve been looking for freedom / Still the search goes on» – er sucht nach Freiheit, und das schon sehr lange, und die Suche geht immer noch weiter. Der Mann trägt eine schwarze Lederjacke mit einer Lichterkettenapplikation, die seinen Oberkörper rhythmisch zum Blinken bringt; um den Hals hat er sich einen Schal geschlungen, auf dem eine Klaviertastatur zu sehen ist; außerdem hat er eine Jeanshose aus kunstvoll ausgeblichenem Stoff an, eine «Stonewashed Jeans», wie man das damals nennt. Die meisten der Menschen, die ihn an diesem Abend feiern, tragen ebenfalls Stonewashed Jeans und Dauerwellenfrisuren, manche haben sich Hüte in Schwarz-Rot-Gold aufgesetzt, andere schwenken Flaggen in diesen Farben.
Wir befinden uns am Silvesterabend des Jahres 1989 am Brandenburger Tor in Berlin, es ist das erste Silvesterfest seit Jahrzehnten, das die Menschen aus dem Ostteil und dem Westteil der Stadt wieder gemeinsam feiern können. Von überallher sind sie zusammengeströmt – auch aus dem Ostteil und dem Westteil des restlichen Landes –, um gemeinsam zu tanzen, Sekt zu trinken, Raketen zu zünden. Eine runde Million Menschen soll es am Ende gewesen sein, die sich an diesem Abend in der Berliner Mitte versammelt hat. Sie klettern auf die Mauer, die noch wenige Wochen zuvor Ost- und Westberlin voneinander trennte. Abertausende drängen sich auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Dort hat eine Jugendsendung des DDR-Fernsehens eine Videoleinwand errichtet; über diese wird auch der kurze Auftritt des US-amerikanischen Popsängers David Hasselhoff übertragen. Das Lied «Looking for Freedom» hat er zwar schon im Frühjahr 1989 veröffentlicht, und die Bezüge auf weltpolitische Umstürze darin sind eher diffus. Dennoch wird es in Deutschland über Nacht zu einer Art Hymne auf die Wiedervereinigung. «Viele von den Menschen, die mir an diesem Abend zujubelten», so hat sich Hasselhoff später erinnert, «konnten ja gar kein Englisch, weil sie in der DDR aufgewachsen waren. Darum verstanden sie auch gar nicht, was ich da sang.» Einige verstehen schlichtweg «Looking for Frieden», aber das läuft ja irgendwie auf das Gleiche hinaus.
Über das Gerüst, an dem die Videoleinwand des DDR-Fernsehens befestigt ist, kann man auf das Dach des Brandenburger Tors klettern, um sich dort neben die Quadriga – den Streitwagen der Siegesgöttin Viktoria, der von vier Pferden gezogen wird – zu stellen oder zu setzen. Bis zu diesem Abend weht dort noch die Flagge der DDR, schwarz-rot-golden mit Hammer und Zirkel, nun wird sie von den Menschen, die emporgekommen sind, eingeholt und hinunter in die Menge geworfen. Ein paar Jugendliche schmücken die Quadriga ersatzweise mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne; später kommt noch eine Europa-Fahne hinzu.
Nach David Hasselhoff tritt die westdeutsche Popsängerin Nena auf und singt ihr Lied «Wunder gescheh’n»: «Wunder gescheh’n / Ich hab’s geseh’n / Es gibt so vieles, was wir nicht versteh’n.» Das Wunder, das hier besungen wird: Das ist nicht nur die Öffnung der Berliner Mauer, die an diesem Abend gerade sieben Wochen zurückliegt. Es ist die Aussicht auf eine Welt ohne Grenzen, auf ein dauerhaftes Ende des Kalten Kriegs und auch darauf, dass aus den kommunistischen Diktaturen des bisherigen Ostblocks liberale Demokratien werden, in denen die Menschen in Freiheit leben; es ist die Aussicht auf ein Jahrzehnt, das im Zeichen der Freiheit steht – und nicht, wie die jetzt zu Ende gehenden Achtzigerjahre, im Zeichen der Angst.
Während der Übertragung der Silvesterfeier im ZDF-Fernsehen erinnert der Kommentator an das Silvesterfest zehn Jahre zuvor, am 31. Dezember 1979. Damals war die Sowjetunion gerade in Afghanistan einmarschiert, die Nato hatte mit der Stationierung neuer Atomwaffen begonnen, «die Achtzigerjahre werden mehr und mehr zum gefährlichsten Jahrzehnt in der Geschichte der Menschheit», so hieß es im Aufruf zur großen Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten 1981.
Wie anders die Stimmung an diesem Abend ist. Die USA und die Sowjetunion haben sich auf nukleare Abrüstung geeinigt, der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow hat in seinem Land wirtschaftliche und demokratische Reformen angestoßen und die Länder des Warschauer Pakts aus dem Klammergriff des sowjetischen Imperiums entlassen. «Das vor uns liegende Jahrzehnt kann für unser Volk das glücklichste dieses Jahrhunderts werden», sagt der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Fernsehansprache am Silvesterabend 1989. «Das 20. Jahrhundert endet mit einem unverhohlenen Sieg des ökonomischen und politischen Liberalismus», schreibt der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in einem Text mit dem Titel «The End of History?», der schon im Sommer 1989 erschienen ist. Fukuyama spricht von der «völligen Erschöpfung lebensfähiger systematischer Alternativen zum westlichen Liberalismus», der Westen, «die Idee des Westens», habe triumphiert. Das zeige sich nicht nur in der hohen Politik und im Erblühen politischer Reformbewegungen in den Ländern des Ostens, sondern vor allem in der «Ausbreitung der westlichen Konsumkultur». In Prag, Rangun und Teheran höre die Jugend mit gleichermaßen großer Begeisterung westliche Rockmusik, in China seien Farbfernseher jetzt allgegenwärtig, und in Moskau hätten westliche Bekleidungs- und Restaurantketten ihre ersten Filialen eröffnet.
Das bedeutendste Ereignis dieser Art findet einen Monat nach den Silvesterfeierlichkeiten in Moskau statt. Am 31. Januar 1990 eröffnet am Puschkinplatz die erste sowjetische Niederlassung der Fast-Food-Kette McDonald’s. Erstmals kann die russische Bevölkerung dort in den Genuss von fettigen Hackfleischplatten in weichen Brötchen gelangen, von frittierten Kartoffelschnitzen und von Mischgetränken aus Speiseeis, Milch und Obst, sogenannten McShakes, und sie scheint sehnsüchtig darauf gewartet zu haben. Über dreißigtausend Menschen stehen am ersten Tag vor der Tür, so viele wie noch nie bei der Eröffnung eines McDonald’s-Restaurants; und noch über mehrere Wochen müssen Sicherheitskräfte die Publikumsströme regeln. Mitten im Herzen von Moskau, nur wenige Gehminuten vom Kreml entfernt, prangt nun das große gelbe «M», das Zeichen des Kapitalismus.
Damit beginnt auch das Zeitalter einer globalen Friedensordnung: Denn noch nie haben zwei Staaten Krieg gegeneinander geführt, in denen es jeweils McDonald’s-Filialen gibt. Das glaubt jedenfalls der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Friedman herausgefunden zu haben, der daraus seine Theorie der «Golden Arches», der Goldenen Bögen, entwickelt. Das Ende des Kalten Kriegs habe die Grenzen geschliffen, die einer dauerhaften Globalisierung der Wirtschaft und der Kultur noch im Wege standen; dafür sei die globale Ausbreitung von McDonald’s das beste Symbol. Wobei die Filialen der Restaurantkette nur die Vorhut bildeten für eine Globalisierung, die noch wirkmächtiger sei: die digitale Vernetzung, den globalen Siegeszug der Informationsgesellschaft. «Dank der Informationsrevolution ist keine Mauer mehr undurchlässig. Wenn wir alle wissen, wie die jeweils anderen leben, entsteht eine völlig neue Dynamik in der Weltpolitik», schreibt Friedman in dem Buch «The Lexus and the Olive Tree», in dem er am Ende des Jahrzehnts seine Theorie der Goldenen Bögen weiterentwickelt. «Wenn Leute sehen können, dass andere Menschen Möglichkeiten haben, die ihnen selbst nicht zur Verfügung stehen, wird es für Politiker schwieriger, sie ihren Bevölkerungen vorzuenthalten.»
Der US-amerikanische Präsident GeorgeH.W.Bush sieht die Epoche einer neuen Weltordnung heraufziehen. «Hunderte von Generationen haben nach dem Weg zu einem dauerhaften Frieden gesucht, Hunderte von Kriegen überspannten die Menschheitsgeschichte. Heute aber können wir dabei zusehen, wie eine neue Welt geboren wird», sagt er im September 1990 in einer Rede vor dem Aspen Institute in Colorado mit dem Titel «Toward a New World Order». In dieser Welt werde es keine unaufhebbaren Gegensätze mehr geben, es werde eine Welt ohne Diktaturen und Autokratien sein, in der «Rechtsstaatlichkeit das Gesetz des Dschungels ersetzt. Eine Welt, in der Nationen die gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit anerkennen. Eine Welt, in der die Starken die Rechte der Schwachen respektieren.»
Zwei Monate später, im November 1990, erscheint das Album «Crazy World» der deutschen Rockband Scorpions, auf dem sich auch der Titel «Wind of Change» findet. Darin beschwört der Sänger Klaus Meine das Wunder einer grenzenlos gewordenen Welt: «The world is closing in / And did you ever think / That we could be so close like brothers? / The future’s in the air, I can feel it everywhere / I’m blowing with the wind of change» – die Welt rückt zusammen, und hättest du je gedacht, dass wir uns einmal so nah sein würden wie Brüder? Danach wird von Klaus Meine hoffnungsvoll gepfiffen. «Wind of Change» wird zur meistverkauften Single in der Geschichte der deutschen Popmusik.
Die Neunziger beginnen als ein Jahrzehnt der Freiheit, sie beginnen mit der Hoffnung darauf, dass die Grenzen verschwinden, die die Menschen in der Epoche des Kalten Kriegs voneinander trennten; dass die Welt nun zusammenrückt und die Menschen und die Kulturen sich miteinander verbinden; dass jeder dorthin reisen kann, wohin er möchte, und jeder dort leben und wohnen kann, wo er will. In Deutschland kommen Familien und Menschen wieder zusammen, die bis dahin lange voneinander getrennt waren, man kann sich über die ehemals waffenstarrende Grenze in den anderen Teil des Landes begeben und Orte besuchen, die man bislang nur aus Erzählungen kannte oder aus dem Fernsehen. Man kann sogar noch weiter reisen, nach Osteuropa und bis nach Moskau, und wenn man dorthin kommt, findet man Dinge, die einem vertrauter erscheinen, als man es bis dahin dachte: zum Beispiel eine McDonald’s-Filiale.
Die Neunziger beginnen als ein Jahrzehnt des Aufbruchs. Die Zukunft ist wieder eine Verheißung, was auch an den Technologien liegt, die sich in dieser Zeit entwickeln werden. Die ersten Knoten des World Wide Web werden geknüpft, die ersten Suchmaschinen programmiert. Mobiltelefone und Personal Computer durchdringen den Alltag, die E-Mail wird zum wichtigen Kommunikationsmittel. Am Ende des Jahrzehnts entsteht mit Google jene Maschine, die die Organisation unseres Wissens für immer verändern wird; und der Film «Matrix» bringt ein Gefühl dieser Zeit auf den Punkt: dass neben der schon bekannten Realität eine zweite entsteht, eine virtuelle Welt, die alle irdischen Grenzen überschreitet.
Aber diese Freiheit und dieser Aufbruch haben auch eine Kehrseite – die in dem Song «New World Order» der US-amerikanischen Industrial-Band Ministry aus dem Jahr 1992 anklingt. Darin werden Ausschnitte aus der Rede von GeorgeH.W.Bush montiert und mit militärischen Rhythmen, schweren Gitarrenakkorden und Sirenenklängen unterlegt. Die neue Welt, die Ministry hier erspüren, ist nicht die Welt der «Freiheit und Gerechtigkeit», die Bush in seiner Rede beschwört. Es ist eine Welt der neuen Konflikte und Kriege.
Die USA führen 1991 die Operation «Desert Storm» an, mit der sie die Invasion des Irak in den Golfstaat Kuwait zurückschlagen – und den westlichen Industrienationen ihren Zugang zu den dortigen Ölreserven sichern. Aus dieser Perspektive erscheint die Neue Weltordnung von Bush nur mehr als Mittel zur globalen Durchsetzung westlich-kapitalistischer Interessen. In Europa führt der Zusammenbruch des Ostblocks zu Bürgerkriegen und Flüchtlingswellen. Und die Menschen, die sich davor in Sicherheit zu bringen versuchen – etwa im wiedervereinigten Deutschland –, müssen erleben, dass die Welt für sie keineswegs grenzenlos geworden ist. Im ehemaligen Jugoslawien wird zum ersten Mal seit 1945 wieder ein Krieg in Europa geführt; am Ende des Jahrzehnts wird Wladimir Putin zum russischen Ministerpräsidenten ernannt und lässt die russische Armee in Tschetschenien einmarschieren.
Und die Neunziger beginnen nicht nur mit dem Ende des Kalten Kriegs – sondern auch mit der Fatwa gegen den indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie durch den iranischen Ayatollah Chomeini. Der politische Islam wird zur globalen Bedrohung, Osama bin Laden steigt zum Kopf der Organisation al-Qaida auf. Das lange Jahrzehnt endet am 11. September 2001 mit dem Anschlag auf das World Trade Center, das auch ein Symbol der spielerischen, globalisierten Postmoderne ist. Deren Gedanke eines universell befreiten «anything goes» ist für die Aufbruchshoffnungen der Neunziger prägend – wie auch für das positive Bild der Globalisierung, das man an ihrem Beginn hegt. In den Neunzigern kommt die Postmoderne zu ihrer Vollendung. Aber sie gelangt auch an ihr Ende, und ein neues Zeitalter der Grenzen, der Identitäten und der Kämpfe zwischen ihnen beginnt. Um die Dialektik der Freiheit in diesem Jahrzehnt soll es im Folgenden gehen.
Teil IAlte Grenzen, neue Grenzen
1. Kapitel«Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich»: Die Euphorie der Befreiung und das plötzliche Rasen der Zeit
In Berlin beginnen die Neunzigerjahre schon knapp zwei Monate vor dem Silvesterfest, am 9. November 1989 um sieben Minuten vor sieben Uhr abends. Im Internationalen Pressezentrum der DDR in der Mohrenstraße in Ostberlin informiert der Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für Informationswesen, Günter Schabowski, Journalisten aus aller Welt über die Ergebnisse der laufenden Tagung seiner Organisation. Selbige widmet sich vor allem der Frage, wie der schweren Wirtschaftskrise der DDR begegnet werden kann. Der ZK-Vorsitzende Egon Krenz hat die Schulden seines Staats im westlichen Ausland auf zwanzig Milliarden US-Dollar beziffert; der Abteilungsleiter für Finanzen, Günter Ehrensperger, nennt am selben Tag den Grund für die Krise: «Man muss ganz sachlich sagen, dass wir mindestens seit 1973 Jahr für Jahr über unsere Verhältnisse gelebt haben und uns etwas vorgemacht haben. Es wurden Schulden mit neuen Schulden bezahlt. Sie sind gestiegen, die Zinsen sind gestiegen, und heute ist es so, dass wir einen beträchtlichen Teil von mehreren Milliarden Mark jedes Jahr für Zinsen zahlen müssen. Und wenn wir aus dieser Situation herauskommen wollen, müssen wir fünfzehn Jahre mindestens hart arbeiten und weniger verbrauchen, als wir produzieren.»
Diese Aussicht stößt in der Bevölkerung der DDR auf geringe Begeisterung, zu Zigtausenden versuchen die Menschen schon seit Monaten, den bankrotten Staat zu verlassen. Seit dem Sommer 1989 hat die DDR eine dramatische Ausreisewelle ergriffen, ermöglicht durch die politischen Veränderungen in den Nachbarstaaten. Der Eiserne Vorhang, der die Epoche des Kalten Kriegs bestimmte, ist durchlässig geworden. Am 2. Mai hat die ungarische Reformregierung den Stacheldraht zwischen Ungarn und Österreich demontiert, in den folgenden Monaten versuchen erst Hunderte, dann Tausende DDR-Bürger über Ungarn in den Westen zu gelangen. Am 10. September gibt der ungarische Außenminister, Gyula Horn, die Öffnung der Grenze für DDR-Bürger bekannt, zu diesem Zeitpunkt befinden sich geschätzt 150000 ausreisewillige Deutsche in seinem Land. Andere verschaffen sich Zutritt zu den Botschaften in Warschau und Prag oder in die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin, um auf diese Weise in den Westen zu kommen.
Es handelt sich um die erste große Völkerwanderung des anbrechenden Jahrzehnts. Sie gibt auch denjenigen Auftrieb, die in der DDR bleiben wollen, aber sich einen anderen Staat wünschen, mit demokratischen Regeln, freien Wahlen, Freiheit der Reise, Freiheit der Meinung. «Wir bleiben hier, aber nur, wenn es nicht so bleibt, wie es ist» – so lautet eine der ersten Parolen auf den Demonstrationen, die ab September 1989 jeden Montag in Leipzig stattfinden. Am 2. Oktober sind es schon zwanzigtausend Menschen, die «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» skandieren und: «Wir sind das Volk» – gerichtet gegen die Volkspolizisten, die vermeintlich im Namen des Volkes den Demonstrierenden entgegentreten. In Berlin gründen Bürgerrechtler und -rechtlerinnen das Neue Forum, die erste politische Partei der Opposition. In Dresden gehen die Vertreter der Staatsmacht im Oktober gegen Tausende vor, die in Zügen nach Prag auszureisen versuchen. Dabei legen sie eine bis dahin unbekannte Brutalität an den Tag. Unter den Menschen wächst die Angst vor der «chinesischen Lösung» – im Juni hat das Militär in Peking eine Demokratie fordernde Demonstration auf dem Platz des Himmlischen Friedens rücksichtslos zusammengeschossen –, doch schreckt die Führung der SED am Ende vor dieser letzten Eskalation zurück; dazu ist ihre Stellung bereits zu schwach.
Die Ereignisse überstürzen sich, es ändert sich das Gefühl für die Zeit: So wird es von vielen Menschen beschrieben, die über die letzten Jahre und Monate der DDR Auskunft gegeben haben. In den Achtzigern hat der Eindruck einer unaufhörlichen Verlangsamung geherrscht, das Gefühl, dass sich das Leben wie in Zeitlupe abspielt: Wer ein neues Auto bestellt, muss fünfzehn Jahre warten; wer gern ein Telefon hätte, wartet noch länger; wer auf gesellschaftliche Veränderung hofft, wartet vielleicht bis an das Ende aller Tage. In den letzten Jahren, Monaten, Tagen vor ihrem Ende liegt die DDR in einem «Dornröschenschlaf», wie es der Dresdner Lyriker Thomas Rosenlöcher in seinen Tagebuchnotizen aus dem Jahr 1989 formuliert, später gesammelt in dem Buch «Die verkauften Pflastersteine». Es ist eine Gesellschaft, in der die meisten mitmachen, aber dabei genau wissen, dass alles falsch ist und auf der Stelle tritt, eine Welt ohne Entwicklung, ohne Perspektive und Zukunft.
Das ändert sich nun. In der Endzeit ihres Staats holen die DDR-Bürger jene Erfahrung nach, die in Westdeutschland und den westlichen Industrienationen das gesamte Jahrzehnt bestimmt hat: Dort gehörte es zu den wesentlichen Signaturen der Achtziger, dass alles immer schneller und unübersichtlicher wird; dass der Alltag von immer neuen Innovationen geprägt wird und von einer Kultur, die immer differenzierter und diverser erscheint; dass lange Zeit geltende Zwänge und Sicherheiten im wirtschaftlichen und kulturellen Wandel verdampfen. Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, der Beginn der Digitalisierung des Lebens und der Kultur, die Entstehung der Informationsgesellschaft prägen eine ganze Generation. All dies verändert die Biografien, macht sie weniger festgelegt, aber auch weniger planbar; manche empfinden das als Befreiung, andere spüren schon die Unsicherheit, die Prekarität, die damit verbunden sein wird.
In der DDR sind diese Entwicklungen verschleppt. Dass die sozialistische Planwirtschaft nicht dazu in der Lage ist, die wirtschaftliche Transformation des Jahrzehnts mitzuvollziehen, trägt wesentlich zu ihrem Niedergang bei. In der UdSSR bemüht sich Michail Gorbatschow seit 1985 um Perestroika und Glasnost, eine Anpassung seines Lands an den Wandel der globalen Ökonomie; in der DDR verkündet der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker noch im August 1989: «Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.» Zwei Monate später, am 18. Oktober 1989, wird Honecker abgesetzt. Sein Nachfolger Egon Krenz versucht sich als Reformer zu präsentieren. So wird am 6. November der Entwurf für ein neues Reisegesetz veröffentlicht: «Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben das Recht, in das Ausland zu reisen», heißt es in der Parteizeitung «Neues Deutschland». Freilich wird dieses Recht dadurch eingeschränkt, dass es nur für jeweils dreißig Tage im Jahr gewährt werden soll; auch dürfen die Reisenden bloß fünfzehn Mark in Devisen mitnehmen, sodass sie im Ausland nahezu mittellos dastehen. Bei den Montagsdemonstranten in Leipzig weckt diese Regelung lediglich Hohn, sie fordern noch am selben Tag «ein Reisegesetz ohne Einschränkungen»: «365 Tage Reisefreiheit und nicht 30 Tage Gnade».
Die Zeit beginnt zu rasen. Die DDR erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Thomas Rosenlöcher notiert am 8. November in seinem Tagebuch: «Die einstmals stillstehende Zeit ist in einen Galopp übergegangen, als wollte sie die verlorenen vierzig Jahre wieder einholen.»
In der Mohrenstraße in Ostberlin scheint sich jedoch noch immer alles im Zustand eines endlosen Wachtraums zu befinden; das ist jedenfalls der Eindruck, wenn man die Bilder von der Pressekonferenz am 9. November betrachtet. Günter Schabowski, der das Amt des Sekretärs für Informationswesen gerade erst seit drei Tagen bekleidet, beginnt um sechs Uhr abends mit seiner Pressekonferenz, er trägt einen grauen Anzug und spricht langsam und tonlos und blickt dabei über seine schmale Lesebrille hinüber ins Unbestimmte. Man weiß nicht, ob er gerade etwas abliest oder ob die Langsamkeit seiner Ansprache der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden geschuldet ist. Neben ihm sitzen zwei SED-Funktionäre und eine Funktionärin auf dem Podium, die noch zeitlupenartiger reden als er; einer von ihnen, der Chefredakteur des SED-Theorie-Magazins «Einheit», Manfred Banaschak, war nach Erinnerung seiner Genossen schon am Nachmittag bei der Tagung des Zentralkomitees in einen Tiefschlaf gefallen. Dem Außenhandelsminister Gerhard Beil obliegt es, über die geplanten Wirtschaftsreformen Auskunft zu geben. «Ausgehend von der kritischen und gründlichen Analyse unserer wirtschaftlichen Situation» sei eine «Veränderung der Wirtschaftspolitik» nötig, «die wiederum zunächst eine umfassende Wirtschaftsreform erforderlich macht». Nach Abschluss der Tagung des Zentralkomitees werde man daher «versuchen zusammenzufassen, wo die Denkrichtungen hingehen», die auf dieser Tagung zu Tage traten, woraufhin Manfred Banaschak noch ergänzt: «Die Beantwortung der Fragen, die eben diskutiert worden sind, bedürfen ganz gewiss gründlichen Bedenkens in all den Konsequenzen, Zusammenhängen.»
Kurz vor dem Erwachen aus dem Dornröschenschlaf: Günter Schabowski, Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für Informationswesen, bei einer Pressekonferenz am 9. November 1989 in Ostberlin. Gleich wird er die Öffnung der Grenzen der DDR bekanntgeben
Die meisten Journalisten verbringen diese Veranstaltung in einer Art Dämmerschlaf. Bis um sieben Minuten vor sieben Uhr der italienische Journalist Riccardo Ehrman das Wort ergreift: «Herr Schabowski, Sie haben von Fehlern gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen?» Schabowski antwortet zunächst in der ihm eigenen umständlichen Weise: «Wir wissen um diese Tendenz in der Bevölkerung, um dieses Bedürfnis der Bevölkerung, zu reisen oder die DDR zu verlassen.» Dies sei aber falschen Vorstellungen vom Leben im Westen geschuldet und der allgemeinen Neigung zum Verlassen des Landes, die von vielen Menschen nur aus Mitläufertum mitgetragen werde. Darum sehe er «die Chance, also durch Erweiterung von Reisemöglichkeiten, die Chance also, durch die Legalisierung und Vereinfachung der Ausreise, die Menschen aus einer, äh, sagen wir mal, psychologischen Drucksituation zu befreien». Er irrt noch ein paar weitere Augenblicke durch Abschweifungen und komplizierte Satzkonstruktionen, bis er zu der Aussage kommt, dass «heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden» ist. Um dann, unter abrupter Steigerung seines Tempos, von einem Blatt abzulesen, das er von der Tagung des Zentralkomitees mitgebracht hat: «Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen – Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse – beantragt werden. Die zuständigen Abteilungen» seien «angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen».
Die Journalisten sind plötzlich hellwach. «Es war, als hätte ein Signal aus dem Weltraum den Saal elektrisiert», so hat sich der US-amerikanische Reporter Tom Brokaw später erinnert. Riccardo Ehrman fragt nach: Es reicht also für die Ausreise ein Pass? Günter Schabowski liest weiter von seinem Zettel vor: «Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehend ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretungen der DDR beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten.» Ein westdeutscher Journalist fragt: «Wann tritt das in Kraft?» Schabowski blättert in seinen Papieren, ohne etwas zu finden, das ihm weiterhilft: «Das tritt, nach meiner Kenntnis ist das sofort …» Die neben ihm auf dem Podium sitzende Vorsitzende des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung im FDGB, Helga Labs, raunt ihm zu: «unverzüglich», woraufhin Schabowski wiederholt: «unverzüglich».
Es ist jetzt sieben Uhr. Der Sekretär des Zentralkomitees für Informationswesen beantwortet noch eine letzte Frage danach, was nun mit der Berliner Mauer geschehen wird, beziehungsweise beantwortet sie in der ihm eigenen Weise nicht – «die Durchlässigkeit also der Mauer von unserer Seite beantwortet noch nicht und ausschließlich die Frage nach dem Sinn, also dieser, ich sag’s mal so, befestigten Staatsgrenze der DDR» –, dann beendet er um eine Minute nach sieben Uhr die Pressekonferenz.
Jetzt sind die Journalisten im Saal nicht nur wach, sondern geradezu aufgescheucht. Es bilden sich kleine Grüppchen. Man versucht zu verstehen, was man gerade von Günter Schabowski gehört hat, und man versucht zu verstehen, ob Günter Schabowski versteht, was er da gerade gesagt hat. Und man rätselt darüber, ob das immer noch tagende Zentralkomitee der SED wohl weiß, was hier gerade passiert ist. Man kann sich auch bei niemandem erkundigen, denn wir befinden uns im Jahr 1989 – es gibt noch so gut wie keine Mobiltelefone, und in der DDR gibt es überhaupt nur wenige Festnetztelefone; die Möglichkeit, schnell bei einem anderen Politiker oder auch nur bei einem Kenner der DDR-Verhältnisse eine Einschätzung zu den Aussagen Schabowskis einzuholen, existiert also nicht.
Kurzerhand entschließen sich die Pressevertreter, Schabowskis vage Aussagen zur Lage in eine eindeutige Stellungnahme zu überführen und aus der veränderten Reiseregelung eine Grenzöffnung zu machen. Der schnellste Kollege braucht dafür genau vier Minuten. «Die DDR öffnet nach Angaben von SED-Politbüromitglied Günter Schabowski ihre Grenzen»: So lautet eine Eilmeldung, die die Nachrichtenagentur Associated Press um fünf Minuten nach sieben verschickt.
Die Pressekonferenz ist im Fernsehen der DDR live übertragen worden; ob ein nennenswerter Teil von denen, die überhaupt eingeschaltet hatten, bis zum Ende durchhalten konnte, ist nicht überliefert. Um halb acht berichtet die Sprecherin der Nachrichtensendung «Aktuelle Kamera» zunächst über die Entscheidung des Zentralkomitees der SED, «die vierte Parteikonferenz vom 15. bis 17. Dezember in Berlin durchzuführen. Sie hat das Ziel, die aktuelle Lage in der Partei und im Lande einzuschätzen, die Aufgaben zur weiteren Vorbereitung des zwölften Parteitags zu beraten und Veränderungen im Zentralkomitee zu beschließen.» Über diese Tatsache, so die Sprecherin, habe Günter Schabowski die internationale Presse informiert, aber auch über «einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen: Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden.» Die «zuständigen Abteilungen der Volkspolizei» seien «angewiesen, auch Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD beziehungsweise zu Berlin (West) erfolgen.»
Das entspricht nicht den Schlussfolgerungen der westlichen Journalisten; denn diese hatten ja auf Nachfrage von Schabowski erfahren, dass gar keine Visa mehr notwendig sind. Auch bleibt unklar, ob die neue Regelung nur für «ständige Ausreisen» gilt – also der nunmehr ungeregelte Grenzübertritt mit der Ausbürgerung aus der DDR und der Verwirkung des Rückkehrrechts verbunden ist – oder ob man nach einer spontanen Stippvisite im Westen ebenso problemlos wieder nach Hause zurückkehren kann. Ebenso diffus ist die Bedeutung des Worts «unverzüglich». In der Fachsprache der SED-Funktionäre bedeutete dies lediglich, dass keine weiteren Beschlüsse zur Umsetzung eines Beschlusses mehr notwendig sind – aber mitnichten, dass ebendiese Umsetzung noch im selben Moment oder auch nur am selben Tag beabsichtigt ist.
So rührt die historische Dynamik, die dieser Abend entfaltet, auch aus einer Kette von Übersetzungsfehlern und semantischen Ambivalenzen, aus mangelnder Informiertheit und mangelnden Möglichkeiten, Informationen zu überprüfen. Die Botschaft, die aus der Mohrenstraße nach außen dringt und um die Welt geht, hat viele Sender und Interpreten, sie ist gar nicht denkbar ohne die Verzerrungen bei der Übertragung. Oder anders gesagt: Es handelt sich um eine Nachricht ohne Original und bestimmbare Quelle. Was an diesem Abend passiert, ist nur deswegen möglich, weil es noch in einer Welt ohne ausgebaute Kommunikationsnetze geschieht. Es ist dies vielleicht das letzte Ereignis von globaler historischer Bedeutung, das unter solchen Bedingungen stattfindet. Auch daran sieht man – wenn man dies auch erst in der über drei Jahrzehnte später vorgenommenen Rückschau erkennt –, wie am 9. November 1989 ein Zeitalter zu Ende geht. Und ein neues beginnt.
Die erste Bürgerin der DDR, die sich die veränderte historische Lage zunutze macht, ist eine Narkoseärztin aus dem Krankenhaus Vogelsang in der Nähe von Magdeburg. Annemarie Reffert hört auf der Heimfahrt im Autoradio von der Pressekonferenz von Schabowski und schaltet zu Hause gleich den Fernseher ein. Gemeinsam mit ihrer Familie schaut sie die «Aktuelle Kamera» und um acht Uhr auch noch im Westfernsehen die «Tagesschau». Diese übernimmt die Formulierungen des Ostfernsehens, allerdings verliest sie der Sprecher Jo Brauner vor einer Schautafel mit der suggestiven Formulierung «DDR öffnet Grenzen».
Annemarie Refferts Tochter Juliane möchte jedenfalls sofort eine Erkundungstour in die westliche Nachbarschaft starten. Nach dem Ende der «Tagesschau» brechen Mutter und Tochter in ihrem Wartburg nach Marienborn auf, dem von Magdeburg aus nächstgelegenen Grenzübergang, etwa sechzig Kilometer entfernt. Gegen Viertel nach neun stehen sie vor dem ersten Kontrollposten und begehren die Durchfahrt. Sie sind weit und breit die Einzigen, die auf diese Idee gekommen sind; bei den anderen Einwohnern von Magdeburg und Sachsen-Anhalt stoßen die neuen Reiseregelungen jedenfalls an diesem Abend auf kein Interesse. Der Grenzsoldat wiederum weiß von nichts. Er hat weder «Tagesschau» noch «Aktuelle Kamera» gesehen und auch ansonsten keine Informationen erhalten. Trotzdem lässt er die Refferts passieren: «Von mir aus fahren Sie weiter, da kommen ja noch mehr Kontrollen.» So ergeht es ihnen bei sämtlichen Grenzsoldaten, auf die sie noch treffen, jeder delegiert die Entscheidung an die jeweils nächste Instanz. Bis sie schließlich vor dem Zoll stehen, der mit der Tatsache, dass sie nichts zum Verzollen dabeihaben, derart überfordert ist, dass er sie auf die andere Seite lässt.
Dort, beim Grenzübergang Helmstedt, warten westdeutsche Journalisten auf sie; diese freuen sich sehr darüber, endlich auf DDR-Bürger zu treffen, die an diesem Abend in den Westen ausreisen wollen. Umso größer ist die Enttäuschung, als Annemarie Reffert ihnen erklärt, dass sie noch am selben Abend wieder nach Hause möchte; sie wolle nur eine Runde durch Helmstedt drehen und ihrem Mann ein Dosenbier kaufen, denn Dosenbier gibt es in der DDR nicht (zwar wird von der Brauerei Lübz in Mecklenberg welches produziert, doch ausschließlich für den Export in die Bundesrepublik, wo man es dann als Billigbier bei Ketten wie Aldi, Spar und Penny erwerben kann). Annemarie Reffert dreht ihre Runde, aber Dosenbier will man ihr nicht verkaufen, weil sie über keine D-Mark verfügt. Nach einer Stunde im Westen machen die Refferts sich auf den Heimweg.
Als erste DDR-Bürgerin testet die Ärztin Annemarie Reffert die neue Reisefreiheit. Sie fährt ins niedersächsische Helmstedt, um ihrem Mann ein Dosenbier zu kaufen. Sie bekommt aber keins, weil sie kein Westgeld besitzt.
Bei den Grenzbeamten kommt es zu einer unangenehmen Situation: Diese haben sich inzwischen informiert und herausgefunden, dass die Rede von «ständigen Ausreisen» ist, darum wollen sie die Refferts erst nicht wieder zurück in die DDR lassen. Doch schließlich gelingt es der Mutter Annemarie, sie umzustimmen.
Um Viertel vor elf sitzt sie mit ihrer Tochter wieder in Magdeburg vor dem Fernseher. Gerade beginnen die «Tagesthemen», die der Moderator Hanns Joachim Friedrichs mit den Worten eröffnet: «Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.»
Anschließend wird live zum Berliner Grenzübergang an der Invalidenstraße geschaltet. Dort ist zu diesem Zeitpunkt allerdings noch weniger los als in Helmstedt-Marienborn: Der Reporter und einige Schaulustige warten ihrerseits auf den ersten DDR-Bürger, der auf diesem Weg in den Westen kommt. Zwar sammeln sich an den Übergängen im Zentrum der Stadt schon seit Stunden besuchswillige Ostberliner. Doch werden sie von den Grenzbeamten, die rat- und anweisungslos vor der Situation stehen, auf den kommenden Morgen vertröstet.
Das gelingt bis etwa halb zehn. Dann wird die Menge am Grenzübergang Bornholmer Straße – zwischen den Stadtteilen Wedding im Westen und Prenzlauer Berg im Osten – so groß, dass sich die Beamten für eine «Ventillösung» entscheiden. Das heißt, sie lassen diejenigen gehen, die in der Menge am lautesten aufbegehren, und hoffen, dass sich die Lage dadurch beruhigt. Natürlich tritt das Gegenteil ein: Als die Menschen sehen, dass einige hinüberdürfen, wird der Protest umso lauter. Das Gedränge wird gefährlich. Eine halbe Stunde vor Mitternacht entscheidet der befehlshabende Oberstleutnant, Harald Jäger, die Tore zu öffnen: «Wir machen auf!» Jetzt strömen die Menschen zu Tausenden über die Bösebrücke nach Westen.
Die «Tagesthemen» sind inzwischen vorüber, doch der Reporter der Sendung steht noch immer an der Invalidenstraße und wartet, jetzt für eine Sondersendung des Senders Freies Berlin. Kurz vor Mitternacht kommen endlich die ersehnten DDR-Bürger in einem gelben Trabant herangefahren, ein winziges Auto, in dem die beiden stattlichen Männer aussehen wie in einer Konservendose gefangen; der Reporter muss sich weit zu ihnen hinunterbeugen, um zu fragen, wie sie es hierhergeschafft haben. «Mit Personalausweis, ganz unkompliziert. Wunderbar.» Reporter: «Was wollen Sie denn jetzt machen hier in Berlin?» Bemerkt seinen Fehler: «Äh, in Westberlin?» – «Wir sind das erste Mal hier heute …» – «Und wieder zurück?» – «Ja, natürlich, unsere Frauen, unsere Familien sind ja zu Hause.» Der Mann auf dem Beifahrersitz ergänzt: «Wir wollen zum Kudamm, mal gucken, wie das da aussieht.» Der Reporter fragt sorgenvoll: «Haben Sie denn Geld dabei?» Die beiden schütteln verlegen den Kopf. Der Reporter: «Ist ja teuer hier.» Der Beifahrer: «Wir waren ja froh, dass wir mit Auto fahren konnten, so dass wir wenigstens ein bisschen beweglich sind. Ansonsten hätten wir mit öffentlichen … Und wir wissen ja auch gar nicht, wie und wo …»
Am Beginn der Neunziger, an diesem 9. November 1989, stehen das Gefühl und die Erfahrung der Freiheit. Es fallen Grenzen, es öffnen sich Räume, man kann Orte erreichen, die einem vorher verschlossen geblieben sind. «Wahnsinn», sagen die Bürgerinnen und Bürger Ostberlins in die westdeutschen Mikrofone, die ihnen entgegengehalten werden. «Wahnsinn»: Siebenundzwanzig Jahre lang sind die beiden Teile Berlins voneinander getrennt gewesen, nun kann man einfach in den jeweils anderen Teil hinübergehen oder hinüberfahren, dem menschlichen Wunsch nach Bewegung werden nun scheinbar keine Schranken mehr gesetzt.
In Berlin vollzieht diese Entwicklung sich am schnellsten und am dramatischsten und mit der größten Aufmerksamkeit, weil hier so viele Menschen so lange Zeit nebeneinanderher gelebt haben, die sich dabei beobachten konnten, ohne wirklich zu wissen, wie sich das Leben auf der anderen Seite der Mauer anfühlt; und weil man bei all seinen neuen Bewegungen weiß, dass die Stadt im Fokus des globalen Interesses steht, weil hier die meisten Journalisten akkreditiert sind und die meisten Kameras ihre Bilder in die Welt schicken. Auf Berlin liegt das Schlaglicht des Ernstfalls. Wer sich hier über die historischen Veränderungen freut, der weiß auch, dass ihm dabei zugesehen wird. Darum spielen die Menschen, die sich in der historischen Nacht hier begegnen, auch eine Rolle: Sie wissen, dass es ihnen obliegt, die plötzliche Beschleunigung der Dinge in Worte und Gesten zu fassen, das Erwachen aus dem «Dornröschenschlaf» zum Ausdruck zu bringen, mit allen Hoffnungen und Erwartungen, die sich damit verbinden – auch darum rufen sie so begeistert «Wahnsinn!» in die Kameras. Sie teilen mit diesen Rufen all jenen etwas mit, die diesen Abend nur vor den Fernsehern mitverfolgen, sei es im Westen oder im Osten des immer noch geteilten Landes.
An anderen Orten dauert es noch ein paar Tage, bis die Grenzbefestigungen fallen, und die Aufmerksamkeit für die Entwicklungen ist weit geringer. Das heißt nicht, dass die Erfahrungen, die man hier, in der Provinz, machen konnte, weniger bedeutsam wären. In meiner Kindheit in den Siebzigerjahren bin ich oft bei meinen Großeltern im Wendland gewesen, in Gorleben, im niedersächsischen Zonenrandgebiet an der Elbe. Wenn man auf die andere Seite des Flusses schaute, dann sah man auf einen Stacheldrahtzaun und dahinter auf leere Häuser oder auf Häuser, deren Fenster zur Westseite zugemauert waren. In einem langen Streifen hatte die Teilung des Landes auch dazu geführt, dass Dörfer auseinandergerissen wurden, Dorfgemeinschaften und Familien; in der Stille des ländlichen Lebens hatte man sich damit abgefunden. Im November 1989 fallen die Grenzen hier langsam, in der Provinz ist man gelassener, aber auch unsicherer, man mobilisiert den Spielmannszug seines Dorfes, um die Menschen von der anderen Seite willkommen zu heißen, man organisiert Feste, brät Würste; an der Elbe beginnt man sogleich darüber nachzudenken, ob und wann die im letzten Krieg gesprengten Brücken über den Fluss nun wieder aufgebaut werden.
Aus der Rückschau des Jahres 2023 kann man dazu sagen: Auf den Wiederaufbau der meisten Brücken warten wir immer noch. Denn die Erfahrung und das Glück der Freiheit, das ist nur die eine Seite der historischen Veränderungen, die sich an diesem Abend zeigt. Die andere weist schon jetzt auf die Furcht, von der die Neunzigerjahre geprägt sein werden. Es ist die Furcht davor, dass der Wandel der Verhältnisse auch die Gewohnheiten und Sicherheiten, mit denen man bis dahin lebte, mit sich davonreißen wird. Thomas Rosenlöcher notiert in seinem Tagebuch: «Die Menschen im Osten des Landes erwachen am 10. November in einem vollends kollabierenden Staat.»
Die Menschen im Westen sehen sich Millionen von anderen Menschen gegenüber, die nun nicht nur nach Reisefreiheit und freien Wahlen verlangen, sondern auch nach demselben Wohlstand, den man selbst in den vorangegangenen Jahrzehnten genossen hat. In der «Tagesschau», die am 9. November um acht Uhr abends die historischen Veränderungen vermeldet, ist in einem späteren Beitrag auch der Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble zu sehen, der all die ausreisewilligen DDR-Bürger ermahnt, sich keinen allzu großen Hoffnungen hinzugeben: Wer in den Westen übersiedelt, so Schäuble, der kann bis auf Weiteres nicht damit rechnen, in den gleichen Wohnungsverhältnissen zu leben wie bisher; da müssen schon Übergangsquartiere oder gar Turnhallen reichen. Und die Frage, die von den Fernsehreportern in dieser Nacht jedem über die Grenze schnuppernden Ostberliner gestellt wird – «Wollen Sie denn auch wieder zurückgehen?» –, sie erinnert an die Frage, die man im Westen seit den Siebzigern jedem aus der Türkei, aus Italien oder sonst wo zugewanderten «Gastarbeiter» stellt: «Wann gehen Sie denn wieder zurück?»
Die Grenzen zwischen Staaten fallen, aber schon an diesem Abend wird darauf mit der Konstruktion neuer Grenzen geantwortet: Es sind die Grenzen zwischen «uns» und den «Anderen»; es sind dies nun keine territorialen Grenzen mehr, sondern solche zwischen unterschiedlichen Identitäten. Schon vor dem Fall der Mauer hat die Konstruktion der Identität von «Wessis» und «Ossis» begonnen, ich komme im folgenden Kapitel darauf zurück. Für die Neunziger wird diese Dialektik aus euphorischer Entgrenzung und furchtsamer Neubegrenzung maßgebend sein, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Man befindet sich in einer einzigartigen historischen Situation, in der alles offen ist, alles fließt, in der unendliche Möglichkeiten bestehen könnten – und man reagiert darauf, indem man neue Beschränkungen und Zwänge schafft.
2. Kapitel«Zonen-Gaby (17) im Glück»: Sauerkrautfrisuren und Schimmeljeans oder Die Erfahrung und Erfindung des Fremdseins
Am 10. November hat sich allseits herumgesprochen, was passiert ist. In Berlin sind die meisten Grenzübergänge geöffnet, zu Hunderttausenden strömen die Bewohner aus dem Ostteil der Stadt in den Westen. Es ist ein Freitag, aber die Bevölkerung Ostberlins hat schon einmal das Wochenende für eröffnet erklärt; im Westteil bekommen die Kinder schulfrei. «Festivalstimmung hat die Stadt ergriffen», schreibt der Korrespondent der «New York Times»: «Die Westberliner sammeln sich an den Übergangspunkten, um die Ostberliner mit Champagner, Jubelrufen und Umarmungen zu begrüßen.» Der Fußballverein Hertha BSC gibt zehntausend Freikarten für sein Spiel gegen Wattenscheid am folgenden Sonnabend aus, viele Restaurants bieten den Brüdern und Schwestern aus dem anderen Teil der Stadt kostenlose Mahlzeiten an. Geschäftsleute kochen Kaffee für die Vorbeiflanierenden, große Unternehmen wie Kaiser’s und Karstadt verteilen Tüten mit Orangen, Bananen, Kokosnüssen und Kiwis, weil sie wissen, dass solche Südfrüchte in der ostdeutschen Mangelwirtschaft besonders selten sind und darum begehrt. Die Menschen spazieren über den Kurfürstendamm und bilden lange Schlangen vor den Westberliner Banken, um sich das «Begrüßungsgeld» abzuholen, das seit 1970 jedem DDR-Bürger bei der Einreise in den Westen zusteht, zunächst waren es dreißig D-Mark, 1988 ist die Summe gerade erst auf hundert D-Mark aufgestockt worden.
Der Bundeskanzler Helmut Kohl hat die Nachrichten von den Ereignissen am 9. November bei einem Staatsbankett in Warschau erhalten. Am Freitag fliegt er zusammen mit seinem Außenminister, Hans-Dietrich Genscher, zurück nach Hamburg, um von dort mit einer Maschine der US-amerikanischen Luftwaffe nach Westberlin weiterzureisen. Beide kommen gerade noch rechtzeitig, um an einer Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus teilnehmen zu können, die von dem Regierenden Bürgermeister, Walter Momper, und dem früheren Bundeskanzler Willy Brandt organisiert worden ist. Brandt gibt sich vorsichtig: «Das Zusammenrücken der Deutschen verwirklicht sich anders, als es die meisten von uns erwartet haben. Und keiner sollte in diesem Augenblick so tun, als wüsste er ganz genau, in welcher konkreten Form die Menschen in den beiden Staaten in ein neues Verhältnis zueinander geraten werden.» Genscher bedenkt die Sorgen des Auslands vor einer wieder erstarkenden deutschen Nation: «Kein Volk dieser Welt, kein Volk in Europa muss sich fürchten, wenn sich jetzt die Tore öffnen zwischen West und Ost.» Lediglich Kohl, der als Letzter redet, appelliert pathetisch an das Nationalgefühl: «Es lebe ein freies deutsches Vaterland, es lebe ein freies einiges Europa.» Von der Menge wird er dafür leidenschaftlich ausgepfiffen und ausgebuht. Das Schöneberger Publikum, das sich wesentlich aus Angehörigen der Westberliner Alternativ- und Gegenkulturen speist, hält jede Perspektive auf einen neuen deutschen Nationalismus für reaktionär, für einen politischen Rückschritt und eine Gefahr.
Das verbindet die Linken im Westen mit den Bürgerrechtlern und -rechtlerinnen im Osten. Das «Neue Forum» veröffentlicht am 12. November eine Erklärung, in der die Bürgerinnen und Bürger der DDR davor gewarnt werden, sich nun allzu besinnungslos in die Arme des Kapitalismus zu werfen. «Ihr seid die Helden einer politischen Revolution, lasst euch jetzt nicht ruhigstellen durch Reisen und Schulden erhöhende Konsumspritzen!» Gerade verteile der westdeutsche Staat noch großzügig Begrüßungsgeld und sonstige Geschenke, doch drohe dahinter schon das «Sanierungskonzept», «das uns zum Hinterhof und zur Billiglohnquelle des Westens macht». Ein «politischer Neuaufbau der Gesellschaft» könne nur stattfinden, wenn die DDR ein souveräner Staat bleibe und ihren eigenen Weg zur Reformation des Sozialismus gehe: «Wir werden für längere Zeit arm bleiben, aber wir wollen keine Gesellschaft haben, in der Schieber und Ellenbogentypen den Rahm abschöpfen.»
Den gleichen Tenor hat ein Aufruf mit dem Titel «Für unser Land», der zwei Wochen später von einigen bekannten Intellektuellen, Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR veröffentlicht wird; die letzte Fassung stammt von der Schriftstellerin Christa Wolf, verlesen wird der Text auf einer Pressekonferenz von dem Schriftsteller Stefan Heym. Gegen den «Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte» gelte es nun für die «Eigenständigkeit der DDR» zu kämpfen. «Noch haben wir die Chance, in gleichberechtigter Nachbarschaft zu allen Staaten Europas eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik zu entwickeln.» Dieser Aufruf wird binnen weniger Tage von zweihunderttausend Menschen unterschrieben, darunter auch Egon Krenz; bis Ende Januar 1990 werden es rund 1,7 Millionen sein.
Gleichwohl haben die Initiatoren des Aufrufs zu diesem Zeitpunkt wohl schon das zutreffende Gefühl, dass die Mehrheit der DDR-Bürger sich nicht auf ihrer Seite befindet. Auf den Montagsdemonstrationen in Leipzig wird die bis dahin leitende Parole «Wir sind das Volk» am Montag nach der Maueröffnung, dem 13. November, erstmals durch «Wir sind ein Volk» ersetzt. Auch nimmt die Zahl der dort geschwenkten schwarz-rot-goldenen Flaggen stetig zu.
Eine Woche nach der Veröffentlichung seines Aufrufs erklärt Stefan Heym schon dessen Scheitern. «Die großen, die erhebenden Momente sind vorbei», schreibt er im «Spiegel». Nun sei – so der Titel seines Essays – der «Aschermittwoch in der DDR» angebrochen. Gerade hätten die Menschen bei ihren Demonstrationen noch den aufrechten Gang eingeübt. Aber nun: «Aus dem Volk, das nach Jahrzehnten Unterwürfigkeit und Flucht sich aufgerafft und sein Schicksal in die eigenen Hände genommen hatte und das soeben noch, edlen Blicks, einer verheißungsvollen Zukunft zuzustreben schien, wurde eine Horde von Wütigen, die, Rücken an Bauch gedrängt, Hertie und Bilka zustrebten auf der Jagd nach dem glitzernden Tinnef. Welche Gesichter, da sie, mit kannibalischer Lust, in den Grabbeltischen, von den westlichen Krämern ihnen absichtsvoll in den Weg platziert, wühlten; und welch geduldige Demut vorher, da sie, ordentlich und folgsam, wie’s ihnen beigebracht worden war zu Hause, Schlange standen um das Almosen, das mit List und psychologischer Tücke Begrüßungsgeld geheißen war von den Strategen des Kalten Krieges.»
Stefan Heym blickt mit Abscheu auf die Menschen, die sich von der Öffnung der Grenzen nun vor allem eine schnelle Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse versprechen. Das verbindet ihn wiederum mit vielen Westdeutschen, deren anfängliche Euphorie schon nach wenigen Tagen abkühlt. Schnell erheben sich die Stimmen derjenigen, die sich übervorteilt fühlen: Wieso dürfen Ostdeutsche im Westen umsonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wo man selber doch jede Mark umdrehen muss und sich über eine Freifahrtkarte genauso freuen würde? Wieso erhalten sie freien Eintritt in Theatern und anderen Freizeiteinrichtungen? Plötzlich steht man in Lebensmittelgeschäften vor leeren Regalen, weil die DDR-Bürger mit ihrem Begrüßungsgeld alles weggekauft haben. Und die Verkäuferinnen in diesen Geschäften klagen darüber, dass sie – wegen der ausgerufenen Sonderregelungen – nun auch noch die Wochenenden durcharbeiten müssen.
Die Stimmung kippt zügig. Eine Reporterin der Berliner «tageszeitung» notiert am 20. November, gerade einmal elf Tage nach dem Mauerfall: «Was man vor Tagen im Überschwang noch bereit war zu verzeihen, wurde jetzt hier und da schon Stein des Anstoßes: Trabis, die auf Gehwegen parkten, überfüllte U-Bahnen, Anstehen im Lebensmittelgeschäft. Aus den südlichen Stadtteilen tauchten Meldungen von zerstochenen Reifen an DDR-Autos auf. Die Freude über den Fall der Mauer scheint kurzatmig. Die Folgen dessen, worauf die DDR-Bürger achtundzwanzig Jahre warten mussten, erträgt so mancher in der Stadt keine Woche.» In Hannover schleudern Unbekannte benzingefüllte Flaschen in abgestellte DDR-Wagen, drei Trabant und ein Wartburg brennen dabei aus. Beim Hamburger Senat mehren sich Protestbriefe zu kurz gekommener Bürger, meldet der «Spiegel» am 26. November: «‹Was die DDRler absahnen, geht auf keine Kuhhaut mehr›, schrieb eine zweiundfünfzigjährige Hansestädterin an ihren Bürgermeister, ‹die Geister, die wir riefen, werden wir nicht mehr los.›»
Die junge Partei der Republikaner, die sich rechts von CDU und CSU zu positionieren versucht und im Januar 1989 mit 7,5 Prozent in das Abgeordnetenhaus von Westberlin eingezogen ist, macht sich die Stimmung zunutze und entwickelt eine bemerkenswerte Doppelstrategie. Einerseits warnt sie vor der unkontrollierten Einwanderung der armen Ostdeutschen in die westdeutschen Sozialsysteme – und bedenkt sie dabei mit denselben Floskeln wie zuvor die geflüchteten Menschen aus anderen Teilen der Welt, die, wie etwa die vietnamesischen Boatpeople, in Deutschland Obdach suchen. Andererseits appellieren die Republikaner an den alten deutschen Nationalismus, wie er in der Nachkriegsgesellschaft und noch in den Achtzigerjahren von den Verbänden der «Heimatvertriebenen» gepflegt wird: Da nun die Wiedervereinigung Deutschlands anstehe, habe diese auch in den Grenzen von 1937 zu erfolgen; es gelte also, gegen den polnischen Staat auf die «Rückgabe der deutschen Ostgebiete» zu dringen.
Vor diesem neuen deutschen Nationalismus fürchten sich viele, nicht zuletzt die westlichen Verbündeten der Bundesrepublik, mit denen Helmut Kohl im November und Dezember 1989 konferiert. Insbesondere die britische Premierministerin Margaret Thatcher wendet sich strikt gegen die Idee einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Drei Wochen nach der Öffnung der Mauer stellt Kohl einen Zehn-Punkte-Plan auf, der wirtschaftliche und humanitäre «Sofortmaßnahmen» für die DDR verspricht, wenn diese sich im Gegenzug zum Wandel ihres politischen Systems bereit zeigt. Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion lehnen Kohls Vorlage ab, zumal sich darin kein förmlicher Verzicht auf die deutschen Ostgebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie findet. Die Bevölkerung der DDR begrüßt den Plan aber mehrheitlich euphorisch, das ist jedenfalls der Eindruck, den man erhält, als Kohl am 19. Dezember 1989 nach Dresden fliegt – seine erste Reise in die DDR seit der Maueröffnung.
Begeisterte Menschen begrüßen den westdeutschen Bundeskanzler Helmut Kohl bei seinem Besuch am 19. Dezember 1989 in Dresden. Die Sachsen erklären sich schon mal in vorauseilendem Gehorsam zu seinen Untertanen.
Schon als er dort aus dem Flugzeug steigt und vom neuen, nach der Maueröffnung ins Amt gekommenen Ministerpräsidenten Hans Modrow empfangen wird, grüßen ihn Hunderte von jubelnden Dresdnerinnen und Dresdnern mit schwarz-rot-goldenen Fahnen. Bei der Fahrt in die Innenstadt stehende Tausende Spalier. Als er mit Modrow vor dem Tagungshotel aus dem Auto steigt, sind sie von einer unüberschaubaren Menge umringt, die euphorisch «Helmut! Helmut!» ruft und neben den schwarz-rot-goldenen Fahnen Schilder hochreckt, auf denen «Bundesland Sachsen grüßt den Bundeskanzler» oder «Deutschland einig Vaterland» steht. Nach der gemeinsamen Pressekonferenz geht Kohl zur Ruine der Frauenkirche im Zentrum der Stadt, um dort eine Rede zu halten. Hier scheinen die Demonstranten nun völlig außer Rand und Band geraten zu sein. Es gibt ein paar, die sich auf ihren Schildern für die Souveränität der DDR und die Zwei-Staaten-Lösung aussprechen, aber sie werden von der «Deutschland, Deutschland» skandierenden Menge nach hinten gedrängt. Ein paar Punks, die sich auf dem Platz vor der Kirche befinden, werden von strammen Gesellen mit dem Ruf «Rote Schweine, haut ab!» verscheucht. Kohl schließt seine Rede mit den Worten: «Ich grüße hier von Dresden aus alle unsere Landsleute in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland. Gott segne unser deutsches Vaterland!» Woraufhin die Menge mit dem Chor antwortet: «So ein Tag, so wunderschön wie heute! So ein Tag, der dürfte nie vergehn!»
An demselben Ort, vor der inzwischen wieder aufgebauten Dresdner Frauenkirche, werden sich sechsundzwanzig Jahre später, 2015, Tausende und Abertausende von Menschen bei den neuen Montagsdemonstrationen gegen die westdeutsche Fremdherrschaft wenden und gegen die Diktatur der westlichen Eliten und des Kapitalismus: Sie klagen darüber, dass ihnen etwas aufgezwungen wurde, das sie gar nicht wollten.
Am 19. Dezember 1989 gehen die Fernsehbilder von den jubelnden und Deutschlandfahnen schwenkenden Demonstranten in Dresden um die Welt; auch in Westdeutschland werden sie aufmerksam verfolgt, vielerorts mit Entsetzen. Ich bin damals gerade zwanzig geworden und zum Studieren nach Hamburg gegangen. Unsere westdeutsche Jugend in den Achtzigerjahren war geprägt von der Kanzlerschaft Helmut Kohls. Als ich dreizehn war, kam er durch das konstruktive Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt an die Macht. Er rief gegen die vermeintlichen sozialdemokratischen Verirrungen des vorangegangenen Jahrzehnts eine «geistige» und «politische» Wende aus, er wollte die Institution der Ehe und der heterosexuellen Kleinfamilie wieder stärken und die drohende Verwandlung der Bundesrepublik in eine multikulturelle Gesellschaft verhindern; er trieb – wie vor ihm schon die SPD-geführte Regierung – den Ausbau der Atomkraftwerke und der Atomindustrie voran und hielt alle Bemühungen der jungen Grünen um ein besseres Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge und ein nachhaltigeres Wirtschaften für bloße Flausen; er stand in anscheinend jedem einzelnen Punkt sämtlichen Überzeugungen entgegen, die man als politisch interessierter junger Mensch in diesem Jahrzehnt so hegte. 1987 wurde Kohl wiedergewählt, nicht zuletzt, weil es seiner Regierung gelungen war, die Wirtschaftskrise der frühen Achtziger zu überwinden, und zwar in einer sozial weit verträglicheren Weise als bei seinen konservativen Politikgeschwistern in Großbritannien und den USA, Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Gleichwohl blieb die von ihm proklamierte «geistige» und «politische» Wende aus: Am Ende der Achtziger war die westdeutsche Gesellschaft weit liberaler und diverser als am Beginn des Jahrzehnts, weit stärker geprägt vom Gefühl eines emanzipatorischen Aufbruchs: Der aus den Siebzigern stammende Geist der Gegen- und Alternativkulturen war in die Mitte der Gesellschaft gerückt; der parlamentarische Arm dieser Kulturen, die Grünen, hatte sich auf den langsamen, aber langsam erfolgreichen Marsch durch die Institutionen begeben. So wirkte Kohl in der Mitte seiner zweiten Legislaturperiode bereits wie ein Mann aus der Vergangenheit, seine Umfragewerte waren so schlecht wie noch nie.
Doch wer im Westen gehofft haben sollte, dass Kohl nun bald abgewählt wird, der weiß an diesem 19. Dezember 1989, dass diese Hoffnung begraben werden muss. An diesem Tag ist klar, dass die Mehrheit der Ostdeutschen keinen Sinn dafür hat, «noch eine weitere Runde Sozialismus dranzuhängen», wie der Schriftsteller Martin Walser es ein Jahr später in einem Text für die «Zeit» formuliert. Stattdessen sucht sie möglichst schnell den Anschluss an den kapitalistischen Westen, und Helmut Kohl ist dafür ihr Gewährsmann: «Alle Macht dem Kanzler», so steht es auf einem Schild der Dresdner Demonstrierenden.
Schon einige Tage vor dem Mauerfall ist die November-Ausgabe des Frankfurter Satiremagazins «Titanic» erschienen. Auf dem Cover sieht man eine junge Frau in einer ausgewaschenen Jeansjacke. In der Hand hält sie eine Gurke, deren Spitze geschält ist, sodass die Schale zu den Seiten herunterhängt. Daneben steht: «Zonen-Gaby (17) im Glück (BRD): Meine erste Banane».
Wie sich später herausstellt, heißt die junge Frau gar nicht Gaby, und sie kommt auch nicht aus der DDR, sondern aus Worms; was nicht weiter ins Gewicht fällt, denn es handelt sich ja um Satire. Dabei ist es eine Satire, die präzise ins Bild bringt, was viele Westdeutsche im November 1989 mit den Ostdeutschen – den «Ossis» oder den «Zonis» – verbinden. Die «Ossis», das sind Menschen, die so tun, als ob sie sich nach Freiheit sehnen und nach Demokratie. Aber in Wirklichkeit sind sie nur wild auf die Segnungen des Kapitalismus, auf den Wohlstand, der im anderen Teil des Landes herrscht. Sie sind wild auf Südfrüchte, insbesondere Bananen, weil es diese in der Mangelwirtschaft der DDR nicht zu erwerben gab; dabei sind sie zugleich so doof, dass sie nicht mal erkennen, wenn man ihnen eine Gurke anstatt einer Banane andreht. Und sie sind schon durch ihren modisch rückständigen Bekleidungs- und Frisurenstil als Menschen aus einem wirtschaftlich wie kulturell rückständigen Land zu erkennen.
Tatsächlich tragen sehr viele von jenen Menschen, die in der Nacht zum 10. November und an den folgenden Tagen aus dem Ostteil in den Westteil des Landes strömen, ausgewaschene Jeansjacken und ebensolche Hosen. Es handelt sich um die sogenannten Stonewashed Jeans, die uns schon im Einleitungskapitel begegnet sind; unter dem Namen «Moonwashed» oder auch «Marmorjeans» erfreuen sie sich in den Achtzigerjahren in der DDR großer Beliebtheit. In der westlichen Popkultur findet man solche Hosen schon Ende der Sechzigerjahre. Sie werden von