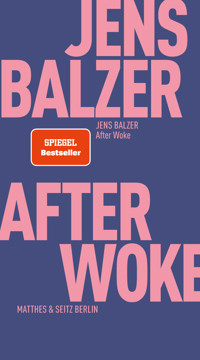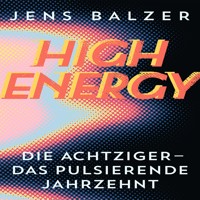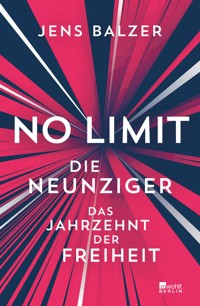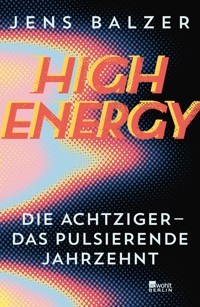16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pop – so viel mehr als nur Musik Von Helene Fischer bis zu Sunn O))), von den Waldschraten des Neo-Folk bis zum queeren Pop von Antony, vom Männlichkeitskult des Hip-Hops bis zum Minimal-Technorausch im Berliner Berghain: Popmusik ist die wichtigste Kunstform der Gegenwart, keine andere reagiert so direkt und schnell auf die Verfassung unserer Zeit. Jens Balzer liefert eine Gegenwartsdiagnose des Pop: einer Musik, die das rasende Tempo der digitalisierten Kultur spiegelt, das Glück und die Qual endloser Möglichkeiten, die Sehnsucht nach Ruhe ebenso wie den Wunsch, dem Leben erst richtig Fahrt zu geben. Jeder Künstler erschafft sich seine eigene Welt zwischen Sound und Performance, sanften Klängen und schrillem Trash, Minimalismus und Größenwahn. Doch wie finden wir uns in dieser Vielfalt künstlerischer Welten zurecht? Was unterscheidet guten von schlechtem Pop? Und was verrät er uns über die Zeit, in der wir leben? Der renommierte Popkritiker Jens Balzer ist stets ganz nah dran, ob als Konzertbesucher, tanzend im Club oder in der Begegnung mit Künstlern und Bands. In diesem Buch skizziert er Strömungen, Charaktere, Trends und Konstellationen der letzten zehn Jahre und lässt so ein energiegeladenes Panorama des aktuellen Pop entstehen – der so viel mehr ist als nur Musik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jens Balzer
Pop
Ein Panorama der Gegenwart
Über dieses Buch
Pop – so viel mehr als nur Musik
Von Helene Fischer bis zu Sunn O))), von den Waldschraten des Neo-Folk bis zum queeren Pop von Antony, vom Männlichkeitskult des Hip-Hops bis zum Minimal-Technorausch im Berliner Berghain: Popmusik ist die wichtigste Kunstform der Gegenwart, keine andere reagiert so direkt und schnell auf die Verfassung unserer Zeit. Jens Balzer liefert eine Gegenwartsdiagnose des Pop: einer Musik, die das rasende Tempo der digitalisierten Kultur spiegelt, das Glück und die Qual endloser Möglichkeiten, die Sehnsucht nach Ruhe ebenso wie den Wunsch, dem Leben erst richtig Fahrt zu geben. Jeder Künstler erschafft sich seine eigene Welt zwischen Sound und Performance, sanften Klängen und schrillem Trash, Minimalismus und Größenwahn. Doch wie finden wir uns in dieser Vielfalt künstlerischer Welten zurecht? Was unterscheidet guten von schlechtem Pop? Und was verrät er uns über die Zeit, in der wir leben?
Der renommierte Popkritiker Jens Balzer ist stets ganz nah dran, ob als Konzertbesucher, tanzend im Club oder in der Begegnung mit Künstlern und Bands. In diesem Buch skizziert er Strömungen, Charaktere, Trends und Konstellationen der letzten zehn Jahre und lässt so ein energiegeladenes Panorama des aktuellen Pop entstehen – der so viel mehr ist als nur Musik.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-12241-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Zur Einleitung: Einige Gedanken beim Anblick eines singenden Superstars auf dem Rücken einer fliegenden Gans
1. Was ist nur aus den Heroen des Pop geworden? The Strokes, The Libertines und der Niedergang der männlichen Herrschaft
2. Grausame Frauen haben es leichter im Leben: Amy Winehouse, Adele und der Angriff der Vergangenheit auf die Gegenwart
3. Bärte des Wartens, Bärte des Werdens: Devendra Banhart, Animal Collective und die neuen Gammler und Freaks
4. Neulich in der satanischen Unterdruckkammer: Sunn O))) und die hohe Kunst des monotonen Lärms
5. Mädchen, die sich wie Männer anziehen, die sich wie Mädchen anziehen: Dir en grey, X Japan und ihre deutschen Verehrerinnen
6. Am Ende der Zeit, nach all den Partys und Räuschen: Kode9, Burial, James Blake und die neuen Ingenieure des Selbst
7. Hart harfende Frauen kehren zum Ursprung des Lebens zurück: Joanna Newsom, Julia Holter und die Wiederentdeckung der weiblichen Stimme
8. Wenn du mich liebst, schlag mich fester: Antony and the Johnsons und die Wonnen des Masochismus
9. Musizieren und tanzen? Das macht bei uns das Gesinde: Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga und die frivole Faulheit der neuen Diven
10. Perverse Exzesse im Nonnenkloster: Justin Bieber und seine ungerufenen Geister
11. Wer gerne stirbt, muss vorher leben: Lana Del Rey, Unheilig und die erregende Kraft des endlosen Endens
12. Unzufriedene Mittelschichtsbürger streben nach höheren Weihen: Sting, Rufus Wainwright, Lou Reed und der Statuspanikpop
13. Elektrische Schafe träumen von Céline Dion: Grimes, Holly Herndon und die Tücken des Digitalfeminismus
14. Wenn man jederzeit Sex haben kann, ist das auch verwirrend: 18+, Kelela, FKA twigs und die erotischen Probleme der Digital Natives
15. Hermaphroditische Backenhörnchen auf Metamphetamin: Skrillex, Flying Lotus, PC Music und die Ästhetik der Hyperbeschleunigung
16. Heute gehört ihr die Volksmusik und morgen die ganze Welt: Helene Fischer und die Geburt des nihilistischen Postfeminismus
17. War die deutsche Wiedervereinigung nicht auch irgendwie schwul? Rammstein, Freiwild, Bushido und die Aggressivität männlicher Opfer
18. Gott wohnt in den Heuchlern und Schizos: Kanye West, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar und die Protestmusik des postheroischen Mannes
Zum Schluss: Ein kleiner Abendspaziergang von der Berliner O2 World bis zum Techno-Klub Berghain
Dank
Bildnachweis
Sie entfachen das ...
Zur Einleitung: Einige Gedanken beim Anblick eines singenden Superstars auf dem Rücken einer fliegenden Gans
Kurz vor dem Ende der Show schwebt dann auch noch eine gewaltige Gans aus goldenem Blech vom Bühnenhimmel hernieder und neigt ihr Haupt voller Demut vor der singenden Frau mit dem sehr blonden Haar. Diese reibt sich einen Moment ebenso gütig wie wohlig am Schnabel des Tieres, um sich dann stolz mit ihm in die Luft zu erheben und auf dem Gänserücken lauthals «My Heart Will Go On» von Céline Dion zu singen. Von blinkenden Drähten geführt und gehalten, flattern Vogel und Frau minutenlang über den Köpfen des Publikums hin und her.
Die Menschen im Saal sind begeistert, obwohl sie auch jetzt, nach über zwei Stunden musikalischer Darbietung, das eine, sehnsüchtig erwartete Lied immer noch nicht zu hören bekommen. Stattdessen wird ihnen ibizenkischer Schranztechno mit ächzend sich blähenden Stadion-Rave-Fanfaren geboten, retrofuturistischer Roboterpop nach Art der Düsseldorfer Elektronikavantgarde der siebziger Jahre und christlich geprägter Goth-Rock, den man sonst nur von Frauen mit schwarz gefärbten Haaren und Tränentattoos auf der Wange kennt.
Helene Fischer heißt die mega-eklektische Multimediakünstlerin, die 2014 in der Mehrzweckhalle am Berliner Ostbahnhof vor fünfzehntausend Zuhörern auftritt. Ganz am Ende des Abends wird sie den einen, allseits von ihr erwarteten Hit natürlich doch noch singen: «Atemlos durch die Nacht» – und zwar zunächst als Akustikballade und dann zur Freude vor allem ihrer älteren Verehrerinnen und Verehrer im bassgesättigt stampfenden Dancefloor-Remix. Bis dahin aber springt sie in rasendem Tempo durch die musikalischen Epochen und Stile, es gibt «Get Lucky» von Daft Punk zu hören und «Jump» von Van Halen, «Purple Rain» von Prince and the Revolution und Motive aus Vivaldis «Vier Jahreszeiten», mit denen das Konzert in vier Teile gegliedert wird: Herbst, Winter, Frühling und Sommer.
Auch Lieder aus dem eigenen Repertoire bringt Helene Fischer dem Publikum zu Gehör, doch ist darin fast nichts übrig geblieben von der bierzelttauglichen Stimmungsmusik, mit denen sie Mitte der nuller Jahre reüssierte. Stattdessen gibt es an Kraftwerk erinnernde minimal-repetitive Synthesizerfiguren, hitzig in den Mix gegniedelte Kraftrockgitarren und ucka-tschuck-hechelnden Funk. Im Ganzen wirkt das Programm dieses Abends so, als hätte es der Zufallsgenerator eines Streaming-Dienstes ausgespuckt.
Derart selbstverständlich gibt sich Fischers extremer Eklektizismus, dass er wie der Normalzustand einer musikalischen Gegenwart wirkt, in der alle Gattungsgrenzen, Traditionen und Konventionen vollständig verflüssigt sind. Post-Postmodernität, oder auch: Post-Internet-Pop. In einer Welt, in der jede erdenkliche Musik aus jeder Zeit jederzeit verfügbar ist, hat die sich in jedem Moment neu zusammensetzende Gegenwart über die Vergangenheit und die Zukunft und alle anderen Zeitlichkeiten gesiegt.
Helene Fischer ist der Inbegriff für diese vollständig entgrenzte Pop-Gegenwart. Und das obwohl oder gerade weil das Feld, aus dem sie kommt – die sogenannte Volksmusik und der deutsche Schlager –, bislang das Paradigma einer streng sich Grenzen setzenden Musik war: «deutsch» und heimatverhaftet, traditionsfest umhegt und verfestigt wie kein anderer Stil. Dass Fischer diese per Definition territoriale Musik zum Ausgangspunkt einer exzessiven Deterritorialisierung nimmt, kann man als ungehörig ansehen. Dass die breite Masse des Publikums es im Gegenteil als zeitgemäß und normal empfindet – das allein sagt schon viel über die Zeit, in der wir leben, und die Musik, die wir hören.
Zwanzig Jahre zuvor wären eine solche Künstlerin, eine solche Art von Ästhetik, eine Szene wie an diesem Abend nicht denkbar gewesen. Aber warum nicht? Und was ist seither passiert?
Mit solchen und anderen Fragen des popmusikalischen Wandels werde ich mich im Folgenden beschäftigen. Dabei geht es nicht allein um das Hören und das Gehörte, um Musik und Rhythmen, Melodien und melodiefreien Krach – sondern genauso um Körperlichkeit, um Erotik und um die Bilder der Welt, die sich in all diesen Facetten des Pop widerspiegeln. Auch die Intensität von Helene Fischer rührt ja nicht aus ihrer Musik allein, sondern ebenso aus deren Verbindung mit ihrer körperlichen Präsenz auf der Bühne und mit einer Aura, die einen Widerspruch in sich trägt.
Helene Fischer ist Ich und Nicht-Ich in einer Person. Sie tritt auf als extrem dominante Künstler-Identität, die sich noch die einander fremdesten Stile gleichmäßig gefügig macht – und als Charakterhülle, die kulturindustriell komplett kontrolliert und jeder Eigenheit beraubt ist. Sie ist ein hyperaktiver, sich unaufhörlich von einer Erscheinungsform in die nächste transformierender Organismus – und wirkt doch zumeist mechanisch und leidenschaftslos, roboterhaft desinteressiert und undurchsichtig. Daraus erklärt sich auch der sonderbar selbstwidersprüchliche und deswegen so erregende Eros, der Helene Fischer umgibt: Die Sprache der Herrschaft und die der Unterwerfung sind in ihrer Inszenierung unentwirrbar verschränkt.
Für die Pop-Heldinnen der Gegenwart ist diese Schizo-Erotik typisch; sie findet sich bei den prägenden Figuren der Pop-Avantgarde, aber auch bei Superstars wie Amy Winehouse und Adele. Typisch für den Pop der Gegenwart ist aber zunächst noch etwas anderes: dass es nämlich überhaupt Heldinnen sind, die ihn beherrschen – und eben nicht Helden. Die Jahrzehnte währende Dominanz heterosexueller weißer Männer an elektrisch verstärkten Instrumenten ist an ihr Ende gekommen.
Wenn Helene Fischer den Höhe- und vielleicht auch den Endpunkt unserer laufenden popmusikalischen Ära darstellt, dann kann man ihren Nullpunkt vielleicht auf jenen Moment datieren, in dem die einst so kraftvolle Verbindung zwischen heterosexueller Männlichkeit und Elektrizität endgültig zum nostalgischen Bildchen verblasste: Das passierte in der ersten Hälfte der nuller Jahre, mit einem letzten Aufbäumen von Bands wie The Strokes oder The Libertines. Von dort bis zum Frühjahr 2016 reicht der Zeitraum, den ich in diesem Panorama der Gegenwart skizziere.
Dazu habe ich Konzerte und Klubs besucht, Schallplatten und Soundcloud-Dateien gehört, mir Videoclips angesehen und nicht zuletzt mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Ich habe nicht nur Helene Fischer getroffen, sondern auch das radikal entschleunigte Krachmönche-Duo Sunn O))). Ich habe den cross-dressenden japanischen Popstar Yoshiki Hayashi von der Band X Japan interviewt und den Sänger Der Graf von der deutschen Gruppe Unheilig. Es geht um den Maskulinismus der Gangsta-Rapper und Deutschrocker, um die Avantgarde der neuen Techno-Feministinnen wie Holly Herndon, Laurel Halo und Grimes ebenso wie um die Gilde der Mainstream-Diven von Beyoncé bis Rihanna und Lady Gaga.
Der Pop der Gegenwart wird von gebrochenen Ich-Identitäten bevölkert – und von Freaks, die sich entschlossen der Identifizierung verweigern. Er handelt von Souveränität und Masochismus, von Hyperbeschleunigung und provokativer Langsamkeit. Oder allgemeiner gesagt: Er handelt von der Suche nach einem immer wieder neuen Verhältnis zwischen dem Ich und der restlichen Welt. Wer bin ich? Wer könnte ich sein? Wer will ich sein? Wie finde ich zu einer Sprache für meine Wünsche und mein Begehren?
Dabei kommt es zu einem stetigen Wechselspiel aus Dezentrierung und dem Kampf um Souveränität, aus der fortwährenden Verflüchtigung alter Identitäten und der Sehnsucht danach, im endlosen Treiben der Gegenwart zu jenen kurzen Momenten der Ruhe und Sicherheit zu gelangen, in denen allein sich das Offene zeigt. Es geht also wie immer um Freiheit und Glück. Davon soll jetzt die Rede sein.
1. Was ist nur aus den Heroen des Pop geworden? The Strokes, The Libertines und der Niedergang der männlichen Herrschaft
Ich persönlich bin ja ganz glücklich, wenn ich einmal ordentlich erniedrigt werde. In Popkonzerten bietet sich dazu aber nur noch selten Gelegenheit; man findet kaum mehr Künstler, die eine Erniedrigung sachgerecht durchzuführen verstehen – die also derart schön, stark, dominant, schillernd und arrogant sind, dass man sich in ihrem Angesicht schäbig, klein und nichtswürdig fühlen kann. Darin zeigt sich ein Traditionsbruch: In den sechziger, siebziger, achtziger und neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die Popmusik von unerreichbaren, sehr schönen oder zumindest sehr wilden oder seltsamen Männern dominiert, die weit jenseits des mittelmäßigen und kleinen, unansehnlichen und weitgehend unwilden Lebens ihres Publikums zu existieren schienen, von Elvis Presley bis zu David Bowie, von Mick Jagger bis zu Michael Jackson, von Prince bis zu Kurt Cobain. Eine Weile lang pflegte man diese Sorte von Männern auch als «Superstars» zu titulieren.
Kurt Cobain war Anfang der neunziger Jahre der letzte Neuzugang in diese Gilde der heroischen Männer. Mit seiner Gruppe Nirvana und dem von ihr popularisierten Grunge-Genre brachte er noch einmal den breitbeinigen, maskulin schwitzenden Rock ins Zentrum der populären Musik; doch die Botschaften, mit denen er das Medium füllte, kündeten vor allem von einer zutiefst Rock-untypischen, rundum verunsicherten und mit sich selbst beschäftigten Männlichkeit. Insbesondere durch sein ausgiebig vorgetragenes Leiden an der eigenen Größe ruinierte Cobain die für den heroischen Pop-Maskulinismus wesentliche Aura der dominanten Unnahbarkeit. Er präsentierte sich als phallischer Charakter, gab dabei jedoch nur einen kläglichen, geknickten Phallus ab; einen Phallus, der nicht eingeführt und gestoßen, sondern gestreichelt und getröstet werden wollte; einen Phallus, der nicht nach einer Sexualpartnerin rief, sondern nach Mama.
Nachdem Kurt Cobain sich 1994 mit einer Schrotflinte erschossen hatte, zeigte das Publikum lange Zeit kein Interesse daran, den auf diese Weise vakant gewordenen Posten neu zu besetzen. Doch selbst wenn man den damit eröffneten Konkurs des klassischen maskulinen Rock-Heroismus – wie ich es im Folgenden tun werde – als sexualemanzipatorischen Fortschritt beschreibt, kommt man nicht umhin festzustellen, dass mit der dazugehörigen Dialektik aus auratischer Dominanz und bewundernder Demut auch ein wesentlicher Teil der überkommenen Pop-Erotik verlorengeht: jene Erotik, die aus der Lust entspringt, sich Künstlern zu unterwerfen, die überlebensgroß wirken, «larger than life».
Zum bislang letzten Mal habe ich eine gelungene Verschränkung von dominantem Rock-Maskulinismus und masochistischem Publikumsverhalten bei einem Konzert der New Yorker Gruppe The Strokes gesehen. Im März 2002 treten sie in der Berliner Columbiahalle erstmals vor einer deutschen Zuhörerschaft auf, um ihr gerade erschienenes Debütalbum «Is This It» vorzustellen; diesem ging eine klassisch musikindustriell geschulte, minutiös durchgeplante Strategie des Schürens von Erregung und der Inszenierung von Aura voran. Dazu gehörten Konzerte in winzigen Klubs und Kunstgalerien in New York für wenige Glückliche, streng limitierte, ausgesucht rätselhafte Gesprächstermine sowie der systematische Aufbau eines überhitzten Rockstar-Geweses durch kontrolliert gestreute Gerüchte über die sexuelle Orientierung der Künstler, über Schrullen, Perversionen oder sonst irgendwie am vermuteten Mehrheitsempfinden vorbeilaufende menschliche und künstlerische Idiosynkrasien. Auf dem Cover der Platte sieht man von der Seite einen weiblichen Hintern, auf den gerade ein Handschuh aus Lackleder patscht.
Zu dieser erotisch-mysteriösen Gesamtinszenierung passt auch das gleißende Konzert, das die Strokes in der Columbiahalle vor einem besinnungslos jubelnden Publikum geben. Der Auftritt dauert kaum länger als eine Dreiviertelstunde, in dieser Zeit rockt die Band sich weitgehend kommentarlos und hastig durch ihr vollständiges Repertoire. Dabei handelt es sich um vierzehn aus ein bis drei Akkorden zusammengesetzte Dreiminutenstücke, nur gelegentlich wird die Abfolge der Songs von unverständlichen hingenuschelten Bemerkungen des Sängers Julian Casablancas unterbrochen. Dann endet das Programm mit einem Stück namens «Take It Or Leave It».
Auch das ist Programm. Die Strokes geben nicht nur keine Zugabe; so eindeutig zugabenuntauglich ist ihr Auftritt gewesen, dass das bis dahin so begeisterte Publikum sich diskussions- und widerstandslos, von greller Hallenbeleuchtung beschienen und von schrecklichem Easy-Listening-Gedudel bedröhnt, in sein Schicksal fügt und einander zufrieden zumurmelnd den Ausgängen zustrebt. Lange schon, denkt man an dieser Stelle, sind die Leute von Rock-’n’-Rollern nicht mehr so abweisend behandelt worden; und lange schon haben die Leute sich nicht mehr dermaßen darüber gefreut.
2002 sind die Strokes noch sehr jung, fünf frisch erblühte dunkelhaarige Schlackse mit allerliebsten lockigen Wuschelfrisuren und sauber rasierten knabenhaften Kinnen; besonders dieses letzte Merkmal wird, wie wir noch sehen werden, im weiteren Fortgang der Popgeschichte von Bedeutung sein. Sie sind wahlweise in zu enges schwarzes Leder gekleidet oder in zu enge schwarze Hemden, die über der Hose getragen werden: So schön sind sie, dass sie sich jede Art von Arroganz leisten können. In keinem Moment erwecken sie denn auch nur den Eindruck, als interessierten sie sich für den zu ihren Füßen umherhopsenden Mob; nie darf das Publikum glauben, es könne der Band etwas zurückerstatten von der Energie und der Freude, die sie verschenkt.
Wenn sich Julian Casablancas nicht gerade mit seinem Mikrophon an den Bühnenrand schleppt, um sich in abrupten Energieschüben die Seele aus dem Leib zu singen und zu seufzen, schlurft er schub- und energielos und dem Publikum abgewandt zwischen seinen vier Mitmusikern umher. Untrennbar sind in diesen Gesten der Coolness Verausgabung und Gleichgültigkeit miteinander verbunden; dies gilt auch für den melodischen Krach, den die Band produziert. In den Gitarrenarrangements wird kaum zwischen Strophe und Refrain unterschieden, und noch in Momenten größter Intensität tuckert das Schlagzeug schnöde und geistesabwesend dahin. Dennoch besitzen die Songs der Strokes eine so ungeheure Dynamik, dass jeder einzelne von ihnen das Publikum in die Raserei treibt. Man kann sich vollständig in ihnen verlieren; ihre rätselhafte Aura versteht freilich nur, wer sich ein wenig aus der hopsenden Masse entfernt. Dann sieht man, dass diese Musik den Menschen zugleich sehr nah ist und sehr fern; dass man auf die Bühne wie durch ein Okular guckt, dessen Brennweite sich nicht recht einstellen lässt.
Wie in jeder masochistischen Liebesbeziehung wechseln sich Launen und Gemütslagen stetig ab. Nicht nur der Sänger, auch sein Publikum schwankt zwischen Verausgabung und äußerster Erschöpfung. Darum fällt die Spannung in dem Moment, in dem die Band die Bühne verlässt, so schlagartig in sich zusammen. Bis dahin aber wird sie von der sonnenbebrillten Coolness der Strokes bis ins Äußerste gespiegelt und verstärkt.
Wenn man mit anderthalb Jahrzehnten historischer Distanz auf dieses Konzert zurückblickt, fühlt man sich wie in einer sehr fremden Welt. Zum letzten Mal wurde hier eine sehr junge, sehr männliche, sehr heterosexuelle Rockband mit allen Mitteln der traditionellen Musikindustrie in das Aufmerksamkeitszentrum der gitarrenrockliebenden Jugend gehievt. Es gab keine Testphase, die Band wurde als ein wie aus dem Nichts erscheinendes Ereignis inszeniert. Das Ereignis war überlebensgroß, so groß, dass man schon beim ersten Anblick ahnte: Es kann ihm kein Überleben beschieden sein. Und tatsächlich, schon wenig später war davon nichts mehr übrig geblieben.
Erst einmal paradierte indes eine lange Reihe von Epigonen an der geneigten Pop-Hörerschaft vorbei: Kaum ein Monat verging in den folgenden etwa zwei Jahren, in dem nicht irgendeine ähnlich gestrickte musizierende Gruppe von jungen heterosexuellen Männern als «die neuen Strokes» auf die Bühne geschickt wurde; Gruppen, an deren Namen sich schon sehr bald kaum noch jemand erinnerte. Viele von ihnen trugen wie The Strokes ein «The» im Namen, weswegen eine Weile auch von den «The-Bands» die Rede war: The Hives, The Vines, The Von Bondies, The Datsuns und The Kills. Es traten aber auch geistesverwandte Gruppen ohne das «The» auf wie Black Rebel Motorcycle Club, Interpol oder – etwas später, um das Jahr 2005 herum – die Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Bloc Party und Art Brut.
All diese Gruppen verglühten ebenso schnell wieder, wie sie aufleuchteten; am schnellsten und schauderlichsten verglommen jedoch The Strokes. Kein weiteres auch nur annähernd erregendes Album ist ihnen mehr gelungen: Auf ihrem zweiten Werk «Room on Fire» behalfen sie sich 2004 mit einer Variation des Debüts; «I Wanna Be Forgotten, I Wanna Be Forgotten», singt Julian Casablancas im Eröffnungsstück, und das Publikum dankte es ihm damit, dass es die Strokes in der Tat schnell vergaß. Auf der dritten Platte «First Impressions of Earth» versuchten sie sich 2006 an einer Art Progressive-Rock-Variante; dabei tauschten sie ihre kurzen, verschwenderisch energiereichen Songs gegen längere, scheinbar raffinierter arrangierte, in Wahrheit jedoch vor allem energetisch medioker eingepegelte Kompositionen ein, die die Verschwendung nicht mehr in der Rasanz suchten, sondern in pseudoschlauer Ornamentik und Verfeinerung.
Man mochte dies als den Versuch anerkennen, nunmehr virtuoser und durchdachter zu klingen, also auch erwachsener. Doch während das rasend schnelle Aufscheinen ungeschützter Jugendlichkeit von kühlem Glamour umfunkelt erschien, wirkte das Aufscheinen rasend schnellen Erwachsen-werden-Wollens lediglich hilflos und unsouverän. Die unerreichbare Coolness der Rock-’n’-Roll-Knaben verwandelte sich binnen kürzester Zeit in die richtungslose Schlaffheit überforderter Jünglinge, die mit der Verehrung, die ihnen einen Wimpernschlag der Popgeschichte lang zuteilwurde, nichts anzufangen wissen.
Es hat in den nuller Jahren nur eine weitere Rockband gegeben, die sich in prägender Weise mit dem Symbolinventar der heroischen Männlichkeit zu inszenieren verstand; und sie lässt sich interessanterweise als das dunkle Spiegelbild der Strokes betrachten: Es handelt sich um The Libertines, ein Londoner Quartett um den Sänger Pete Doherty. The Libertines betraten die Szene kurz nach The Strokes, eines ihrer ersten Londoner Konzerte spielten sie im Jahr 2001 als Vorgruppe beim fünfundzwanzigjährigen Jubiläumskonzert von den Sex Pistols.
Ihr erstes Konzert in Berlin gaben die Libertines im November 2002 im wenig später schon gentrifizierungshalber geschlossenen Magnet Club an der Greifswalder Straße. Zu diesem Zeitpunkt waren sie auch in Deutschland bereits ein ebenso großes Gerücht, wie Julian Casablancas und seine Band es ein Dreivierteljahr zuvor gewesen waren. Über den Vorschuss für ihr erstes Album «Up the Bracket» kursierten die tollsten Mutmaßungen; um eine halbe Million Pfund wird es wohl gewesen sein. Doch anders als die Strokes übersetzen die Libertines diesen plötzlichen Reichtum, diese plötzlich geschenkte Größe, nicht in die Unberührbarkeit von Stars.
Bei ihrem ersten Berlin-Konzert sind die Libertines alles andere als unerreichbar, und das liegt nicht nur daran, dass der Klub so viel kleiner ist als die Halle, in der die Strokes debütierten. Die Menschen müssen nicht zur Bühne hochschauen, um ihre gerade entflammten und sogleich wieder verglimmenden Idole zu erblicken, und mehr noch, es gibt eigentlich gar keine Trennung zwischen Bühne und Publikum. Beim Musizieren stürzen die Libertines über- und durcheinander wie ein Wurf junger Welpen, sie stehen unentwegt einander im Weg, treten sich auf die Füße, rempeln sich an und verheddern sich in den eigenen Mikrophonkabeln oder in den Mikrophonkabeln der anderen Musiker.
In den Interviews, die Pete Doherty vor dem Erscheinen des Debütalbums «Up the Bracket» gegeben hat, erklärte er dieses Chaos zu seinem Lieblingszustand, als idealen Aggregatzustand des Punkrock; der Produzent des Albums, der ehemalige The-Clash-Bassist Mick Jones, hat dem insofern Rechnung getragen, als er sämtliche Nebengeräusche der Studioaufnahmen wie den Sound stürzender Mikrophonständer im fertigen Mix gelassen hat.
Der einzige Mensch, der auf der Bühne für Ordnung und Ruhe zu sorgen vermag, ist ein großer, stämmiger, grobgebauter Roadie, der mindestens einen Kopf größer ist als der Rest der um ihn herumwimmelnden Menschen. Er steht geduldig und mit kunstvoll genervtem Gesicht in der Mitte der Bühne zwischen Pete Doherty und seinen Mitmusikern und tapst ihnen bei Bedarf hinterher; er richtet Mikrophonständer wieder auf, wenn Doherty sie ein weiteres Mal umgeworfen hat; er entheddert die Mikrophon- und Verstärkerkabel, wenn sich Sänger, Gitarrist und Bassist im Spiel zu oft umschlungen haben; er richtet die Beckenständer wieder auf, wenn der Schlagzeuger sie umgehauen hat oder einer der anderen Musiker in das Schlagzeug getaumelt ist; er hindert Pete Doherty daran, von der Bühne ins Publikum zu stolpern, und er hindert das Publikum daran, auf die Bühne zu kommen und Pete Doherty so zu umschlingen und anzurempeln wie seine Mitmusiker ihn und er sie.
Vielleicht könnte man sagen: So wie die Strokes ihr Publikum zur Verehrung auffordern und es zugleich zurückweisen und damit gewissermaßen die Rolle des Meisters in einer masochistischen Liebesbeziehung einnehmen – so ist der Masochismus, die Unterwerfung, die passive Verehrung bei den Libertines in die Bühneninszenierung selbst gewandert. Größe erlangen Doherty und seine Musiker nur, indem sie sich ihrerseits unterwerfen; das Symbol dieser Unterwerfung ist der dominante Roadie, ein phallischer Charakter, der das verkörpert, was dem heroisch-heterosexuellen Männerrock der Libertines an eigener phallischer Stärke fehlt.
Die Erotik, die sie verströmen, ist keine Erotik der Dominanz und unerreichbaren Schönheit. Es ist vielmehr eine Erotik der Verpeiltheit, der Überforderung und Lebensuntüchtigkeit. Vom ersten Moment an ist Pete Doherty ohne Frage von der Aura des Genies umgeben. Doch ist es ein Genie, dem geholfen werden muss, ein juveniles Genie, das sich nicht entfalten kann, wenn nicht im Hintergrund eine starke Figur steht: ein Vater, eine Mutter, ein Onkel, eine Tante, ein väterlicher Freund oder ein Manager. Oder eben ein Roadie.
Das Interessante ist, dass die Libertines – anders als die Strokes – nicht sofort nach ihren ersten Auftritten verglommen. Eine Weile lang wuchsen und gediehen sie und wurden immer größer, stilbildender und populärer. Entscheidend für ihren Ruhm war allerdings, dass sich das Hilfsbedürftige und Verpeilte, Absonderliche und Lebensuntüchtige ihres Sängers zu monströser Gestalt auswuchs; oder anders gesagt: dass Pete Doherty sich vor den Augen der interessierten Pop- und bald auch sonstigen Öffentlichkeit in einen Freak verwandelte, der in den Celebrity-Spalten der Boulevardpresse mindestens ebenso viele Schlagzeilen erzeugte wie in den Musikmagazinen und popkritischen Feuilletons.
Dieses Schicksal wurde ein paar Jahre später – ich komme im nächsten Kapitel darauf zurück – von seiner zu noch weit größerem Ruhm gelangenden Londoner Bekannten, Geistesverwandten und Party- und Drogenmissbrauchsgefährtin Amy Winehouse wiederholt. Kurz bevor diese mit ihrem zweiten Album «Back to Black» zur erfolgreichsten britischen Popsängerin aufstieg, im März des Jahres 2006, gab Pete Doherty sein zweites Berliner Konzert. Allerdings hatte er die Libertines inzwischen nach diversen hässlichen, öffentlich ausgiebig ausgewalzten Streitigkeiten mit seinen Mitmusikern aufgelöst und eine zweite Band mit dem Namen Babyshambles gegründet.
Das Konzert findet im Berliner Columbiaclub statt, dem kleinen Schwestersaal neben der Columbiahalle, in dem The Strokes vier Jahre zuvor ihren ersten Berlin-Auftritt absolvierten. Viele Menschen haben sich Karten für diesen Abend gekauft, auch wenn sie der Überzeugung sind, dass Doherty ohnehin nicht auftauchen wird. Zu oft hat er in den vorangegangenen Wochen und Monaten seine Auftritte kurz zuvor abgesagt, etwa weil er nach eigenen Angaben seinen Pass verloren oder zu Hause vergessen hat und das erst vor einem Beamten des Londoner Flughafens bemerkt, der ihm nicht erlaubt, das Land zu verlassen.
Auch an diesem Abend ist zum angekündigten Beginn des Konzerts um zwanzig Uhr natürlich nichts von Pete Doherty zu sehen. Immerhin, schon zwei Stunden später wird den Fans die freudige Botschaft überbracht, dass der Künstler gerade in London ein Flugzeug bestiegen habe und es eine «zwanzigprozentige Chance» gebe, «dass er tatsächlich auftritt». Kurz vor Mitternacht heißt es, er sei nun in Berlin, die Show werde um halb eins beginnen. Um halb zwei kommt er dann tatsächlich in einem seine Blässe besonders betonenden lilafarbenen Hemd auf die Bühne und beginnt begrüßungslos, auf der hohen E-Saite seiner Gitarre herumzuplinkern und Gesangsfetzen neben das Mikrophon zu nuscheln. Gelegentlich erkennt man Stücke von der ersten Babyshambles-LP, meist aber hat man nicht das Gefühl, dass der gebückt wankende Doherty weiß, was er da gerade tut; seine Mitmusiker wissen es mit Sicherheit nicht.
Was nichts daran ändert, dass sich das Publikum gut amüsiert – wenn auch nicht unbedingt besser als beim vorherigen Warten und der ausführlichen Erörterung der Frage, warum man so gerne in einem Biergarten vor einem Klub herumsitzt und auf ein Konzert wartet, von dem man weiß, dass es, wenn es überhaupt stattfindet, ein sehr schlechtes Konzert werden wird.
Zum letzten Mal habe ich Pete Doherty im Dezember 2009 in der Berliner Kulturbrauerei gesehen; inzwischen hatte er auch die Babyshambles aufgelöst und eine dritte Karriere unter seinem eigenen Namen begonnen. Der Auftritt war also gewissermaßen sein Berliner Solo-Debüt. Das Risiko eines Ausfalls schien diesmal gering; zumindest konnte ihn in London niemand an der Ausreise hindern, weil er sich schon seit ein paar Tagen in Deutschland befand. Bei einem Festival eines öffentlich-rechtlichen Radiosenders hatte er ein paar seiner Lieder gespielt und bei dieser Gelegenheit gleich noch einmal für einen kleineren Skandal gesorgt, weil er zwischen zwei Songs die erste Strophe des Deutschlandlieds intonierte; ihm sei dessen «kontroverse Natur nicht bewusst» gewesen, sagte er später.
In Berlin verzichtet er darauf, stattdessen betritt er die Bühne mit einer kleinen Deutschlandfahne, die er heftig schwenkt. Nachdem er sie auf den Gitarrenverstärker gestellt hat, muss er allerdings noch einmal von der Bühne herunter, weil er bei dem Versuch, die Gitarre in den Verstärker zu stöpseln, des Umstands gewahr wird, dass er die Gitarre vergessen hat. Inzwischen gibt es keinen Roadie mehr, der ihm bei seinen Auftritten hilft; zumindest keinen, der im Zentrum des Bühnengeschehens steht.
Zum allgemeinen Erstaunen lässt sich der Abend sehr gut an. Mit karger, punkig zerschrundener Virtuosität spielt er sich durch das Libertines-, Babyshambles- und Solo-Repertoire. Doch so hell kann das Genie gar nicht strahlen, dass der Freak darunter verschwände. Nicht nur wird Pete Doherty immer heiserer – schon nach zwanzig Minuten kriegt er kaum noch einen klaren Ton aus der Kehle –, er wird auch immer betrunkener. Auf einem Spirituosentisch am Rand der Bühne finden sich diverse Bier-, Wein- und Schnapssorten drapiert: ein Vorrat, aus dem Doherty sich unermüdlich bedient. Immer länger werden die Pausen zwischen den Stücken, immer blasser, verschwitzter und ungelenker bewegt der Musiker sich über die Bühne; und was man anfangs als kunstvoll löchriges Gitarrenspiel genossen hat, regrediert zusehends in stümperhaften Stuss.
«Warum bezahlt ihr dafür / mich in diesem Käfig zu sehen / den manche auch Bühne nennen», singt Doherty in dem Stück «Kilimangiro» – und für einen sonderbaren, schönen, aber auch schreckenerregenden Moment beginnt das Publikum umstandslos, die «ohho-ohao»- und «hoho-wao-wao»-Chöre im Refrain mitzusingen, während Doherty schweigend die begleitenden Akkorde greift. Was für eine seltsame Mischung aus der Zerrissenheit und Brüchigkeit, die sich auf der Bühne darbietet, und dem Versuch des Publikums, mit seinem Gesang so etwas wie Fülle zu stiften: so etwas wie Erlösung.
Der Versuch misslingt. Schon bald ist das Band zwischen Bühne und Saal gekappt. Immer heiserer und wunder wird Dohertys Stimme, was ihn nicht daran hindert, sich gegen Ende des Abends und vor dem Stück «Hooligans on E» eine Zigarette zu gönnen. Deren Wirkung ist buchstäblich umwerfend, sie holt ihn fast von den Füßen. Blicklos zittert er vor dem deutschlandbeflaggten Verstärker, als wisse er nicht mehr, wo er sich gerade befindet.
«Es gibt niemanden, der mich noch verehrt», heißt es im letzten Stück «Hired Gun», das Doherty im Duett mit dem Komponisten des Songs, Alan Wass, interpretiert, einem käsigen Bob-Dylan-Double mit strohigem Schopf. Beide haben im Jahr 2005 einige Tage gemeinsam im Gefängnis verbracht, wegen Erpressung und Diebstahl; im Frühjahr 2015 wird Wass an einer Überdosis Heroin sterben. An diesem Abend ist er mindestens ebenso betrunken und hinfällig wie Doherty und – zu diesem Zeitpunkt – große Teile des Publikums, das sich beim Hinausdrängen nach dem Ende des Auftritts mit einer alkoholschwangeren Aggressivität auf die Füße tritt, wie ich es selten bei einem Konzert erlebt habe. Die Rettung, auf die alle hofften, ist ausgeblieben, nun herrschen ganz die schlechten Schwingungen vor.
So endet an diesem Abend in der Berliner Kulturbrauerei die Geschichte des heroisch-männlichen Indierocks, wie wir ihn kennen und wie er die Popgeschichte so lange geprägt hat. Es ist kein Triumph, es ist ein bedenkenswerter, trauriger, bitterer Tag.
2. Grausame Frauen haben es leichter im Leben: Amy Winehouse, Adele und der Angriff der Vergangenheit auf die Gegenwart
Es gibt nach diesem Ende natürlich noch ein weiteres Ende. Wider Erwarten hat Pete Doherty seine Drogensucht bis zum Redaktionsschluss dieses Buchs überlebt und sich zehn Jahre nach der Auflösung der Libertines sogar wieder mit seinen ehemaligen Mitmusikern vereint. 2015 erschien ein neues Album mit dem Titel «Anthems For Doomed Youth» – aber es klingt weder hymnisch noch untergangsgeweiht oder jugendlich, sondern eher wie die postume Reise in eine verlorene Lebendigkeit, musealisierend, schwunglos und blass. Aus der «doomed youth» ist eine irgendwie weitermachende Zombiegruppe geworden, die zu ihren Konzerten nunmehr meist pünktlich erscheint, beim Publikum aber keine größere Aufmerksamkeit mehr erregt.
Aus der Position des beliebtesten Selbstzerstörers war Pete Doherty schon ein paar Jahre zuvor verdrängt worden, und zwar durch die ebenfalls aus London stammende Soul-Jazz-Sängerin Amy Winehouse. Diese habe ich erstmals im Jahr 2007 auf der Bühne gesehen; an einem dunklen Januarabend spielte sie ein sogenanntes Showcase-Konzert. Im kleinen Klub Kalkscheune in Berlin-Mitte trat Winehouse vor einem Grüppchen von Journalisten und Medienmultiplikatoren auf, die sich an Häppchen und Freigetränken bedienten. Sie war gerade dreiundzwanzig Jahre alt geworden und hatte ihr zweites Album «Back to Black» herausgebracht, das erste bei einem großen Tonträgerkonzern. Der wollte sie nun auch auf dem Kontinent und besonders in Deutschland ganz nach oben bringen.
Auf ihrem Debüt «Frank» hatte Winehouse 2003 in mäßig origineller Weise elektronische R-’n’-B-Rhythmen, Jazz-Arrangements und Soulgesang miteinander zu verbinden versucht und dabei ihre Liebe zu den großen Selbstzerstörerinnen des Jazz wie Billie Holiday bekundet. Im ersten Song des Albums, «Stronger Than Me», beschwert sie sich darüber, dass ihr Geliebter und die Männer von heute im Allgemeinen so verweichlichte Typen sind; sie hasse es, eine starke Frau sein zu müssen, viel lieber wäre sie selbst schwach. Zu Beginn ihrer Karriere posierte sie denn auch als schüchternes Mädchen aus der Vorstadt, dem es nur darum geht, schöne Lieder zu singen. Bei dem Konzert in der Kalkscheune sah das schon anders aus: Vor dem Erscheinen von «Back to Black» hatte ihr das Management einen kompletten Relaunch verpasst. Winehouse war nun von Kopf bis Fuß tätowiert, trug eine gewaltige Bienenkorbfrisur und sang mit schmutziger Soulstimme Lieder im Sixties-Retrostil.
So war sie vom Typus «Mädchen von nebenan» übergewechselt zum Typus «Jazzsängerin, die sich selbst zerstört» beziehungsweise zum Modell «Rockerbrautschlampe, mit der man Pferde stehlen und ordentlich mal einen heben kann». Im Booklet ihrer CD ließ die Plattenfirma sie bevorzugt mit gespreizten Beinen posieren; in den vor dem Showcase versandten Pressemitteilungen wurde breit schmunzelnd darauf verwiesen, dass Winehouse von mehreren Drogen abhängig ist und erst wenige Tage vor ihrem Berliner Konzert einmal