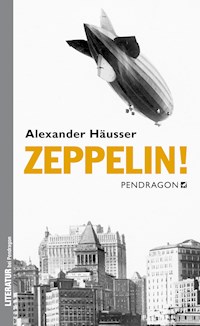Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: PendragonHörbuch-Herausgeber: PENDRAGON Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Spurensuche nach seinem Vater wird für Edvard zur Suche nach dem eigenen Glück. Er begibt sich auf eine Reise hoch in den Norden Norwegens. Es ist die Reise seines Lebens. Nach dem Tod seiner Mutter entdeckt Edvard ein Sparbuch auf seinen Namen. Ein kleines Vermögen hat sich angesammelt. Warum hat seine Mutter ihm das Sparbuch verschwiegen? Steckt vielleicht sein vor 50 Jahren verschwundener Vater dahinter? Jetzt will Edvard die Wahrheit wissen und eine erste Spur führt ihn zu einer Bank in Oslo. Auf der Überfahrt lernt er die junge Berliner Journalistin Alva kennen. Auch sie ist auf der Suche - nach sich selbst. Eine Reise durch Fjorde, Gebirge, einsame Hochebenen und magische Orte beginnt, die beide für immer verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Häusser • Noch alle Zeit
Alexander Häusser
Noch alle Zeit
Für Nico – auf seinem Weg.
Perfect memories fall down like ashes
From the fire we made alone
Everything we’re gonna say, we save it
See the black heels around the fire
Feel the night air and perfect darkness
Perfect darkness is all I can see.
Perfect darkness, Fink
Til J. – alltid.
Eins
EDVARD
Irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas in dem Raum hatte sich verändert. Edvard stand im Türrahmen und blickte in das Zimmer seiner Mutter. Der Bettgalgen ragte ihm entgegen, der Raum schien an seiner Triangel aufgehängt. Wie ein Gemälde, das seit Jahren seinen festen Platz im Haus hat. Ungezählte Male hatte er es gesehen. Im Morgenlicht, wenn er ihr den durchsichtigen Kaffee brachte. Im Mittagsschatten, wenn er auf dem Teller das Fleisch zerdrückte. In der Abendsonne, wenn er kleine Brotwürfel schnitt. Im Lampenschein las er ihr aus den Illustrierten von der Welt vor, weil sie nicht schlafen konnte. Und in der Dunkelheit hatte er ihre Hand gehalten, damit sie nicht alleine in die wirren Träume hatte gehen müssen.
Jetzt war sie nicht mehr da.
Aber sie war es nicht, die fehlte. Es lag nicht an dem kahlen Bett oder der jetzt leeren Vase auf der Kommode. Etwas anderes hatte sich verändert, doch Edvard konnte nicht sagen, was es war. Er hielt sein Erinnerungsbild dagegen – Original und Fälschung – wie in den Rätselheften seiner Mutter. Als sie noch gelebt hatte und es ihr besser gegangen war, hatte sie oft unten am Küchentisch gesessen. Er hatte ihr über die Schulter gesehen, während er das Geschirr abtrocknete, hatte gestaunt, wie schnell sie auf dem gefälschten Bild die Kringel machte. Mit dem Kugelschreiber um den fehlenden Schornstein auf dem Dach, um die kleine Lücke in der Krone eines Baumes.
Er erkannte die Unterschiede nicht. Als ob er automatisch ergänzte, was in der Fälschung fehlte und sie so zum Original machte. Vielleicht nahm er aber auch dem Original die Stellen weg und machte es so zur Fälschung. Wie lange war das her? Ein trockener Laubhaufen Zeit, längst im Hof verbrannt.
Edvard trat über die Schwelle, zwei Schritte waren es zum Bett. Vielleicht, wenn er ihre Perspektive hätte, wenn er sähe, was sie gesehen hatte, vielleicht könnte er dann die Veränderung entdecken. Er setzte sich an den Rand der Matratze. Er sah den Himmel im Fenster, die Bücherrücken und das Schmuckkästchen im Regal. Daneben an der Wand – der vergessene Kalender, der keine Monate mehr zählte, dort nur noch wegen der Motive hing. Bilder von Horizonten, vom Fluss und den Schafen auf dem Elbdeich direkt hinter dem Haus.
Für seine Mutter war das alles unerreichbar geworden, für seine Mutter hatte es nur noch diese vier Wände gegeben und die Erinnerung. Und mit einem Mal wusste Edvard, was da nicht stimmte. Er sah den dünnen Rand auf der Tapete, den Nagel, den er selbst eingeschlagen hatte, aber wo das Familienfoto gehangen hatte, war nur noch ein leeres Rechteck. Als wären die verblassten Bonbonfarben in das Tapetenmuster eingesickert und verschwunden, als wäre der Rahmen zu Staub geworden, weil er nichts mehr zu halten hatte. Die Runde um den Tisch im Hof. Seine Mutter, der Vater und er selbst, zehn Jahre alt, an seinem Geburtstag. Das letzte Foto der Familie. Edvard hatte es für sie umgehängt, von unten im Flur in ihr Zimmer, dem Bett gegenüber, damit sie es immer vor Augen hatte. Bis zum Schluss.
Warum hatte sie es abgehängt? Und wie? Sie hatte sich nicht mehr auf ihren dünnen Beinen halten können. Und sie hätte bestimmt auch nicht die Pflegerin darum gebeten. »Warum soll denn das schöne Foto weg?«, hätte die gefragt und ihm von der Bitte seiner Mutter erzählt.
Edvard suchte im Regal, griff in die Reihe Bücher, zwischen die Buchdeckel, unter die Zeitschriften. Irgendwo hier im Zimmer musste es geblieben sein. Die Schubladen der Kommode waren verkantet. Um sie zu öffnen, hätte ihre Kraft nicht ausgereicht. Wann hatte sie es abgehängt? Er öffnete den Schrank. Von all den Kleidern hatte sie keines mehr gebraucht. Aus ihrer feinen braunen Bluse strich er einen blassen süßlichen Geruch. Da hing ihr Leben vor der Krankheit und an einem Bügel das blaue Kostüm, unter der dünnen vergilbten Plastikfolie einer Reinigungsfirma im Ort, die es schon lange nicht mehr gab. An seinem Geburtstag vor mehr als fünfzig Jahren hatte sie es zuletzt getragen. Auf dem Foto, das sie nicht mehr hatte sehen wollen. Irgendwann würde er den Schrank ausräumen. Alles aus dem Schrank und der Kommode in Kartons packen und zu den Sachen seines Vaters stellen. In den blauen Schuppen, der vernagelt war.
Edvard durchsuchte die Wäschefächer, den Stapel aus Pullovern und Schals, und er dachte schon daran, den Schrank wieder zu schließen, als er ganz hinten in einer Lade die Ecke eines Holzrahmens ertastete. Doch es war nicht allein die gerahmte Fotografie, die er hervorzog. In den Klammern auf dem Rücken des Bildes steckte ein Sparbuch. Er nahm es heraus, blätterte es auf. Auf der ersten Seite stand sein Name. Er hatte nichts davon gewusst. Schwach in blassem Blau gestempelte Einträge. Er ging zum Fenster, hielt es ins Licht. Zeilen in dünner Tintenschrift dazwischen. Spalte für Spalte, Seite für Seite Zahlenkolonnen, Monat für Monat, über Jahrzehnte. Nur Einzahlungen. Ein kleines Vermögen.
Er konnte nicht begreifen, was er sah. Wie konnte sie so viel Geld gespart haben? Warum hatte sie ihm nichts davon gesagt? Wie sehr hätten sie das Geld gebraucht! Für die Heizung, die im letzten Winter nicht mehr angesprungen war. Und die maroden Fenster, die nur noch die Farbe zusammenhielt. Und als sie noch nicht krank war, hätten sie in Urlaub fahren können, in die Sonne. Weit weg von ihren traurigen Gedanken. Da wäre ihr Gesicht weich geworden und die Nerven warm. Aber sie hatte jeden Pfennig zweimal umgedreht. Schon als er noch zur Schule gegangen war. Weil ihnen nach Vaters Tod nur ihr Lohn von der Streichholzfabrik geblieben war. Die Pergament-Tüte voll abgezählter Scheine und Münzen, ausgeschüttet am Monatsanfang auf dem Küchentisch und in zwei leere Kaffeedosen gezählt: Haushalt und Besonderes. Und die Besondere füllte sich erst nach seiner Lehre in der Druckerei. Bleibuchstaben für neue Schindeln auf dem Dach und damit die Rohre wieder Rohre wurden und Überstunden, damit endlich sein Klavier gestimmt war. Die Zahlen bedeuteten ein anderes Leben.
Er starrte auf das Sparbuch. Woher kam das Geld? Edvard schoss das Blut in die Wangen. Als wäre er ertappt worden.
Wie an jenem Abend, als er kein Kind mehr war und statt zu schlafen, Tagebuch geschrieben hatte. Plötzlich hatte die Mutter in seinem Zimmer gestanden: »Was schreibst du da? Was schreibst du, das ich nicht wissen darf.«
Doch das Sparbuch war nicht sein Geheimnis, es war das Geheimnis seiner Mutter. Und es riss mit einem Mal sein Leben in zwei Teile, das eine vor, das andere nach seiner Entdeckung. Und als müssten sich sofort wieder beide Teile zusammenfügen suchte Edvard weiter – er wusste nicht wonach.
Er ging durchs Haus, als würde er es nicht kennen. Die Treppe hoch und hinunter, als wäre er vergesslich. Er zog den Kopf ein, als er sein Zimmer betrat, das immer sein Kinderzimmer geblieben war, das nie für ihn gewachsen war, das ihn ein Leben lang klein gehalten hatte und immer noch nach Klebstoff roch. Als hätte es seine ganze Kindheit eingesogen, um sie ihm später vorzuhalten. Sein beleidigtes, besserwisserisches Zimmer, das es Edvard nie verziehen hatte, erwachsen geworden zu sein. Es hatte sein Tagebuch für ihn versteckt und jetzt wurde ihm sein Geheimnis heimgezahlt. Edvard fand nichts, was das Geld erklären konnte.
Es war dreizehn Uhr, die Sparkasse hatte noch eine Stunde Mittagspause. Elsie würde beim Bäcker gegenüber stehen wie früher. Sie war die einzige, die etwas wissen konnte. Er würde noch eine halbe Stunde warten, es sollte nicht viel Zeit für Blicke bleiben. Er würde ihr nur das Sparbuch zeigen und fragen, ob sie etwas darüber sagen könne.
Edvard rasierte sich. Die Stoppeln klebten im Waschbecken neben den schwarzen Haarrissen in der Keramik. Auch das Bad hätte man mit dem Geld renovieren können.
Er bürstete seine Jacke aus, wischte die Schuhe blank, setzte sich auf den Klavierhocker, und während er darauf wartete, dass es Zeit wurde, zu gehen, strich er mit den Handflächen über die Hosenbeine, auf und ab. Wie es seine Mutter immer getan hatte, wie es nur die alten Leute taten, beim Arzt im Wartezimmer oder im Bus, wobei sie vogelgleich aus kleinen Augen ihre Umgebung musterten. Edvard wusste nicht mehr, wann es bei ihm selbst angefangen, wann er es bemerkt hatte. Die Zeit hatte an ihm Spuren hinterlassen, die ihm selbst verborgen blieben. Es waren nicht allein die Falten. Er hatte schon längst damit begonnen, alt zu handeln und zu denken. Er musste aufmerksam sein, misstrauisch, um etwas über sich zu erfahren, und versuchte verzweifelt, all die Marotten und Nachlässigkeiten, die er an sich entdeckte, abzulegen, das Sinnlose und Überflüssige abzuschneiden, wie die wuchernden Haare aus seiner Nase und den Ohren. Aber er war allein, und zu viel blieb von ihm unbemerkt. Einmal hatte er beim Einkaufen im Supermarkt zufällig einen eingetrockneten Fleck (war es Suppe?) auf seinem Pullover entdeckt und sich gefragt, wie lange er den Pulli schon so getragen hatte. Er schämte sich und begann, den Essensrest wegzukratzen. Und obwohl der Fleck bald nicht mehr zu sehen war, hörte er nicht auf, an der Stelle herum zu reiben bis er an der Kasse die Frielings, seine Nachbarn, von gegenüber traf. Seit vierzig Jahren waren sie miteinander verheiratet und Sophia Frieling zupfte im Gespräch beiläufig ein paar graue Haare vom Mantelkragen ihres Mannes. Edvard hatte es die Kehle zugeschnürt.
Viertel vor zwei verließ Edvard das Haus. Der sonnige Juni-Tag wusste nichts von seinen Gedanken. An der warmen Mauer stand sein Fahrrad angelehnt – wie immer. Edvard stieg auf, fuhr scheppernd über den mit Katzenköpfen gepflasterten Hof, am Schuppen vorbei, durch das Schattengeflecht der Buche auf den weißen Schotterweg, der zur Hauptstraße führte. Schon an der Ecke zur Andreas-Apotheke sah er gegen die Sonne Elsie an einem der Tischchen vor der Bäckerei stehen, er hätte ihre Silhouette unter tausenden erkannt. Je näher er kam, desto härter wurde sein Griff um den Lenker. Er legte sich die Worte zurecht, aber keines machte vergessen, dass er sie sah. In einem blauen Sommerkleid mit Puffärmeln, den Rücken durchgestreckt, das Gesicht in der Sonnenwärme, den Hals verdeckt durch ein Tuch. Ganz bei sich stand sie da, und er dachte noch, er sollte sofort anhalten und umdrehen. Doch Elsie drehte den Kopf in seine Richtung und erkannte ihn, und sie winkte ihm lachend zu. »Edvard!«
Ihr Gesicht strahlte, als er das Rad zu ihr auf den Gehweg schob. Es wäre zu viel gewesen, sich zu umarmen und zu wenig, sich einfach nur die Hand zu geben. So standen sie sich gegenüber. Das letzte Mal hatten sie sich bei der Trauerfeier gesehen, vor einer Woche. Da hatten sie sich auch so gegenüber gestanden, als alle Gäste gegangen waren.
»Wie schade, ich muss gleich wieder zur Arbeit. Wir hätten einen Kaffee trinken können.«
»Ja, schade«, sagte Edvard und zog schnell das Sparbuch aus seiner Jackentasche, »ich hab das in ihrem Schrank gefunden, sie hatte es vor mir versteckt.«
Er schob ihr das Sparbuch aufgeschlagen über den Tisch.
»Weißt du was darüber? Sie hat die Einzahlungen hier gemacht.«
Elsie beugte sich über den Tisch, las und blätterte, ohne das Sparbuch in die Hand zu nehmen. Edvard tippte auf eine Reihe blassblauer Unterschriften.
»Da hast du unterschrieben.«
Elsie kniff die Augen zu.
»Das ist fast vierzig Jahre her! Sieh dir mal das Datum an!«
»1980. In dem Jahr bist du nach Lübeck gegangen.«
Das hatte er nicht sagen wollen. Er sah sie nicht an, aber er spürte ihren Blick.
Die letzte Seite war nur zur Hälfte ausgefüllt. Elsie fuhr mit dem Finger die Zeile ab. Elsies klarlackierten Fingernägel, Elsies schmales Handgelenk. Ob sie es immer noch mit einem Tropfen Parfum über der Pulsader betupfte, mit der Vorstellung, das Blut würde im Fließen den Duft auf ihren ganzen Körper verteilen?
»So viel Geld. Und die aufgelaufenen Zinsen kommen auch noch dazu. Hier 1999 wurde in Euro umgerechnet. Das Sparbuch ist gültig, aber ich verstehe nicht woher – ich meine, ihr wart doch immer knapp.«
»Und damals hast du dich nicht gewundert, woher das Geld kommt? Habt ihr nicht darüber gesprochen?«
»Deine Mutter mochte mich nicht. Schon vergessen?«
Vergessen! Vergesslichkeit war nicht sein Problem.
»Du hättest mir von dem Geld erzählen können! Es wäre alles anders gekommen.«
Sie sahen sich an. Elsie zupfte an ihrem Halstuch. Sie hat immer geglaubt, sie habe keinen schönen Hals. Edvard fasste sich ans Handgelenk, weil er sich nicht mehr spürte.
»Das Geld hätte doch nichts geändert, Edvard.«
Er strich den Jackenärmel von seiner Uhr.
»Du musst jetzt gehen,« sagte er, ohne auf die Uhr zu sehen. »Kannst du herausfinden, wo das Geld herkam?«
»Wenn es von einer Überweisung stammte, vielleicht.« Elsie nahm das Sparbuch. »Aber die letzten Einzahlungen sind auch schon eine Weile her – ich weiß nicht, ob die Bank noch die Konto-Unterlagen von 2007 hat.«
»Versuch es. Ja?«
»Ich brauche deinen Erbschein. Ich darf das nicht ohne.«
»Das dauert mir zu lange. Bitte, Elsie.«
Immer noch sprach er ihren Namen sanft aus. Er konnte nicht anders.
Elsie nickte. »Soll ich dann bei dir vorbeikommen?«
»Ruf mich einfach an.«
Edvard drehte sich weg, und er saß schon auf dem Fahrrad, da blickte er noch einmal über die Schulter: »Wie geht es deinem Jungen?«
Er wartete keine Antwort ab und fuhr los, mit kurzem Atem, ohne sich noch einmal nach ihr umzudrehen. Edvard hatte Elsies Sohn noch nie gesehen, kannte nicht einmal seinen Namen. Er musste schon ein junger Mann sein. Sicher hatte er Ähnlichkeit mit ihr, hatte ihre Augen, ihre Ohren. Aber sicher glich er auch dem Anderen, hatte ihre Augen und seinen Mund.
Edvard würde sich bei Edeka eine Flasche Helbing und Zigaretten holen. Er hoffte nur, an der Kasse nicht den Frielings zu begegnen.
ALVA
Aus der prallgefüllten braunen Papiertüte lugte eine Lauchstange heraus. Alva beobachtete Jo, wie er aus dem Super Bruggsen kam, die Tüte in den Armen haltend als wäre sie eine Geliebte. Er kaufte leidenschaftlich gerne Lebensmittel ein, legte sogar Dosen und Plastikverpacktes mit Sorgfalt in den Einkaufswagen. Das war etwas, was man lieben könnte, dachte Alva. Sie hatte im Auto warten wollen.
Jo blieb neben dem Wagen stehen, sah zum Himmel und schüttelte den Kopf. Into the light, we fall into each other. Alva nahm die Knöpfe aus ihren Ohren, wischte die Musik vom Smartphone. Gleich würde er reden wollen.
»Vielleicht wird es bald regnen«, sagte er und lud die Tüte ein, »sollen wir nicht doch lieber zurückfahren? Es ist ein Stück bis Råbjerg Mile und bei Regen ist es dort nicht schön. Andererseits: das Wetter ändert sich hier ja dauernd und wenn es regnet, scheint auch bald wieder die Sonne.«
»Aber es regnet doch gar nicht«, sagte Alva.
»Aber falls es regnet, kann genauso schnell wieder die Sonne scheinen«, sagte er.
»So wie jetzt«, sagte sie.
Jo fuhr, er kannte sich aus. Alva wollte ihn nur ansehen und dabei Musik hören. Sie wollte sich mit ihm in ihren Kopf verkriechen. Seine schönen Hände am Lenkrad, sein schönes Profil vor dem blauen Fenster. Kleine krüppelige Fichten, die vorbeizogen, sein Blick in den Rückspiegel, schwarze Augen unter dichten dunklen Brauen.
Aber er wollte auch während der Fahrt reden.
»Die größte Wanderdüne! Bis zu vierzig Meter hoch. Dänemarks Sahara wird sie genannt. Du wirst es mögen, es ist ein magischer Ort.«
Er drehte kurz den Kopf zu ihr, als könne er sehen, ob sie ihm zuhörte, ob sie überhaupt noch da war.
»Na ja, kein richtiger. Nicht das, was du für dein Thema brauchen kannst, aber für mich. Ich gehe jedes Mal hin, wenn ich hier bin. Das ist wie ein gigantischer Akku. Man wird aufgeladen. Ich bin mir sicher, dass du das auch spürst.«
Wieder sah er sie an. Alva wusste, er konnte sich nicht sicher sein. Aber er wünschte es sich so sehr.
»Ganz bestimmt«, sagte sie.
Es war nicht gelogen, aber sie fühlte nichts. Sie streckte die Hand aus dem offenen Fenster, spielte mit den Fingern. Der Wind sollte sie mitnehmen, forttragen, sie wäre so gerne bei ihm, ohne bei ihm zu sein.
Jo lächelte.
»Du musst da dranbleiben, Alva. Es ist eine fantastische Idee: Eine Reise zu den magischen Orte der Welt. Sowas finden die Zuschauer toll.«
Er sei sich sicher, sie habe großes Potential. Sie müsse ihre Projekte nur ernsthafter verfolgen, müsse dranbleiben, sie sei zu flatterhaft. So etwas sagte man zu einer Zwanzigjährigen, nicht zu einer Frau von dreißig Jahren und mit kleiner Tochter. Schon gar nicht, wenn der Mann drei Jahre jünger war und neben der Wohnung in Berlin schon ein Ferienhaus in Dänemark besaß. Er hatte einen guten Start gehabt, kam aus einer wohlhabenden Familie. Alva wusste: Jo sagte nicht, dass er an sie glaube, weil er sie im Bett haben wollte, aber sie schlief mit ihm, weil er an sie glaubte. Und sie ahnte, wann immer er von »Festanstellung« beim Sender sprach, meinte er damit ein gemeinsames Leben. Ein ganz normales Leben. Jeder Trottel konnte das, warum nicht sie. Ihre Tochter würde er in Kauf nehmen. Er würde Lina womöglich richtig gern haben.
Auf dem Parkplatz war es still, nicht einmal das Meeresrauschen war zu hören. In den Hagebuttensträuchern knisterte Sand. Alva steckte sich wieder die Musik in die Ohren. Das Stück lief an derselben Stelle weiter, als wäre keine Zeit vergangen. Jo sah sie schulterzuckend an. Aber er lächelte, zeigte zum Sandweg, der steil nach oben in den Himmel führte. Sie gingen über Kiesel bis der Sand begann. Alva hakte sich bei ihm ein, um Halt zu haben und schlüpfte aus den Flipflops, hielt sie schlenkernd mit dem kleinen Finger an den Riemen. Zeit für Haut.
Sie grub die rotlackierten Zehen in den Weg, merkte die Steigung in den Knien, spürte auf der Stirn die Sonne und einen kühlen Hauch vom Meer. Heiß und kalt sah sie Jo an. Oben fuhr Wind unter sein T-Shirt, und der Weg versank unter ihr bis zu den Knöcheln. Wolkenschatten zogen über die Sandberge in die Täler hinein. Eine Wüste, in der Ferne Menschen als verlorene Striche. Sie nahm Jos Hand. Sie lief, sank, fiel im Steigen, stieg im Fall, sie war sich immer voraus. Sie lachte, ohne ihr Lachen zu hören. Der Sand war Sonne, die Sonne war Sand. Auf den Kämmen fegten ihr Böen Nadelstiche ins Gesicht. Alva ließ sich einfach fallen, riss Jo mit. Sie rollten in eine Mulde. Und Jo lag auf ihr, windstill. Wolken zogen über sie. Sie strich mit der Hand über seine Arme, stellte seine Härchen auf, Härchen in der Farbe des Hafers. Sie griff in seine Shorts, öffnete den Knopf. Er streifte sie hinunter, sie berührte seine Lippen, blickte gegen die Sonne, um geblendet zu werden, für die Zeit, die er brauchte, bis sie ihn auf ihrer Haut spüren konnte. We fall into the light, we fall into each other. Immer die gleiche Zeile, Haut auf Haut. Er griff nach den Kabeln ihrer Ohrhörer, aber sie schüttelte den Kopf, nahm seine Hände, legte sie auf ihre Brüste. An ihr Herz, wo die Musik war. Die Musik durfte nicht aufhören, das Lied musste immer weitergehen – in ihrem Kopf, während er in sie drang und erfüllte, was nicht zu erfüllen war. Sie schloss die Arme um ihn und der Himmel schaukelte, Wolken verdunkelten die Sonne. Schwere Regentropfen fielen in seine Haare, rannen in ihr Gesicht. Ihre Hände schwammen auf seinem nassen Rücken und ihr Kopf rauschte bei dem Gedanken, einen großen, wunderbaren Fisch in den Armen zu halten, sich von ihm hinaustragen zu lassen auf den Wellen, die durch ihren Körper liefen. Sie hatte Sex, sie hatte einfach Sex, aber Alva sah sich in einem Märchenbuch, einem Märchenbuch von Lina, in dem zärtliche Tiere mit Menschenstimmen sprechen. Verzaubert und Erinnerung für ein ganzes Leben. Sie bäumte sich auf, wollte mit ihm zurückfallen, doch er verwandelte sich zum Menschen, stützte sich mit den Händen in den Sand, löste sich aus ihrer Umarmung und sagte: »Es regnet, lass uns gehen.«
Später im Ferienhaus schloss sich Alva im Badezimmer ein. Den Sand wolle sie loswerden, sagte sie und hörte Jo an die Tür klopfen und lachen: »Aber vom Regen hast du ja nichts abbekommen, unter mir. Ich fange schon mal mit dem Kochen an. Beeil dich.«
»Ja! Ich dusche nur schnell.«
Der Duschstrahl schoss ins Leere. Alva hockte in der Ecke auf dem Boden, die Zehen an das Holz der Saunakabine gedrückt. Als Mädchen hatte sie sich oft ins Badezimmer eingeschlossen. Sie passte genau hinein. Sie hatte die Klospülung gedrückt und den Wasserhahn aufgedreht, damit es in den Ohren ihrer Mutter gluckerte und rauschte. »Ich weiß, dass du nicht auf der Toilette bist«, rief ihre Mutter, »Wenn du jetzt nicht rauskommst, gehe ich alleine mit deiner Schwester einkaufen.« Sollen sie doch gehen. »Ich gehe mit deiner Schwester einkaufen, deine Schwester mag das Essen, deine Schwester hat sich darüber gefreut« – sie sagte immer »deine Schwester«, als hätte ihre kleine Schwester keinen Namen. Und dabei hatte sie den schöneren. Aber Alva hatte sich längst den eigenen Namen gegeben, den keiner kannte außer ihr und Wiesel, dem kahl gestreichelten Stofftier, das sie im Arm hielt. Obwohl sie dafür schon zu alt war. Ihre jüngere Schwester jedenfalls brauchte kein Stofftier mehr.
»Komm, Mama, lass sie doch!«, hörte sie Emma vor der Tür sagen. Alva stand an dem kleinen Badezimmerfenster und sah in den Hinterhof hinunter. Ihre Mutter und ihre Schwester traten aus dem Haus, und obwohl sie und Wiesel in Deckung waren und nicht bemerkt werden konnten, winkte ihr Emma hinter dem Rücken der Mutter zu, ohne nach oben zu sehen, weil sie wusste, dass sie da stand. Und sie hüpfte blöde beim Gehen und nahm die Mutter bei der Hand. Die beiden blickten nicht zurück. Sie sahen nicht, dass Alva ihnen die Zunge herausstreckte, und als das Tor zum Hof ins Schloss fiel, sagte Wiesel: Sie sind weg, Alva, sie sind endlich weg. Jetzt gibt es nur noch uns.
Wiesel schnupperte aus dem Badezimmer, krabbelte ins Wohnzimmer, das ein Saal war, zum Sofa, das ein Thron war, auf dem schon Alva, die dunkle Feenkönigin wartete, die es vom Boden hob und neben sich in ein Kissen legte. Denn Wiesel war die Beraterin der Feenkönigin, die oft ein dunkles Herz hatte und Schrecken über die Menschen in ihrem Reich brachte. So stand es in ihrem Lieblingsbuch. Alva – Die Feenkönigin, die vor langer Zeit herrschte, in einem weit entfernten Land.
Nur Wiesel konnte Alva milde stimmen: Sie wissen es nicht besser. Du bist anders als die anderen. Wiesel durfte ihr die Wahrheit sagen, das hätte sie sonst keinem erlaubt. Es wusste mehr als sie. Über Stunden war Alva allein mit ihren Stimmen.
Der Abend zu zweit begann. Und weil sie sich schon eine Weile kannten, trug Alva ihre Jogginghose und das Kapuzenshirt. Auf dem Tisch brannte die blaue dänische Kerze, ein Blau wie der Himmel hinter vereistem Glas. Die Kerze passte zum Norden draußen und dem Kiefernholz drinnen und den blau gestreiften Vorhängen dazwischen und obwohl ein warmer Wind die Vorhänge bewegte, machte Jo nach dem Essen Feuer im Kamin und es hatte den roten Schein vom Rotwein und dem schmalen Streifen Sonne am Horizont. Jo setzte sich mit einem Buch auf die Couch, lächelte Alva an, klopfte mit der flachen Hand neben sich aufs Polster. Und natürlich verstand sie, dass es Ironie war. So wie er verstand, dass ihre beiden ausgestreckten Zeigefinger und die hochgezogenen Augenbrauen bedeuteten, er solle sich einen Moment gedulden, sie komme gleich zu ihm. Alles war schon wie ein ganzes Leben, und Alva dachte, dass nur noch Lina fehlte. Sie ging mit dem Telefon auf die Terrasse. Wenigstens Linas Stimme hören, fragen, wie es in der Kita gewesen war, was sie und Oma denn gerade machten. Es sei ja langsam Zeit, schlafen zu gehen und Zähneputzen nicht vergessen. Vielleicht würde Lina aber auch noch eine Geschichte hören wollen. Dann würde Alva von dem Zauberfisch erzählen, der die Menschenfrau gerettet, sie aus dem Meer auf den großen Sand getragen hatte. Jo würde sich gedulden müssen, aber er könnte das verstehen. Sie war eben eine Mutter, und es war doch schön, dass sie sich Zeit für ihre Tochter nahm.
Alva hatte die deutsche Vorwahl und die drei-null getippt, als sie innehielt, weil sie Lina schon fragen hörte, wann sie denn zurückkäme. Noch bevor sie einen Satz gesagt hätte, würde Lina wissen wollen, wie lange sie noch bei Oma wäre. Und Alva müsste wieder sagen, dass sie bald zurückkäme. Aber sie würde mit bald nicht das Wochenende meinen, auf das Lina wartete, das Wochenende, das doch immer ihnen gehörte, an dem sie nicht bei Oma oder ihrem Papa wäre, sondern bei ihr. Sie beide zusammen.
Sie müsse arbeiten, würde sie sagen, nein, nicht in Berlin, nicht in dem großen Haus, das sie ihr einmal gezeigt habe, ihre Arbeit sei eine Reise. Und dann würde sie blöden Kinderkram erzählen: »Ich fahre mit dem Schiff in ein Land, das Norwegen heißt. Da gibt es viele Märchen, von Trollen und Riesen, die kann ich dir dann erzählen.« Aber über das Felsenportal Kirkeporten, das Tor zur Unterwelt, dürfte sie nicht mit ihr sprechen, auch nicht vom Wald in Finnskogen, in dem Menschen einfach verschwinden, da bekäme sie Angst. Womöglich würde auch ihre Mama verschwinden. Aber wahrscheinlich wären Lina auch die Märchen egal. Entscheidend wäre allein: sie würde nicht da sein. An ihrem Wochenende wäre sie nicht da.
»Hast du sie nicht erreicht?«
Alva spürte Jos Hand auf ihrer Schulter. Sie schüttelte den Kopf und als ob er wüsste, dass sie an die bevorstehende Reise dachte, fragte er, warum sie denn eigentlich alleine fahren wolle.
»Wir könnten doch zusammen durch Norwegen tingeln und deine magischen Orte besuchen. Das wäre doch schön!«
Er war wie Lina. Alle, die liebten, waren wie Lina. Sie zerrten und wollten, dass man für sie da ist. Und sie glaubten, dass es einem genau so gehen müsste, sonst wär es keine Liebe. Da wirst du Lina aber ganz doll vermissen, wenn du so lange weg bis, hatte Mareike vergangenen Freitag noch zu ihr in der Kita gesagt und den Kopf schräg gelegt. Sie halte ja kaum die paar Stunden aus, die ihre kleine Charlotte in der Kita sei. Nicht wahr, Zwiebelchen, wir sind unzertrennlich, und dann ging Mama Mareike vor Charlotte auf die Knie und band ihr die Schuhe. Einer Fünfjährigen band sie die Schuhe, während Lina schon nach draußen vor die Tür gestürmt war und Alva keine Angst wegen des Verkehrs auf der Greifswalder hatte. Und sie hatte wieder die Stimme in ihrem Kopf gehört: Du bist anders als die anderen und sich die Knöpfe ins Ohr gesteckt, ohne Mareike und ihrem Zwiebelchen richtig tschüss gesagt zu haben.
»Also? Was hältst du davon?«, fragte Jo. »Wir würden unter der Mitternachtssonne kühlen Weißwein trinken und Fisch essen.« Alva legte den Kopf schief. »Und arbeiten! Natürlich auch arbeiten. Nein, wirklich, ich wäre dir bestimmt eine Hilfe.«
Alva wollte seine Hilfe nicht, wollte kein Essen zu zweit unter der Mitternachtssonne. Jo konnte doch nicht davon reden, dass sie ihre Projekte ernsthafter verfolgen müsste und dann von Weißwein und Fisch sprechen. Nein, es war allein ihre Idee gewesen und es sollte ihre Reise sein. Monatelang hatte sie das Material zusammengetragen, die Kosten bis auf den letzten Cent kalkuliert – preiswerte Hostels, Zugverbindungen, Busse und Fähren. Niemand von den Leuten in der Redaktion könnte sagen, Jo habe sie protegiert und ausgehalten. Er wäre schon wieder in Berlin, während sie durch Norwegen reiste. Alle würden sehen: sie geht ihrer Arbeit nach. Ohne Jo. Und sie würde bis zum Überdruss Brot und Käse essen, nur um alles aus eigener Tasche bezahlen zu können. Auch vom Stiefvater und ihrer Mutter hatte sie kein Geld genommen. Gerade von ihrer Mutter nicht.
»Ich muss das alleine machen, Jo.«
Er sagte, dass er das verstehe. Aber natürlich verstand er es nicht. Es sollte eben zu ihm gehören, alles zu verstehen. Er hatte tatsächlich einmal von sich gesagt, er sei ein »moderner Mann«. Mit ihm stimmt was nicht, hatte sie da gedacht.
»Na, wir haben ja noch Zeit bis du losmusst. Ich fahre dich dann zur Fähre und winke mit dem Taschentuch.«
Dann nahm er Alva an die Hand und zog sie zur Couch. Es war ganz still im Haus. Er hatte keine Musik, die ihm das Herz zerreißen konnte.
NACHT
Es war nicht mehr der alte graue Apparat von damals, mit Wählscheibe und dem verzwirbelten Spiralkabel, der auf dem Garderobenkästchen im Flur gestanden hatte. Schon lange war es ein schnurloses Tastentelefon. Überall konnte es liegen: auf dem Klavier im Wohnzimmer, das nie eines gewesen war oder auf der dritten Treppenstufe, die besonders schäbig aussah, weil Edvard unzählige Male auf ihr gestanden hatte, stehengeblieben war, um nach der Mutter zu horchen – im Glauben, ein Geräusch gehört zu haben, ein Stöhnen oder einen leisen Ruf.
Jetzt lag das Telefon auf dem Küchentisch, die halbleere Flasche Helbing stand daneben und ein Wasserglas. Vor dem Fenster versank der Hof langsam in Dunkelheit, der blaue Schuppen vergraute, und Edvard saß vor dem Telefon und wartete. Noch vor dem Klingelton würde das Display aufleuchten. Er würde Elsies Anruf sehen können, bevor er ihn hörte, als würde das silberne tote Ding zum Leben erweckt, als müsste es sich aufrichten und ihm entgegenspringen.
Damals war er es gewesen, der Elsie immer angerufen hatte. Ihr Klingeln hätte seine Mutter wecken können. Jeden Tag dankte er Gott, wenn Mama endlich Ruhe fand, nachdem sie die Arbeit im Büro überstanden hatte und die Stunden des restlichen Tages über ihren Rätselheften in der Küche saß. Oder im Haus herumgeisterte, aufräumte und dabei Unordnung machte, kochte, was ungenießbar war. Edvard konnte sich nicht vorstellen, dass sie in der Streichholzfabrik irgendetwas Sinnvolles zustande brachte. Wie sollte sie dort Akten führen und Briefe an Kunden schreiben können, wenn sie doch zuhause nicht imstande war, die einfachsten Aufgaben zu bewältigen. Sie war krank. Eine Krankheit, für die es keinen Namen gab. Er nannte sie Automatenkrankheit. Manchmal sprang sie an und funktionierte, als hätte man eine Münze eingeworfen. Und im Büro hatten sie wohl Kleingeld.
Edvard saß vor dem Telefon und in ihm zogen und zerrten die Erinnerungen. Wenn du vergessen willst, hatte seine Mutter einmal gesagt, dann geh mit dem Strom auf dem Deich entlang. Der Fluss nimmt alle Erinnerung mit und trägt sie fort. Geht man gegen den Strom, kommt alles zurück, und was längst vergessen schien, taucht plötzlich wieder auf. Und was ist, wenn man stehenbleibt, fragte Edvard. Dann bist du ein Schaf, hatte sie geantwortet. Seit ihrem Tod ging er immer gegen den Strom, gleichgültig welche Richtung er auch einschlug. Er dachte an Elsie und wusste nicht, ob es die Erinnerung an Sehnsucht oder die Sehnsucht selber war. Er dachte an ihren letzten gemeinsamen Abend. Die Mutter hatte, statt ins Bett zu gehen, lange vor dem Fernseher gesessen. Dabei mussten sie beide am nächsten Morgen früh zur Arbeit und wenig Schlaf machte alles noch viel schlimmer. Sie war dann wie im Fieber, aufgekratzt und ungeduldig, ohne zu wissen, was sie wollte. Als es oben endlich still geworden war und Edvard endlich nach dem Hörer greifen konnte, war es schon fast elf gewesen. Elsie ging sofort ans Telefon.
»Kommst du noch?«, flüsterte er im Flur. »Kommst du noch, bitte.« Er drückte den Hörer ans Ohr, hörte Elsie atmen.
»Ja.«
»Bleibst du die Nacht bei mir?«
»Ich weiß nicht. Ich muss ja morgen arbeiten.«
»Ich doch auch. Ich warte draußen.«
Er ging aus dem Haus und schloss leise die Tür.
Sie war anders an jenem Abend. Aber er spürte ihre Hand und zog sie fort. Der Himmel lag ohne Schimmer im Fluss. Elsies Gesicht, ihr Körper, waren nur schwarze Fetzen in der Dunkelheit. Aber Edvard spürte ihre Wärme, die Regentropfen auf der Haut, das weiche Gras unter seinen Schritten bis zu den Kieseln auf dem Weg. Es zog in den Beinen, als der Weg von der Deichkrone nach unten führte. Zu dem stillen Haus, in dem nur das Licht im Flur brannte. Doch sie wussten beide, ihnen blieb nur der Schuppen. Die Mutter würde nach ihm rufen, sobald er die Haustür öffnete. Sie stünde oben an der Treppe, sähe voller Furcht hinunter und würde wieder alles durcheinander bringen: die Nacht und die Vergangenheit. Und er müsste ihr erklären, was sie nicht begreifen wollte, dass er ein eigenes Leben wollte.
Leise gingen sie Hand in Hand am Haus vorbei, blickten hinauf zu ihrem Schlafzimmer, hofften, dass das Fenster dunkel blieb. Sie überquerten den Hof, verschwanden hinter dem Schuppen.
»Ich gehe zuerst hinein und sehe nach den Fallen, ja?«
Er wollte ihr den Anblick ersparen. Elsie würde ohnedies wie immer kein Auge zutun, ganz egal, ob in den Fallen Mäuse wären oder nicht. Sie läge mit offenen Augen neben ihm auf der Matratze und er dürfte nicht aufhören, sie zu streicheln. Edvard hatte nie verstanden, wovor sie sich bei diesen kleinen Tieren fürchtete, aber seine Angst vor der Dunkelheit und ihre vor den Mäusen schweißte sie zusammen. Sie würden sich im Schein der Petroleumlampe lieben, von Dunkelheit und dem Rascheln der Mäuse umgeben. Sie würden sich wie verwandelt in die Augen sehen, und ihre Küsse würden den Brief versiegeln. Den Brief an eine Zukunft mit geteilter Angst. So sollte es sein. So würde es doch sein, bestimmt.
Auf der vom Haus abgewandten Seite löste Edvard drei Latten von der Bretterwand, schlüpfte durch den engen Spalt in den Schuppen hinein. Er zündete die Petroleumlampe an. Die Fallen waren leer. Aber auf den alten ausgelegten Teppichen lag Mäusekot.
»Alles klar – komm rein«, flüsterte er nach draußen und drehte den Docht der Lampe weit nach oben, damit sie auch sehen konnte, dass es keine Mäuse gab. Er breitete auf der Matratze eine saubere Decke aus, die er in Folie verpackt immer für sie bereit hielt, doch Elsie setzte sich in den alten Korbsessel, der zwischen vollgestellten Regalen vor der zugenagelten Tür stand. Von einem Scharnier zum anderen spannten sich dicke Spinnfäden wie Saiten auf einem Instrument. Elsie griff nach dem zerschlissenen Buch mit den aufgedunsenen Seiten, das neben der Lampe lag. Das Buch blätterte sich in Elsies Hand von alleine auf, an der Stelle, wo ihm der Rücken gebrochen worden war. Edvard kannte die Stelle auswendig: »Geliebter! Es ist merkwürdig, zu denken, dass ich nichts anderes ausgerichtet habe, als auf die Welt zu kommen und Sie zu lieben, und jetzt vom Leben Abschied zu nehmen. Glauben Sie mir, es ist sonderbar, hier zu liegen und auf Tag und Stunde zu warten. Geliebter, Sie sollten wissen, wie ich Sie geliebt habe. Jetzt da ich sterben soll und es für alles zu spät ist, schreibe ich Ihnen noch einmal und sage es Ihnen.«
Stolz sah er Elsie an. »Das ist schön, nicht wahr? Ein schönes Buch. Auch so sorgfältig gesetzt. So was machen wir in der Druckerei gar nicht mehr. Elsie?«
Sie blickte auf und er sah im Lichtschein ihre Wangen glänzen. Er dachte, sie seien noch regenfeucht. Aber dann hörte er ihre Stimme.
»Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht.«
Edvard stieg stolpernd über die Matratze, zwängte sich an den Regalen vorbei. Es war so eng im Schuppen, so schrecklich eng. Er kniete sich vor den Sessel und versuchte eine Umarmung.
»Ich kann Mutter nicht alleine lassen, das weißt du doch. Aber sie wird mich irgendwann nicht mehr brauchen, der Apotheker sagt, das wird schon.«
»Nichts wird schon. Nach so vielen Jahren wird man nicht einfach wieder normal. Seit wir zusammen sind, ist es nicht besser geworden. Es wird ja eher schlimmer. Es können sich auch andere um sie kümmern. Nicht nur du allein.«
»Aber sie braucht doch mich.«
Elsie wollte nicht umarmt werden. Er spürte, sie wollte aufstehen, die Arme ausbreiten, sie wollte große Schritte machen, sie wollte sich von ihm entfernen, auf ihn zugehen können. Es war so eng hier, so schrecklich eng.
»Ich hasse diesen Schuppen!«
Sie schrie und Edvard fuhr zusammen, dachte an seine Mutter, die vom Bett aufgeschreckt, das Licht anknipste, immer noch in ihren wirren Träumen wäre und nicht wüsste wohin. Und er müsste zu ihr gehen, Elsie hier alleine lassen, aber sie bliebe nicht. Heute würde sie nicht bleiben, heute würde sie nicht warten. Es war anders als sonst. Elsies Gesicht sah aus wie der Fetzen in der Nacht.
»Elsie, leise, bitte.«
»Nein! Ich hasse diesen Schuppen! Ich wünschte …«
Elsie sprang auf, stürzte zur Matratze, sie wollte nach der Petroleumlampe greifen, doch Edvard warf das Buch nach ihr und traf sie am Kopf. Ein Schrei, sie fasste sich an die Stirn, sank auf die Matratze, und Edvard sah, wie sie sich schüttelte, geschüttelt wurde, sich ihr Rücken hob und wieder senkte, ohne einen Laut.
»Entschuldige, Elsie, das wollte ich nicht.«