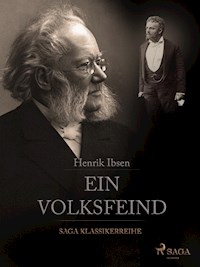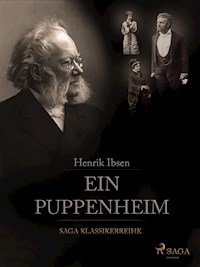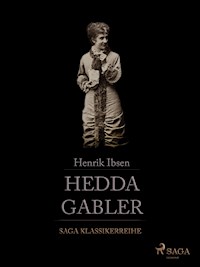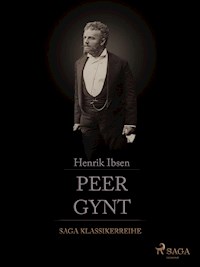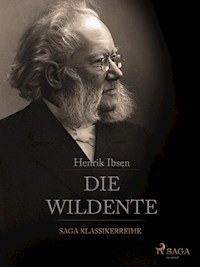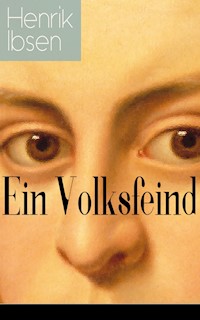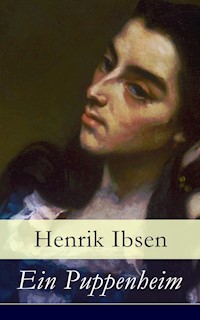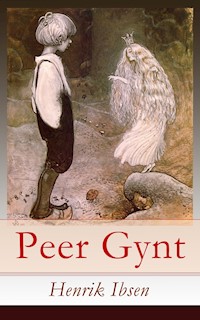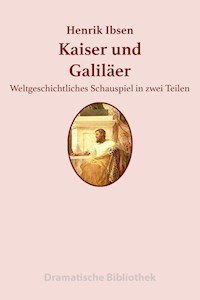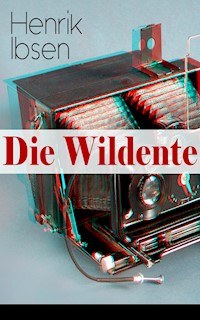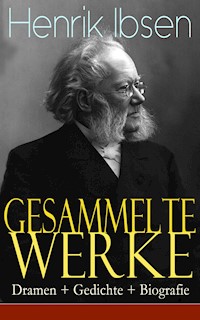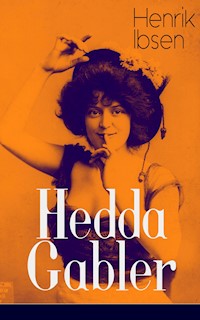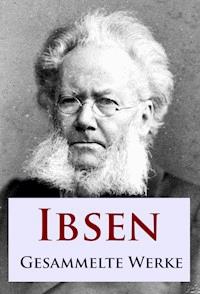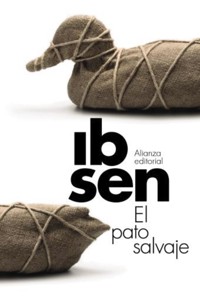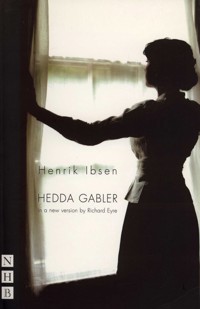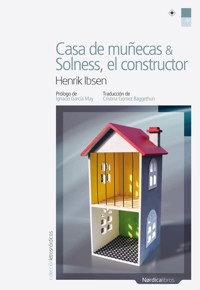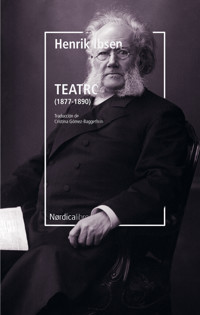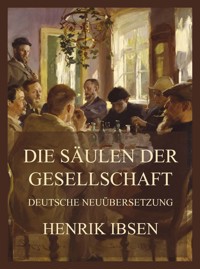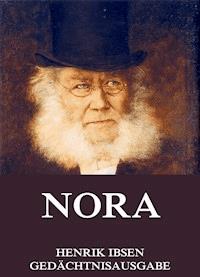
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Nora oder Ein Puppenheim ist ein Theaterstück von Henrik Ibsen. Der Titel beschreibt die Starre und Eingeschlossenheit, aus der die Protagonistin Nora am Ende ausbricht. Sowohl ihr Vater als auch ihr Mann Torvald behandeln sie, den zeitgenössischen gesellschaftlichen Konventionen entsprechend, als einen Besitz, der ihnen zwar kostbar ist, dem sie aber kein Eigenleben zubilligen. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nora
Oder Ein Puppenheim
Henrik Ibsen
Inhalt:
Henrik Ibsen – Biografie und Bibliografie
Nora
Personen.
Erster Akt.
Zweiter Akt.
Dritter Akt.
Nora, H. Ibsen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849626167
www.jazzybee-verlag.de
Henrik Ibsen – Biografie und Bibliografie
Henrik Ibsen, der größte Dramatiker Norwegens und einer der gewaltigsten Geister der neuern Zeit, geb. 20. März 1828 zu Skien in Norwegen, war der älteste Sohn eines erst wohlhabenden Kaufmanns dänischer Abstammung. Nach dem Konkurs seines Vaters verfloß seine früheste Jugend in beschränkten Verhältnissen. In Skien erhielt er eine notdürftige Schulbildung und kam, 15 Jahre alt, als Apothekerlehrling nach Grimstad. Hier entstanden seine ersten dichterischen Versuche, Spottverse, die den Schrecken der Stadtbewohner bildeten, mondscheintrunkene Lyrik, die von den Damen des Ortes fleißig gelesen und gesammelt wurde, und vor allem der »Catilina« (1850, neue Ausg. 1875), ein Drama, in dem sich der Sturm der Zeit und der brausenden Jugendkraft des Dichters entlädt. 1850 siedelte I. nach Christiania über, ging in Heltbergs »Presse« und bestand bereits nach fünf Monaten das medizinische Vorexamen. Dabei fand er Zeit, das kleine, unselbständige Drama »Das Hünengrab« (»Kjœmpehøien«) zu schreiben. Außerdem gab er damals zusammen mit Botten-Hansen und Vinje ein politisch-satirisches Wochenblatt (»Manden«, gewöhnlich »Audhrimer« genannt) heraus, das indessen schon nach neun Monaten wieder einging. Aber man war auf den jungen I. aufmerksam geworden: im November 1851 berief ihn Ole Bull an das norwegische Nationaltheater in Bergen, wo er nun bis 1857 als Regisseur und Theaterdichter wirkte. Alljährlich zum 2. Januar, dem Gründungstag des Hauses, lieferte er ein Stück, und entrichtete in diesen Werken der nationalen Romantik seinen Tribut. Es entstanden: »Die Johannisnacht« (1853; ungedruckt), »Die Herrin von Östrot« (»Fru Inger ti! Östraat«, 1854; gedruckt 1857, neue Ausg. 1874), »Das Fest auf Solhaug« (»Gildet paa Solhaug«, 1855) und »Olaf Liljekrans« (1856; erstmalig gedruckt in Ibsens »Sämtlichen Werken«, Bd. 2, Berl. 1898). Im I. 1857 siedelte I. als artistischer Direktor an das Norwegische Theater in Christiania über, im folgenden Jahr vermählte er sich mit Susanna Daae Thoresen aus Bergen. Sein Aufenthalt in Christiania dauerte bis 1864, und es entstanden in dieser Zeit: »Die Helden auf Helgoland « (»Nordische Heerfahrt«, »Hærmændene paa Helgeland«, 1858), unter dem Eindruck der isländischen Familiengeschichten, besonders der »Völsungasaga«, bei aller Gewalt der darin ausgedrückten Stimmungen ein Meisterwerk klarer dramatischer Technik; »Die Komödie der Liebe« (»Kjælighedens Komedie«, 1862), eine scharfe Satire gegen die landesüblichen Auffassungen von Ehe und Liebe, das einen Sturm der Entrüstung entfesselte-die Spießbürger fühlten sich in ihren heiligsten Gefühlen verletzt- und »Die Kronprätendenten« (»Kongsæmnerne«, eigentlich: »das Holz, aus dem Könige geschnitzt werden«, 1863), Ibsens erste große Dichtertat, durch die er verkündet, »daß stets der. Königsgedanke' einer neuen Zeit siegt, und daß da keine Hoffnung ist für die, die nur das Vergangene, schon Dagewesene wiederholen können« (Woerner, »Henrik I.«). Gekränkt durch den Unverstand des Publikums und der Kritik und aufs höchste erbittert über das Verhalten Norwegens in dem dänisch-preußischen Konflikt, verließ I. im April 1864 Christiania und reiste über Berlin nach Rom. Er wurde heimatfrei. Die Weltgeschichte berührte ihn. Die Keime zu einem Drama über das untergehende römische Kaiserreich fallen in seine Brust. Zunächst aber befreit er sich von den Lebenseindrücken, die er aus Skandinavien mitbrachte, durch zwei gewaltige, im höchsten Sinne kritische Versdramen: »Brand« (1866) und dessen Gegenstück »Peer Gynt« (1867). In beiden Werken werden die Gebresten des norwegischen Volkes gegeißelt, nur wird, wie Brandes sagt, im »Brand« norwegische Schlaffheit wenigstens von einer norwegischen Idealgestalt abgeurteilt, während im »Peer Gynt« der Held als der typische Vertreter norwegischer Willensschwäche und Phantasterei angelegt und gestaltet ist. Auch ein unausgesprochener Protest gegen die Idealisierung norwegischer Bauerngestalten, wie sie um diese Zeit Björnson vornahm, läßt sich in beiden Dichtungen nicht verkennen. 1868 verließ I. Rom und ging nach Dresden, wo er zunächst das Lustspiel »Der Bund der Jugend« (»DeUnges Forbund«, gedruckt 1869), in mancher Beziehung ein Hinweis auf die Gesellschaftskritik seiner spätern Werke, ausführte. Erst unter dem Einfluß der großen Zeit, die das Deutsche Reich entstehen sah, konnte er das welthistorische Schauspiel in zwei Teilen, »Kaiser und Galiläer« (»Keiser og Galilæer«) im Frühling 1873 abschließen; es schildert den Kampf der Antike mit dem Christentum, den Untergang Julians des Apostaten, und ist »das Fundament dessen, was I später geschaffen hat, wodurch er eigentlich erst er selbst geworden ist« (Schlenther), ein historisches Schauspiel, das vieles von dem Ideengehalt seiner Gegenwartswerke einschließt, deutet und ergänzt. Erst jetzt läßt I. die Scholle tief unter sich. Er wird trotz des Heimatsduftes, den seine Werke nie abstreifen, und ohne den sie in ihren letzten Gründen unverständlich bleiben, der Bahnbrecher einer neuen dramatischen Kunst, einer neuen Zeit. Der Dichter schlug sein Hauptquartier seit 1875 abwechselnd in München und in Rom auf, besuchte aber auch Skandinavien, wo man ihn wie einen Triumphator empfing. Seit 1892 wohnt er in Christiania. Es erschienen: »Die Stützen der Gesellschaft« (»Samfundets Stotter«, 1877), »Ein Puppenheim« (»Et Dukkehjem«, 1879), »Gespenster« (»Gjengangere«, 1881), »Ein Volksfeind« (»En Folkefiende«, 1882), »Die Wildente« (»Vildanden«, 1884), »Rosmersholm« (1886), »Die Frau vom Meer« (»Fruen fra Havet«, 1888), »Hedda Gabler« (1890), »Baumeister Solneß« (»Bygmester Solness«, 1892), »Klein Eyolf« (»Lille Eyolf«, 1894), »John Gabriel Borkmann« (1896) und der dramatische Epilog »Wenn wir Toten erwachen« (»Når vi Døde vågner«, 1899). Gemeinsam ist diesen Werken, daß sie soziale und menschliche Verhältnisse der Gegenwart behandeln. Problem- oder gar Tendenzdichtungen sind sie nicht. Der Ausgangspunkt liegt immer in der Anschauung menschlicher Charaktere, bedeutender Geschicke. Aber die Liebe und der Haß, die den Dichter erfüllen, veranlassen Auseinandersetzungen, die Kritik alter Anschauungen, die Prägung neuer Werte. Die Grundstimmung ist ein großartiger Optimismus, ein unerschütterlicher Glaube an »das dritte Reich«, in dem »der Geist der Wahrheit und der Geist der Freiheit« herrschen werden. Als Techniker des Dramas greift I. auf die Tradition der Griechen zurück. Er gibt fünfte Akte, in denen sich mit unvergleichlicher Folgerichtigkeit lange Lebensschicksale entschleiern und lösen. Zu erwähnen sind noch Ibsens »Gedichte« (zuerst 1871, dann in vermehrter Auflage 1875). Ibsens »Sämtliche Werke« erschienen in einer kritischen deutschen Ausgabe mit guten Einleitungen von Brandes und Schlenther (Berl. 1898–1903, 9 Bde.), dazu als Bd. 10 eine Auswahl aus Ibsens Briefen, hrsg. von I. Elias und H. Koht (das. 1904). Vgl. G. Brandes, Björnson und I. (Kopenh. 1881) und Henrik I. (das. 1898); H. Jäger, Henrik I. 1828–1888 (1888; deutsch von Zschalig, 2. Aufl., Dresd. 1898); R. Woerner, Henrik I. (Münch. 1900, Bd. 1); Lothar, Henrik I. (2. Aufl., Leipz. 1902); E. Reich, H. Ibsens Dramen. 20 Vorlesungen, gehalten an der Universität Wien (4. Aufl., Dresd. 1902); B. Litzmann, Ibsens Dramen (Hamb. 1901.
Nora
Personen.
Helmer, Advokat
Nora, seine Frau
Doktor Rank
Frau Linde
Krogstad, Anwalt
Die drei kleinen Kinder Helmers
Anne-Marie, Kinderfrau bei Helmers
Ein Hausmädchenbei Helmers
Ein Dienstmann
Das Stück spielt in Helmers Wohnung.
Erster Akt.
Ein gemütlich und geschmackvoll, aber nicht luxuriös eingerichtetes Zimmer. Rechts im Hintergrund führt eine Tür in das Vorzimmer; eine zweite Tür links im Hintergrund führt in Helmers Arbeitszimmer. Zwischen diesen beiden Türen ein Pianino. Links in der Mitte der Wand eine Tür und weiter nach vorn ein Fenster. Nahe am Fenster ein runder Tisch mit Lehnstühlen und einem kleinen Sofa. Rechts an der Seitenwand weiter zurück eine Tür und an derselben Wand weiter nach vorn ein Kachelofen, vor dem ein paar Lehnstühle und ein Schaukelstuhl stehen. Zwischen Ofen und Seitentür ein kleiner Tisch. An den Wänden Kupferstiche. Eine Etagere mit Porzellan und anderen künstlerischen Nippessachen; ein kleiner Bücherschrank mit Büchern in Prachteinbänden; Teppich durchs ganze Zimmer. Im Ofen ein Feuer. Wintertag.
Im Vorzimmer klingelt es; gleich darauf hört man, wie geöffnet wird. Nora tritt vergnügt trällernd ins Zimmer; sie hat den Hut auf und den Mantel an und trägt eine Menge Pakete, die sie rechts auf den Tisch niederlegt. Sie läßt die Tür zum Vorzimmer hinter sich offen, und man gewahrt draußen einen Dienstmann, der einen Tannenbaum und einen Korb trägt; er übergibt beides dem Hausmädchen, das ihnen geöffnet hat.
NORA. Tu den Tannenbaum gut weg, Helene. Die Kinder dürfen ihn jedenfalls erst heut abend sehen, wenn er geputzt ist. Zum Dienstmann, indem sie ihr Portemonnaie hervorzieht. Wieviel –?
DIENSTMANN. Fünfzig Öre.
NORA. Da ist eine Krone. Nein – behalten Sie den Rest. Der Dienstmann dankt und geht. Nora schließt die Tür. Sie lacht noch immer stillvergnügt vor sich hin, während sie den Hut und Mantel ablegt. Sie zieht eine Tüte mit Makronen aus der Tasche und ißt ein paar; dann geht sie vorsichtig an die Tür ihres Mannes und lauscht. Ja, er ist zu Hause. Trällert wieder leise vor sich hin, indem sie rechts an den Tisch tritt.
HELMER in seinem Zimmer. Zwitschert da draußen die Lerche?
NORA während sie einige Pakete öffnet. Ja, das tut sie!
HELMER. Poltert da das Eichhörnchen herum?
NORA. Ja!
HELMER. Wann ist das Eichhörnchen nach Hause gekommen?
NORA. Diesen Augenblick. Steckt die Makronentüte in die Tasche und wischt sich den Mund ab. Komm, Torvald, und sieh Dir mal meine Einkäufe an.
HELMER. Nicht stören! Bald darauf öffnet er die Tür und sieht herein, mit der Feder in der Hand. Einkäufe, sagst Du? Diese vielen Sachen? Ist das lockere Zeisiglein wieder ausgewesen und hat Geld verschwendet?
NORA. Aber Torvald, dies Jahr dürfen wir doch wirklich ein bißchen über die Stränge schlagen. Sind es doch die ersten Weihnachten, wo wir nicht zu sparen brauchen.
HELMER. Hör' mal, Du, Luxus dürfen wir auch nicht treiben.
NORA. Doch, Torvald, wir dürfen jetzt schon ein bißchen Luxus treiben. Nicht wahr? Nur ein ganz, ganz klein bißchen. Du bekommst ja nun ein großes Gehalt und wirst viel, viel Geld verdienen.
HELMER. Ja, von Neujahr ab. Aber dann vergeht noch ein ganzes Quartal, bis das Gehalt fällig ist.
NORA. Bah! Bis dahin können wir ja borgen.
HELMER. Nora! Geht hin zu ihr und zupft sie scherzhaft am Ohr. Geht schon wieder der Leichtsinn mit Dir durch? Gesetzt den Fall, ich borgte ihr heute tausend Kronen, und Du brächtest sie in der Weihnachtswoche durch, und am Sylvesterabend fiele mir ein Ziegelstein auf den Kopf, und ich läge da –
NORA hält ihm den Mund zu. Pfui, laß die garstigen Reden!
HELMER. Ja, nimm mal an, daß so was passierte, – was dann?
NORA. Wenn so was Gräßliches passierte, dann wär' es mir ganz gleichgültig, ob ich Schulden hätte oder nicht.
HELMER. Und die Leute, von denen ich das Geld geliehen hätte?
NORA. Die? Wen gingen die was an? Das sind ja Fremde.
HELMER. Nora, Nora, Du bist ein Weib! Aber im Ernst, Nora: Du weißt, wie ich in diesem Punkt denke. Keine Schulden! Niemals borgen! Es kommt etwas Unfreies und damit auch etwas Unschönes über ein Hauswesen, das auf eine Borgwirtschaft gegründet ist. Bis auf den heutigen Tag haben wir beide tapfer ausgehalten, und das wollen wir nun auch noch die kurze Zeit tun, wo es nötig ist.
NORA geht zum Ofen hin. Na ja; wie Du willst, Torvald.
HELMER geht hinter ihr her. Ei, nun darf aber die kleine Lerche auch nicht die Flügel hängen lassen. Wie? Das Eichhörnchen steht und mault? – Zieht das Portemonnaie. Nora, was mag ich da wohl haben?
NORA wendet sich schnell um. Geld!
HELMER. Da nimm! Gibt ihr einige Banknoten. Du lieber Gott, ich weiß, daß zu Weihnachten im Hause eine ganze Menge draufgeht.
NORA zählt. Zehn, – zwanzig, – dreißig, – vierzig. Schönen Dank, Torvald, schönen Dank; damit behelfe ich mich lange.
HELMER. Ja, das mußt Du aber auch!
NORA. Ja, ja, das werde ich schon. Aber nun komm und laß Dir alle meine Einkäufe zeigen. Und so wohlfeile Einkäufe. Schau her, – ein neuer Anzug für Ivar – und dazu ein Säbel. Hier ist ein Pferd und eine Trompete für Bob, und da eine Puppe und Puppenwiege für Emmy. Es ist freilich recht einfach, aber sie macht doch immer gleich alles entzwei. Und hier Kleiderstoff, und Taschentücher für die Mädchen. Mutter Anne-Marie müßte eigentlich viel mehr haben!
HELMER. Und was ist in dem Paket da?
NORA schreit. Weg, Torvald! Das bekommst Du erst am Abend zu sehen!
HELMER. Ach so! – Aber nun sag' mir, Du kleiner Verschwender, womit hast Du denn Dich selbst bedacht?
NORA. Ach geh, – ich mich? Ich wüßte wirklich nicht, was –
HELMER. Du sollst aber! Nenne mir etwas Vernünftiges, was Dir ganz besondere, Freude machen würde.
NORA. Ich wüßte wirklich nichts. – Doch, Torvald, hör' –
HELMER. Na?
NORA spielt an seinen Knöpfen, ohne ihn anzusehen. Wenn Du mir ein Geschenk machen willst, so könntest Du ja –; Du könntest –
HELMER. Na also – heraus damit!
NORA hastig. Du könntest mir Geld schenken, Torvald. So viel nur, wie Du meinst entbehren zu können. Ich kann mir dann gelegentlich später etwas dafür kaufen.
HELMER. Aber Nora, –
NORA. Ach ja, tu's, lieber Torvald, ich bitte Dich recht sehr; ich wickle mir dann das Geld in schönes Goldpapier ein und hänge es an den Weihnachtsbaum. Wäre das nicht reizend?
HELMER. Wie nennt man doch die Vögel, die alles Geld durchbringen?
NORA. Ja, ja, lockere Zeisige, – ich weiß schon. Aber wir wollen es so machen, wie ich sage, Torvald: dann habe ich Zeit zu überlegen, was ich am notwendigsten brauche. Ist das nicht sehr vernünftig, Torvald, wie?
HELMER lächelnd. Ei freilich –, das heißt, wenn Du das Geld, das ich Dir gebe, wirklich festhalten und Dir selbst etwas dafür kaufen könntest. So aber geht es im Haushalt und für allerhand unnütze Dinge drauf, und dann muß ich wieder herausrücken.
NORA. I bewahre, Torvald –
HELMER. Läßt sich nicht leugnen, meine kleine liebe Nora! Legt den Arm um ihre Taille. Mein lockerer Zeisig ist entzückend, aber er braucht eine schwere Menge Geld. Man sollte es nicht glauben, wie hoch einem Mann solch ein Vögelchen zu stehen kommt.
NORA. Aber nein! Wie kannst Du nur so was sagen? – Ich spare doch wirklich, wo ich kann.
HELMER lacht. Ein wahres Wort! Wo Du kannst. Aber Du kannst absolut nicht.
NORA trällert und lächelt stillvergnügt. Hm! Du solltest nur wissen, wie viele Ausgaben wir Lerchen und Eichhörnchen haben, Torvald.
HELMER. Du bist ein sonderbares Dingchen. Ganz wie Dein Vater. Auf jede Art bemühst Du Dich, Geld in die Hand zu kriegen, und sobald Du es hast, verschwindet Dir's zwischen den Fingern; Du weißt nie, wo es geblieben ist. Na, aber man muß Dich nehmen, wie Du bist. Das liegt im Blut. Ja, ja, ja, Nora, so was vererbt sich.
NORA. Nun, ich wünschte, ich hätte viele von Papas Eigenschaften geerbt.
HELMER. Und ich möchte Dich gar nicht anders haben, als Du bist, meine liebe, kleine, singende Lerche. Doch – da fällt mir etwas ein. Du siehst heute so –, so, – wie soll ich gleich sagen? – so verdächtig aus –
NORA. Ich?
HELMER. Allerdings. Sieh mir mal gerade in die Augen.
NORA sieht ihn an. Na?
HELMER droht mit dem Finger. Hat das Leckermäulchen etwa heut in der Stadt genascht?
NORA. Aber nein, wie kommst Du darauf?
HELMER. Hat das Leckermäulchen ganz gewiß keinen Abstecher in die Konditorei gemacht?
NORA. Nein, Torvald, ich versichere Dir –
HELMER. Nicht ein wenig Konfitüren geschleckt?
NORA. Nein, wahrhaftig nicht!
HELMER. Auch nicht ein paar Makronen probiert?
NORA. Nein, Torvald, ich versichere Dir wirklich –
HELMER. Na, na, na – es ist ja natürlich nur im Scherz gemeint –
NORA geht rechts an den Tisch. Es würde mir doch nie einfallen, gegen Deinen Wunsch zu handeln.
HELMER. Nein, das weiß ich ja wohl. – Und dann hast Du mir ja Dein Wort gegeben – Geht zu ihr. Behalt Deine kleinen Weihnachtsüberraschungen nur für Dich, mein Herz. Heut abend, wenn der Baum brennt, werden sie schon ans Licht kommen, davon bin ich überzeugt.