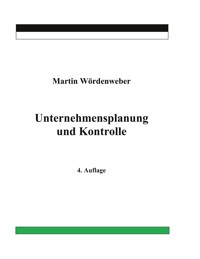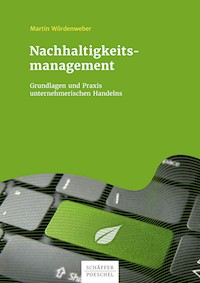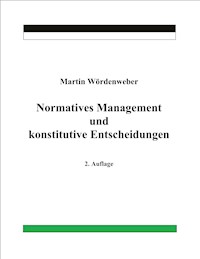
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Augenscheinlich wird immer häufiger über Unternehmenskrisen, oft mit (ethisch) bedenklichen Ausmaßen, berichtet. In diesen Situationen gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht in Aktionismus zu verfallen, erst recht nicht, die gut überlegten, (sehr) langfristig getroffenen Grundsatzentscheidungen sinnlos zu revidieren. Insofern kommt diesen Grundsatzbeschlüssen, die sich zum einen auf die konstitutiven Entscheidungen, zum anderen aber auf die normativen Regelungen beziehen und interdependent verknüpft sind, eine wesentliche Bedeutung für den Bestand und die Fortentwicklung des Unternehmens zu. Insbesondere die Inhalte des normativen Managements eines Unternehmens wirken sich immer häufiger und stärker auf den Erfolg des Unternehmens aus. Verstöße gegen Wertevorstellungen einzelner Anspruchsgruppen oder großer Teile der Gesellschaft werden von diesen immer häufiger und in der Stärke zunehmend sanktioniert. Die Effekte dieser Sanktionen können existentiell sein. In dieser Schrift wird zunächst auf die werteorientierte Unternehmensführung mit ihren Werten und Normen grundlegend eingegangen, bevor später die Elemente des normativen Managements (Vision, normative Unternehmensziele, Mission, Unternehmenspolitik und Leitbild, Unternehmenskultur, Unternehmensverfassung und Corporate Governance) detailliert vorgestellt werden. Besondere Themen sind Corporate Compliance sowie der DCGK 2022. Zu den konstitutiven Entscheidungen gehören die Standortwahl, Rechtsformwahl und Unternehmenszusammenschlüsse. Den wesentlichen Änderungen im Personengesellschaftsrecht ab 01.01.2024 ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Das vorliegende Werk wendet sich an alle Leser, die sich in Studium oder Beruf mit dem normativen Management, insb. einer werteorientierten Unternehmensführung, und konstitutiven Entscheidungen beschäftigen. Es richtet sich an Dozenten und Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen, Universitäten und Berufsakademien. Es ist gleichermaßen zum Selbststudium für Führungskräfte geeignet, die sich ein fundiertes Basiswissen über die vorgenannten Themen aneignen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 849
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort zur 2. Auflage
Ethik, insbesondere Wirtschaftsethik, ist (nicht nur) in diesen Tagen ein gefragtes und bewegendes Thema. Seit der letzten Auflage hat sich im Umfeld des Unternehmens viel geändert. Und das betrifft nicht nur die zahlreichen neuen oder modifizierten Gesetze. Daher ist es jetzt Zeit, eine neue Auflage auf den Weg zu bringen.
In dieser Auflage wird auf die Funktionen von allgemeinen und unternehmensbezogenen Werten näher eingegangen. Neu aufgenommen wurden die Regeln- bzw. Vorschriften-Regulierungsfunktionen der Ethik. Der Begriff Ethos wurde präzisiert und speziell auf das Berufsethos hingewiesen. Nachgereicht wurde die fehlende Definition zum Begriff Wirtschaftsethik. Zur Lösung wirtschaftsethischer Konflikte wird eine strukturierte Vorgehensweise zur Lösung vorgestellt und der Grundriss einer wirtschafts- bzw. unternehmensethischen Fallbesprechung erläutert. Daran anschließend findet sich ein ausführliches Beispiel einer wirtschaftsethischen Fallbesprechung. Da in diesem Jahr auch der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) überarbeitet wurde ‒ u. a. mit einer stärkeren Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit ‒, fand eine Aktualisierung desselben statt. Neu hinzugefügt wurde ein neuer Paragraf mit dem Thema „Gesetze zum Schutz von Whistleblowern“. In diesem werden das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) und Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) behandelt. Eine weitere Ergänzung bezieht sich auf die weitreichenden Änderungen im Personengesellschaftsrecht durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrecht (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, MoPeG), die fast ausnahmslos ab dem 01.01.2024 gelten.
Zur Verwendung der geschlechtsspezifischen, meist männlichen Schreibweise sei folgender Hinweis erlaubt: Es ist schreibtechnisch deutlich einfacher, nur die männliche Form zu verwenden, anstatt der gelegentlich gebrauchten Ausdrücke wie AutorIn, Autor*in, Autor/in, Autor:in, Autor oder Autorin, StudentIn, Student/in, Student*in, Student oder Studentin etc. Zweitens wäre die vorstehende Verwendung grammatikalisch falsch. Drittens lässt sie sich in sehr vielen Fällen wie z. B. beim Arzt nicht einheitlich anwenden: Eine Arztin gibt es nicht. Viertens führt die Ausführung zu einer erschwerten Les- und Erfassbarkeit des Textes. Zuletzt ist vorstehende Art der genderorientierten (?) Schreibweise angesichts der drei Geschlechter (Männer, Frauen, Intersexuelle) ohnehin nicht korrekt und ethisch bedenklich, da sie nicht alle Formen der sexuellen Orientierung gleichwertig nebeneinanderstellt; die Angehörigen des dritten Geschlechts werden zu reinen Symbolen herabgesetzt. Eine Lösung könnte in der Findung neuer Sprachformen liegen. Was aber etliche neue Probleme schafft. Denn dann bräuchten wir bei detaillierter Betrachtung (neben dem Neutrum) mind. vier Formen: m, w, d und ein übergeordnetes Substantiv für Personen. Infolgedessen opfern wir nicht nur die hergebrachte deutsche Sprache, sondern schaffen wie im Lateinischen oder Griechischen eine noch komplexere Sprache, deren Anwendbarkeit und Beherrschbarkeit die nächsten Fragen aufwirft. (So würden etwa bestimmte gesellschaftliche Gruppen (negativ) diskriminiert, da sie schon allein rein sprachlich überfordert sein könnten.) Es sei zudem darauf hingewiesen, dass das Sprechen mit einer zeitlichen Lücke, etwa beim „Gender-Sternchen“ eine Zumutung für die vielen Hörgeschädigten darstellt. Die Nutzung der vorherrschenden Ausdrucksweise, die oft das männliche Genus beinhaltet, ist in dieser Monografie lediglich als Kurzform für die drei Geschlechter zu verstehen. Insofern mögen Leserinnen und Intersexuelle mir verzeihen und ein wenig Verständnis aufbringen.
Für die zahlreichen Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge möchte ich mich bei den Studenten (cand. B. A.) der Fachhochschule Bielefeld herzlich bedanken. Mein besonderer Dank gilt neben Herrn Prof. Dr. Axel Benning und Herrn Prof. Dr. Burkhard Schütte für die juristischen Hilfestellungen sowie v. a. Frau Dr. Melanie Frieling für die generelle und Herrn Prof. Dr. Manuel Teschke für die steuerliche Durchsicht. Ebenfalls bedanken darf ich mich bei Frau cand. B. A. Charlotte Heß und Herrn cand. B. A. Piet Bendix Schott, die mit außerordentlichem Fleiß und kreativen Ideen zum Gelingen des Buches beigetragen haben.
Für Anregungen, die der weiteren inhaltlichen und didaktischen Verbesserung dienen, bin ich unter der E-Mail-Adresse [email protected] dankbar.
Büren, im September 2022
Martin Wördenweber
Vorwort zur 1. Auflage
Augenscheinlich wird immer häufiger über Unternehmenskrisen, oft mit (ethisch) bedenklichen Ausmaßen, berichtet. In diesen Situationen gilt es, einen „kühlen Kopf“ zu bewahren, nicht in Aktionismus zu verfallen, erst recht nicht, die gut überlegten, (sehr) langfristig getroffenen Grundsatzentscheidungen sinnlos zu revidieren. Insofern kommt diesen Grundsatzbeschlüssen, die sich zum einen auf die konstitutiven Entscheidungen, zum anderen aber auf die normativen Regelungen beziehen, eine wesentliche Bedeutung für den Bestand und die Fortentwicklung des Unternehmens zu.
Insbesondere die Inhalte des normativen Managements eines Unternehmens wirken sich immer häufiger und stärker auf den Erfolg des Unternehmens aus.
Wie wichtig insb. Normen und Werte − als entscheidende Grundlagen des normativen Managements − sind zeigt(e) sich bei Facebook Inc. und Volkswagen AG. Sie haben nicht nur ihre Kunden, sondern auch ihre Aktionäre stark enttäuscht. Während sie bei ersteren stark an Glaubwürdigkeit verloren haben, mussten die Anteilseigner herbe Verluste infolge der Kursrückgänge hinnehmen. Beide Unternehmen, eines aus den USA im Bereich digitaler Medien tätig und eines aus Deutschland in der Automobilindustrie, haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben eklatant gegen für ihre Kunden bedeutsame Werte, in erster Linie das Vertrauen, verstoßen. Sowohl bei Facebook (82 %) infolge der unbefugten Weitergabe persönlicher Daten als auch bei VW (84 %) nach Bekanntwerden der Abgasmanipulationen äußert die Mehrzahl der befragten Bürger, dass sie nicht überzeugt seien, die Unternehmen folgten einem höheren Zweck. Es sei unklar, für welche ethischen Werte das jeweilige Unternehmen eintrete.
Verstöße gegen Wertevorstellungen einzelner Anspruchsgruppen oder großer Teile der Gesellschaft werden von diesen immer häufiger und in der Stärke zunehmend sanktioniert. Die Effekte dieser Sanktionen können existentiell sein. Noch gut in Erinnerung ist die publizitätsträchtige Aktion von Greenpeace gegen Shell 1995 im Rahmen der Versenkung des schwimmenden Erdöltanks Brent Spar. Auch wenn sich gegen Ende der Kampagne herausstellte, dass die von Greenpeace genannten Zahlen öliger Schlämme völlig überzogen waren, verloren die Shell-Tankstellenpächter, v. a. in Deutschland, zwischen 20 und 50 % ihres Umsatzes infolge von zahlreichen Boykottaufrufen und eines Brandanschlags auf eine Shell-Tankstelle in Hamburg. Aber nicht nur die Unternehmen als Organisation, sondern auch das Top-Management selbst ist von ethischen Verstößen betroffen. So wurde 2016 in einer Studie ein massiver Anstieg außerplanmäßiger CEO-Demissionen aufgrund ethischer Verfehlungen in Erfahrung gebracht. Weltweltweit stieg der Anteil von 3,9 % (2007 bis 2011) auf 5,3 % (2012 bis 2016). Nicht zuletzt wegen der Auswirkungen ethischen Fehlverhaltens muss sich das Management fragen, welche der zur Verfügung stehenden Optionen tatsächlich handlungsrelevant sein dürfen bzw. können, genauer: Welche Entscheidung darf nach allgemeinen ethischen (moralisch-sittlichen) Maßstäben (Werten und Normen) zukünftig überhaupt getroffen werden? Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die sowohl unternehmerische als auch gesellschaftliche Werte berücksichtigt, ist einer der tragenden Säulen des normativen Managements.
Zur Verwendung der geschlechtsspezifischen, männlichen Schreibweise sei folgender Hinweis erlaubt: Es ist schreibtechnisch deutlich einfacher, nur die männliche Form zu verwenden, anstatt der gelegentlich gebrauchten, aber doch recht mühsam zu lesenden Ausdrücke wie AutorIn, Autor/in, Autor oder Autorin, StudentIn, Student/in, Student oder Studentin etc. Die vorstehende Art der genderorientierten (?) Schreibweise wäre angesichts der drei Geschlechter (Männer, Frauen, Intersexuelle) ohnehin nicht korrekt. Die Nutzung der männlichen Ausdrucksweise ist in dieser Monografie lediglich als Kurzform für die drei Geschlechter zu verstehen. Insofern mögen Leserinnen und Intersexuelle mir verzeihen und ein wenig Verständnis aufbringen.
Für die zahlreichen Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge möchte ich mich bei den Studenten (cand. B. A.) der Fachhochschule Bielefeld, insbesondere Herrn Paul Hersekorn, Frau Stefanie Kerkhoff, Herr Jan Lukas Rittershaus und Frau Anna Stricker, herzlich bedanken. Mein besonderer Dank gilt Frau Ass. jur. Martina Volkhausen, Herrn Ass. Jur. Markus Schikore, Herrn Prof. Dr. Axel Benning und besonders Herrn Prof. Dr. Burkhard Schütte für die juristischen Hilfestellungen sowie Herrn Prof. Dr. Manuel Teschke für die steuerliche Durchsicht. Ebenfalls bedanken darf ich mich bei Herrn Dr. Nils Müller, Frau Dipl.-Betriebsw. Sabine Demoliner und Frau Dipl.-Betriebsw. (FH) Jutta Lau sowie bei meiner studentischen Hilfskraft, Frau cand. B. A. Stephanie Bertram, die mit außerordentlichem Fleiß und kreativen Ideen zum Gelingen des Buches beigetragen haben.
Für Anregungen, die der weiteren inhaltlichen und didaktischen Verbesserung dienen, bin ich unter der E-Mail-Adresse [email protected] dankbar.
Büren, im August 2019
Martin Wördenweber
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Normatives Management
1.1 Grundlagen des normativen Managements
1.2 Werteorientierte Unternehmensführung
1.2.1 Philosophie, Ethik, Ethos und Werte
1.2.2 Sektoren der Wirtschaftsethik
1.2.2.1 Ordnungsethik
1.2.2.2 Unternehmensethik
1.2.2.3 Individualethik (Wirtschaftsbürgerethik)
1.2.3 Wertemanagement
1.2.3.1 Wesentlichkeitsmatrix
1.2.3.2 Lösung wirtschaftsethischer Konflikte
1.2.4 Nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensführung
1.2.4.1 Geschichte der Nachhaltigkeit
1.2.4.2 Begriffe im Kontext des Nachhaltigkeitsmanagements
1.2.4.3 Gründe für eine nachhaltigkeitsbezogene Unternehmensmensführung
1.2.4.4 Grundhaltungen des Nachhaltigkeitsmanagements
1.2.4.5 Nachhaltigkeits-Controlling
1.2.4.6 Nachhaltigkeitsberichterstattung
1.2.5 Unternehmensphilosophie
1.3 Vision
1.4 Normative Unternehmensziele
1.5 Mission
1.6 Unternehmenspolitik und Leitbild
1.7 Unternehmenskultur
1.7.1 Funktionen einer Unternehmenskultur
1.7.2 Ebenen der Unternehmenskultur
1.7.3 Kulturtypen und Subkulturen
1.7.4 Kulturbeeinflussende Faktoren
1.7.5 Gestaltung der Unternehmenskultur und Risiken
1.7.6 Unternehmenskultur der Deutsche Lufthansa AG
1.8 Unternehmensverfassung und Corporate Governance
1.8.1 Unternehmensverfassung
1.8.1.1 Unternehmensverfassung als Ordnung eines Unternehmens
1.8.1.2 Principal-Agent-Theorie
1.8.1.3 Stewardship-Theorie
1.8.1.4 Systeme der Unternehmensverfassung
1.8.2 Corporate Governance
1.8.2.1 Grundlagen der Corporate Governance
1.8.2.2 Änderungen bestehender Gesetze
1.8.2.3 OECD-Grundsätze der Corporate Governance
1.8.2.4 Deutscher Corporate Governance Kodex
1.8.2.5 Überwachungs- und Sanktionsmechanismen
1.8.2.6 Corporate Compliance
1.8.2.7 Gesetze zum Schutz von Whistleblowern
Ausgewählte konstitutive Entscheidungen
2.1 Standortwahl
2.2 Rechtsformwahl
2.2.1 Kriterien für die Wahl der Rechtsform
2.2.2 Einzelunternehmen
2.2.3 GbR/BGB-Gesellschaft
2.2.4 OHG
2.2.5 KG
2.2.6 GmbH
2.2.7 UG haftungsbeschränkt
2.2.8 AG
2.2.9 SE
2.2.10 GmbH & Co. KG
2.2.11 Wechsel der Rechtsform (Umwandlung)
2.2.12 Änderungen im Personengesellschaftsrecht ab dem 01.01.2024
2.3 Unternehmenszusammenschlüsse
2.3.1 Ziele, Arten und Merkmale von Unternehmenszusammenschlüssen
2.3.2 Formen der Kooperation
2.3.3 Formen der Konzentration
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a. a. O.
am angegebenen Ort, am angeführten Ort
ACT
Akzeptanz- und Commitment-Therapie
AG
Aktiengesellschaft
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AktG
Aktiengesetz
altgriech.
altgriechisch
ALR
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten
Anm.
Anmerkung
AnSVG
Gesetz zur Verbesserung des Anlagerschutzes (Anlegerschutzverbesserungsgesetz)
AO
Abgabenordnung
AOC APAG
Auditor Oversight Commission Gesetz zur Fortentwicklung der Berufsaufsicht über Abschlussprüfer in der Wirtschaftsprüferordnung (Abschlussprüferaufsichtsgesetz)
APAK
Abschlussprüferaufsichtskommission
APAReG
Gesetz zur Umsetzung der aufsichts- und berufsrechtlichen Regelungen der Richtlinie 2014/56/EU sowie zur Ausführung der entsprechenden Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 im Hinblick auf die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz)
APAS
Abschlussprüferaufsichtsstelle
AR
Aufsichtsrat
ArbSchG
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz)
AReG
Gesetz zur Umsetzung der prüfungsbezogenen Regelungen der Richtlinie 2014/56/EU sowie zur Ausführung der entsprechenden Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 im Hinblick auf die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (Abschlussprüfungsreformgesetz)
ARGE
Arbeitsgemeinschaft
Art.
Artikel
ARUG II
Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (EU-Richtlinie 2017/828 vom 17.05.2017)
Aufl.
Auflage
Az.
Aktenzeichen
BAFA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BAWe
Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel
BB
Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BCG
Boston Consulting Group
Bd.
Band
BDA
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BfJ
Bundesamt für Justiz
BFuP
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (Zeitschrift)
BGA
Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGL
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung
BilMoG
Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz)
BilReG
Gesetz zur Einführung internationaler Rechnungslegungsstandards und zur Sicherung der Qualität der Abschlussprüfung (Bilanzrechtsreformgesetz)
BilRUG
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz)
bspw.
beispielsweise
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVG
Besonderes Verhandlungsgremium
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CARB
California Air Resources Board
CB
Compliance-Berater (Zeitschrift)
CC
Corporate Citizenship
CCO
Chief Compliance Officer
CCZ
Corporate Compliance Zeitschrift
CEO
Chief Executive Officer
Chr.
Christus
CI
Competitive Intelligence, Corporate Identity
CO
2
Kohlendioxid
COB
Chairman of the Board
c. p.
ceteris paribus
CS
Corporate Sustainability (Nachhaltigkeitsmanagement)
CSR
Corporate Social Responsibility
CV
Corporate Volunteering
Darst.
Darstellung
DAX
Deutscher Aktienindex
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
DFB
Deutscher Fußball-Bund e. V.
DFL
Deutsche Fußball Liga GmbH
d. h.
das heißt
DICO
Deutsches Institut für Compliance
DIHK
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Diss.
Dissertation
DJSI
Dow Jones Sustainability Index (Dow Jones Nachhaltigkeits-Index)
DNK
Deutscher Nachhaltigkeitskodex
DNWE
Deutsches Netzwerk der Wirtschaftsethik
DrittelbG
Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz)
DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DSW
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
DVFA
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
E-Autos
Elektrisch betriebene Automobile
eG
eingetragene Genossenschaft
eGbR
eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts
EGMR
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EK
Eigenkapital
Elvis
Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure
EnEG
Energieeinsparungsgesetz
ESG Issues
Environmental, Social and Governance Issues (Umwelt-, Sozial- und Untenehmensführungsthemen)
etc.
et cetera
ETF
Exchange Traded Fund (börsengehandelter Indexfonds)
EU
Europäische Union
EUBestG
Gesetz zu dem Protokoll vom 27. September 1996 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (EU-Bestechungsgesetz)
EUGBS
European Green Bond Standard
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EUROSIF
European Forum for Sustainable Investment
e. V.
eingetragener Verein
evtl.
eventuell
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
f. bzw. ff.
folgende, fortfolgende
FCPA
United States Foreign Corrupt Practices Act (Anti-Korruptions-Gesetz)
F&E
Forschung und Entwicklung
FinDAG
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
FISG
Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz)
FK
Fremdkapital
FKVO
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (Fusionskontrollverordnung)
FührposGleichberG
Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst
G
Gewinn
gem.
gemäß
GEMA
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GenG
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz)
GeschGehG
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimissen (Geschäftsgeheimnisgesetz)
GewO
Gewerbeordnung
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GG
Grundgesetz
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GNotKG
Gerichts- und Notarkostengesetz
GoB
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GrESt
Grunderwerbsteuer
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HDE
Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels
HGB
Handelsgesetzbuch
HinSchG
Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen (Hinweisgeberschutzgesetz)
Hrsg.
Herausgeber
HS
Halbsatz
HWK
Handwerkskammer
IAS
International Accounting Standards
i. d. R.
in der Regel
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IFRS
International Financial Reporting Standards
IHK
Industrie- und Handelskammer
IHKG
Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHK-Gesetz)
IntBestG
Gesetz zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1997 über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr (Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung)
i. S. d.
im Sinne des/der
ISO
International Organization for Standardization
i. S. v.
im Sinne von
IT
Informationstechnologie
i. V. m.
in Verbindung mit
i. w. S.
im weiteren Sinne
iX
Magazin für professionelle Informationstechnik
Jg.
Jahrgang
Kap.
Kapitel
KartVO
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (Kartellverordnung)
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KPI
Key Performance Indicator (Schlüsselkennzahl)
KrWG
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz)
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KWG
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)
lat.
lateinisch
lt.
laut
Ltd.
Limited (Bezeichnung für eine haftungsbeschränkte Gesellschaft)
LTI
Long Term Incentives
MAR
Market Abuse Regulation (Marktmissbrauchsverordnung, MMVO) (Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission)
M&A
Mergers and Acquisitions
m. a. W.
mit anderen Worten
MbO
Management by Objectives
MHD
Mindesthaltbarkeitsdatum
MiFIR
Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012)
Mio.
Million(-en)
MitBestG
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz)
MMVO
Marktmissbrauchsverordnung (engl.: Market Abuse Regulation, MAR) ) (Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission)
MoMiG
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
MontanMitbestG
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (Montanmitbestimmungsgesetz)
MontanMitbestGErgG
Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (Mitbestimmungsergänzungsgesetz)
MoPeG
Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz)
Mrd.
Milliarde(n)
MSC
Marine Stewardship Council
n.
nach
NGO
Non-Governmental Organizations (Nichtregierungsorganisation, nichtstaatliche Organisation)
NJW
Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NPO
Non-Profit-Organizations (Nicht gewinnorientierte Organisationen)
Nr.
Nummer
NZG
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
OECD
Organization for Economic Co-Operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
o. O.
ohne Ortsangabe
o. V.
ohne Verfasser
OWiG
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz)
p. a.
pro anno
PEST
Political, Economical, Social, Technological
PESTEL
Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal
PESTLE
Political, Economical, Social, Technological, Legal, Environmental
pp.
paginae (Seiten)
Rn.
Randnummer
ROI
Return on Investment
S.
Seite
SDG
Sustainable Development Goals
SEC
United States Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht)
SEBG
Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft
SE-VO
Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft
SIS
Sustainability Image Score
s. o.
siehe oben
SOA
Sarbanes-Oxley Act
sog.
so genannt(-e, -er, -en)
SOX
Sarbanes-Oxley Act
spätgriech.
spätgriechisch
St.
Stück, Steuern
StGB
Strafgesetzbuch
STI
Short Term Incentives
SWOT
Strength, Weakness, Opportunities, Threats
t
Zeit, Jahr(-e), Tonne(-n)
Tab.
Tabelle
TransPuG
Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität (Transparenz- und Publizitätsgesetz)
U
Umsatz
u.
und
u. a.
unter anderem, und andere
u. Ä.
und Ähnliche(s)
UBGG
Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften
UG
Unternehmergesellschaft
UmwG
Umwandlungsgesetz
UmwStG
Umwandlungssteuergesetz
USt
Umsatzsteuer
UStG
Umsatzsteuergesetz
usw.
und so weiter
u. U.
unter Umständen
VAG
Versicherungsaufsichtsgesetz
Verf.
Verfasser
VergRModG
Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsgesetz)
VerpackV
Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung)
VG Wort
Verwertungsgesellschaft Wort
vgl.
vergleiche
VorstAG
Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung
VorstOG
Gesetz über die Offenlegung von Vorstandsvergütungen (Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz)
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VVG
Versicherungsvertragsgesetz
WiSt
Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift)
WpHG
Wertpapierhandelsgesetz
WPO
Gesetz über die Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung)
WpÜG
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
z. B.
zum Beispiel
ZCG
Zeitschrift für Corporate Governance
ZfbF
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
ZHR
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZIR
Zeitschrift Interne Revision
ZPO
Zivilprozessordnung
ZRFC
Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance
z. T.
zum Teil
ZUb
Zeitschrift der Unternehmensberatung
Symbolverzeichnis
$
Dollar
€
Euro
§
Paragraf
§§
Paragrafen
%
Prozent
1 Normatives Management
Bereits während der Gründungsphase eines Unternehmens sind Planungen zu erstellen und Beschlüsse zu fassen, die als Grundsatzplanung bzw. Grundsatzentscheidungen anzusehen sind.1 Diese Entschlüsse werden als konstitutive Entscheidungen oder Metaentscheidungen bezeichnet. Da das Adjektiv konstitutiv2 „als wesentliche Bedingung den Bestand von etwas ermöglichend, das Bild der Gesamterscheinung bestimmend“3, grundlegend oder tragend bedeutet, wird klar, dass es sich bei konstitutiven Entscheidungen um grundlegende, eher seltene Entscheidungen von erheblicher Tragweite im Lebenszyklus eines Unternehmens handelt.
Darst. 1.001: Zusammenhang der Handlungsfelder
Diese sind auf Dauer angelegt, genau genommen „bis auf Widerruf“ und bestimmen längerfristig den weiteren Gestaltungs- und Handlungsrahmen des Unternehmens. Sie sind gleichzeitig bindend für das strategische, taktische und operative Management,4 wie die vorstehende Darstellung verdeutlicht.
Als weiteres Charakteristikum konstitutiver Entscheidungen lässt sich anführen, dass diese i. d. R. auf der Grundlage schlecht-strukturierter Entscheidungssituationen zu fällen sind. Zudem beanspruchen derartige Entschließungen zumeist (erhebliche) Ressourcen.
Wie vorstehend ausgeführt werden konstitutive Entscheidungen während der gesamten Lebensdauer des Unternehmens getroffen: zu Beginn, während und zum Ende der geschäftlichen Tätigkeit. Dementsprechend können die in der nachstehenden Darstellung aufgelisteten konstitutiven Entscheidungstatbestände den einzelnen Lebenszyklusphasen wie abgebildet zugeordnet werden.5
Darst. 1.002: Konstitutive Entscheidungen
Konstitutive Entscheidungen können auch während des unternehmerischen Lebens notwendig sein, insbesondere dann, wenn sich in der Umwelt des Unternehmens bedeutende Änderungen ergeben, die strukturelle Mängel offenbaren oder eine Neuordnung unternehmerischer Abläufe erforderlich machen oder andere konstitutive Wechsel (s. vorstehende Abbildung) induzieren. Auch der fortlaufende Wertewandel6 kann ein Grund sein, sich an neue Gegebenheiten anpassen zu müssen. Die einmal getroffenen konstitutiven Entscheidungen, wie auch diejenigen im – noch vorzustellenden – normativen Bereich, können bzw. müssen im Laufe des Unternehmenslebens geändert werden. Dies ist jedoch im Vergleich zu anderen Entschlüssen, z. B. operativen, eher selten der Fall, da eine Änderung z. B. der Rechtsform angesichts der erheblichen Mühen und des i. d. R. erheblichen finanziellen Aufwands keinen entscheidenden Vorteil generiert oder einen sehr bedeutsamen, von den Stakeholdern als abrupt wahrgenommenen und oft nicht (sofort) nachvollziehbaren Richtungswechsel nach sich zieht. Ausgenommen davon sind im normativen Management aufgrund des Wertewandels, dessen Dynamik im Laufe der vergangenen Jahrhunderte und Jahrzehnte, auch im Zuge der Globalisierung (globalisierungsbedingte Freiräume und gleichzeitig steigende Wettbewerbsintensitäten) und Digitalisierung7, zugenommen hat, die häufigeren Änderungen von Normen und Werten. Erwähnt seien hier etwa die Regelungen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), z. B. das Verbot der negativen Diskriminierung8 wegen des Alters, der Religion, der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität oder einer Behinderung. Auch die Berücksichtigung eines dritten Geschlechts, u. a. bei Stellenausschreibungen, ist hier zu nennen.9
Jede Entscheidung eines Individuums oder einer Gemeinschaft wird u. a. bewusst oder unbewusst durch Normen und Werte gesteuert. Dies trifft auch ‒ vgl. Darst. 1.001 ‒ für
die vorgenannten konstitutiven Entscheidungen bei der Gründung des Unternehmens (z. B. bei der Frage der Mitbestimmung der Arbeitnehmer),
die (meist) spätere Ausarbeitung und weiter unternehmenslebenslangen Überarbeitungen der normativen Regeln der Unternehmensführung (z. B. im Hinblick auf die Erstellung eines Unternehmensleitbildes oder der Corporate Governance) als auch für
die auf der Basis der konstitutiven Festlegungen zu fällenden strategischen, taktischen und operativen Entscheidungen zu.
Wie wichtig Normen und Werte sind, zeigt sich bei Facebook Inc. und Volkswagen AG. Sie haben nicht nur ihre Kunden, sondern auch ihre Aktionäre stark enttäuscht. Während sie bei ersteren stark an Glaubwürdigkeit verloren haben,10 mussten die Anteilseigner herbe Verluste infolge der Kursrückgänge hinnehmen. Beide Unternehmen, eines aus den USA im Bereich digitaler Medien tätig und eines aus Deutschland in der Automobilindustrie, haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben eklatant gegen für ihre Kunden bedeutsame Werte, in erster Linie das Vertrauen, verstoßen. Sowohl bei Facebook (82 %) infolge der unbefugten Weitergabe persönlicher Daten als auch bei VW (84 %) nach Bekanntwerden der Abgasmanipulationen äußert die Mehrzahl der befragten Bürger, dass sie nicht überzeugt seien, die Unternehmen folgten einem höheren Zweck. Es sei unklar, für welche ethischen Werte das jeweilige Unternehmen eintrete. Ein weiterer Fall ist Alphabet Inc. (vormals Google Inc.). Dieses Unternehmen plante die Entwicklung einer nach den Wünschen der Kommunistischen Partei zensierten Suchmaschine für China. Hier lehnten mehr als 1.000 Mitarbeiter und die Tech-Community das Projekt „Dragonfly“ ab.11 Suchanfragen zu Menschenrechten, Demokratie, Religion und Protesten sollten automatisch aussortiert werden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die Pläne als „schweren Angriff auf die Informationsfreiheit“.12 Besondere Aufmerksamkeit erregt nach wie vor der Fall „Contergan“ der Grünenthal GmbH. Obwohl dem Unternehmen schon länger bekannt war, dass der Verkaufserfolg Contergan, ein Beruhigungs- und Schlafmittel mit dem Wirkstoff Thalidomid, erhebliche Nebenwirkungen, u. a. Fehlbildungen bei Neugeborenen, hervorrief, wurde die Arznei nicht vom Markt genommen. Im Fall eines Verkaufsverbots drohte Grünenthal sogar mit einer einstweiligen Verfügung sowie einer Haftbarmachung des Düsseldorfer Innenministeriums für den möglicherweise entstehenden finanziellen Schaden.13 Erst am 27.11.2021 ‒ nach über 60 Jahren ‒ rangen sich die Eigentümer zu einer Entschuldigung durch!
Neben nationalen Konflikten und regionalen Kontroversen innerhalb eines Staates treten zunehmend auch solche auf, die infolge der Globalisierung international, d. h. auch zwischenstaatlich, entstehen bzw. entstehen können. Diese Widersprüche bzw. Konfrontationen sind nicht nur rechtlicher Natur, sondern auch gesellschaftlicher. Sie können erschwerend wie im Fall der USA unter Präsident Trump oder der Türkei unter Präsident Erdogan zudem emotional gesteuert sein. Insbesondere dann, wenn die Lösung von Konflikten einer rechtlichen Regelung nicht zugänglich ist, kann eine ethische Orientierung unternehmerischen Handelns (Unternehmensethik) im Hinblick auf ein verständigungsorientiertes Agieren erfolgversprechend sein.14
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass ein Unternehmen maßgeblich durch seine Normen und Werte und die Art und Weise, wie sich die diese Normen und Werte im täglichen Handeln der Unternehmensmitglieder zeigen, geprägt wird. Immer häufiger und in der Stärke zunehmend werden Verstöße gegen Wertvorstellungen einzelner Anspruchsgruppen oder großer Teile der Gesellschaft von diesen sanktioniert. Die Effekte dieser Sanktionen können existentiell sein. Noch gut in Erinnerung ist die publizitätsträchtige Aktion von Greenpeace gegen Shell 1995 im Rahmen der Versenkung des schwimmenden Erdöltanks Brent Spar. Auch wenn sich gegen Ende der Kampagne herausstellte, dass die von Greenpeace genannten Zahlen öliger Schlämme völlig überzogen waren,15 verloren die Shell-Tankstellenpächter, v. a. in Deutschland, zwischen 20 und 50 % ihres Umsatzes infolge von zahlreichen Boykottaufrufen und eines Brandanschlags auf eine Shell-Tankstelle in Hamburg.16 Aber nicht nur die Unternehmen als Organisation, sondern auch das Top-Management selbst ist von ethischen Verstößen betroffen.
So wurde 2016 in einer Studie17 ein massiver Anstieg außerplanmäßiger CEO-Demissionen aufgrund ethischer Verfehlungen in Erfahrung gebracht. Weltweit stieg der Anteil von 3,9 % (2007 bis 2011) auf 5,3 % (2012 bis 2016). Für Westeuropa wurde gar ein Anstieg von 4,2 % auf 5,9 % errechnet. Allerdings konnte in dieser Studie letztendlich nicht geklärt werden, ob sich die Zahl der ethischen Verstöße erhöht hat oder der zunehmende öffentliche Druck zu einer Abberufung führte. Nicht zuletzt wegen der Auswirkungen ethischen Fehlverhaltens muss sich das Management fragen, welche der zur Verfügung stehenden Optionen tatsächlich handlungsrelevant sein dürfen bzw. können, genauer: Welche Entscheidung darf nach allgemeinen ethischen (moralisch-sittlichen) Maßstäben (Werten und Normen) zukünftig überhaupt getroffen werden? Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die sowohl unternehmerische als auch gesellschaftliche Werte berücksichtigt, ist eine der tragenden Säulen des normativen Managements. Neben der Festlegung der über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Normen und der Werteordnung des Unternehmens befasst sich das normative Management mit der Legitimität des Unternehmens in Bezug auf seinen Sinn und Zweck bzw. seine Existenzberechtigung sowie mit den grundsätzlichen Unternehmenszielen. Die Daseinsberechtigung besteht darin, einen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten und die Bedürfnisse von Bezugsgruppen, wie z. B. Kunden zu befriedigen. Dies erreicht das Unternehmen durch Anbieten von Produkten und Dienstleistungen oder durch Lösungen für bestimmte Probleme. Somit richtet sich das normative Management an der Nutzenstiftung der Bezugsgruppen aus.18 Auf diese Weise schafft das normative Management die Rahmenbedingungen für die Gesellschafter des Unternehmens, um eine Wertsteigerung des Unternehmens zu erreichen oder Einkünfte zu erzielen. Demzufolge gehören zu den Aufgaben des normativen Managements in erster Linie jene Grundsatzbeschlüsse, die nicht durch übergeordnete Unternehmensentscheidungen sachlich begründet sind, sondern von den Gründern bzw. vom Top-Management des Unternehmens als einzuhaltende Norm vorgegeben werden.19
Der Vollständigkeit halber sei klargestellt, dass auch die normativen Entscheidungen Beschlüsse mit Grundsatzcharakter sind. Sie haben eine hohe Bindungswirkung für das Unternehmen, können nicht aus übergeordneten Unternehmensentscheidungen abgeleitet werden und grenzen die Alternativen von Folgeentscheidungen ein. Sie sind weit in die Zukunft gerichtet. Zudem betreffen sie das gesamte Unternehmen. Sie sind damit Unternehmensführungsentscheidungen, i. d. R. auf der Grundlage schlecht-strukturierter Entscheidungssituationen. Wie bei den konstitutiven Entscheidungen bereits kurz angedeutet, ist jedes Unternehmen Teil der es umgebenden Umwelt. Diese Umwelt ist ständigen Veränderungen unterworfen. Der Wandel der Umweltbedingungen wirkt sich auf das Unternehmen aus und kann je nach Stärken und Schwächen des Unternehmens eine Chance oder ein Risiko für sie darstellen. Durch Stärken können Chancen genutzt und Risiken bewältigt werden. Hingegen führt eine Schwäche zu einem Risiko, welches das Überleben des Unternehmens gefährdet. In der sich ständig verändernden Umwelt ist es somit auch Aufgabe des normativen Managements, die Richtung der Unternehmensentwicklung zu definieren sowie zukunftstaugliche Rahmenbedingungen für die strategischen, taktischen und operativen Entscheidungen zu schaffen. Auf diese Weise wird es dem Unternehmen ermöglicht, die Chancen zu nutzen, Risiken zu bewältigen und zur Erhaltung oder Verbesserung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit beizutragen.
Ein inhaltlicher Vergleich zwischen den konstitutiven Entscheidungen und den Festlegungen im Rahmen des normativen Managements offenbart zwei Überschneidungen. In beiden Fällen ist sowohl die Wahl der Rechtsform bzw. ggf. in einer späteren Phase des Unternehmenslebenszyklus ein Wechsel der Rechtsform als auch die Festlegung des Geschäftszwecks (Leistungsprogramm) Gegenstand der Erläuterungen. Im Folgenden wird die Rechtsformwahl als auch die Bestimmung des Geschäftszwecks im Kapitel 1 „Normatives Management“ abgehandelt, wobei die Rechtsformwahl sich hier auf die grundlegende Darstellung der Systeme einer Unternehmensverfassung beschränkt. Die konstitutiven Entscheidungen „Standortwahl“, „Wahl der Rechtsform“ und „Unternehmenszusammenschlüsse“ finden sich im Kapitel 2 „Ausgewählte konstitutive Entscheidungen“ wieder.
Im Rahmen der prozessorientierten Unternehmensführung20 wird hinsichtlich der Bearbeitung der grundsätzlichen Entscheidungen, die im Prinzip „unternehmenslebenslang“ gelten, also die konstitutiven Entscheidungen sowie die normativen Rahmenbedingungen, folgende Reihenfolge gewählt. Werte und Normen bestimmen die Handlungen und Verhaltensweisen eines jeden Menschen. Sie werden i. d. R. über die Sozialisation von Generation zu Generation weitergegeben und sind somit auch beim Gründer und Unternehmensnachfolger, gleich in welchem Umfang und mit welcher Bedeutung, vorhanden. Diese fließen dementsprechend auch in die konstitutiven Festlegungen im Zuge der Unternehmensgründung ein, etwa bei der Wahl der Rechtsform die moralisch-sittliche Frage der (dauerhaften) Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg bzw. am Wertzuwachs des Unternehmens, auch wenn andere Kriterien, wie z. B. die Haftungsfrage eine große Bedeutung haben. Daher wird zunächst das normative Management vorgestellt.
1 Vgl. GUTENBERG, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd. 1: Die Produktion, 24. Aufl., Berlin, Heidelberg, New York 1983, S. 140. Siehe auch die Übersicht im Unter-Unterabschnitt 1.6.5.2 „Planung nach dem Inhalt“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung und Kontrolle, im Folgenden abgekürzt mit „Unternehmensplanung“, 3. Aufl., Norderstedt 2022, S. 150).
3 Vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/konstitutiv, Abruf am 23.08.2018.
4 Der Zusammenhang der Handlungsfelder wird kurz im Unter-Unterabschnitt 1.2.2.4 „Handlungsebenen der Unternehmensführung“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O., S. 52) beschrieben.
5 Bea unterscheidet konstitutive Entscheidungen während der Gründung, Sanierung und Liquidation. Siehe BEA, F. X.: Entscheidungen des Unternehmens, in: BEA, F. X., SCHWEITZER, M.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Band 1: Grundfragen, 10. Aufl., Stuttgart 2009, S. 359–360. Zu den konstitutiven Entscheidungen siehe u. a. auch JUNG, H.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 13. Aufl., Berlin, Boston 2016, S. 63–157, OPRESNIK, M. O., RENNHAK, C.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Grundlage unternehmerischer Funktionen, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg 2015, S. 23–24, 32–64, WÖHE, G., DÖRING, U., BRÖSEL, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 27. Aufl., München 2020, S. 207f.
6 Vgl. dazu ausführlich Abschnitt 1.5 „Rahmenbedingungen der Unternehmensführung“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O.).
7 Erinnert sei bspw. an einen (bewusst oder ungewollt/unbedacht) ausgelösten „Shitstorm“. (Als Shitstorm wird das explosionsartige, (sehr) voluminöse Auftreten negativer einschl. beleidigender Äußerungen gegen eine Person oder Organisation in digitalen Medien bezeichnet.) In diesem Kontext findet auch der Begriff „Cyberwar“ Verwendung.
8 Es ist – auch im vorliegenden Fall – darauf hinzuweisen, dass eine positive Diskriminierung (z. B. als geschlechtsspezifische Geförderte(r)) immer auch (mindestens) eine negative Diskriminierung (z. B. als nicht geschlechtsspezifische(r) Geförderte(r)) mit sich bringt. Mal ganz abgesehen davon, dass die Offenbarung des Diskriminierungstatbestandes, z. B. der sexuellen Orientierung, von den Betroffenen möglicherweise (gar) nicht gewünscht ist.
9 Ausgehend von einer Dreiteilung der Geschlechter (vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10.10.2017, 1 BvR 2019/16 in: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html, Abruf am 19.03.2018, muss korrekterweise eine Aufsplittung in Männer, Frauen und Diverse (Intersexuelle) vorgenommen werden.
10 Vgl. DÖRING, J.: Facebook und VW stehen nicht für Werte, 05.07.2018, https://www.springerprofessional.de/-corporate-social-responsibility/krisenmanagement-/facebook-und-vw-stehen-nicht-fuer-werte/15876790, Abruf am 23.08.2018. Noch vor wenigen Jahren hatte sich Google mit Verweis auf das hohe Maß an Illiberalität aus dem lukrativen Markt zurückgezogen.
11 ZEITONLINE: Google-Mitarbeiter kritisieren Suchmaschine für China, 17.08.2018, https://www.zeit.de/digital/internet/2018-08/dragonfly-google-mitarbeiter-bedenken-suchmaschine-china, Abruf am 23.08.2018, BRANDT, M: Tech-Community lehnt Googles China-Plan eher ab, 22.08.2018, https://de.statista.com/infografik/15174/einstellung-der-tech-community-zu-googles-china-plan/, Abruf am 23.08.2018.
12 OSTEXPERTE.DE: „Dragonfly“: Google-Mitarbeiter kritisieren China-Pläne, 17.08.2018, https://ostexperte.de/google-dragonfly/, Abruf am 23.08.2018.
13https://www.contergan.de/index.php/gruenenthal/faktencheck/26-gruenentahl/gruenentahl-phasen/9-gruenenthalwaehrend-der-contergan-katastrophe, Abruf am 23.08.2018.
14 Vgl. STEINMANN, H., SCHREYÖGG, G., KOCH, J.: Management. Grundlagen der Unternehmensführung: Konzepte – Funktionen – Fallstudien, 7. Aufl. 2013, S. 101.
15 Statt der behaupteten 5.500 Tonnen befanden sich an Bord des schwimmenden Erdöllagers laut einem Prüfungsbericht der Det Norske Veritas tatsächlich nur 75 bis 100 Tonnen (1,4 bis 1,8 % der von Greenpeace unterstellten Mengen). Heute würde in diesem Zusammenhang von Fake News gesprochen.
16 Vgl. DEHMER, D.: Goliath gegen Goliath, 09.07.2005, http://www.tagesspiegel.de/kultur/goliath-gegen-goliath/623062.html, Abruf am 06.01.2017. Zwar konnte Shell durch etwa 30 im Vorfeld von namhaften Dritten erstellte Studien und entsprechende Genehmigungen seitens der Behörden nachweisen, dass die Versenkung der Brent Spar die (zum damaligen Zeitpunkt) am wenigsten umweltgefährdende Entsorgungsmaßnahme war. Doch der medienwirksamen und (hoch) emotionalen Aktion von Greenpeace („David gegen Goliath“) hatte Shell keine geeignete Kommunikationsstrategie entgegenzusetzten, zumal die Konzernspitze in Großbritannien die Dynamik auf dem Festland (Deutschland, Niederlande, Dänemark) völlig falsch eingeschätzt hatte.
17 STRATEGY& (HRSG.): 2016 CEO Success Study, https://www.strategyand.pwc.com/ceosuccess, Abruf am 13.09.2018.
18 Vgl. BLEICHER, K., ABEGGLEN, C.: Das Konzept Integriertes Management. Visionen – Missionen – Programme, 9. Aufl., Frankfurt/New York 2017, S. 152.
19 Vgl. HUNGENBERG, H., WULF, T.: Grundlagen der Unternehmensführung, 4. Aufl., Heidelberg, Dordrecht, London, New York 2015, S. 25ff.
20 Vgl. Darst. 1.203 „Dimensionen der Unternehmensführung“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O.).
1.1 Grundlagen des normativen Managements
Im Buch „Unternehmensplanung und Kontrolle“ wird das Thema „Regeln für Führungskräfte“ angesprochen und u. a. auf die Konsequenzen für das Unternehmen und das Management hingewiesen,21 wenn gegen bestimmte externe obligatorische22 Regeln23 wie etwa im Fall der Deutsche Bank AG, der Siemens AG oder der Volkswagen AG24 verstoßen wurde. Diese Missachtung von Regeln hat gleichzeitig erhebliche Verletzungen moralisch-ethischer Werte und Normen offenbart. Es sind nicht nur externe obligatorische, sondern auch im Hinblick auf die Stakeholder des Unternehmens, auf die später noch einzugehen sein wird, aus Unternehmenssicht fakultative Regeln, deren Verletzung von internen und externen Anspruchsgruppen sanktioniert werden (können).
Darst. 1.101: Arten von Regeln
Neben den externen Regeln existieren in einer Organisation wie dem Unternehmen auch interne Richtlinien, die wiederum in Form eines obligatorischen oder fakultativen Richtmaßes auftreten können.25 Sämtliche vorgenannten Regeln können wiederum explizit oder implizit sein. Auf die Regeln in Form von Normen und Werten ist später noch ausführlicher einzugehen.
Die Bedeutung von Orientierungen in Form von Werten und Normen und damit des normativen Managements dürfte auch weiterhin zunehmen:26
Aufgrund zunehmender struktureller Veränderungen in den Organisationen, z. B. durch Fusionen von Unternehmen, Eingliederungen übernommener Unternehmen oder Unternehmensteile oder Gestaltwechsel der Aufbau- oder Prozessorganisation im Unternehmen, nimmt die Zahl der Entscheidungsträger zu, die sich neu orientieren müssen. Die zentrale Herausforderung besteht darin, diesen Wechsel in der Zusammensetzung der betroffenen Mitarbeiter zum Wohle des Gesamtunternehmens zu gestalten.
Die zunehmende Bedeutung der zu berücksichtigenden Anspruchsgruppen (u. a. Eigentümer, Mitarbeiter, Konsumenten, Lieferanten, Fremdkapitalgeber, Staat, nachhaltigkeitsorientierte Gruppierungen im Bereich Ökologie und Soziales sowie der Staat) beansprucht immer mehr das normative Management in Bezug auf ein optimales Stakeholdermanagement.
Die Unternehmenskultur kann als Gesamtheit der von den Unternehmensangehörigen geteilten Wert- und Normvorstellungen sowie Denk- und Verhaltensmuster verstanden werden.
27
Auch sie ändert sich im Zeitablauf dynamisch. Zu den Aufgaben des normativen Managements gehört es, nicht nur den (ständigen) Abgleich der Werte und Normen des Unternehmens mit denen der Gesellschaft vorzunehmen und ggf. Änderungen zu bewirken, sondern die unternehmerischen Werte und Normen kompatibel mit den – in der Regel – wertorientierten Zielen des Unternehmens zu gestalten.
Nach diesen ersten einführenden Anmerkungen soll zunächst geklärt werden, was unter einem „normativen Management“ zu verstehen ist. Dabei wird anfänglich von den beiden Begriffen „normativ“ und „Management“ ausgegangen.
Wie Wördenweber28 definiert, soll im Weiteren Management als Funktion im Sinne von Prozessen bzw. Tätigkeiten/Aktivitäten betrachtet werden. Diese funktionale Perspektive enthält die Beschreibung der Prozesse und Funktionen des Managements und der eingesetzten Instrumente.29
Der zweite Bestandteil „normativ“ ist aus dem Lateinischen abgeleitet. „Norma“ bedeutet Winkelmaß, Richtschnur, Vorgabe, Regel. Gelegentlich findet sich auch Vorschrift als Übersetzung. Wie später zu lesen sein wird, ist das Synonym Vorschrift hier nicht zutreffend, da es sich nicht nur um (obligatorische oder fakultative) schriftlich fixierte Direktiven handelt, sondern auch um unausgesprochene (implizite) Maßstäbe. Letztere sind immer dann bedeutsam, wenn für Einzelfälle (Einzelentscheidungen) keine entsprechenden Vorschriften obwalten. Dementsprechend liefert der Duden folgende ausgewählte Bedeutungen:
allgemein anerkannte, als verbindlich geltende Regel für das Zusammenleben der Menschen
Rechtsnorm
(in Wirtschaft, Industrie, Technik, Wissenschaft) Vorschrift, Regel, Richtlinien o. Ä. für die Herstellung von Produkten, die Durchführung von Verfahren, die Anwendung von Fachtermini o. Ä.
30
In dieser Abhandlung wird der Begriff der Norm wie folgt definiert:
Normen sind Vorgaben, die mehr oder weniger genau festlegen, was in einer bestimmten Situation eine angemessene und erwartete Verhaltensweise ist.
Darst. 1.102: Norm
Normen sind meist „ungeschriebene Gesetze“. Aus Normen entwickeln sich oft Regeln. Eine Regel (synonym: Bestimmung, Richtlinie, Direktive, Standard) wird als eine aus bestimmten Regelmäßigkeiten abgeleitete, aus Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene, festgelegte, als verbindlich geltende Richtlinie definiert. Es handelt sich häufig um eine in einer bestimmten Form schriftlich fixierte Norm oder Vorschrift.31
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch gesellschaftliche Normen existieren, die wertefrei sind und mehr oder weniger als willkürliche Regeln bzw. Vorschriften erscheinen, auch wenn es für sie im Einzelfall gute Gründe gibt. Diese werden als Konventionen bezeichnet.
Normen geben Soll-Zustände wieder. In dem Sinne, wie etwas (auf jeden Fall) sein sollte oder sein muss. Normen sind eine (explizite oder implizite) Anweisung in Form eines „so sollte es gemacht werden“. Der Weg für eine (geplante) Handlung oder Handlungsweise ist somit quasi vorgegeben. In diesem Sinnzusammenhang liefert der Duden folgende Erläuterung für „normativ“, indem er als Bedeutungen angibt: als Richtschnur, Norm dienend, eine Regel, einen Maßstab für etwas darstellend, abgebend.32 Der Begriff „normativ“ wird daher wie folgt definiert:
Normativ bedeutet einer Norm (Vorgabe) folgend, maßgebend, verpflichtend und wegweisend/richtungsgebend.
Darst. 1.103: Normativ
Grundsätzlich soll das normative Management die (Über-)Lebensfähigkeit des Unternehmens sicherstellen und die (Weiter-)Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens,33 d. h. die Fähigkeit zur Unternehmensentwicklung in Richtung eines positiven, sinnvollen Wandels im – i. d. R. in einer Marktwirtschaft – wertorientierten Sinne begünstigen. Die Notwendigkeit der Anpassung ergibt sich aus dem ständigen Wandel in der Makro- und Mikroumwelt des Unternehmens.34
Diese Maxime erfüllt das normative Management, indem es sich die nachfolgenden Punkte zu eigen macht.
Wie eingangs angemerkt basieren die Entscheidungen eines oder mehrerer Unternehmensgründer auf den Normen und Wertvorstellungen dieser Personen. Insofern bedarf auch die unternehmerische Tätigkeit an sich bereits im Zuge der Gründung eines Unternehmens der ethischen Legitimation durch die Unternehmensgründer. Daneben ist aber auch die gesellschaftliche Legitimation elementar. Diese betrifft zum einen die Existenzberechtigung in der Leistung des Unternehmens für die Gesellschaft, zum anderen die grundlegenden Wertfragen unternehmerischen Handelns, d. h. die frühzeitige Auseinandersetzung mit unternehmenspolitischen Wert- und Interessenskonflikten – bevor nachfolgend strategische oder operative Entscheidungen vermeidbare Konflikte mit Stakeholdern des Unternehmens verursachen. Ausgangspunkt ist das Erkennen/Ermitteln und Bewerten konfligierender Anliegen und Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen. In der Klärung (und anschließenden Bekanntgabe) ihrer zentralen Werte verdeutlicht das Unternehmen seine Verantwortung für die Gesellschaft. Wichtig ist hierbei, die Glaubwürdigkeit bei allen Bezugsgruppen des Unternehmens aufzubauen.35
Die gesellschaftliche Legitimation zeigt sich darin, dass die Organisation den von ihr geschaffenen Nutzen für ihre Ziel- und andere Anspruchsgruppen in einer Sinn- und Zweckbegründung darlegt. Dieser Nutzen wird als Nutzenpotenzial bezeichnet. Er stellt ein aktuelles oder potenzielles Feld unternehmerischer Tätigkeit dar, welches für alle (relevanten) Ziel- und sonstigen Anspruchsgruppen einen Mindestnutzen erwarten lässt. Ein Unternehmen, das keinen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann, also keine Nutzenstiftung vorweisen kann, hat keine gesellschaftliche Legitimation. Die Fragen nach dem „Warum“ und „Wozu“ müssen überzeugend beantwortet werden können.
Nach Ansicht von Waibel/Käppeli besteht ein Grundproblem des normativen Managements in der Uneinigkeit über die normativen Grundsätze und dabei insbesondere über die Verteilung der (materiellen und immateriellen) Nutzen und Kosten des unternehmerischen Handelns auf die einzelnen Anspruchsgruppen.36 In diesem Fall stellt sich das normative Management als Handlungsebene für die Generierung von Konsens zwischen den Stakeholder-Gruppen dar. Ein entsprechendes Unterziel normativer Unternehmensführung ist der Aufbau unternehmenspolitischer Verständigungspotenziale.37
Da die Normen gleichzeitig einen wegweisenden/richtungsgebenden Charakter aufweisen, zählen auch die (richtungsweisenden) grundsätzlichen Unternehmensziele zum Inhalt des normativen Managements. In diesem Sinne sind Normen auch zielführend.
Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich jetzt die Ziele des normativen Managements ableiten:
Das Ziel des normativen Managements ist die grundsätzliche juristische, ökonomische und ethische (und damit auch nachhaltigkeitsbezogene1) Sicherung des Unternehmens, um seine Lebensfähigkeit zu gewährleisten und die Fähigkeit zur Entwicklung des Unternehmens zu begünstigen. Im Wesentlichen geht es um die Werte und Normen des Unternehmens, die gesellschaftliche Legitimität (Sinn und Zweck, Existenzberechtigung, Nutzenstiftung) des Unternehmens und die grundsätzlichen Unternehmensziele.
Darst. 1.104: Ziele des normativen Managements 1 Neben dem ökonomischen Bereich sind dies die Sektoren Ökologie und Soziales sowie weitere gesellschaftliche Aspekte. Vgl. WÖRDENWEBER, M.: Nachhaltigkeitsmanagement, a. a. O., S. 9.
Aus den vorgenannten Zielen lassen sich unmittelbar die Aufgaben des normativen Managements ableiten:
Das normative Management befasst sich mit der erstmaligen Festlegung, der wiederkehrenden Prüfung und ggf. Anpassung
des Sinns und Zwecks des Unternehmens,der grundsätzlichen Unternehmensziele,der über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Normen undder Werteordnung des Unternehmens.Darst. 1.105: Aufgaben des normativen Managements
Die vorgenannten Aufgaben verdeutlichen, dass das normative Management eine konstitutive Funktion für ein Unternehmen hat oder anders ausgedrückt die normativen Festlegungen die „begründenden“ Elemente eines Unternehmens enthalten, da diese das Fundament des Unternehmens darstellen, d. h. auf einer der sehr grundsätzlichen, wenn nicht gar grundsätzlichsten Ebene, die Handlungen und Verhaltensweisen der Organisation und aller Unternehmensmitglieder begründet. Das normative Management bildet die oberste und generellste Gestaltungsebene eines Unternehmens. Die hier getroffenen Entschlüsse setzen sich daher nahezu zwangsläufig in allen anderen Ebenen fort, d. h.: Alle weiteren Entscheidungen wie insbesondere die strategischen fußen auf der normativen Basis bzw. bewegen sich innerhalb des normativen Rahmens.
Bei den normativen Entscheidungen handelt es sich um übergeordnete Festlegungen interner (Eigentümer) oder externer (z. B. Gesetzgeber) Personen oder Institutionen, die obligatorisch sind, und der fakultativen des Top-Managements, die als Norm für alle Mitarbeiter des Unternehmens, ggf. bei identischer Übernahme über die Anteilseignervertreter in die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates38 auch für diesen, Gültigkeit besitzen. Letztere fußen auf ethischen und nachhaltigkeitsbezogenen39 sowie weiteren gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Unternehmensführung.
Insofern ein Unternehmen sozusagen zwangsweise (bspw. auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten, Fiskus) mit der Umwelt unmittelbar in diversen Beziehungen steht, müssen deren unterschiedliche Einflüsse berücksichtigt werden. Darüber hinaus existieren in der Unternehmensumwelt mittelbar weitere Stakeholder, die ihre (normativen) Ansprüche an das Unternehmen ebenfalls geltend machen. Inwieweit diese Anforderungen und Erwartungen in das normative Management eingehen, wird weiter unten noch ausführlich zu diskutieren sein (Stichwort: Stakeholdermanagement). Es lässt sich schon hier festhalten, dass die Entscheidungen im Rahmen des normativen Managements auch die Beziehung zwischen der Unternehmensumwelt und dem Unternehmen tangieren und diese somit − auch im Hinblick auf die Seriosität – sorgfältig zu definieren und zu gestalten ist.
Letztlich lässt sich aus dem Sinn und Zweck des Unternehmens und seinen Zielen sowie seinen Normen als Regeln (auch Spielregeln) und Werten die Identität eines Unternehmens (Unternehmensidentität) bestimmen. Die Identität eines Unternehmens ist die Gesamtheit aller unternehmensspezifischen Charakteristika/Charakterzüge/Eigentümlichkeiten/Besonderheiten. Eine Identität lässt sich als die Antwort auf die Frage verstehen, wer man selbst ist bzw. bei Unternehmen: Wer sind wir? Zu klären ist also das Selbstverständnis. Dies ist laut Hungenberg/Wulf zentrale Aufgabe der normativen Unternehmensführung.40 In Anlehnung an Brunner/Zeltner kann die Identität als „Wahrnehmung der relativen Einheitlichkeit der Einstellungen […] und des Verhaltens [eines Unternehmens; Einf. d. Verf.] trotz wechselnder Umweltbedingungen und des Fortschreitens der Zeit beschrieben werden.“41
Sofern das Selbstverständnis des Unternehmens nach innen und nach außen kommuniziert wird, kann zum einen eine höhere Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und zum anderen eine bessere Wahrnehmung und Einschätzung durch alle anderen Stakeholder erreicht werden. Wie bereits oben angemerkt, spielt die Glaubhaftigkeit der Botschaft eine entscheidende Rolle.
Eine entscheidende Voraussetzung für die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit ist die Standortbestimmung des Unternehmens (mit seinen Stärken und Schwächen) innerhalb des gesamten Systems (mit ihren Risiken und Chancen für das Unternehmen) jetzt und künftig.
In diesem Kontext wird auch die Verknüpfung mit dem Change Management sichtbar. Jede Änderung in der Umwelt, aber auch im Unternehmen selbst (z. B. Einstellungs-/Wertewandel der Beschäftigten) ist im Hinblick auf die unternehmerische Relevanz zu prüfen. Oft wird eine optimale Führung des Unternehmens verhindert, da das Management Wandel und Veränderungen nicht erkennt.42 Denn die Neuregelungen, -ordnungen und -orientierungen, vor allem in der Unternehmensumwelt, induzieren oft auch Änderungen im Unternehmen (gesamtbetrieblich oder funktionsbereichsbezogen) hinsichtlich der Strategien, Strukturen und/oder Prozesse. Aber auch die Verhaltensweisen können dazu gehören. Somit kann ein umfassendes Veränderungsmanagement auch Umgestaltungen im Bereich des normativen Managements bedeuten.
Darst. 1.106: Handlungsebenen und Aufgaben des Managements
Auf der Basis der normativen Festlegungen werden alle weiteren Entscheidungen auf der strategischen, taktischen und operativen Handlungs-/Planungsebene getroffen. Aus organisatorischer Sicht sind davon die Aufbau-, Prozess- und Projektorganisation betroffen.
Die bei Wördenweber43 beschriebenen Aufgaben (Funktionen) des Managements, die Planung, Organisation, Kontrolle und Personalführung, fallen auf jeder der vier Planungsebenen an. Diesen Sachverhalt verdeutlicht die vorstehende Abbildung.
Das vorstehende Modell basiert auf dem St. Galler Management-Konzept.44Grundlage aller strategischen, taktischen und operativen Handlungen sind die von den Unternehmensgründern und/oder den im Zuge der Gründung berufenen Fremdmanagern zu fällenden konstitutiven und normativen Entscheidungen45. Normative Beschlüsse spiegeln die Motivationen der Top-Entscheider ebenso wider wie die Einschätzung von Gegebenheiten und Entwicklungstendenzen der Umwelt und können sich in gewissen, meist längeren, d. h. sehr langen Zeitabständen ändern. Sie gelten daher, ebenso wie die konstitutiven Entscheidungen, unbefristet, d. h. bis auf Widerruf. Die Erarbeitung normativer Vorgaben kann durch das Controlling begleitet werden. Konstitutive Entscheidungen werden ebenfalls im Zuge der Gründung eines Unternehmens getroffen und betreffen im Wesentlichen die Rechtsform und damit die Unternehmensverfassung, den Standort und einen möglichen Unternehmenszusammenschluss.46 Da diese konstitutiven Entscheidungen grundsätzlich revidiert werden können, wenngleich mit enormen finanziellen und ertragswirtschaftlichen Konsequenzen, gehören sie zu den zu behandelnden Themen der Unternehmensführung. Konstitutive Entscheidungen stehen bspw. dann in einer engen Verbindung mit normativen Vorstellungen, wenn das normative Gedankengut Einfluss auf die zu wählende Rechtsform nimmt.47 Nicht nur wegen der stark divergierenden Aufgaben, sondern auch wegen des Vorgabecharakters für die strategischen Ebene macht eine Trennung zwischen normativen und strategischen Entscheidungen Sinn.
Zusammenfassend ergeben sich folgende Charakteristika eines normativen Managements:48
Darst. 1.107: Charakteristika des normativen Managements
Im nächsten Schritt muss konkretisiert werden, was im Einzelnen unter den Begriff des normativen Managements fällt. Es sollen Antworten auf folgende Fragen gegeben werden:
Worauf basiert das normative Management? Was sind die Quellen des normativen Managements?
Was sind konkret die Aufgaben, Inhalte und Elemente des normativen Managements?
Wie hängen die verschiedenen Elemente der normativen Unternehmensführung zusammen?
Wie bzw. wo zeigt sich im Einzelnen das normative Management?
In welcher Form werden die Überlegungen und Entscheidungen der normativen Unternehmensführung dokumentiert und/oder kommuniziert?
Im Zusammenhang mit dem normativen Management werden in der Literatur – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – folgende Elemente (in alphabetischer Reihenfolge) genannt:
Anspruchsgruppen (Stakeholder)
(Corporate) Compliance
Corporate Governance
Corporate Identity
Grundsatzplanung
Leitmaxime
Moral
Normen
(Unternehmens-)Ethik
Unternehmensgrundsätze
Unternehmenskultur
Unternehmensleitbild
Unternehmensleitsätze
(Unternehmens-)Mission
Unternehmensordnung
Unternehmensphilosophie
Unternehmenspolitik
Unternehmensverfassung
(Unternehmens-)Vision
(Unternehmens-)Werte
Unternehmensziele
Sowohl in der Literatur als auch in der Unternehmenspraxis herrscht weder Einigkeit über die Zahl der wichtigsten Elemente des normativen Managements, noch über deren Begrifflichkeit. In manchen Fällen widersprechen sich gar die Erläuterungen der Begriffe. So kann sich bspw. die Vision „eher nach außen richten“49 oder „dem Unternehmer und seinen Mitarbeitern den Blick öffnen“50. Darüber hinaus werden oft die Zusammenhänge zwischen den Elementen nicht oder nicht eindeutig geklärt. Als Basis für das Verstehen der normativen Unternehmensführung und insbesondere der Entscheidungen im Rahmen des normativen Managements ist jedoch eine eindeutige Definition vonnöten. Daher wird nachstehend von folgenden Elementen und Vernetzungen ausgegangen, die in der folgenden Abbildung zusammengestellt werden.
Darst. 1.108: Elemente und Beziehungsgefüge des normativen Managements
Grundlage allen unternehmerischen Handelns sind primär die in der Unternehmensethik51 über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden festgelegten Werte und Normen einschließlich einer Nachhaltigkeitsorientierung52. Sekundär der aus der ersten Gründer-Vision bzw. später neuen oder angepassten Vision53 abgeleitete Sinn und Zweck des Unternehmens und seine grundsätzlichen Unternehmensziele,54 denn die ethische Grundhaltung des Gründers bzw. des späteren Top-Managements beeinflusst neben anderem, wie z. B. in der Ferne erkennbare Markterfordernisse oder Kundenwünsche, die Vision entscheidend.
Die grundlegenden ethischen Vorstellungen, die bereits auch einen Abgleich mit der Unternehmensumwelt (Stakeholder) enthalten, sind Bestandteil der Unternehmensphilosophie55. Sie kann als paradigmatisch geprägte Einstellung der Unternehmung gegenüber seinen wesentlichen Stakeholdern sowie allgemein zur Gesellschaft angesehen werden, die sich neben weiteren nachstehend formulierten Themen in der Unternehmenspolitik56 als Summe der gebündelten Unternehmensgrundsätze manifestiert. Diese Unternehmensleitlinien ergeben sich aus dem Wertekatalog einschließlich der Unternehmensphilosophie, aus der Vision bzw. den abgeleiteten grundlegenden Zielen sowie der Mission57. Die Unternehmensgrundsätze werden in einem Unternehmensleitbild58 schriftlich fixiert.59
Eine Unternehmensmission60 enthält den Unternehmenszweck/-auftrag. Sie soll zum Ausdruck bringen, welches die grundlegenden Existenzgründe einer Organisation sind.
Zwischen dem Unternehmensleitbild und der Unternehmenskultur61, die die Gesamtheit der in einem Unternehmen anzutreffenden Wertvorstellungen und Normen sowie Denkhaltungen und Meinungen widerspiegelt, besteht eine interdependente Beziehung: Während das Unternehmensleitbild als Soll-Zustand angesehen werden kann und somit auch zur Veränderung der Unternehmenskultur beitragen soll, ist es andererseits eine (oft gewünschte starke) Unternehmenskultur, die aufgrund ihres Beharrungsvermögens eine Veränderung gemäß Unternehmensleitbild be- oder gar verhindert.
Die Gestaltung der Unternehmensverfassung (und der Corporate Governance) gehört, soweit diese nicht bereits durch externe Regelungen des Gesetzgebers vorbestimmt ist, zu den grundlegenden normativen und − was die Rechtsform bzw. ggf. den Wechsel der Rechtsform betrifft – auch konstitutiven Führungsaufgaben/-entscheidungen. Eine Unternehmensverfassung ist eine konstitutive und normative Ordnung, die für alle Betroffenen Verbindlichkeitscharakter besitzt. In einer Unternehmensverfassung werden zentrale Normen determiniert, die die Binnenordnung und die Außenbeziehungen des sozialen Systems „Unternehmung“ betreffen. Trotz der Beachtung gesetzlicher Vorschriften verbleiben dem Unternehmen viele Freiräume, die es zu gestalten gilt. In den entsprechenden Regelungen finden sich explizit die Wertvorstellungen und Normen der Unternehmensträger wieder – anders als bei der Unternehmenskultur, die diese Wertvorstellungen und Normen eher implizit, nämlich über das Verhalten der Unternehmensmitglieder reflektiert.62 Des Weiteren fließen in die konkrete Ausgestaltung der Unternehmensverfassung die Ziele und die Mission des Unternehmens ein.
21 Vgl. WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O., S. 77–93.
22 Obligatorisch i. S. v. gesetzlich vorgeschrieben.
23 Eine Regel wurde im Unterabschnitt 1.4.4 „Regeln für Führungskräfte“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O., S. 77–93) als eine aus bestimmten Regelmäßigkeiten abgeleitete, aus Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene, festgelegte, für einen bestimmten Bereich als verbindlich geltende Richtlinie definiert. Es handelt sich häufig um eine in einer bestimmten Form schriftlich fixierte Norm oder Vorschrift.
24 Vgl. etwa die Analyse der nachhaltigen Unternehmensführung bei der Volkswagen AG, insbesondere die ausführliche Darlegung der Auswirkungen der VW-Abgasmanipulationen bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Nachhaltigkeitsmanagement, Stuttgart 2017, S. 344–362).
25 Vgl. dazu die Ausführungen im Unterabschnitt 1.4.4 „Regeln für Führungskräfte“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O., S. 77–93).
26 Vgl. NIBBE, J.: Ökologische Unternehmenspolitik, Wiesbaden 1998, S.189–190.
27 Vgl. KREIKEBAUM, H., GILBERT, D. U., BEHNAM, M.: Strategisches Management, 8. Aufl., Stuttgart 2018, S. 181f. Dieses Thema wird ausführlich im Abschnitt 1.7 „Unternehmenskultur“ behandelt.
28 Siehe Unter-Unterabschnitt 1.2.2.1 „Definition Management“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung und Kontrolle, a. a. O., S. 30–36).
29 Vgl. GRASS, B.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Das System Unternehmung, 2. Aufl., Herne, Berlin 2003, S. 286.
30 DUDEN (HRSG.): https://www.duden.de/rechtschreibung/norm, Abruf am 15.08.2018.
31 Ein Gesetz ist ein Regelungssystem der Legislative für eine Gesellschaft, welches aus Vorschriften besteht, die das menschliche Verhalten regeln. Typisch ist die Allgemeinheit eines Gesetzes, d. h. die abstrakte Formulierung der Vorschrift für unbestimmt viele Sachverhalte und Personen. Auch Rechtsverordnungen und Satzungen, die auf einer Ermächtigung der Legislative fußen, haben Gesetzescharakter. Sowohl Gesetze als auch Rechtsverordnungen und Satzungen können sowohl wertende als auch nicht wertende Normen enthalten. Vgl. HOLZMANN, R.: Wirtschaftsethik, 2. Aufl., Wiesbaden 2019, S. 7.
32 DUDEN (HRSG.): https://www.duden.de/rechtschreibung/normativ, Abruf am 12.07.2018.
33 Vgl. BLEICHER, K., ABEGGLEN, C.: a. a. O., S. 151.
34 Auf dieses Thema wird im Paragrafen 1.6.11.1 „Analyseinstrumente für langfristige Planungszeiträume“ bei Wördenweber (WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O., S. 258‒313) dezidiert eingegangen.
35 Vgl. GUTTING, D.: Interkulturelles Management, Diversity und internationale Kooperation, Herne 2016, S. 111.
36 Vgl. WAIBEL, R., KÄPPELI, M.: Betriebswirtschaft für Führungskräfte – Die Erfolgslogik des unternehmerischen Denkens und Handelns, 2. Aufl., Zürich 2009, S. 19.
37 Vgl. GLÄSER, M.: Medienmanagement, 3. Aufl., München 2014, S. 60.
38 Anmerkung: Der Deutsche Corporate Governance Kodex 2019 sieht in Kapitel D Abschnitt I. ausdrücklich vor, dass Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen sich eine Geschäftsordnung geben.
39 Neben dem ökonomischen Bereich sind dies die Sektoren Ökologie und Soziales sowie weitere gesellschaftliche Aspekte. Vgl. WÖRDENWEBER, M.: Nachhaltigkeitsmanagement, a. a. O., S. 9.
40 Vgl. HUNGENBERG, H., WULF, T.: a. a. O., S. 25f.
41 Vgl. BRUNNER, R., ZELTNER, W.: Lexikon zur pädagogischen Psychologie und Schulpädagogik, München 1980, S. 100.
42 Vgl. SCHWENKER, B., MÜLLER-DOFEL, M.: Gute Führung. Über den Lebenszyklus von Unternehmen, Köln 2012, S. 24f.
43 Vgl. WÖRDENWEBER, M.: Unternehmensplanung, a. a. O., S. 37–41.
44 Vgl. BLEICHER, K., ABEGGLEN, C.: a. a. O., S. 147ff., DILLERUP, R., STOI, R.: Unternehmensführung, 5. Aufl., München 2016, S. 51, HUNGENBERG, H., WULF, T.: a. a. O., S. 23f., ALTER, R.: Strategisches Controlling. Unterstützung des strategischen Managements, 2. Aufl., München 2013, S. 10, BIRKER, K.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre: Grundbegriffe, Denkweisen, Fachgebiete, 2. Aufl., Berlin 2007, S. 161f.
45 Sie fußen auf ethischen, sozialen, umwelt- und nachhaltigkeitsbezogenen sowie weiteren gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Unternehmensführung. Vgl. DILLERUP, R., STOI, R.: a. a. O., S. 43.
46 Siehe Kapitel 2 „Konstitutive Entscheidungen“.
47 Beispielsweise im Rahmen einer intensiven Mitarbeiterbeteiligung oder der Umwandlung des Unternehmens in eine Stiftung.
48 In Anlehnung an DILLERUP, R., STOI, R.: a. a. O., S. 45.
49 BEA, F. X., HAAS, J.: Strategisches Management, 6. Aufl., Konstanz, München 2013, S. 74.
50 SCHMID, G.: KMU-spezifische Aspekte der Erarbeitung von Marketingkonzeptionen, in: HAAG, P., ROSSMANN, P. (HRSG.): Management kleiner und mittlerer Unternehmen. Strategische Aspekte, operative Umsetzung und Best Practice, Berlin, Boston 2015, S. 154.
51 Siehe Unter-Unterabschnitt 1.2.2.2 „Unternehmensethik“.
52 Siehe Unterabschnitt 1.2.4 „Nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensführung“.
53 Siehe Abschnitt 1.3 „Vision“.
54 Vgl. KOHLERT, H.: Strategische Ausrichtung als Wettbewerbsvorteil, Stuttgart 2018, S. 30.
55 Siehe Unterabschnitt 1.2.5 „Unternehmensphilosophie“.
56 Die Unternehmenspolitik wird im Unterabschnitt 1.6 „Unternehmenspolitik und Leitbild“ näher beschrieben.
57 Vgl. etwa GOGOLL, F., WENKE, M.: Unternehmensethik, Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility, Stuttgart 2017, S. 241, HÄRDLER, J., GONSCHOREK, T. (HRSG.): Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure. Lehr- und Praxisbuch, 6. Aufl., Leipzig 2016, S. 46, POOTEN, H., LANGENBECK, J.: Bilanzanalyse, 4. Aufl., Herne 2016, S. 295, REISINGER, S., GATTRINGER, R., STREHL, F.: Strategisches Management. Grundlagen für Studium und Praxis, 2. Aufl., Hallbergmoos 2017, S. 144.
58 Das Unternehmensleitbild wird im Unterabschnitt 1.6 „Unternehmenspolitik und Leitbild“ vorgestellt.
59 Vgl. ULRICH, H.: Unternehmungspolitik – Instrument und Philosophie ganzheitlicher Unternehmensführung, in: Die Unternehmung, 39. Jg., 1985, Nr. 4, S. 401.
60 Inhalt und Wesen einer Mission werden im Unterabschnitt 1.5 “Mission” erläutert.
61 Das Thema Unternehmenskultur wird im Unterabschnitt 1.7 „Unternehmenskultur“ vertieft.
62 Vgl. HUNGENBERG, H.: a. a. O., S. 38, HUNGENBERG, H., WULF, T.: a. a. O., S.88f.
1.2 Werteorientierte Unternehmensführung
1.2.1 Philosophie, Ethik, Ethos und Werte
Bereits oben wurde die Frage beantwortet, was inhaltlich das normative Management ausmacht. Es geht beim normativen Management neben der Begründung der gesellschaftlichen Legitimität (Sinn und Zweck, Existenzberechtigung, Nutzenstiftung) des Unternehmens und der grundsätzlichen Unternehmensziele um die ethische Grundeinstellung und Ausrichtung des Unternehmens.
Die Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie. Das Wort Philosophie leitet sich aus dem Altgriechischen φιλοσοφία (philosophía) ab und wird mit Liebe zur Weisheit/zur Wissenschaft, Streben nach Bildung/Erkenntnissen, Wissbegier, Wissenschaft, wissenschaftliche Beschäftigung/ Untersuchung übersetzt. Platon hat Philosophieren mit dem „Streben nach Weisheit“ gleichgesetzt.63 Es wird versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen. Es geht somit um das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt. Als Resultat dieses Erkenntnisgewinnungsprozesses kann Philosophie auch als Lehre, Wissenschaft von der Erkenntnis des Sinns des Lebens, der Welt und der Stellung des Menschen in der Welt definiert werden64
Kerngebiete der Philosophie sind die Logik (als die Wissenschaft des richtigen Denkens), die Ethik (als die Wissenschaft des rechten Handelns) und die Metaphysik (als die Wissenschaft der ersten Gründe des Seins und der Wirklichkeit).
Das Wort Ethik leitet sich aus dem Altgriechischen ἔϑος (éthos) ab und lässt sich als Gewohnheit, Sitte, Brauch übertragen, während ἦϑος (aethos) (auch neben Wohnort, Wohnstatt) Charakter, Sinnesart, Sitte bedeutet. Ethik kann als eine methodische, fundierte, prinziporientierte Morallehre mit den beiden Teilaspekten Moral65 (Sitte) und Sittlichkeit (Moralität) bezeichnet werden:66
Darst. 1.201: Moral und Sittlichkeit als Komponenten der Ethik
Während Moral (Sitte) als das faktisch vorhandenes Werte- und Normensystem, das von einer Gesellschaft gemeinsam geteilt wird, verstanden werden kann, bedeutet Sittlichkeit (Moralität) ethisches Denken und Handeln, das sich am Gewissen einer Person orientiert und einem unbedingten Anspruch (dem Guten), dem „Gutseinwollen“, verpflichtet weiß.67
Ethik befasst sich im Wesentlichen völlig wertfrei mit der Herkunft und Begründbarkeit der Moral bzw. moralisch geprägter Aussagen und Ansprüche.68 Im Gegensatz zur „theoretischen Philosophie“ (Logik, Erkenntnistheorie oder Metaphysik) wird Ethik oftmals als „praktische Philosophie“ bezeichnet, da diese sich mit dem Handeln der Menschen auseinandersetzt. Ethik bedeutet das theoretische Herleiten und Gestalten des normativen Grundrahmens eines Menschen zu sich als Individuum (Individualaspekt), zu seinen mit den Mitmenschen (sozialer und gesellschaftlicher Aspekt) und zu seiner ihn umgebenden ökologischen Umwelt (Umweltaspekt). Die praktische Moral (Sitte) gibt dabei vor, was in einer Gesellschaft als gutes oder schlechtes Verhalten betrachtet wird. Während die Ethik offensichtlich bei allen Menschen zumindest im Kern gleich ist, sind von Region zu Region gesellschaftlich und kulturell bedingte Unterschiede in der Moral der Menschen (z. B. hinsichtlich der Rechte und „Wertigkeit“ von Frauen, Korruption) festzustellen.
Da die Adjektive moralisch/sittlich doppeldeutig sind und sowohl im Sinne von ἔϑος als auch von ἦϑος verwendet werden,69 hat sich in der Ethikdiskussion herauskristallisiert, dass das Abstraktum „Ethik“ wie auch das Adjektiv „ethisch“ ausschließlich für die philosophische Wissenschaft vom moralisch-sittlichen Handeln des Menschen vorgesehen werden. Inhalt der philosophischen Ethik ist die wissenschaftliche Reflexion über das ἔϑος, ein kritisches Hinterfragen und ggf. eine Revision von Werturteilen und tradierten Normen.70 Die philosophische (Teil-)Disziplin „Ethik“, manchmal auch als Moralphilosophie