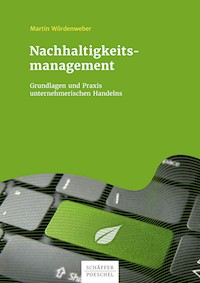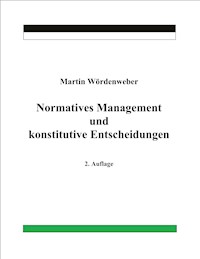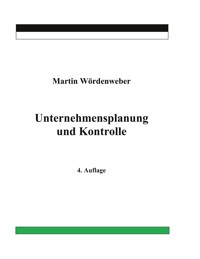
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Jede sinnvolle Entscheidung bezüglich einer bestimmten Aktivität, dazu gehört grundsätzlich auch immer die Unterlassensalternative, setzt ein Ziel voraus. In beiden Fällen, Ziel und Maßnahme/Aktivität, ist es unvermeidlich, vor der Entscheidung über ein Ziel bzw. eine Maßnahme systematisch Alternativen zu suchen und zu finden, sich mit letzteren auseinanderzusetzen, d. h. sie zu untersuchen und zu bewerten sowie die Auswahl der besten Aktivität zu treffen. Diesen Prozess nennt man Planung im engeren Sinne. Eine Planung ohne spätere Kontrolle führt jedoch oft nicht zu einem Optimum. Erst im Zuge einer Kontrolle des geplanten und entschiedenen Ziels bzw. einer Maßnahme wird klar, ob das Ziel das richtige war bzw. die Maßnahme zur Zielerreichung geführt hat. In dieser Schrift wird auf beide Themen grundlegend eingegangen, indem zunächst die Themen Planung und Kontrolle in den Kontext der Unternehmensführung eingeordnet werden. Dabei wird explizit auf die Organisationseinheit "Unternehmen" als auch auf die Führungsebenen und -aufgaben sowie die Anforderungen an eine Führungskraft eingegangen sowie die Rahmenbedingungen der Unternehmensführung beschrieben. Das vorliegende Werk wendet sich an alle Leser, die sich in Studium oder Beruf mit Planung und Kontrolle in einem Unternehmen beschäftigen. Es richtet sich an Dozenten und Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Berufsakademien. Es ist ebenso zum Selbststudium für Führungskräfte geeignet, die einen fundierten theoretischen Background für Planungen und Kontrollen im Unternehmen suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort zur 4. Auflage
Die zunehmende Digitalisierung, verbunden mit Änderungen in immer kürzeren Zeitabständen, erfordert eine neue Auflage. So wurden u. a. entsprechende Abschnitte im Bereich der Planung, insb. Koordination, und Kontrolle aufgenommen.
Die wesentlichen Ergänzungen finden sich im Unterabschnitt 1.6.11 „Instrumente der Planung“ wieder. Dort wurden grundlegende Elemente der strategischen Planung wie Wettbewerbsvorteile, Erfolgspotenziale und Erfolgsfaktoren erläutert sowie die strategischen Geschäftsfelder (SGF) von den strategischen Geschäftseinheiten (SGE) abgegrenzt. Hinzu getreten sind Analyseformen des Unternehmens wie die PIMS-Studie, die Wertschöpfungskettenanalyse, die Ressourcen- und Kompetenzanalyse, die (Produkt-)Lebenszyklusanalyse und die Erfahrungskurvenanalyse. Bei den Portfolio-Analysen wurde die Marktattraktivitäts-Wettbewerbs-Analyse (GE-Matrix) hinzugefügt. Die SWOT-Analyse wurde um ein weiteres Beispiel aus der Praxis ergänzt.
Ein weiterer neuer Block umfasst die planbaren strategischen Handlungsoptionen mit der Definition des Strategiebegriffes, der Vorstellung der Arten von Strategien sowie die Unternehmensstrategien, Geschäftsbereichsstrategien und Funktionsbereichsstrategien.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet.1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.
Für die zahlreichen Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge möchte ich mich bei den Studierenden und Ehemaligen der HSBI Hochschule Bielefeld bedanken. Zum Gelingen des Buches hat auch Frau Prof. Dr. Ricarda Hildebrand-Peitzmeier von der EAH Jena mit zahlreichen Diskussionen beigetragen.
Für Anregungen, die der weiteren inhaltlichen und didaktischen Verbesserung dienen, unter der E-Mail-Adresse [email protected], bin ich dankbar.
Büren, im März 2025
Martin Wördenweber
1 Eine ausführliche Begründung und Erläuterung dieses Themenkomplexes finden Sie bspw. bei WÖRDENWEBER, M.: Leitfaden für wissenschaftliche Arbeiten. Praktikums-, Seminar-, Bachelor-und Masterarbeiten sowie Dissertationen, 3. AufL, Berlin 2024, S. 164-172.
Vorwort zur 3. Auflage
Der Unterabschnitt „Instrumente der Planung“ wurde im Themengebiet „Analyse der Konkurrenten“ deutlich erweitert. Des Weiteren wurde neben der BCG-, Gap- und SWOT-Analyse die Vorstellung der Prognoseinstrumente neu in das Buch aufgenommen.
Zur Verwendung der geschlechtsspezifischen, meist männlichen Schreibweise sei folgender Hinweis erlaubt: Es ist schreibtechnisch deutlich einfacher, nur die männliche Form zu verwenden, anstatt der gelegentlich gebrauchten Ausdrücke wie Autorin, Autor*in, Autor/in, Autor:in, Autor oder Autorin, Studentin, Student/in, Student*in, Student oder Studentin etc. Zweitens wäre die vorstehende Verwendung grammatikalisch falsch. Drittens lässt sie sich in sehr vielen Fällen wie z. B. beim Arzt nicht einheitlich anwenden: Eine Ärztin gibt es nicht. Viertens führt die Ausführung zu einer erschwerten Les- und Erfassbarkeit des Textes. Zuletzt ist vorstehende Art der genderorientierten (?) Schreibweise angesichts der drei Geschlechter (Männer, Frauen, Intersexuelle) ohnehin nicht korrekt und ethisch bedenklich, da sie nicht alle Formen der sexuellen Orientierung gleichwertig nebeneinanderstellt; die Angehörigen des dritten Geschlechts werden zu reinen Symbolen herabgesetzt. Eine Lösung könnte in der Findung neuer Sprachformen liegen. Was aber etliche neue Probleme schafft. Denn dann brauchten wir bei detaillierter Betrachtung (neben dem Neutrum) mind. vier Formen: m, w, d und ein übergeordnetes Substantiv für Personen. Infolgedessen opfern wir nicht nur die hergebrachte deutsche Sprache, sondern schaffen wie im Lateinischen oder Griechischen eine noch komplexere Sprache, deren Anwendbarkeit und Beherrschbarkeit die nächsten Fragen aufwirft. (So würden etwa bestimmte gesellschaftliche Gruppen (negativ) diskriminiert, da sie schon allein rein sprachlich überfordert sein könnten.) Es sei zudem darauf hingewiesen, dass das Sprechen mit einer zeitlichen Lücke, etwa beim „Gender-Sternchen“ eine Zumutung für die vielen Hörgeschädigten darstellt. Die Nutzung der vorherrschenden Ausdrucksweise, die oft das männliche Genus beinhaltet, ist in dieser Monografie lediglich als Kurzform für die drei Geschlechter zu verstehen. Insofern mögen Leserinnen und Intersexuelle mir verzeihen und ein wenig Verständnis aufbringen.
Für die zahlreichen Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge möchte ich mich bei den Ehemaligen der Fachhochschule Bielefeld, allen voran Herrn M. A. Daniel Jockwitz, bedanken. Zum Gelingen des Buches hat meine wissenschaftliche Hilfskraft, Frau cand. M. A. Sophie Rehlaender, mit außerordentlichem Fleiß und kreativen Ideen beigetragen.
Für Anregungen, die der weiteren inhaltlichen und didaktischen Verbesserung dienen, unter der E-Mail-Adresse [email protected], bin ich dankbar.
Büren, im Juli 2022
Martin Wördenweber
Vorwort zur 1. Auflage
Planlosigkeit erreicht spielend Ziele – anderer.2
Jede sinnvolle Entscheidung bezüglich einer bestimmten Aktivität (dazu gehört grundsätzlich auch immer die Unterlassensaltemative) setzt ein Ziel voraus. Sicher, auch ohne ein Ziel können - und müssen oft, meist auf Drängen Externer, Entscheidungen getroffen werden. Allerdings könnte man ohne Ziel auch gleich würfeln oder eine Münze werfen oder anderweitig zufällige Ergebnisse bewirken. Aber eine derartige „fremdbestimmte“ Entscheidung kann nicht im Sinne eines rational handelnden Menschen, einer Gruppe oder einer Organisation wie das Unternehmen sein.
Dem Vorstehenden folgend ist ein Ziel die Grundlage jeder sinnstiftenden Entscheidung. Somit stellen sich u. a. die Fragen, welche Ziele sich (überhaupt) anbieten und wie man diese finden kann, welches Ziel das richtige ist bzw. wie man bei Vorliegen mehrerer Ziele agiert. Diese und weitere Fragen soll die vorliegende Monografie beantworten.
Grundsätzlich ist also zunächst eine Entscheidung zu treffen, welches Ziel angestrebt werden soll. Ist darüber ein Beschluss gefasst, gilt es, diejenigen Maßnahmen zu finden, mittels derer das Ziel erreicht werden kann.
In beiden Fällen (Ziel und Maßnahme/Aktivität) ist es unvermeidlich, vor der Entscheidung über ein Ziel bzw. eine Maßnahme systematisch Alternativen zu suchen und zu finden, sich mit letzteren auseinanderzusetzen, d. h. sie zu untersuchen und zu bewerten sowie die Auswahl der besten Aktivität zu treffen. Diesen Prozess nennt man Planung (i. e. S.). Durch sie wird das zukünftige Handeln durchdacht, sie ist das gedankliche Durchdringen der Zukunft. Denn sowohl ein Ziel als auch eine Entscheidung über eine Maßnahme ist immer zukunftsbezogen. Am Ende einer solchen Planungsphase steht ein Plan und die Entscheidung an, ob dieser Plan umgesetzt wird oder nicht (Planungsphase i. w. S.). – Unterlässt man jedoch die Planung, gleich ob sich diese auf die Ziele oder auf die Maßnahmen zur Zielerreichung bezieht, wird es so sein, dass man fremdbestimmt den Zielen anderer folgt. Es ist oft mehr als fraglich, ob diese Ziele mit den eigenen, so denn man eines hat, kompatibel sind bzw. ob die fremdbestimmten Maßnahmen zum eigenen Wohl gerieren. Gleiches gilt in etwa, ließe man den Zufall über eigene Ziele und Aktivitäten entscheiden. 3
Planung ohne Kontrolle ist [... ] sinnlos, Kontrolle ohne Planung unmöglich.3
Diese elementare Feststellung von Wild verdeutlicht, dass eine Planung ohne spätere Kontrolle nicht zu einem Optimum führen kann. Diese Denkweise impliziert, dass es sich i. d. R. um einen Regelkreis von Planung und Kontrolle handelt, denn erst wenn die Kontrolle eines geplanten (und entschiedenen) Ziels bzw. einer Maßnahme erfolgt ist, wird klar, ob das Ziel das richtige war bzw. die Maßnahme zur Zielerreichung geführt hat. Je nach Ausgang der Kontrolle entscheidet sich, ob ein anderes Ziel gesucht werden muss bzw. eine andere Aktivität besser zur Zielerreichung beiträgt. Insofern versteht es sich von selbst, dass eine Kontrolle nur dann durchgeführt werden kann, wenn vorab eine entsprechende Planung vorgenommen und darüber entschieden wurde. (Anmerkung: Eine Planung ohne abschließende Entscheidung ist sinnlos; man hätte sich letztere ersparen können – unabhängig davon, ob man sich für oder gegen einen Plan entscheidet oder ggf. eine Alternativplanung („Schubladenplanung“) vomimmt.) Planung und Kontrolle bilden somit eine untrennbare Einheit; Kontrolle ist die „Zwillingsfunktion der Planung“.4
In dieser Schrift wird auf beide Themen grundlegend eingegangen, indem zunächst die Themen Planung und Kontrolle in den Kontext der Unternehmensführung eingeordnet werden. Dabei wird explizit auf die Organisationseinheit „Unternehmen“ als auch auf die Führungsebenen und -aufgaben sowie die Anforderungen an eine Führungskraft eingegangen. Nachdem die Rahmenbedingungen der Unternehmensführung beschrieben worden sind, wird das Themengebiet „Planung“ intensiver bearbeitet. Daran schließt sich (nahezu zwangsläufig) die „Kontrolle“ an.
Für die zahlreichen Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge möchte ich mich bei den Studierenden (cand. B. A.) der Fachhochschule Bielefeld, insbesondere Frau Stefanie Kramp, Frau Laura Müller, Frau Isabel Panhorst, Frau Lara Steggewentz. Frau Bernadett Weese herzlich bedanken. Ebenfalls bedanken darf ich mich bei meiner wissenschaftlichen Hilfskraft, Herrn Daniel Jockwitz, B. A. und meinen studentischen Hilfskräften, Frau cand. B. A. Jennifer Mersch und Frau cand. B. A. Tina von dem Brinke, Frau cand. B. A. Stephanie Bertram, die mit außerordentlichem Fleiß und kreativen Ideen zum Gelingen des Buches beigetragen haben.
Für Anregungen, die der weiteren inhaltlichen und didaktischen Verbesserung dienen, bin ich unter der E-Mail-Adresse [email protected] dankbar.
Büren, im April 2019
Martin Wördenweber
2 Manfred Hinrich (1926-2915), Dr. phil., deutscher Philosoph, Philologe, Lehrer, Journalist, Kinderliederautor, Aphoristiker und Schriftsteller.
3 WILD, J.: Grundlagen der Untemehmensplanung, 4. Aufl., Opladen 1982, S. 44.
4 DELFMANN, W., REIHLEN, M.: Planung, in: KÜPPER, H.-U., WAGENHOFER, A. (HRSG.): Handwörterbuch Untemehmensrechnung und Controlling, 4. Aufl., Stuttgart 2002, S. 1440.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1 Grundlagen der Unternehmensplanung und -kontrolle
1.1 Unternehmen, Betrieb, Firma, Gewerbebetrieb
1.1.1 Unternehmen
1.1.2 Betrieb
1.1.3 Firma
1.1.4 Gewerbebetrieb
1.2 Unternehmensführung und Managern ent
1.2.1 Unternehm ensführung
1.2.1.1 Führung, Macht, Herrschaft, Leitung
1.2.1.2 Definition Unternehmensführung
1.2.1.3 Dimensionen der Unternehmensführung
1.2.2 Management
1.2.2.1 Definition Managern ent
1.2.2.2 Aufgaben des Managernents
1.2.2.3 Führungsprozess
1.2.2.4 Handlungsebenen der Unternehmensführung
1.2.2.5 Integriertes System der Unternehmensführung
1.3 Führungsebenen und -aufgaben
1.3.1 Top-Management
1.3.2 Middle-Management
1.3.3 Lower-Management
1.4 Anforderungen an eine Führungskraft
1.4.1 Definition Führungskraft
1.4.2 Einordnung der Führungsbedeutung
1.4.3 Kompetenzen von Führungskräften
1.4.3.1 Fachkompetenz
1.4.3.2 Methodenkompetenz
1.4.3.3 Sozial- und Führungskompetenz
1.4.3.4 Lernkompetenz
1.4.3.5 Individual-/Personalkompetenz
1.4.4 Regeln für Führungskräfte
1.4.5 Anforderungen an Führungskräfte in Abhängigkeit vom Reifegrad des Unternehmens
1.5 Rahmenbedingungen der Unternehmensführung
1.6 Planung
1.6.1 Notwendigkeit der Planung, Planungsbegriffe und Prognose
1.6.2 Kennzahlen
1.6.3 Planungsgrundsätze
1.6.3.1 Rechtliche Grundlagen
1.6.3.2 Grundsatz der Vollständigkeit
1.6.3.3 Grundsatz der Genauigkeit
1.6.3.4 Grundsatz der Flexibilität
1.6.3.5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
1.6.3.6 Grundsatz der Kontrollierbarkeit
1.6.3.7 Grundsatz der Einfachheit und Klarheit
1.6.3.8 Grundsatz der Realisierbarkeit
1.6.4 Planungsproblematik
1.6.5 Planungsarten
1.6.5.1 Planung nach der Datensituation
1.6.5.2 Planung nach dem Inhalt
1.6.5.3 Planung nach den Funktionsbereichen
1.6.5.4 Planung nach dem Integrationsgrad
1.6.5.5 Planung nach dem Zeitraum
1.6.5.6 Planung nach den Planungsebenen
1.6.6 Merkmale und Elernente eines Plans
1.6.7 Koordination der Planung
1.6.7.1 Vertikale Koordination
1.6.7.1.1 Maßnahmen zur Lösung des vertikalen Koordinationsproblems
1.6.7.1.2 Top-down-Planung
1.6.7.1.3 Bottom-up-Planung
1.6.7.1.4 Gegenstromverfahren
1.6.7.2 Horizontale Koordination
1.6.7.2.1 Simultanplanung
1.6.7.2.2 Sukzessivplanung
1.6.7.3 Zeitliche Koordination
1.6.7.3.1 Koordination von Plänen mit unterschiedlichen Zeithorizonten
1.6.7.3.2 Planungsrhythmus
1.6.7.4 Koordination der Verwendung nach
1.6.7.5 Koordination im digitalen Kontext
1.6.8 Planungsträger
1.6.8.1 Selbstplanung
1.6.8.2 Unternehmensführung
1.6.8.3 Zentrale Planungsträger
1.6.8.4 Controller
1.6.8.5 Bereichsleiter
1.6.8.6 Planungsträger entlang der Linie
1.6.8.7 Planungsteams
1.6.8.8 Ausschüsse und Kommissionen
1.6.8.9 Externe Planungsträger
1.6.8.10 Auswahl der Planungsträger
1.6.9 Planungshandbuch
1.6.9.1 Aufgaben eines Planungshandbuchs
1.6.9.2 Aufbau und Inhalt eines Planungshandbuchs
1.6.10 Aufgaben der Planungsphasen eines Planungsprozesses
1.6.10.1 Anregungsphase
1.6.10.1.1 Lageanalyse
1.6.10.1.2 Lageprognose
1.6.10.1.3 Problemlücke
1.6.10.2 Such- und Orientierungsphase
1.6.10.2.1 Alternativensuche
1.6.10.2.2 Kreativitätstechniken
1.6.10.2.3 Prognose
1.6.10.3 Optimierungs- und Auswahlphase
1.6.10.3.1 Bewertungsprozess
1.6.10.3.2 Entscheidung
1.6.11 Instrumente der Planung
1.6.11.1 Analyseinstrumente für langfristige Planungszeiträume
1.6.11.1.1 Grundlagen langfristiger Analysen
1.6.11.1.1.1 Wettbewerbsvorteile, Erfolgspotenziale und Erfolgsfaktoren
1.6.11.1.1.2 Arten langfristiger Analysen
1.6.11.1.2 Analyse der Makroumwelt
1.6.11.1.3 Analyse der Mikroumwelt
1.6.11.1.3.1 Branchenstrukturanalyse
1.6.11.1.3.2 Marktformanalyse
1.6.11.1.3.3 Analyse der Konkurrenten
1.6.11.1.4 Analyse des Unternehmens
1.6.11.1.4.1 Strategische Geschäftsfelder (SGF)/ Strategische Geschäftseinheiten (SGE)
1.6.11.1.4.2 Gap-Analyse
1.6.11.1.4.3 PIMS-Studie
1.6.11.1.4.4 Wertschöpfungskettenanalyse
1.6.11.1.4.5 Ressourcenorientierte Analyse
1.6.11.1.4.6 (Produkt-)Lebenszyklusanalyse
1.6.11.1.4.7 (Kosten-)Erfahrungskurvenanalyse
1.6.11.1.5 Portfolio-Analysen
1.6.11.1.5.1 Grundlagen der Portfolio-Analyse
1.6.11.1.5.2 Marktanteils-Marktwachstums-Analyse (BCG-Analyse)
1.6.11.1.5.3 Marktattraktivitäts-Wettbewerbs-Analyse (GE-Matrix)
1.6.11.1.6 SWOT-Analyse
1.6.11.2 Prognoseinstrumente
1.6.11.3 Planbare strategische Handlungsoptionen
1.6.11.3.1 Strategiebegriff
1.6.11.3.2 Arten von Strategien
1.6.11.3.3 Unternehmensstrategien
1.6.11.3.3.1 Norm Strategien für die BCG-Matrix
1.6.11.3.3.2 Norm Strategien für die GE-Matrix
1.6.11.3.3.3 Wachstumsstrategien
1.6.11.3.3.4 Stabilisierungsstrategien
1.6.11.3.3.5 Desinvestitionsstrategien
1.6.11.3.4 Geschäftsbereichsstrategien
1.6.11.3.4.1 Marktorientierte Strategien
1.6.11.3.4.2 Ressourcenbasierte Strategien
1.6.11.3.5 Funktionsbereichsstrategien
1.6.11.4 Bewertungsinstrumente
1.6.12 Planung im digitalen Kontext
1.6.13 Grenzen der Planung
1.7 Kontrolle
1.7.1 Zusammenhang von Planung und Kontrolle
1.7.2 Kontrollprozess
1.7.3 Kontrollzeitpunkte
1.7.4 Kontrollobjekte
1.7.5 Kontrollgröße und Vergleichswert
1.7.6 Bewertung von Kennzahlen und Benchmarking
1.7.7 Darstellung und Bewertung von Abweichungen
1.7.8 Abweichungsursachenanalyse
2 Planung und Kontrolle von Zielen
2.1 Funktionen von Zielen
2.2 Zielhierarchie des Unternehmens und Fristigkeit von Zielen
2.3 Ziel-Führungsprozess
2.4 Zielarten
2.5 Zieldimensionen und -eignung
2.6 Zielbeziehungen und Zielsystem
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
$
Dollar
€
Euro
§
Paragraf
§§
Paragrafen
Prozent
und
A
Aktiva
AG
Aktiengesellschaft
a. a. O.
am angegebenen Ort, am angeführten Ort
AGG
Allgem eines Gleichbehandlungsgesetz
AIDA
Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Bedürfnis), Action (Kauf)
AktG
Aktiengesetz
altgriech.
altgriechisch
Anm.
Anmerkung
AO
Abgabenordnung
AR
Aufsichtsrat
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
Art.
Artikel
Aufl.
Auflage
AWG
Außenwirtschaftsgesetz
AZ
Aktenzeichen
BAFA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BAG
Bundesarbeitsgericht
BB
Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
Bd.
Band
BDU e. V.
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e. V.
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BSI
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
bspw.
beispielsweise
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CARB
California Air Resources Board
cbm
Kubikmeter
CC
Corporate Citizenship
CEO
Chief Executive Officer
cm
Zentimeter
CO2
Kohlendioxid
CSR
Corporate Social Responsibility
Darst.
Darstellung
DAX
Deutscher Aktienindex
DDR
Deutsche Demokratische Republik
d. h.
das heißt
Diss.
Dissertation
DNK
Deutscher Nachhaltigkeitskodex
DrittelbG
Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz)
Eds.
Editors (Herausgeber)
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
EK
Eigenkapital
EBO
Employee-Buyout
EPA
(United States) Environmental Protection Agency
EStG
Einkomm ensteuergesetz
etc.
et cetera
EuGH
Europäischer Gerichtshof
e. V.
eingetragener Verein
evtl.
eventuell
f. bzw. ff.
folgende, fortfolgende
FCPA
United States Foreign Corrupt Practices Act (Anti-Korruptions-Gesetz)
F&E
Forschung und Entwicklung
g
Gramm
G
Gewinn
gem.
gemäß
GeschGehG
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Geschäftsgeheimhaltungsgesetz)
GG
Grundgesetz
ggf-
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
HGB
Handelsgesetzbuch
Hrsg.
Herausgeber
IAS
International Accounting Standards
i. d. R.
in der Regel
IFRS
International Financial Reporting Standards
inkl.
inklusiv(e)
IoT
Internet of Things (Internet der Dinge)
IPO
Initial Public Offering (Erstemission einer Aktie)
i. S. d.
im Sinne des/der
i. S. v.
im Sinne von
IT-Sicherheitsgesetz
Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme
i. V. m.
in Verbindung mit
i. w. S.
im weiteren Sinne
Jg.
Jahrgang
Kap.
Kapitel
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KWG
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)
kWh
Kilowattstunde
lat.
lateinisch
1t.
laut
m3
Kubikmeter
M&A
Mergers and Acquisitions
m. a. W.
mit anderen Worten
MBLM
Mindestbestand an liquiden Mitteln
MBO
Managern ent-Buy out
MbO
Managernent by Objectives
Mio.
Million(-en)
MitBestG
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz)
MontanMitbestG
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (Montanm itbestimmungsgesetz)
Mrd.
Milliarde(n)
n.
nach
NGO
Non-Governmental Organizations (Nichtregierungsorganisation,-
NJW
nichtstaatliche Organisation) Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NPO
Non-Profit-Organization (Nicht gewinnorientierte Organisation)
Nr.
Nummer
o. g.
oben genannt(-e, -er)
o. O.
ohne Ortsangabe
o. V.
ohne Verfasser
OWiG
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz)
P-
page (Seite)
PEST
Political, Economical, Social, Technological
PESTLE
Political, Economical, Social, Technological, Legal, Environmental
PIMS
Profit Impact of Market Strategies
POLC
Planning (Planung), Organizing (Organisation), Leading (Mitarbeiterführung), Controlling (Controlling)
POSDC
Planning (Planung), Organizing (Organisation), Staffing (Personaleinsatz), Directing (Führung), Controlling (Kontrolle und Korrektur)
POSDCoRB
Planning (Planung), Organizing (Organisation), Staffing (Personaleinsatz), Directing (Führung), Co-ordinating (Koordination), Reporting (Berichtswesen), Budgeting (Budgetierung)
qm
Quadratmeter
ROI
Return on Investment
S.
Seite
SBU
Strategie Business Unit (Strategische Geschäftseinheit)
SEC
United States Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht)
s. O.
siehe oben
sog.
so genannt(-e, -er, -en)
sonst.
sonstige(-r)
SprAuG
Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten (Sprecherausschussgesetz)
SGE
Strategische Geschäftseinheit
SGF
Strategisches Geschäftsfeld
St.
Stück, Steuern
StGB
Strafgesetzbuch
Std.
Stunde(-n)
strat.
strategisch(-e, -es)
SWOT
Strength, Weakness, Opportunities, Threats
t
Zeit, Jahr(-e), Tonne(-n)
Tab.
Tabelle
Tsd.
Tausend
U
Umsatz
u.
und
u. a.
unter anderem, und andere
Um
Universität
USP
Unique Selling Proposition (Alleinstellungsmerkmal)
UStG
Umsatzsteuergesetz
usw.
und so weiter
u. U.
unter Umständen
u. v. m.
und vieles mehr
Verf.
Verfasser
vgl.
vergleiche
Vorj.
Vorjahr
VRIO
Value (Wert), Rarity (Seltenheit), Inimitability (Nicht-Imitierbarkeit), Organization (Organisation)
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
W
Woche
WiSt
Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift)
WpHG
Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetzt)
z. B.
zum Beispiel
ZfbF
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
z. T.
zum Teil
1 Grundlagen der Unternehmensplanung und -kontrolle
1.1 Unternehmen, Betrieb, Firma
Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Titel dieses Buches „Unternehmensplanung und Kontrolle“. Planung und Kontrolle sind zwei wesentliche Aufgaben der Unternehmensführung, wie dies im Verlauf dieser Monografie (Unter-Unterabschnitt 1.2.2.2 „Aufgaben des Managements“) noch deutlich wird. Es geht also um die Führung eines Unternehmens. Um auf die Führung, speziell eines Unternehmens, näher eingehen zu können, ist zunächst der Begriff „Unternehmen“ zu klären.
Sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der Fachliteratur wird der Unternehmensbegriff kontrovers definiert. Je nach Disziplin bzw. fachspezifischer Ausrichtung findet sich eine oft divergierende Auffassung, wie das Erfahrungsobjekt „Unternehmen“ beschrieben werden kann oder sollte. Dies liegt weniger an der unterschiedlichen Bezeichnung, sondern vielmehr an der unterschiedlichen Funktion (Zweck) und Ausgestaltung des Begriffs in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen oder der Gesetzgebung. Die Auseinandersetzung mit dem Unternehmensbegriff findet in diesem ersten Abschnitt statt, um letztlich zu einer Definition zu gelangen, mit der in diesem Werk gearbeitet werden kann.
Da der Untemehmensbegriff oft im Kontext mit den Begriffen „Unternehmung“, „Betrieb“ und „Firma“ verwendet wird, werden diese Begriffe näher untersucht. Es ist zu klären, ob und bei welchen Begriffen es sich um Synonyme handelt. Zusätzlich soll für jeden der abzugrenzenden Begriffe eine eigene Definition aufgestellt werden.
Zunächst sollen fachübergreifend die Begriffe „Unternehmen“ und „Betrieb“ analysiert werden. Die Abgrenzung zwischen den Begriffen „Unternehmen“ und „Betrieb“ ist nicht einheitlich. Es bieten sich folgende Varianten an:
Darst. 1.101: Abgrenzungsmöglichkeiten Unternehmen und Betrieb
1.1.1 Unternehmen
Zuerst soll ausgeführt werden, was im Allgemeinen unter einer Unternehmung zu verstehen ist. Grundsätzlich wird das Wort „Unternehmung“ aus dem Verb „unternehmen“ gebildet. Hiermit ist gemeint, dass der Mensch auf Dauer eine Tätigkeit ausübt, um einen Zweck zu verfolgen, der über diese Tätigkeit hinausgeht.5
Im Rahmen der Suche nach einer Definition für den Begriff „Unternehmen“ werden nachfolgend etliche Ausführungen in der Literatur näher beleuchtet.
In der Volkswirtschaftslehre wird das Unternehmen, dessen Zweck des Wirtschaftens in der Versorgung der Haushalte mit Konsumgütem zur Bedürfnisbefriedigung liegt, einerseits als produzierende Wirtschaftseinheit verstanden; andererseits werden u. a. Faktorleistungen, die die Unternehmungen von den Haushalten nachfragen (Arbeits-, Sachkapital- und Bodenleistungen), eingesetzt.6 Unter Produktion wird nicht nur die industrielle oder handwerkliche Produktion verstanden, sondern allgemeiner die Erzeugung wirtschaftlicher Güter, zu denen auch Dienstleistungen gehören. Demnach gelten als Unternehmen „auch das Transport-, das Lebensmitteleinzelhandels- und das Friseurgeschäft, ebenso die Rechtsanwalts- und die Arztpraxis.“7 Nach Turin „erscheint der Unternehmer als der Hauptagent der Produktion, als derjenige, der das Gebilde, das die Unternehmung darstellt, in den Markt, den volkswirtschaftlichen Gesamtprozess, einordnet.“8
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht beschreibt Gutenberg, der als Begründer der modernen deutschen Betriebswirtschaftslehre gilt, drei „Systemindifferente Tatbestände“, die allen Betrieben – unabhängig vom Wirtschaftssystem – gemeinsam sind:9
der kombinierte Einsatz von Produktionsfaktoren,
die Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips
10
und
die Einhaltung eines finanziellen Gleichgewichts.
11
Hinsichtlich der Betriebe differenziert Gutenberg zwischen Betrieben in einer Marktwirtschaft, die er als Unternehmungen bezeichnet und Betrieben (im engeren Sinne) in einer Planwirtschaft, da die vorgenannten Betriebe, abhängig von dem jeweiligen Wirtschaftssystem („systembezogene Tatbestände“) sind, in dem sie agieren. Während bei ersteren das erwerbswirtschaftliche Prinzip (= Gewinnmaximierung) und das Autonomieprinzip sowie das Privateigentum die Basis bilden, gelten für die Betriebe in der Planwirtschaft das Gemeineigentum, die Produktion nach einem zentralen staatlichen Plan (Organprinzip) und die Erfüllung dieses Plans als grundsätzliche Kennzeichen. Das erwerbswirtschaftliche Prinzip geht davon aus, „dass volkswirtschaftlich die beste Versorgung mit [Sach]gütern und Dienstleistungen erreicht [wird], wenn jedes einzelne Unternehmen versucht, auf die Dauer einen möglichst großen Gewinn auf das eingesetzte Kapital zu erzielen.“12 Das Autonomieprinzip heißt, dass die Entscheidungen von Unternehmen nicht durch unternehmensexteme Instanzen vorgegeben sind. Aus dem Prinzip des Privateigentums wird der Anspruch auf Alleinbestimmung abgeleitet. Des Weiteren findet sich bereits in seiner Habilitationsschrift die Idee des Zusammenhangs der betrieblichen Teilbereiche Produktion, Finanzierung und Absatz (und Beschaffung). Gutenberg notiert 1929: „So gesehen, kann man die Unternehmung als einen Komplex von Quantitäten bezeichnen, die in gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen (funktional verbunden sind) ... “13
Bei Gutenberg ist zu erkennen, dass der Betrieb dem Unternehmen (als spezieller Ausprägung des kapitalistisch-liberalen Wirtschaftssystems) übergeordnet ist.
Die Differenzierung zwischen Unternehmen in der Marktwirtschaft als einer speziellen Betriebsform und zentralwirtschaftlichen Betrieben (= Organbetrieb) hat in den letzten Jahrzehnten – mit dem Niedergang des Sozialismus14 – an Bedeutung verloren. Daher wird heute üblicherweise die Unternehmung als Oberbegriff und autonome rechtlich-wirtschaftliche Einheit angesehen.
Im Gegensatz zu Gutenberg zählt Kosiol das erwerbswirtschaftliche Prinzip und das Prinzip des Privateigentums nicht zu den konstitutiven Merkmalen einer Unternehmung, da es Unternehmen gibt, die nicht nach Gewinnmaximierung streben und/oder nicht im Privateigentum stehen.15 Insofern trennt Kosiol zwischen öffentlichen Unternehmen16 und privaten Unternehmungen.
Laut Seyffert wird eine Unternehmung von einem Unternehmer geleitet, der freiwillig ein Marktrisiko auf sich nimmt, um fremde Bedarfe zu decken und sich bei diesem Vorhaben stets an die kaufmännischen Grundsätze hält.17 Becker führt aus, dass „die Unternehmung oder das Unternehmen ... die rechtliche und wirtschaftliche Einheit einer nach dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip tätigen Institution [darstellt]“18. Interessant ist an dieser Stelle, dass der Autor die Unternehmung und das Unternehmen in einem Zuge nennt und diese auf die gleiche Weise definiert. Als Ergänzung hierzu erwähnt er in seinen Fußnoten, dass beide Begriffe synonym verstanden werden; die Verwendung des einen oder des anderen jedoch nur auf Gewohnheiten beruht. Rieger spricht in seinem Buch zum Beispiel erst über die Unternehmung, verwendet dann kurz den Begriff des Unternehmens und wechselt dann wieder zu ersterem Begriff.19 Aufgrund der vorstehenden Befunde sollen die Begriffe „Unternehmung“ und das „Unternehmen“ als Synonyme verwendet werden.
Albers betrachtet das Unternehmen als „produzierende Wirtschaftseinheit in ganzheitlicher Sicht“.20 Dies umfasst die Kombination der Produktionsfaktoren, um Sachgüter und Dienstleistungen herzustellen, aber auch die finanziellen Mittel, die zur Erstellung der Sachgüter und Dienstleistungen erforderlich sind, und die rechtlichen Erscheinungsformen des Unternehmens. Für die weitere Definition des Unternehmens als produzierende Wirtschaftseinheit in ganzheitlicher Sicht, wird zwischen drei verschiedenen Fassungen unterschieden.
Erstens beinhaltet die engste Fassung des Unternehmensbegriffes die für den anonymen Markt produzierenden großen Erwerbswirtschaften. Diese Erwerbswirtschaften erstellen Güter für den anonymen Markt in Massenproduktion und aus diesem Grund werden kleinere Produktionseinheiten nicht mit in den Unternehmensbegriff eingeschlossen. Es werden nicht mehr nur die privaten Unternehmen betrachtet, sondern ebenso die öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen. In diesem Zusammenhang treten also eher die Probleme der großen Erwerbswirtschaften auf, die sowohl organisatorische, finanzielle und absatzwirtschaftliche Aspekte umfassen können.21
Zweitens umfasst der Begriff in der weiteren Fassung alle erwerbswirtschaftlich orientierten Produktionseinheiten, sodass die Zielsetzung der Unternehmen im Mittelpunkt steht. Dieses Ziel heißt nicht zwingend Gewinnmaximierung, aber stützt sich trotzdem weitestgehend auf die Gewinnerzielung. In der älteren Literatur wird entweder von einem Unternehmer wie in der Privatwirtschaft ausgegangen, der durch die Kombination von Faktoren Unternehmergewinne erzielt oder von einem Unternehmer, der gleichzeitig Geschäftsführer und Kapitalgeber des Unternehmens ist, wobei er dadurch auch das Risiko trägt. Da dies aber nicht mehr zeitgemäß ist und den Anforderungen der neueren Unternehmensformen nicht mehr gerecht wird, spricht man nun oft von einer Trennung von Eigentum und Geschäftsführung, was bedeutet, dass es zum einen einen (oder mehrere) Kapitalgeber gibt, der das Risiko trägt und somit auch die erzielten Gewinne erhält und zum anderen einen Geschäftsführer, der das Unternehmen leitet und dafür ein Gehalt bekommt, das unternehmerische Risiko allerdings nicht tragen muss. Charakteristisch für das Unternehmen ist nicht nur das erwerbswirtschaftliche Prinzip, sondern auch die innere und äußere Autonomie kennzeichnen dieses. Die äußere Autonomie besagt, dass das Unternehmen selbst über Bedarf und Deckung in einer Volkswirtschaft entscheidet und die innere Autonomie bezieht sich darauf, dass der Anteilseigner ein Alleinbestimmungsrecht besitzt, welches er auch auf die von ihm gewählten Geschäftsführer übertragen kann. Auch bei dieser Auffassung werden öffentlich-rechtliche und gemischtwirtschaftliche Wirtschaftseinheiten von dem Unternehmensbegriff eingeschlossen.22
Drittens werden die produzierenden Wirtschaftseinheiten ohne jede Einschränkung in die weiteste Fassung des Unternehmensbegriffs aufgenommen. Unternehmen wollen fremde Bedarfe decken, sind wirtschaftlich selbstständig und übernehmen freiwillig ein Marktrisiko. In diesem Fall werden alle Einheiten, die werteschaffend agieren, als Unternehmen angesehen und somit gilt dies auch für die Landwirtschaft und die freien Berufe, die sonst aus dem Unternehmensbegriff ausgeschlossen werden. Die Haushalte zählen allerdings auch hier nicht zu den Unternehmen dazu, da sie nicht produzieren, sondern konsumieren.23
Die Privatwirtschaftslehre befasst sich nur mit privaten oder Einzelwirtschaften, weshalb diese Definition gesondert von der betriebswirtschaftlichen betrachtet wird. Wenn hier von einer Unternehmung gesprochen wird, wächst der Horizont über das Wirtschaften im Betrieb hinaus und umfasst auch geldliche und finanzielle Aspekte. Das Unternehmen wird von Rieger als „eine geschlossene wirtschaftliche Einheit, die zum Zwecke des Gelderwerbs für ihre Rechnung und Gefahr Güter herstellt oder vertreibt“24 bezeichnet. Die Besonderheiten bei einem Unternehmen sind, dass die Höhe der Produktion geschätzt wird und kein direkter Kontakt zum Verbraucher besteht, der diese Daten liefern könnte. Es entstehen bestimmte Risiken und Gefahren, die der Unternehmer tragen muss. Es ist für ihn nicht möglich, diesen Risiken und Gefahren ohne weiteres zu entgehen und wenn es so wäre, würde das Unternehmen kein Unternehmen mehr sein. Ein Unternehmen stellt Waren und Dienstleistungen zur Verfügung, ohne direkt beauftragt worden zu sein, weshalb Preis, Absatzmenge und Absatzzeitraum ungewiss sind. All das wird unternommen, um Gewinne zu erzielen. Das Unternehmen gilt als Erwerbswirtschaft und um dieses Ziel zu verfolgen, müssen Produktionsfaktoren und Kapital zur Verfügung stehen. Hiermit wird ein anderer wichtiger Punkt aufgefasst, denn der Unternehmer muss in das Unternehmen Kapital in nennenswerter Höhe investieren, ohne zu wissen, ob und wie viel er daran verdient. Auch hier entsteht für ihn ein sehr hohes Risiko, da zum Beispiel Investitionen in feste Anlagen getätigt werden müssen, an die der Unternehmer vorerst gebunden sein wird. Gleiches Risiko entsteht in Bezug auf umlaufende Mittel, da, wie zuvor erwähnt, nicht sicher ist, ob und wann der Unternehmer die Waren und Dienstleistungen seines Unternehmens verkaufen kann. Trotzdem muss er neues Umlaufvermögen beschaffen, um neue Einheiten produzieren zu können. Darüber hinaus bestehen auch Produktionsrisiken. Zudem können sich Preise ändern und Neuerungen auftreten. Auch der Geschmack der Verbraucher kann sich gegensätzlich entwickeln. Der Unternehmer kann sich also niemals in Sicherheit wiegen und ist stets konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt. Grundsätzlich hat der Unternehmer die Chance, sich gegen verschiedene Risiken abzusichern, wie zum Beispiel Brand oder Diebstahl, aber gegen das Risiko der Unternehmung kann und soll es keine Absicherung geben.25 Rieger beschreibt „Unternehmer ... [als] Leute, die wagen, um dadurch zu gewinnen“26. Ein Unternehmen erfordert nicht nur technisches, sondern auch kaufmännisches Wissen, da auch geldliche und finanzielle Probleme auftreten können. Das Unternehmen hat die Aufgabe, „sich selbst zu unterhalten und darüber hinaus dem Unternehmer einen Geldertrag zu verschaffen“27. Das Unternehmen erhält nur Einnahmen aus den Betriebserzeugnissen und -leistungen, sodass ein Risiko besteht, dass das Unternehmen finanziell scheitert. Die Beziehung von Unternehmen und Betrieb laut Rieger wurde zuvor schon dargestellt und soll hier nur kurz aufgegriffen werden. Der Betrieb bildet den Kem des Unternehmens und verfolgt den technischen Zweck, wobei das Unternehmen den Betrieb umschließt und den Gedanken nach Gewinnstreben hinzufügt. Das Unternehmen nutzt den Betrieb als Instrument zum Wirtschaften und kann selbst aus vielen einzelnen Betrieben bestehen.
Ähnlich beschreibt Dieter Schneider den Unternehmer: „Wer die Ziele erst im Einzelnen festlegen, die Mittel suchen, die Handlungsmöglichkeiten in ihren Beiträgen zu den Zielen und ihrer Mittelbeanspruchung erforschen muss, wer sich dann für eine Handlungsmöglichkeit entscheidet und sie verwirklicht, den nennen wir Unternehmer. Unternehmer heißt im Folgenden also jeder Mensch, der Einkommen erwerben will und dabei Ziele, Handlungsmöglichkeiten, Mittel angesichts einer unsicheren Zukunft untersuchen muss.“28
In der Privatwirtschaftslehre kennzeichnen ein Unternehmen neben dem erwerbswirtschaftlichen Charakter vor allem das vorhandene Unternehmensrisiko und der Einsatz von nennenswertem Kapital, das vielleicht nicht wieder erwirtschaftet werden kann.
Laut Hugentobler werden Unternehmen in private, öffentliche oder gemischtwirtschaftliche Unternehmen eingeteilt. Öffentliche Unternehmen sind Eigentum des Staates, wohingegen private Unternehmen einer natürlichen oder juristischen Person gehören. Bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmen sind sowohl der Staat als auch eine private oder juristische Person Eigentümer des Unternehmens. Im Folgenden wird eher auf die privaten Unternehmen eingegangen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Gewinne zu erwirtschaften. Demnach ist anzunehmen, dass Non-Profit-Organisationen aus dem Unternehmensbegriff auszuschließen sind. Die Gewinne können verwendet werden, um dem Kapitalgeber einen Teil seines zur Verfügung gestellten Kapitals zurückzugeben und diesen für das Risiko, das er eingegangen ist, zu entschädigen. Es ist nicht zwingend notwendig, dass der Kapitalgeber gleichzeitig der Eigentümer des Unternehmens ist. Das Gewinnstreben ist auch in dieser Definition Bestandteil des Unternehmens, da es ohne diese Gewinne nicht langfristig erhalten bleiben kann. Außerdem hat das Unternehmen eine Rechtsform zu wählen, welche dieses dabei unterstützt, rechtliche Beziehungen gegenüber Dritten zu führen. Insgesamt lassen sich verschiedene Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können: Eigentum, Gewinnorientierung, Branche, Größe, Standort, geografische Ausbreitung und Rechtsform. Gründet ein Unternehmer ein neues Unternehmen, muss er all diese Aspekte bedenken und für jeden dieser Faktoren eine für sich geeignete Lösung finden.29
Thommen/Achleitner beschreiben Unternehmen im Gegensatz zu Haushalten als produktionsorientierte Wirtschaftseinheiten, die primär der Fremdbedarfsdeckung dienen.30 Sie werden in private, öffentliche und gemischtwirtschaftliche Einheiten unterteilt. Für die Unterscheidung der Unternehmensformen gibt es einige Merkmale, die dabei helfen, zu erkennen, ob ein Unternehmen privat oder öffentlich ist, aber wie zuvor wird der Fokus auf die privaten Unternehmen gelegt. Deren verschiedene Charakteristika sollen an dieser Stelle kurz erwähnt werden: rechtliche Grundlagen, Kapitalbeteiligung, Grad der Selbstbestimmung und Gewinnorientierung. Es wird erklärt, dass ein privates Unternehmen gewinnorientiert handelt. Die Ausrichtung des Unternehmens ist auf die Bedürfnisse des Marktes ausgelegt und um diese Bedürfnisse zu decken, muss das Unternehmen produktive Leistungen erstellen. In dem Unternehmen ist ein soziales System wiederzufinden, da in diesem viele Menschen tätig sind, welche durch ihr Verhalten einen Einfluss auf das Unternehmen haben können. Dies erklärt auch die Offenheit eines Unternehmens, da es viele Beziehungen zu seiner Umwelt pflegt und mit dieser im ständigen Austausch ist. Laut dieser neueren Definition besteht ein Unternehmen aus vielen einzelnen Elementen, wodurch es zu einem komplexen System wird, welches wiederum laufenden Änderungen unterzogen werden muss, um sich der Umwelt und den Entwicklungen anzupassen. Zusammenfassend kann das Unternehmen aus managementorientierter Sicht als ein offenes, dynamisches, komplexes, autonomes, marktgerichtetes und produktives soziales System charakterisiert werden.31
Aus rechtswissenschaftlicher Sicht lässt sich – ähnlich wie in der Betriebswirtschaftslehre - keine einheitliche Definition des Begriffs „Unternehmen“ finden. Dies liegt weniger an der unterschiedlichen Bezeichnung, sondern vielmehr an der unterschiedlichen Funktion und Ausgestaltung des Begriffs in den einzelnen Rechtsgebieten.32 Die recht unterschiedlichen Interpretationen des Unternehmensbegriffs belegt folgende Auswahl an Fundstellen: Jacobi betitelt die erwerbswirtschaftlichen Unternehmen, die Gewinne zu erzielen versuchen, als „[gewerbsmäßige] Unternehmen“.33 Neben diesen gewerbsmäßigen Unternehmen gibt es aber auch noch die gemeinnützigen Unternehmen und öffentlichen Behörden, die keineswegs aus dem Untemehmensbegriff ausgeklammert werden müssen.34 Das Unternehmen wird durch das Ziel, welches den Willen des Unternehmers darstellt und auf der Bedürfnisbefriedigung beruht, zu einer Einheit und nicht durch den technischen Zweck allein. Es ist zu beachten, dass ein einziges Rechtssubjekt die Herrschaft über mehrere Unternehmen besitzen kann, und außerdem können persönliche, sächliche und immaterielle Mittel zur Befriedigung verschiedener Bedürfnisse genutzt werden, obwohl diese Bedürfnisse keine Einheit darstellen, also unterschiedlich sind. Somit findet sich ein Rechtsbegriff des Unternehmens, der wie folgt lautet: „Die Vereinigung von persönlichen, sächlichen und immateriellen Mitteln durch das von einem Rechtssubjekt (oder von mehreren Rechtssubjekten gemeinsam) verfolgte Ziel, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen“.35 Ein Unternehmen beginnt mit der Zielsetzung und endet, wenn das Ziel nicht weiterverfolgt wird.36
Von Gierke schlägt folgende Definition vor: „Unternehmen ist der durch Gewerbe (Betriebstätigkeit) geschaffene Tätigkeitsbereich mit den ihm (regelmäßig) ein- und angegliederten Sachen und Rechten einschließlich der zu ihm gehörenden Schulden.37 Eine andere an Raisch anlehnende Erklärung lautet: „[Ein Unternehmen ist] die organisierte Wirtschaftseinheit, mittels derer der Unternehmer am Markt auftritt.“38 Bei dieser Formulierung wird davon ausgegangen, dass ein Markt für die zu produzierenden und abzusetzenden materiellen und immateriellen Güter existiert. Es bleibt aber u. a. offen, ob es sich um eine Organisation mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt. Ebenso ungenau bleibt Dütz, der „unter einem Unternehmen eine wirtschaftliche Organisationseinheit [versteht], der ein oder mehrere Betriebe zugeordnet sind, z. B. gemeinschaftliche Wirtschaftsleitung für mehrere Betriebe.“39 Nach Canaris ist „das kaufmännische Unternehmen ein Tätigkeitsbereich in Verbindung mit den dazugehörigen Gegenständen (Sachen, Rechten, Chancen, Beziehungen usw.) einschließlich der Schulden.“40
Im Zuge der Einführung von Verbraucherschutzvorschriften im Falle von z. B. einem Verbrauchsgüterkauf und einem Verbraucherdarlehensvertrag wurde 2000 der Begriff des Unternehmers im BGB verankert. Nach § 14 BGB ist ein Unternehmer eine natürliche oder juristisehe Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Die rechtsfähige Personengesellschaft (u. a. OHG und KG) ist in § 14 Abs. 2 BGB näher bestimmt. Die Definition des Unternehmers enthält damit drei Merkmale:
persönliche Kriterien:
Es kann sich um natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften gemäß § 14 Abs. 2 BGB handeln. Natürliche Personen sind die Personen an sich, die bspw. keine GmbH oder OHG für ihre Tätigkeiten als Rechtsform gewählt haben. Zu den natürlichen Personen gehören auch Einzelhändler, Freiberufler, Künstler, Wissenschaftler und Landwirte. Juristische Personen sind z. B. die GmbH, die AG, eingetragene Vereine (e. V.) oder die KGaA. Zu den rechtsfähigen Personengesellschaften zählen u. a. die OHG, die Partnerschaftsgesellschaft oder die KG.
gewerbliche Tätigkeit:
Die gewerbliche Tätigkeit wird in § 14 BGB nicht weiter erläutert. Insofern wird hier auf die Definition des Gewerbebegriffs in § 1 Abs. 2 HGB zurückgegriffen. Unter einer gewerblichen Tätigkeit ist ein planvolles und auf längere Sicht angelegtes selbstständiges Handeln unter Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr zu verstehen. Laut BGH-Urteil vom 29.03.2006 (VIII ZR 173/05) muss die Geschäftstätigkeit nicht mit der Absicht verbunden sein, Gewinn zu erzielen;
41
für die Annahme einer gewerblichen Tätigkeit reicht die bloße Entgeltlichkeit aus.
selbständige, berufliche Tätigkeit
bedeutet jedes berufliche Tun, ohne dass ein Abhängigkeitsverhältnis gegeben ist. Nicht selbstständig tätig sind demnach bspw. Angestellte und Beamte in ihrem Tätigkeitsbereich.
42
Selbstständig beruflich tätig sind die Angehörigen der freien Berufe wie Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Architekten usw. Selbständiges Handeln meint, dass eine Person seine Tätigkeit im Wesentlichen frei gestalten kann und seine Arbeitszeit frei festlegen kann.
43
§ 631 BGB regelt die vertragstypischen Pflichten beim Werkvertrag. Dort ist der Unternehmer die Partei, die ein dem Besteller versprochenes (vertraglich vereinbartes) Werk herstellt.44 Damit sind nicht einmal die beiden im BGB enthaltenen Unternehmensbegriffe deckungsgleich.
Ähnlich § 14 BGB findet sich der Begriff des Unternehmers im Umsatzsteuerrecht. Demnach ist Unternehm er, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt.45 „Beruflich oder gewerblich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt.“ (§ 2 Abs. 1 S. 3 UStG) Nachhaltig meint hier dauerhaft, also mit Wiederholungsabsicht. Selbstständig ist im UStG nicht weiter definiert; wohl aber werden im § 2 Abs. 2 UStG die Fälle der Unselbstständigkeit benannt.
In der Abgabenordnung wird der Betriebsbegriff dem Unternehmensbegriff untergeordnet.
Der Begriff „Unternehmer“ ist vom Begriff „Kaufmann“ zu unterscheiden, der nicht im BGB festgeschrieben ist. Letzterer bestimmt sich nach §§ 1 ff. HGB. „Kaufmann“ ist im Vergleich zum „Unternehmer“ der engere Begriff, denn nur ein Teil aller Unternehmer ist zugleich auch Kaufmann im handelsrechtlichen Sinn. In § 1 Abs. 1 HGB ist zu lesen, dass nur derjenige ein Kaufmann ist, der ein Handelsgewerbe betreibt. Entscheidend, und dies stellt ein zentrales Tatbestandsmerkmal des Handelsgewerbes gemäß § 1 Abs. 2 HGB dar, ist das Erfordernis eines in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetriebes.46 90 % aller Einzeluntemehmer (Einzelhändler, Handwerker, Gastwirte etc.) sind keine Kaufleute im Sinne des HGB. Ebenfalls kein Kaufmann, wohl aber Unternehmer sind die so genannten Freiberufler (Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Architekten usw.), sofern sie nicht als Privatperson handeln, es sei denn, einer oder mehrere von ihnen gründen z. B. eine GmbH, die als Handelsgesellschaft gilt.
Nach § 84 HGB hingegen ist ein Unternehmer derjenige, der einen Handelsvertreter ständig damit beauftragt hat, Geschäfte zu vermitteln oder in seinem Namen abzuschließen.47
Zuletzt wird das Unternehmen aus soziologischer und psychologischer Sicht analysiert, um eine umfassende Betrachtung des Unternehmensbegriffes darzustellen und nicht nur auf wirtschaftliche und rechtliche Aspekte einzugehen.
Von Beckerath versteht ein Unternehmen als „ein dynamisch ausgerichteter Leistungsverbund in einem Interessengeflecht von Kapital-, Arbeits-, Bezugs- und Absatzmärkten“.48 Ein Unternehmen bezieht Leistungsbeiträge von verschiedenen Quellen und der Unternehmer hat die Aufgabe, durch das Zusammenführen dieser Leistungen die Entstehung von Produkten und Dienstleistungen zu erzielen, die danach am Absatzmarkt verkauft werden können, wobei in diesem Prozess Gewinne entstehen sollen. In diesen Fachgebieten ist definiert, dass Zweck und Ziel des Unternehmens nicht von dem Unternehmer allein festgelegt werden, sondern von allen, die an dem Unternehmen beteiligt sind. Daraus folgt, dass der Zweck des Unternehmens nicht die Gewinnerzielung sein muss, sondern dass die Gewinne nur dazu dienen, zu messen, welche Position das Unternehmen in der Wirtschaft einnimmt. Beispielsweise kann der Kapitalgeber den Zweck verfolgen, Gewinne zu erzielen, um seinen Kapitaleinsatz erneut zu erwirtschaften, aber dieser Zweck wird nicht von den Mitarbeitern eines Unternehmens verfolgt. Außerdem wurde bereits erwähnt, dass das Unternehmen an verschiedenen Märkten tätig ist. Nun ist es Ziel der Unternehmensleitungen, den Leistungsaustausch an diesen Märkten im Gleichgewicht zu halten, um alle am Unternehmen Beteiligten zur vollen Leistungshergabe zu motivieren. Es soll ein Ausgleich zwischen den Interessengruppen bestehen und dazu sollen sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Bedürfnisse befriedigt werden.49 5500
Bereits anhand dieser Quelle lässt sich festhalten, dass nicht nur der Unternehmer und die Gewinnerzielung im Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen, sondern dass die Mitarbeiter ebenfalls Einfluss auf die Zielsetzung und den Zweck eines Unternehmens haben. Insgesamt befassen sich diese Fachgebiete stark mit den menschlichen Faktoren im Unternehmen und weniger mit den wirtschaftlichen.
Neben die Mitarbeiter mit ihren – teilweise gesetzlich fixierten – Einflussmöglichkeiten treten noch weitere Anspruchsgruppen, die unter dem Begriff Stakeholder subsumiert werden. Mit diesen steht das Unternehmen als offenes System in unterschiedlichen, ein- oder zweiseitigen Beziehungen.50
Es ist festzustellen, dass in den einzelnen Disziplinen, auch in der Betriebswirtschaftslehre, viele verschiedene Auffassungen über den Unternehmensbegriff vertreten sind und insofern keine einheitliche Definition zu finden ist. Allerdings gibt es einige Merkmale, die wiederkehrend erwähnt werden. Dazu gehören
eine rechtliche Einheit (Rechtsform),
eine Organisation, die Waren und Dienstleistungen produziert, um einen Fremdbedarf zu decken,
kombinierter Einsatz von Produktionsfaktoren,
die freiwillige Übernahme eines Marktrisikos mit der Möglichkeit, im schlimmsten Fall das eingesetzte Kapitel zu verlieren,
die Ausübung einer Tätigkeit auf Dauer, um einen Zweck zu verfolgen, der über diese Tätigkeit hinausgeht,
ein zielorientiertes Handeln,
vielfältige Beziehungen zur Untemehmensumwelt (offenes System), insbesondere der zunehmende Einfluss von Anspruchsgruppen (Stakeholder) auf die Ziele der Unternehmung.
das erwerbswirtschaftliche Prinzip (Gewinnstreben) als primäres Ziel, • die Beachtung des System indifferenten Wirtschaftlichkeitsprinzips,
ein soziales System (durch die Zusammenarbeit von Menschen in Gruppen und Teilsystemen) und
das Autonomieprinzip (selbstständige Entscheidungen).
Unter den vorgenannten Aspekten sind einige Punkte, die kritisch diskutiert werden müssen. Zum einen betrifft dies das (primäre) Ziel der Gewinn- und/oder Renditemaximierung, zum anderen das Autonomieprinzip. In unserer Gesellschaft, speziell im Gesundheits- und Sozialbereich, sind viele Organisationen tätig, deren Ziel nicht die Verfolgung des erwerbswirtschaftlichen Prinzips ist. Unter diesen befinden sich auch große Organisationen wie beispielsweise der Deutsche Caritasverband e. V. mit fast 600.000 Menschen, die dort in 24.000 Einrichtungen und Diensten beschäftigt sind oder die gemeinnützige kirchliche Unternehmensgruppe St. Franziskus-Stiftung Münster mit rd. 10.000 Mitarbeitern und einem konsolidierten Umsatz 2013 in Höhe von 618,9 Mio. € in 13 Krankenhäusern, neun Behinderten- und Senioreneinrichtungen sowie weiteren Beteiligungen oder die zweitgrößte deutsche Hochschule, die Ludwig-Maximilians-Universität München mit über 50.000 Studierenden im WS 2014/15 und ca. 17.000 Mitarbeitern. Angesichts solch großer Zahlen wird deutlich, dass auch diese Organisationen unternehmerisch geführt werden müssen. Aus diesem Grund beziehen sich die nachfolgenden Ausarbeitungen sowohl auf Non-Profit-Organisationen als auch auf erwerbswirtschaftliche Unternehmen aller Branchen, schwerpunktmäßig jedoch auf Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht.
Der zweite Punkt betrifft die Autonomie. In einer freien Marktwirtschaft können bestimmte Personen wie z. B. alte Menschen, Kranke, Arbeitslose kein Einkommen generieren, da sie keine marktfähigen Leistungen produzieren. Folglich sind sie nicht in der Lage, ihre existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen. Dies zieht gravierende soziale, moralisch-sittliche/ethische Probleme nach sich. Aus diesen Gründen und weil das Angebot von kollektiven und meritorischen Gütern (z. B. Bildung, Infrastruktur) ausbleiben würde, möglicherweise eine kurzfristige Ausrichtung an Maximalgewinnen langfristige, chancenreiche Investitionen vernachlässigen würde und der ungehinderte Wettbewerb zu einer Monopolisierung mit all den i. d. R. negativen Begleiterscheinungen wie beispielsweise erhöhten Preisen und ausbleibendem technologischen Fortschritt führen würde, sind staatliche Eingriffe mit Augenmaß erforderlich. Das Unternehmen kann sich in einer sozialen Marktwirtschaft nur innerhalb der durch staatliche Organe gesetzten Grenzen (Gesetze, Verordnungen etc.) bewegen. Daneben wird die gesellschaftliche Akzeptanz des Unternehmensverhaltens als Wettbewerbsfaktor immer bedeutsamer.51 In diesem Zusammenhang können auch von Anspruchsgruppen Grenzen definiert werden. Dies 51 wird insbesondere bei den sogenannten gefährlichen Stakeholdern deutlich, die aufgrund ihrer Macht ein Risiko gegenüber Vorhaben des Unternehmens darstellen können. Nicht zuletzt schränkt die im Laufe der Zeit verstärkte Mitbestimmung der Arbeitnehmer (als wohl stärkste Anspruchsgruppe) die Verfügungsgewalt über das Unternehmen ein. Insofern kann statt von Autonomie nur von einer Teilautonomie des Unternehmens ausgegangen werden.
Wirtschaftlichkeit heißt, die Effizienz (des Handelns), also Inputs und Outputs in Geldeinheiten zu bewerten. Abhängig vom Unternehmensziel und -zweck sind Inputs (Ressourcen) und Outputs (Ziele) aber nicht in jedem Fall in Geldeinheiten zu messen. Daher soll allgemeiner von Produktivität gesprochen werden, wenngleich vorrangig privatwirtschaftliche Unternehmen im Fokus der folgenden Ausarbeitungen liegen.
Die wirtschaftliche Selbstständigkeit ist Ursache für das wirtschaftliche Risiko (Marktrisiko auf der Seite der Produktionsfaktoren einerseits und des Absatzes andererseits), dass der Unternehmer aus freiem Willen und sicherlich auch bewusst übernommen hat. Aufgrund des Kausalzusammenhangs muss dieser Aspekt nicht in die Definition des Unternehmensbegriffs aufgenommen werden.
Als Quintessenz aller Überlegungen kann ein Unternehmen wie folgt definiert werden:
Ein Unternehmen ist ein rechtliches, soziales, komplexes, weitgehend autonom agierendes, offenes System, das zur Erreichung der Unternehmensziele materielle und/ oder immaterielle Güter zwecks Fremdbedarfsdeckung produktiv hervorbringt und vermarktet.
Darst. 1.102: Definition Unternehmen
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass diese Definition auch Non-Profit-Organisationen wie z. B. eine gGmbH mit einschließt, wenngleich der Schwerpunkt der nachfolgenden Ausführungen Unternehmen mit dem Ziel Gewinnmaximierung bzw. Wertorientierung sind.
1.1.2 Betrieb
In den vorherigen Ausführungen war zu erkennen, dass das Unternehmen der Oberbegriff für verschiedene Betriebsformen ist. Jetzt ist noch zu klären, wie der Betrieb definiert werden kann.
Unter einem Betrieb ist laut Seyffert „ein soziales Gebilde, das mit menschlichem Zweckhandeln erfüllt ist“52, zu verstehen. Ein einzelner Mensch kann also einen Betrieb bilden, um die Durchführung von Arbeit, die auf einen Zweck gerichtet ist, zu verfolgen. Wie bei der Unternehmung bereits dargestellt, handelt es sich bei diesem Zweck um die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse. Gründen mehrere Menschen zusammen einen Betrieb spricht man von einer Betriebsgemeinschaft. Die Bedürfnisse des Menschen umfassen viele Bereiche, daher kann ein Betrieb ebenfalls in diesen unterschiedlichsten Bereichen gebildet werden. Genannt werden an dieser Stelle beispielsweise politische, künstlerische, erzieherische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Bereiche.53
Im Rahmen dieser Arbeit werden die wirtschaftlichen Betriebe in den Fokus genommen. Derartige Betriebe sind i. d. R. geschlossene Organisationseinheiten, in denen wirtschaftliche Prozesse stattfinden, um Bedarfe zu decken.54
Rieger geht davon aus, dass der Betrieb „eine rein technische Institution“55 ist. Der Betrieb wirtschaftet nicht als Subjekt selbst, sondern es wird mit ihm als Objekt gewirtschaftet, wodurch der Betrieb einer Instanz zugeordnet werden muss, um als Wirtschaftseinheit angesehen werden zu können. An dieser Stelle kommt die Abgrenzung zu dem Unternehmen zum Tragen. Der Betrieb bildet also den Kern und befasst sich mit technischen Aspekten, wohingegen das Unternehmen den Betrieb und außerdem noch die Idee des Gewinnstrebens umfasst. Rieger bringt zum Ausdruck, dass der Betrieb die „konkrete Gestalt ist, in der der Unternehmungsgedanke auftritt“56. Das Unternehmen bedarf also des Betriebes, um sein Vorhaben, Gewinne zu erzielen, verfolgen zu können. Fügt man dem Betrieb einerseits also das Gewinnstreben hinzu, wird es zu einem Unternehmen und andererseits kann ein Unternehmen aus vielen Betrieben bestehen, solange der Unternehmensgedanke, also das verfolgte Ziel existiert und von allen zugehörigen Betrieben verfolgt wird. Abschließend wird passend zusammengefasst, dass „der Betrieb der technische Kern; finanzieller, geldlicher Mantel und zugleich richtungsgebende Idee ... die Unternehmung [ist]“57. Betriebe verkörpern somit die produktionswirtschaftliche Seite/Untereinheit eines Unternehmens und somit der Ort des kombinierten Faktoreinsatzes (Betriebsoder Produktionsstätte, Werk).58
Ein Unternehmen kann aus mehreren Betrieben bestehen, aber auch über keinen Betrieb im vorstehenden Sinn verfügen (z. B. eine Holding-Gesellschaft als Dachgesellschaft verschiedener Unternehmen).
Handelt es sich bei den Betrieben um rechtlich selbstständige Gebilde, wird der Begriff des Konzerns verwendet.
Sofern der Betrieb eine Organisation ist, die Waren und Dienstleistungen produziert, um ausschließlich denjenigen Fremdbedarf zu decken, der als Unternehmenszweck z. B. im Gesellschaftsvertrag einer GmbH oder der Satzung einer AG festgelegt ist, würden deren Aufwendungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung sämtlich Kosten darstellen; es sei denn, es würde sich bei den zu buchenden Kosten um periodenfremde oder außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge handeln. Kostenrechnerisch ist der Betrieb diejenige (gedankliche) Teileinheit eines Unternehmens, die (ausschließlich) dem Unternehmenszweck dient.
Auch in der Rechtswissenschaft wird zumeist davon ausgegangen, dass sich der Betrieb auf den technischen Zweck beschränkt und auch nur dieser Zweck kann als Betriebszweck bezeichnet werden.59 Rechtlich ist eine Unterscheidung z. B. aufgrund des Gesellschafts- und Mitbestimmungsrechts erforderlich, da zwischen Unternehmens- und Betriebsverfassung unterschieden wird. Während die Unternehmensverfassung60 die Vorschriften für das Gesamtsystem Unternehmen beinhaltet, regelt die Betriebsverfassung61 die Mitwirkung der Arbeitnehmer über ihre Vertreter am Ort der Faktorkombination, dem Betrieb. Daneben wurde die Interessenvertretung der Leitenden Angestellten im Sprecherausschussgesetz62 eingeführt, das ebenfalls die Einflussnahme auf der Ebene des Betriebs ermöglicht.
Als Kemaussage lässt sich festhalten:
Ein Betrieb verkörpert die produktionswirtschaftliche Untereinheit eines Unternehmens. Kostenrechnerisch ist der Betrieb diejenige (gedankliche) Teileinheit eines Unternehmens, die (ausschließlich) dem Unternehmenszweck dient.
Darst. 1.103: Definition Betrieb
1.1.3 Firma
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Betrieb und Firma oft synonym verwendet. Ein Beispiel hierfür ist die Aussage: „Ich gehe in den Betrieb/in die Firma“. Allerdings ist die synonyme Verwendung nicht zulässig, da „Firma“ gem. § 17 Abs. 1 HGB nur „der Name [ist], unter dem [ein Kaufmann] seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt“.63Ausschließlich Kaufleute besitzen das Recht, eine Firma zu führen. Zudem kann ein Kaufmann „unter seiner Firma klagen und verklagt werden“ (§17 Abs. 2 RGB). Auch dies trifft nicht auf den Betrieb zu, da er kein Rechtssubjekt ist, das die Fähigkeiten besitzt, zu klagen oder verklagt zu werden, sondern eine Organisationseinheit der Wirtschaft, die den technischen Zwecken des Unternehmens dient. Somit sind auch die Begriffe „Unternehmen“, „Betrieb“ und „Firma“ nicht synonym zu verwenden.
1.1.4 Gewerbebetrieb
Der steuerliche Begriff des Gewerbebetriebs gern. § 15 Abs. 2 S. 1 EstG unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den Definitionen des Unternehmens und des Betriebes. Der Gewerbebetrieb ist eine selbständige und nachhaltige Betätigung, die mit Gewinnabsicht unternommen wird, sich als Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt und nicht als Ausübung von Land- oder Forstwirtschaft oder selbständiger Arbeit anzusehen ist; darüber hinaus darf es sich nach der Rechtsprechung nicht um private Vermögensverwaltung handeln64. Im Vergleich zum Betrieb ähnelt der Gewerbebetrieb eher dem Unternehmen, da der Gewerbebetrieb weit mehr als nur die produktionswirtschaftliche Untereinheit eines Unternehmens ist und auch kostenrechnerisch nicht allein dem Unternehmenszweck dienen muss. Andererseits schließt der Gewerbebetrieb gegenüber dem Unternehmen die Land- und Forstwirtschaft aus. Auch eine Gewinnerzielungsabsicht ist bei einem Unternehmen nicht in jedem Fall gegeben.65
5 Vgl. MOLITOR, E.: Das Wesen des Arbeitsvertrages. Eine Untersuchung über die Begriffe des Dienst- und Werkvertrags, sowie des Vertrags über abhängige Arbeiten, Leipzig, Erlangen 1925, S. 6.
6 Vgl. beispielsweise SCHUMANN, J., MEYER, U., STRÖBELE, W.: Grundzüge der mikroökomischen Theorie, 9. Aufl., Berlin, Heidelberg 2011, S. 127.
7 SCHUMANN, J., MEYER, U., STRÖBELE, W.: a. a. O., S. 127.
8 TURIN, G.: Der Begriff des Unternehmers, Zürich 1947, S. 46.
9 Vgl. GUTENBERG, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd. 1: Die Produktion, im Folgenden mit „Grundlagen“ abgekürzt, 24. Aufl., Berlin, Heidelberg, New York 1983, S. 458ff.
10 Vermeidung von Verschwendung.
11 Damit ist die Fähigkeit gemeint, jederzeit zu den vereinbarten Zeitpunkten fällige Zahlungen leisten zu können.
12 Vgl. GUTENBERG, E.: Grundlagen, a. a. O., S. 464.
13 GUTENBERG, E.: Die Unternehmung als Gegenstand betriebswirtschaftlicher Theorie, im Folgenden mit „Unternehmung“ abgekürzt, Berlin, Wien 1929, S. 42.
14 Dieser hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Als Beispiel sei nur die nicht praktikable Durchführbarkeit einer Zentralplanung genannt. Selbst mit den heutigen Rechenmöglichkeiten müsste auf einem viel zu hohen Aggregationsgrad gearbeitet werden, um für eine (insbesondere große) arbeitsteilige (wegen der Produktivität!) Volkswirtschaft ein (im besten Fall) optimales, zumindest aber zufriedenstellendes Input-Output-Modell mit allen erforderlichen Lieferverflechtungen zu konzipieren. Allein für die Erfassung und Bearbeitung der Daten und die ständigen Änderungsanforderungen aufgrund von Lieferverzögerungen und -ausfällen (z. B. aufgrund der Witterung und von Unfällen) wäre unter Beachtung des Instanzenweges ein Heer von (unproduktiven) Arbeitskräften nötig, die für die Produktion der Güter fehlen und einen Zielkonflikt in Bezug auf die (Arbeits-)Produktivität der Volkswirtschaft offenbaren. Hierbei ist noch nicht berücksichtigt, dass der technische Fortschritt, sofern der Wohlstand und insbesondere der medizinische Standard höher sein sollen als im Kapitalismus, sowie Änderungen der Bedürfnisse der Volksangehörigen – unabhängig von saisonalen Schwankungen – ständige Planänderungen hervorrufen. Als zweiter Punkt sei die von Marx als ein Hauptziel geforderte Aufhebung der Entfremdung genannt, unter der die Arbeiter im kapitalistischen System leiden. Sofern eine hohe (Arbeits-)Produktivität einer Volkswirtschaft erreicht werden soll, um letztlich den Wohlstand aller zu mehren, kann auf eine Arbeitsteilung nicht verzichtet werden. Arbeitsteilung ist vom Wirtschaftssystem unabhängig, und soweit sie (überhaupt) Entfremdung hervorruft, muss sich diese auch in einer sozialistisch industrialisierten Wirtschaft zeigen. Im real existierenden Sozialismus hat sich die Entfremdung aufgrund der zentralen Planungen, weit ab vom produzierenden Betrieb, eher noch verstärkt.
15 Vgl. KOSIOL, E.: Die Unternehmung als wirtschaftliches Aktionszentrum, 4. Aufl., Reinbek bei Hamburg 1972, S. 203f.
16 Im Sinne von öffentlich-rechtlichen Unternehmen. (Anmerkung: Öffentliche Zwecke können auch von privaten Unternehmen erfüllt werden.)
17 Vgl. SEYFFERT, R.: Über Begriff, Aufgaben und Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre, 6. Aufl., Stuttgart 1971, S. 11f.
18 BECKER, F. G.: Grundlagen der Unternehmensführung, Einführung in die Managementlehre, Berlin 2011, S. 22.
19 Vgl. RIEGER, W.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2. Aufl., Erlangen 1959, S. 17.
20 ALBERS, W., BORN, E., DÜRR, E. ET AL.: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW). Zugleich Neuauflage des Handwörterbuchs der Sozialwissenschaften. Terminmärkte bis Wirtschaft der DDR, Bd. 8, Stuttgart u. a. O. 1980, S. 65.
21 Vgl. ALBERS, W., BORN, E., DÜRR, E. ET AL.: a. a. O., S. 66.
22 Vgl. ALBERS, W., BORN, E., DÜRR, E. ET AL.: a. a. O., S. 66f.
23 Vgl. ebenda, S. 67.
24 RIEGER, W.: a. a. O., S. 15.
25 Vgl. RIEGER, W.: a. a. O, S. 15-26.
26 Ebenda, S. 29.
27 Ebenda, S. 37.
28 SCHNEIDER, D.: Investition, Finanzierung und Besteuerung, 7. Aufl., Wiesbaden 1992, S. 3.
29 Vgl. SCHAUFELBÜHL, K., HUGENTOBLER, W., BLATTNER, M. (HRSG.): Betriebswirtschaftslehre für Bachelor, Zürich 2007, S. 37–71.
30 Vgl. hier und im Folgenden: THOMMEN, J.-P., ACHLEITNER, A.-K.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre – Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht, 8. Aufl., Wiesbaden 2017, S. 40-49.
31 Vgl. THOMMEN, J.-P., ACHLEITNER, A.-K.: a. a. O., S. 44–45.
32 Als Beispiel sei das Aktienrecht genannt, das beispielsweise für das Konzemrecht keine Definition des Unternehmens enthält. Laut Eisenhardt hat der Gesetzgeber (hier) von einer genaueren Umschreibung des Begriffs wegen der großen praktischen Schwierigkeiten bewusst abgesehen. (EISENHARDT, U.: Gesellschaftsrecht, 9. Aufl., München 2000, S. 469.)
33 JACOBI, E.: Betrieb und Unternehmen als Rechtsbegriff, Leipzig 1926, S. 17.
34 Vgl. JAOCBI, E.: a. a. O., S. 16f.
35 JAOCBI, E.: a. a. O., S. 20.
36 Vgl. ebenda, S. 18–20.
37 VON GIERKE, J., SANDROCK, O.: Handels- und Wirtschaftsrecht, Bd. I, Allgemeine Grundlagen. Der Kaufmann und sein Unternehmen, 9. Aufl., Berlin 1975, § 13 III 1.
38 SCHMIDT, K.: Handelsrecht, 5. Aufl., Köln 1999, § 4 12.
39 DÜTZ, W.: Arbeitsrecht, 22. Aufl., München 2017, S. 25.
40 CANARIS, C.-W.: Handelsrecht, 24. Aufl., München 2006, S. 173.
41 Vgl. BGH, Urteil vom 29.03.2006, VIII ZR 173/05 – Untemehmerbegriff, in: NJW 2006, S. 2250ff.
42 Dies schließt nicht aus, dass die vorgenannten Arbeitnehmer nicht nebenberuflich als Unternehmer tätig sind.
43 Vgl. § 84 Abs. 1 S. 2 HGB.
44 Vgl. §631 Abs. 1 BGB.
45 Vgl. § 2 Abs. 1 S. 1 UStG.
46 § 1 Abs. 2 HGB:..... das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb ... erfordert.“ „Kaufmännische Einrichtungen sind vor allem Buchführung und Bilanzierung, Führung einer Firma sowie eine kaufmännische Ordnung der Vertretung, insbesondere die Bestellung von Prokuristen.“ (MEHRINGS, J.: Grundlagen des Wirtschaftsprivatrechts. Theorie und Praxis für Wirtschaftswissenschaftler, München 2006, S. 73.)
47 Anmerkung: Gemäß § 84 Abs. 4 HGB kann der Unternehmer auch ein Handelsvertreter sein.
48 VON BECKERATH, P. G. ET AL. (HRSG.): Handwörterbuch der Betriebspsychologie und Betriebssoziologie, Stuttgart 1981, S. 367.
49 Vgl. VON BECKERATH, P. G. ET AL.: a. a. O., S. 366f.
50 Dieser Aspekt wird im Abschnitt 1.5 „Rahmenbedingungen der Unternehmensfuhrung“ und im Abschnitt 2.3 „Ziel-Führungsprozess“ vertiefend behandelt wird.
51 Deutlich wird dies bei aktuellen Themen wie Umwelt- und Klimaschutz sowie Globalisierung.
52 SEYFFERT, R.: a. a. O., S. 7.
53 Vgl. ebenda, S. 7f.
54 Vgl. SEYFFERT, R.: a. a. O., S 8.
55 RIEGER, W.: a. a. O., S. 33.
56 Ebenda, S. 40.
57 RIEGER, W.:a. a. O., S. 42.
58 Vgl. MACHARZINA, K., WOLF, J.: Unternehmensfuhrung: Das internationale Managementwissen. Konzepte - Methoden – Praxis, 12. Aufl. Wiesbaden 2023, S. 18.
59 Vgl. JACOBI, E.: a. a. O., S. 9-16.
60 Die Mitbestimmung auf Unternehmensebene wird im MontanMitbestG von 1951, dem MitbestG von 1976 sowie dem DrittelbG von 2004 geregelt.
61 Das im Jahr 2001 novellierte BetrVG von 1972 regelt die Mitbestimmung auf Betriebsebene.
62 SprAuG vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2312).
63 ULLRICH, N.: Wirtschaftsrecht für Betriebswirte, 4. Aufl., Herne, Berlin, S. 117.
64 Vgl. z. B. BFH, Urteil vom 07.11.2018, X R 34/16, BFH/NV 2019, 686.
65 Zum Beispiel bei den sog. NPOs (Non-Profit-Organizations).
1.2 Unternehmensführung und Management
In der Fachliteratur sowie im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Unternehmensführung und Management immer häufiger verwendet. Speziell der Begriff Management findet sich als eigenständiges Wort als auch in Kombination mit anderen Termini66 auf. Dementsprechend existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Auffassungen über die terminologische Handhabung dieser beiden Ausdrücke67 Angesichts der Tatsache, dass sich der Managementbegriff erst seit relativ kurzer Zeit in der deutschen Sprache etabliert hat, wird sich dieses Kapitel der vorliegenden Monografie mit beiden Begriffen befassen, um zu erarbeiten, ob es sich bei diesen Begriffen möglicherweise um Synonyme oder doch um (völlig) unterschiedliche handelt.
1.2.1 Unternehmensführung
1.2.1.1 Führung, Macht, Herrschaft und Leitung
Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Titel dieses Buches „Unternehmensführung“. Es geht also um die Führung eines Unternehmens. Um auf die Führung, speziell eines Unternehmens, näher eingehen zu können, ist zunächst der Begriff „Führen“ zu erläutern.
Das deutsche Verb „führen“ entstammt dem Wort „fahren“ bzw. dem altertümlichen Begriff „fahren machen“ (mittelhochdeutsch „vueren“, altdeutsch „fuoren“). Insbesondere die mittelhochdeutschen Verben enthalten im Kern die zentralen Aspekte der Dynamik und Zielorientierung und lassen sich am besten mit „in Bewegung setzen“ und „Richtung weisen“ in das Hochdeutsche übertragen.68
Ein erster Ansatz, Führung zu begründen, entspringt der Anthropologie69. Führung existiert deshalb, weil Menschen aufgrund der unterschiedlich verteilten Fähigkeiten geführt werden müssen bzw. wollen. Somit werden geordnete, wünschenswerte Zustände erreicht. Menschen wollen geführt werden, um nicht die Last der Verantwortung zu tragen.70
Immer dann, wenn mehrere Personen (arbeitsteilig) Zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen, ergibt sich ein Koordinationsbedarf. Dieser führt zu einer Arbeits- und Rollenzuweisung innerhalb der Gruppe, so dass sich die Betroffenen (tendenziell) als Führende oder Geführte klassifizieren lassen. Führung wird – insbesondere bei größeren Organisationsformen – als notwendig angesehen.71 Dies trifft auch dann zu, wenn für die zu lösenden Aufgaben keine vorgegebenen Mittel oder Lösungswege verfügbar sind.72 Dies gilt vor allem für komplexe Umweltsituationen mit schlecht strukturierten Problemen oder Sachverhalte, die komplex, mehrdeutig, widersprüchlich oder instabil sowie zeitkritisch sind.73
Führung wird oft im Kontext von Herrschaft, Macht und Einfluss gesehen 74 Um den Begriff Führung (und später Unternehmensführung) definieren zu können, ist eine kurze Abgrenzung zu den vorgenannten Termini erforderlich. Führung ohne ein gewisses Potential an Macht75 - genauer: mit Machtverhältnissen – ist nicht möglich 76 Im Zusammenhang mit Machtverhältnissen fragt sich, was Führung von Herrschaft unterscheidet. Nach Triepel liegt Führung „zwischen der Stufe des bloßen Einflusses und der der Herrschaft. Führung ist mehr als Einfluss, sie ist bestimmender Einfluss.“77 Sie ist diejenige Macht, „die ein starkes Maß von Energie des Willens, aber nicht den Willen zur Herrschaft enthält. Führung ist energische, aber gebändigte
Macht.“78 Herrschaft „ist [im Gegensatz zur Führung – Anm. des Verf.] als solche vollkommen unabhängig von der Anerkennung der Unterworfenen.“79
Des Weiteren stellt sich die Frage, ob und wie Führung von Leitung abzugrenzen ist. Ein Blick in die Fachliteratur zeigt hier stark divergierende Ansichten. Erste Position: Während Führung grundsätzlich stets in Verbindung mit Personen (Mitarbeitern) gesehen wird,80 ist Leitung nach Rühli als die „mittelbare Executive der Führung“ zu betrachten, die im Gegensatz zur Führung nicht das Zentrum der Willensbildung, sondern als (untergeordnetes) Organ zwecks Willensdurchsetzung anzusehen ist.81 Leitung konzentriert sich eher auf sachbezogene Aspekte. Gibb ergänzt u. a.: Bei der Leitung ist nur eine geringe oder gar keine Beteiligung anderer Personen bei der Verfolgung eines bestimmten Ziels gegeben. Zudem besteht eine große soziale Distanz zwischen den Gruppenmitgliedern einerseits und dem Leiter andererseits.82 Nach Weibler ist die Akzeptanz der Beeinflussten Kennzeichen der Führung, so dass „die potenziell Geführten darüber [entscheiden], ob freiwillige Gefolgschaft geleistet wird“83, z. B. im Rahmen der informellen Führung, während die Leitung eine rein formale hierarchische Position darstellt.84 Letztere wird dann auch als Amtsautorität bezeichnet. Einer anderen Auffassung nach wird wie folgt differenziert: Leitung wird im institutionellen Sinne, z. B. als Unternehmensleitung interpretiert, während Führung im funktionalen Sinn, z. B. als konkretes Tun verwendet wird. Drittens: Häufig werden die beiden Begriffe synonym benutzt.
Eine Auswahl chronologisch geordneter Definitionen von Führung lautet:
„Führung [ist] der Prozess der Beeinflussung der Aktivitäten einer organisierten Gruppe in Richtung auf Zielsetzung und Zielerreichung.“
85
Führung wird als „eine Tätigkeit definiert, die die Steuerung und Gestaltung des Handelns anderer Personen zum Gegenstand hat.“
86
„Führung ist jede zielbezogene interpersonelle Verhaltensbeeinflussung mit Hilfe von Kommunikationsprozessen. “
87
„Führung von Menschen wird ausgeübt, wenn Personen mit bestimmten Motiven und Zielen im Wettbewerb oder im Konflikt mit anderen die institutionellen, politischen, psychologischen und anderen Ressourcen so mobilisieren, sodass die die Motive der Geführten wecken, verpflichten und befriedigen.“
88
„Führung wird verstanden als System atisch-strukturierter Einflussprozess der Realisation intendierter Leistungs-Ergebnisse; Führung ist damit im Kern zielorientierte und zukunftsbezogene Handlungslenkung, wobei diese Einwirkung sich auf Leistung und Zufriedenheit richtet.“
89
Führung „ist die Fähigkeit, menschliche Ressourcen zur Durchsetzung bestimmter Ziele zu mobilisieren.“
90
„Führung soll heißen, Anweisungen zu geben, die befolgt werden, weil die Untergebenen sich mit ihnen identifizieren.“
91
„Führung ist richtungsweisendes und steuerndes Einwirken auf das Verhalten anderer Menschen, um eine Zielvorstellung zu verwirklichen; es umfasst den Einsatz materieller Mittel. Ein wesentliches Merkmal erfolgreicher Führung ist ihre Dynamik.“
92