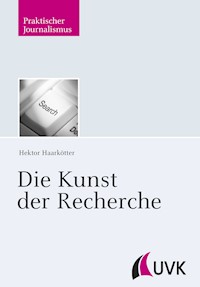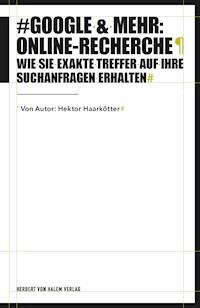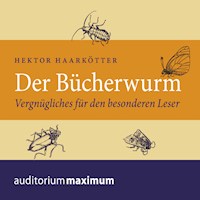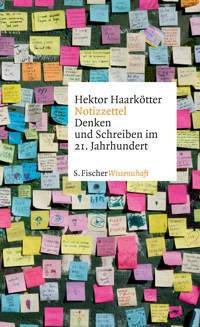
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ohne die Zettel, also allein durch Nachdenken, würde ich auf solche Ideen nicht kommen.« Niklas Luhmann Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Hektor Haarkötter hat die erste Kulturgeschichte des Notizzettels geschrieben und gleichzeitig eine Philosophie dieses unscheinbaren Mediums verfasst. Denn Notizzettel – Einkaufszettel, Spickzettel, Schmierzettel, Skizzen, Entwürfe, Karteikarten, Haftnotizen, Wandkritzeleien – sind der erste Haltepunkt vom Gedanken zum Geschriebenen: Ich denke, also notiere ich. Wer den Menschen beim Notieren zusieht, der kann ihnen beim Denken zusehen. Erstmals erzählt Hektor Haarkötter die Kulturgeschichte des Notizzettels von den dunklen Anfängen bis in die unklare Zukunft und formuliert gleichzeitig dessen Theorie. Ob als Knochengerüst der Literatur, als Laborbuch der Naturwissenschaften oder als handgeschriebene Notiz im zeitgeistigen Notizbuch: Der Notizzettel ist Hard- und Software in einem, nicht nur ein Medium des Denkens, sondern vielleicht das Denken selbst. »Notizzettel« schließt eine Lücke, die bisher überhaupt noch niemand vermisst hat, und geht zwei so spektakulären wie spekulativen Hypothesen nach: Medien sind nicht zum Kommunizieren da, und Medien sind auch nicht zum Erinnern da! Mit auf die Reise durch die schillernde Welt der Notizzettel gehen Lionardo da Vinci, Ludwig Wittgenstein, Astrid Lindgren, Robert Walser, Hans Heberle, Georg Christoph Lichtenberg, Arno Schmidt, Herta Müller, Niklas Luhmann uvm. Die Wahrheit hinter »Zettel's Traum« wird ebenso erzählt wie die Geschichte der Graffiti als »Notizen an der Wand«: Der erste »Sprayer« war übrigens ein Österreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dessen Name heute weitgehend vergessen ist, obwohl er ihn manisch an Wände, Felsen und Mobiliar geschrieben hat. Die Entwicklung des Zettelkastens wird ebenso geschildert wie seine Bedeutung für den Büroalltag des 20. Jahrhunderts. Vor allem geht »Notizzettel« aber der Frage nach, wie sich die Praxis des Notierens und des Schreibens im Übergang zum digitalen Zeitalter verändert hat und welche Auswirkungen das auf das Denken und die Kommunikation hat. Die Bedeutung des Notizzettels für die Kulturgeschichte des Denkens ist nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr zu unterschätzen. »Hätte ich als Juror die Gelegenheit gehabt, den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 für das beste Sachbuch der Saison zu vergeben, so hätte ich Hektor Haarkötter für sein fulminantes Buch ›Notizzettel. Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert‹ (S. Fischer) ausgezeichnet.« Hanns-Josef Ortheil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hektor Haarkötter
Notizzettel
Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert
Über dieses Buch
Notizzettel sind Einkaufszettel, Spickzettel, Schmierzettel, Skizzen, Karteikarten, Post-its. Sie halten Flüchtiges für das Gedächtnis fest und sind doch provisorisch, unkompliziert und vorläufig – sie organisieren Wissen. Erstmals erzählt Hektor Haarkötter die Kulturgeschichte des Notizzettels von den Anfängen bis heute und formuliert gleichzeitig dessen Theorie: Ob als politisches Kommunikationsmedium der RAF-Gefangenen, als Strukturgerüst von Literatur, als Laborbuch der Naturwissenschaften oder als Link im Internet: Der Notizzettel ist ein Aufschreibesystem, Hard- und Software in einem und: ein Vergessensmedium. Seine Bedeutung für die Kulturgeschichte des Denkens ist nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr zu unterschätzen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Hektor Haarkötter, geb. 1968, ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er studierte u.a. Philosophie, Geschichte und Germanistik in Rom, Düsseldorf und Göttingen und arbeitete als Journalist und Fernsehautor. Ehrenamtlich ist der Vorstand der Initiative Nachrichtenaufklärung, die jährlich eine Liste der wichtigsten Themen veröffentlicht, die der Journalismus vernachlässigt hat. Für seine Arbeiten hat er zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhalten, u.a. den alternativen medienpreis 2015.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Gundula Hißmann und Andreas Heilmann, Hamburg
Umschlagabbildung: Getty Images / Thomas Winz
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490580-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Am Anfang notiert
Die Erfindung des Notizzettels
Schreiben Drucken Veröffentlichen
Renaissance-Mensch Universalgenie
Lionardo als Erfinder des Notizzettels?
Erfindung des Überblicks
Notieren Erinnern Vergessen (Theorie des Notizzettels I)
Geist Körper Zettel (Theorie des Notizzettels II)
»Das kann man noch gebrauchen«
Verzettelt denken
Ludwig Wittgenstein bittet zum Diktat
Notizen Manuskripte Typoskripte
Die Geburt des Zettels aus dem Geiste des Fußballs (Theorie des Notizzettels III)
Im Kino mit Wittgenstein (Theorie des Notizzettels IV)
Privatheit Veröffentlichkeit Wahnsinn
Letzte Zettel
Das handgeschriebene Buch
Meditation und Maulwurfsfell
Hand Schrift Selbst
Immer dieser Michel: Haushalts-, Schmier- und Sudelbücher
Barocke Selbstschreibungen
Eselei Faselei Hudelei Klügelei Sudelei Witzelei
Von der Liste zum Buch (Theorie des Notizzettels V)
Am Buch laborieren
Das leere Notizbuch
Der Zettel im Kasten
Zettel’s Albtraum
Zettel Kisten Exzerpte
Von der Lesetechnik zur Verwaltungstechnik
Wilde Formen des Verzettelns
Datei löschen
Notizen an der Wand
Graffiti Wände Hände
Exkurs: Philosophie des Hip-Hop
Ach, wie gut, dass niemand weiß … (Theorie des Notizzettels VI)
Wiener-Hof-Write-Schule oder Fifteen minutes of publicity
»Stoß langsam!« Antike Kritzeleien
Nachrichten auf der Wand: Acta Diurna
Sprechende Statuen
Begehbare Notizzettel
Geheimnisse unter den Dielen
Hohentwiel
Keller Zelle Wand
Das Atelier des Francis Bacon
Das Leben notieren
Der Fluss der Kommunikation
Ein Einbruch in eine Bank
Notieren im digitalen Zeitalter
Die Kommunikation im Fluss
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Index
Fußnoten
[1]
Bei unbestimmten Personenangaben werde ich immer im Wechsel weibliches und männliches Genus verwenden, das jeweils andere Geschlecht ist entsprechend »mitgemeint«, wie man heute so sagt, um alle Diskussionen um generisches versus biologisches Geschlecht zu umschiffen. Ich werde mich aber auch daran nicht sklavisch halten, sondern möglichst liberal und lesefreundlich formulieren.
Die Erfindung des Notizzettels
Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung.
(Lionardo da Vinci)
Was für ein Jahr, dieses Jahr 1452! Johannes Gensfleisch zu Gutenberg druckte in Mainz seine 42-zeilige Bibelausgabe und damit das erste, mit beweglichen Lettern hergestellte Buch, mit Friedrich III. wurde der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs vom Papst in Rom gekrönt (der dann allerdings von der Nachwelt als »Reichsschlafmütze« bezeichnet wurde), der portugiesische Seefahrer Diogo de Teive entdeckte die zu den Azoren gehörenden Inseln Flores und Corves, Papst Nikolaus V. erlaubte die Versklavung dunkelhäutiger Menschen, der osmanische Sultan Mehmed II. begann die Eroberung Konstantinopels, in dem kleinen toscanischen Dörfchen Vinci wird der uneheliche Sohn des Florentiner Notars Ser Piero namens Lionardo geboren und, schließlich, der Notizzettel erfunden.
Die beiden letztgenannten Ereignisse hängen umständehalber miteinander zusammen. Und beide haben mit dem erstgenannten historischen Faktum, der Erfindung des Buchdrucks, zu tun. Womöglich hängen ja alle Ereignisse irgendwie miteinander zusammen, auf offenkundige oder auf geheime Art und Weise. Womöglich ist dies aber auch nur ein Gedanke, der selbst tief im Gutenberg-Zeitalter der Bezüge, Verweise, Knoten, Links und Relationen steckt. Man kann jedenfalls Lionardo (so schrieb er sich selbst, und unter diesem Namen wurde seine Geburt von seinem Großvater vermerkt, und zwar wo? Natürlich auf dem Rücken eines alten Notizbuches) da Vinci mit Fug und Recht als den Erfinder und den frühen Meister des Notizzettels bezeichnen. Heute ist Lionardo als Künstler und Maler, als Erfinder und Konstrukteur berühmt. Allerdings war er als öffentlicher Künstler nicht sehr produktiv. Nur etwa fünfzehn Gemälde, die nachweislich von ihm selbst geschaffen wurden, sind erhalten, einige davon in sehr schlechtem oder nie vollendetem Zustand. Von all seinen wirklichen und angeblichen Erfindungen hat er nahezu nichts selbst realisiert. Im heutigen Mailand ist im Stadtteil Brera nahe der Kirche San Marco der Überrest einer Schleuse aus dem 15. Jahrhundert zu besichtigen, die auf Lionardo zurückgehen soll. Es handelt sich mutmaßlich um »die einzige Erfindung des Meisters […], die bis in unsere Zeit überdauert hat«.[1]
Wenn Lionardo da Vinci etwas war, dann war er ein Schreiber. Über 10000 Blätter, Bögen, Entwürfe, Fetzen, Schnipsel, Skizzen, Papiere, Seiten und Zettel hat er hinterlassen. Und das ist nur der Teil seiner vielen Aufzeichnungen, der uns erhalten ist. Von anderen Kladden, Notizbüchern und Codices mit seinen Papieren wissen wir; sie sind aber verschwunden, zerstreut, auseinandergerissen, verscherbelt oder schlicht im Laufe der Zeit auf die ein oder andere Art vernichtet worden. Wie groß die Zahl jener Lionardo’schen Aufzeichnungen ist, von denen wir keine, na ja: Notiz haben, ist unabschätzbar.
Zeit seines Lebens hat Lionardo Aufzeichnungen gemacht. Und er hat alles beschrieben, was man nur irgendwie als Notizzettel verwenden kann. Im Herbst 1517 besucht Kardinal Luigi von Aragon, ein Enkel des Königs von Neapel, mit seinem Gefolge den gealterten Lionardo in seinem Schlösschen an der französischen Loire. Sein Kaplan und Sekretär Antonio de Beatis hat über diesen Besuch ein, wie Lionardo-Biograph Charles Nicholl notiert, etwas »geschwätziges Reisetagebuch« verfasst, in dem er sich auch über Lionardos Notizensammlung äußert:
»Dieser Edelmann hat viel über Anatomie geschrieben, mit zahlreichen Abbildungen von Körperteilen wie den Muskeln, Nerven, Adern und den Windungen der Eingeweide, so dass es möglich ist, den Körper des Mannes und der Frau in einer Weise zu verstehen, wie es noch niemand zuvor getan hat. All das sahen wir mit unseren eigenen Augen, und er sagte uns, er habe schon mehr als dreißig Leichen seziert, Männer und Frauen jeglichen Alters. Er hat auch, wie er selbst sagte, eine unendliche Menge von Bänden über die Natur des Wassers, über diverse Maschinen und andere Dinge geschrieben, alle in der Volkssprache, und wenn man sie ans Licht brächte, wären sie nicht nur eine nützliche, sondern auch eine vergnügliche Lektüre.«[2]
»Oculatamente« – mit eigenen Augen: Mit dieser Formulierung hat Antonio de Beatis unabsichtlich ein Verfahren beim Namen genannt, das wahrhaft lionardesk ist und auf das beginnende neue Zeitalter hinweist. Der eigene Augenschein, die empirische Weltwahrnehmung wird zu einer eigenen Instanz. Was man selbst gesehen hat, »mit eigenen Augen«, beglaubigt die Tatsachen, die die Welt ausmachen. Lionardos Notizen, die er selbst nie veröffentlicht hat, aber offensichtlich dennoch öffentlich machte (wenn auch nur einer sehr begrenzten, oder darf man sagen: »privaten« Öffentlichkeit), werden durch sein eigenes Verfahren beglaubigt. Für den dahintersteckenden schrägen Öffentlichkeitsbegriff hat Jakob Jünger jüngst den Ausdruck »unklare Öffentlichkeit« geschaffen, für den er die paradoxe Umschreibung fand: »Nicht alles, was öffentlich ist, ist öffentlich.«[3] Jünger hebt damit auf aktuelle Erscheinungen der Onlinekommunikation ab. Mir scheint, er habe damit auch ganz gut eine Metapher für den Öffentlichkeitsstatus von Notizzetteln geschaffen.
Lionardo bastelte sich aber nicht nur Notizbücher. Er beschrieb alles, was sich irgendwie beschreiben ließ. Bei seinem künstlerisch und wirtschaftlich erfolglosen Romaufenthalt von 1513 bis 1515 trifft er seinen Halbbruder Giuliano. Dieser hatte von seiner Frau Alessandra, die mit ihrem Kind in Florenz verblieben war, einen rührenden Brief erhalten, in dem sie auch Grüße an den »eccellentissimo e singularissimo«, den herausragenden und einzigartigen Schwager ausrichten lässt. Offenbar hat Giuliano dieser Grüße wegen den Brief an Lionardo übergeben, und so landete dieser zwischen dessen Papieren. Für Lionardo war der Brief aber nicht als nostalgisches Souvenir an seinen Bruder aufhebenswert, sondern weil er den freien Raum am Ende des Briefs für eigene Notizen zur Geometrie nutzte. Auf der Rückseite des Briefes vermerkt er sogar noch, dass er ein anderes seiner Notizbücher dem Messer Battista dell’Aquila, dem privaten Kämmerer des Papstes, geliehen hatte.
Wenn ich im Angesicht von Lionardos Notizuniversum von der Arbitrarität der Beschreibstoffe spreche, hebe ich damit auf eine historische Aufzeichnungspraxis ab, die, im Übergang von der Manuskriptzeit, die man auch Manuzän nennen könnte, zur Typoskriptzeit und zur Gutenberg-Galaxis, dem Typozän, für das alltägliche Schreiben noch keine Regeln und Vorkehrungen kannte, keine Industrien und keine Produkte. Aus der antiken Tradition hatten schon die mittelalterlichen Schreiber die Wachstäfelchen übernommen. Diese tabulae ceratae oder griechisch hypomnêmata waren Holzschindeln, die einseitig oder auch beidseitig mit einer Mischung aus Bienenwachs, Kiefernharz und Ruß beschichtet waren und mit einem Griffel (lat. stilus) beschrieben wurden, indem mit der Spitze ins weiche Wachs gekratzt wurde. Mit einem Spachtel ließ sich die Oberfläche wieder glätten und die Beschriftung löschen. Auf diese Weise waren die Wachstafeln multipel verwendbar. Aus der Antike ist beispielsweise von Cicero, Seneca oder Augustinus überliefert, dass auf solchen Tafeln Briefe überbracht wurden, die vom Empfänger wieder gelöscht wurden, um sogleich als Antwortmedium herzuhalten. Mehrere Tafeln ließen sich mittels Kordeln oder Scharnieren auch zu Klappbüchern zusammenbinden. Ein Buch aus zwei Tafeln war ein Diptychon, eines aus dreien ein Triptychon und ein vielteiliges ein Polyptychon. Ein solches gebundenes Buch nannte sich Codex im Unterschied zum Volumen, also der Buchrolle, in der längere Schriften aufgezeichnet und auch gespeichert wurden. In der Spätantike löste dann der Codex die Schriftrolle als typisches Buchmedium ab, die Gestalt des Notizbuchs hat sich also medienhistorisch gegen den älteren Buchtypus durchgesetzt. Wenn heute Schauspielerinnen eine »Rolle« lernen oder wenn, vor allem im englischen Sprachraum, mehrbändige Schriften als »volumes« bezeichnet werden, rekurrieren wir noch auf den antiken Mediengebrauch.
So wie die Aufzeichnungen auf den tabulae ceratae flüchtig sind, dienen sie auch nur dem flüchtigen Schreiben, sie sind ein Verkehrs-, aber kein Speichermedium. Die Botschaften Lionardos waren aber nicht ausschließlich flüchtiger Natur. Darum schuf er sich seine eigenen Medien. Als Beschreibstoff nahm er alles her, was sich überhaupt beschreiben ließ. Die Herstellung von Tinten und Farben besorgte er als Handwerker und Künstler professionell selbst, und er band auch seine Aufzeichnungen selbst zu kleinen oder größeren Codices, Libretti, libricini (Büchelchen) oder taccuini (Heftchen). Dazu schlug Lionardo die Papiere in Pergament oder Leder ein und fixierte diesen Umschlag mit kleinen hölzernen Keilen, die durch die Schleifen einer Kordel gezogen wurden. Die Formate reichten vom verbreiteten Oktavformat bis hin zu miniaturisierten Taschenbuchformaten, die nicht größer als ein Kartenspiel waren. Der Künstler folgte damit gängiger Medienpraxis. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert war es vor der Industrialisierung auch des Druckwesens durchaus üblich, von der Offizin die beschriebenen oder gedruckten Bögen ungebunden zu erhalten und selbst für einen Einband zu sorgen. Deswegen finden sich in älteren Bibliotheksbeständen auch äußerst disparate Schriften zwischen den Buchdeckeln: Gebunden wurde auch, was nicht zusammengehörte.
Abb. 2: Lionardos Codex Forster
Lionardo trug offenbar praktisch immer ein Notizbuch bei sich, das er für schriftliche Aufzeichnungen oder für Skizzen nutzen konnte, häufig für beides zugleich. Ein Augenzeuge berichtet aus Lionardos Mailänder Zeit von einem »kleinen Buch, das stets an seinem Gürtel hing«.[4] Als er 1502 durch das Städtchen Cesena läuft, hat Lionardo offenbar ein solches Büchelchen bei sich, denn rasch wirft er eine kleine Skizze einer Alltagsbeobachtung auf Papier und gibt ihr eine Überschrift, die mittelbar auch über das Zustandekommen der Aufzeichnung Auskunft gibt: »So tragen sie in Cesena Trauben.« Man sehe ihn praktisch »wie einen Reporter« durch die Gassen schlendern, fügt Charles Nicholl an und findet damit die Formel für den spezifischen Empirismus Lionardos, seine Lehre vom eigenen Augenschein.[5] Ein Künstler solle, führt Lionardo andernorts aus, stets gewahr und in der Lage sein, schnell eine Skizze anzufertigen, »wie es die Umstände erlauben«. Hierbei geht es mehr um das Tempo als um die Qualität der Ausführung, und Lionardo gibt auch noch eine Anweisung für das Skizzieren, das mehr wie das Tutorial eines Comicstrips oder einer Clipart als wie das einer Studie erscheint:
»Man muß sie [die Menschen] auf den Straßen und Plätzen und auf freiem Feld beobachten und sie sich in knappen Umrissen aufzeichnen, das heißt, statt eines Kopfes mache ein O und statt eines Armes eine gerade oder gekrümmte Linie, und dasselbe gilt für Beine und Rumpf; und wenn man nach Hause kommt, führe man diese Aufzeichnungen in vollendeter Form aus.«[6]
Auch Vasari, der erste und zeitgenössische Biograph des großen Renaissancekünstlers, weiß von Lionardos Schreibwütigkeit, seiner jederzeitigen Schreibbereitschaft und täglichen Schreib-, Mal- und Kritzeltätigkeit zu berichten. Für die Existenz der Notizsammlungen kann Vasari eigene Augenzeugenschaft für sich reklamieren, und auch die völlige Disparatheit der Sujets, die Lionardo beschäftigten und die er in Vasaris Augen offenbar total inkohärent zu Papier brachte, bemerkte er. Vielleicht fühlte der Biograph aber auch nur die eigene intellektuelle Unterlegenheit angesichts des so immensen wie ingeniösen Ausflusses an Gedankenblitzen:
»Täglich verfertigte er Modelle und Zeichnungen, wie man mit Leichtigkeit Berge abtragen und durchbrechen könne, um von einer Ebne zur andern zu gelangen; wie mit Winden, Haspen und Schrauben große Lasten aufzuziehen wären, in welcher Weise man Seehäfen reinigen, und durch Pumpen Wasser aus tiefen Gegenden heraufholen könne. Solchen schwierigen Dingen sann er ohne Unterlaß nach, und es finden sich von diesen Gedanken und Bemühungen eine Menge Zeichnungen, deren ich viele gesehen habe.«[7]
Lionardo starb im Jahr 1519 im Château du Cloux (heute Clos Lucé) in Amboise, das ihm der französische König Franz I. überlassen hatte. Seinen gesamten schriftlichen Nachlass hinterließ er laut Testament seinem Schüler Franceso Melzi. In einer Holzkiste, die so schwer war, dass sie von zwei Männern getragen werden musste, ließ der Mailänder Patriziersohn Melzi den schriftlichen Nachlass seines Meisters zum Familienlandsitz in Vaprio d’Adda am Fuße der lombardischen Alpen tragen. Die Villa Melzi war auch zu Lebzeiten Lionardos schon einmal Aufbewahrungsort seiner Notizen. In der Zeit zwischen 1511 und 1513, in den Wirren der oberitalienischen Kriege, zog der maestro sich mit seinem Schüler hierher zurück. Genau in dem Turm, in dem Lionardo bei seinem Aufenthalt residierte, richtete Melzi nach seiner Wiederkehr sein Lionardo-Archiv ein, das ein Gedenkort war, vielleicht ein Denkmal, womöglich sogar ein Lionardo-Tempel oder, wie Stefan Klein schreibt, das »Allerheiligste«.[8] Er beschäftigte zwei Sekretäre, mit denen zusammen er Ordnung in die schier unüberschaubare Menge an Zetteln und Notaten bringen wollte und denen Melzi wenigstens einen Bruchteil von Lionardos Ideen zu diktieren versuchte. Eine Umschrift von Lionardos Aufzeichnungen war auch deswegen dringend geboten, weil der maestro seine Notizen in einer Geheimschrift verfasst hatte: Lionardo schrieb spiegelverkehrt von rechts nach links und band seine Notizbücher, so er sie überhaupt gebunden hat, von hinten nach vorne. Einer spontanen und flüchtigen Lektüre verwehrten sich die handschriftlichen Notizen darum von vornherein. Melzi empfing auch großzügig und bereitwillig Besucher, denen er seinen Lionardo-Schatz vorführte, was den Ruf dieser Aufzeichnungen, jedenfalls in den Kreisen der Eingeweihten und Kennerinnen, merklich erhöhte.
Wenn Melzi an der selbstgestellten Aufgabe, aus den unzähligen Notizen Lionardo da Vincis druckbare Manuskripte und damit letzten Endes im Druck veröffentlichte Werke herzustellen, gescheitert ist, hat er als gelehriger Schüler nur das Scheitern seines Lehrers und des Autors der Notizzettel nachempfunden. Auch wenn einzelne Notizbücher und Passagen zusammenhängende, kohärente Texte darstellten, war das überwältigende Gros der Aufzeichnungen Lionardos ein disparates Textmonster, das sich der kohärenten Zusammenstellung und Drucklegung eindrucksvoll widersetzte. Aus heutiger Sicht, da wir hypertextuelle und in Schichten, Überschreibungen und Palimpsesten organisierte Textsysteme kennen und wenn schon nicht meistern, dann doch bearbeiten können, erscheinen uns Lionardos Notizen nicht mehr so fremd und unbeherrschbar, wie sie Francesco Melzi und seinen Zeitgenossinnen vorgekommen sein müssen, sondern in gewissem Maße aktuell und modern. Lionardos Notizen sind deswegen noch nicht die Vorläufer heutiger moderner, postmoderner und neomoderner oder modernistischer Aufschreibesysteme, denn dazu fehlt bei der verschlungenen und disruptiven Überlieferungsgeschichte dieser Notizblätter die klare Sukzession. Aber sie sind doch die Blaupause für die aktuellen und die zukünftigen Formen des Schreibens und Notierens, die in ihrer Komplexität die Ordnung einer modernen Welt und eines modernen Denkens nachzeichnen wollen, die selbst womöglich stetig an Komplexität zunehmen. Francesco Melzi schaffte es in jahrzehntelanger Beschäftigung mit den Notizsammlungen Lionardo da Vincis gerade mal, einen einzigen halbwegs kohärenten Text als Manuskript herzustellen, der später Basis für den 1651 erstmals in Paris im Druck veröffentlichten trattato della pittura (Traktat über die Malerei) darstellte. Als Melzi 1570 hochbetagt verschied, hinterließ er Lionardos Zettelwerk seinem Sohn Orazio, dem hingegen jedes Geschick und wohl auch jedes Verständnis für den Umgang damit abging. Orazio Melzi trägt die Verantwortung dafür, dass der Nachlass Lionardo da Vincis in alle Winde zerstreut wurde, und wer heute das schriftstellerische Werk des Florentiners mit eigenen Augen, »oculatamente«, inspizieren möchte, muss eine Weltreise antreten. Der Hauslehrer der Familie Melzi konnte 13 Bände von Lionardos Aufzeichnungen entwenden und an den Großherzog der Toscana verscherbeln. Ein weiteres großes Konvolut an Notizen Lionardos, insgesamt über 2500 Blätter, ging an den Bildhauer Pompeo Leoni, der ihnen mit Schere und Kleber auf den Leib rückte. Die Disparatheit der Zettel und ihrer Inhalte weder verstehend noch beherrschend, schnitt er vermeintlich Zusammengehöriges aus und klebte es auf frische Bögen, die er wiederum zu eigenen neuen Konvoluten zusammenband. Nach Leonis Tod im Jahr 1608 ging jener Teil von Lionardos schriftlichem Erbe, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Besitz befand, an den Grafen Galeazzo Arconati, der ihn 1637 der Biblioteca Ambrosiana in Mailand überließ. Der heute noch dort vorhandene Teil der Notizen wird als Codex Atlanticus bezeichnet, umfasst 1119 Bögen und gilt als einer der wichtigsten Teile des Textnachlasses Lionardo da Vincis. Der Name des Codex leitet sich nicht von dem Ozean her, sondern vom sogenannten großen Atlasformat, da die Bögen eine Höhe von mehr als 60 cm haben, weswegen der Bibliothekar Baldassare Oltrocchi das Konvolut 1780 als »codice in forma atlantica« bezeichnete. Es enthält viele der heute berühmten Darstellungen von Flugmaschinen, Kriegsgerät und anderen technischen Erfindungen, die Lionardo auf dem Papier ersonnen hat.
Andere Teile aus Lionardos hinterlassenem Zettelkonvolut sind buchstäblich in alle Winde zerstreut und heute auf praktisch allen Erdteilen wiederzufinden. Wichtige Notizbücher Lionardo da Vincis landeten auf Windsor Castle und in der British Library, im Pariser Institut de France, im Vatikan oder in New York City.
Die Geschichten und Anekdoten von Verlust und stückweisem Wiederauffinden Lionardo’scher Manuskripte beleuchten drastisch den gewandelten Stellenwert von Notizsammlungen und handschriftlichen Aufzeichnungen und können darum als erster tentativer Beleg für eine der in diesem Buch vorgestellten Thesen dienen, dass nämlich Medien zum Vergessen da sind und nicht zum Erinnern. Dies mögen drei solcher Lost-and-Found-Geschichten illustrieren:
Der Codex Windsor wurde im 17. Jahrhundert von dem sammelwütigen englischen König Karl I. erworben. Er enthält vor allem die berühmten anatomischen Skizzen Lionardos. In den Wirren des englischen Bürgerkriegs wurde diese Handschrift in einer schweren Holzkiste verstaut, wo sie für über 100 Jahre schlicht vergessen wurde. Ähnlich erging es einer Sammlung rätselhafter Manuskripte, die heute als Codex Madrid bezeichnet werden. Wie diese Lionardo’schen Notizbücher in den Bestand der Biblioteca Nacional in Madrid gelangt sind, ist bis heute ungeklärt. Die mehr als 700 Bögen, die auf zwei Bände verteilt sind, waren seit dem Jahr 1866 im Madrider Bibliothekskatalog aufgeführt, aber nicht auffindbar. Erst der amerikanische Romanist Jules Piccus konnte sie 1967 durch einen glücklichen Zufall wieder aufspüren.
Dieses Vergessen ist symptomatisch und zeichnet eine wesentliche Medienfunktion nach, denn was aufgeschrieben ist, kann vergessen werden, und nichts ist vergesslicher und vergessenswerter als Notizzettel. Ergo: Medien sind nicht zum Erinnern da, Medien sind zum Vergessen da. Das Dingsymbol dieses Vergessens ist jene schlichte Holztruhe in Windsor Castle. Im konkreten texthistorischen Fall sprechen die vergessenen Lionardo’schen Notizzettel für das fehlende Bewusstsein des Werts von Autographen und Unikaten, das sich über die Jahrhunderte der modernen Mediengeschichte erst bilden musste und auch mit der Apotheose eines bestimmten Künstlertyps zu tun hat, an der Lionardo nicht ganz unbeteiligt war. Der Gebrauchswert dieser Notizen allein schien zu gering, so dass der Tauschwert und damit die Holzkiste mit den Zetteln in den Keller ging.
Ganz anders stellen sich Wert und Wirkung des Zettelnachlasses Lionardo da Vincis im Ausgang des 20. Jahrhunderts dar. Der Codex Leicester enthält 18 Bögen, die jeweils mittig gefaltet und beidseitig beschrieben sind, also ein Manuskript von 72 Seiten, das 1980 von einem amerikanischen Industriellen ersteigert wurde. 1994 landete Lionardos Zettelsammlung erneut beim Auktionshaus Christie’s und wurde für die Summe von 30,8 Millionen US-Dollar vom Gründer des Softwarehauses Microsoft, Bill Gates, erstanden, der noch heute der Eigentümer ist. Mit der Auktionssumme ist der Codex Leicester die teuerste jemals verkaufte Handschrift der Welt. Der Notizzettel als nichtiges und wertloses Medium? Davon kann wohl seitdem keine Rede mehr sein.
Viele Notizen Lionardos bereichern heute als Einzelblätter die Bibliotheken und Museen in aller Welt, weil Bibliophile, Büchernarren und Langfinger durch die Jahrhunderte die ursprünglichen Sammlungen gefleddert haben. Kaum abschätzbar ist, wie viele Notizzettel Lionardos komplett verschwunden sind. Martin Kemp schätzt in seinem Leonardo-Buch, dass zwischen 25 und 80 Prozent des Nachlasses Lionardo da Vincis verloren gegangen sind.[9] Lionardo da Vincis Notizzettel sind nicht nur als Werk ein disparates Konvolut verstreuter und zerstreuter Bemerkungen, sie institutionalisieren auch nach dem Ableben ihres Schöpfers ihr eigenes Schicksal, indem sie auseinandergerissen, fragmentiert und aufgelöst und schließlich in alle Winde zerstreut werden. Ihre Erinnerungsfunktion wird schon dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, dass diese Notizen als Ganzes nicht mehr erinnerlich sind, ein Angriff auf das kulturelle Gedächtnis.
Schreiben Drucken Veröffentlichen
Nichts von dem, was Lionardo notiert hat, hat er jemals veröffentlicht. Er tat sich ja schon schwer damit, seine Gemälde der Öffentlichkeit preiszugeben. Seine wichtigsten Bilder, unter anderem die Mona Lisa, befanden sich bei seinem Tod noch in seinem Besitz, er hat sie von Florenz querweltein bis nach Frankreich mitgeschleppt. Umso schwerer tat er sich mit seinen Notizbüchern und Zetteln. Für seinen Renaissance-Biographen Vasari war Lionardo darum der Inbegriff des vergeudeten Talents, des Schludrians, des Nicht-fertig-Bringers, des buchstäblich Unvollendeten und Unvollendenden. So hebt seine Lionardo-Vita mit der Bemerkung an, »daß er viele Dinge unternahm und, begonnen, wieder liegen ließ«. Später stellt er fest: »Lionardo unternahm vielerlei zum Verständnis der Kunst, beendete aber nichts«, um dann noch die intrikate Interpretation hinterherzuschieben: »es schien ihm, die Hand könne der Vollkommenheit, die er mit den Gedanken erfaßte, nichts mehr hinzufügen, sintemal er sich in der Idee einige feine, wunderbare Schwierigkeiten zu schaffen pflegte, welche die geschicktesten Hände nicht auszuführen vermocht hätten«.[1]
Gerade aber auch diese Worte in eine abschließende Gestalt zu bringen, tat Lionardo da Vinci sich lebenslänglich schwer. Wer in und mit Zetteln arbeitet, der will eben nicht finalisieren, sondern sich verzetteln. Abschlüsse und Enden sind das Gegenteil von Zetteln. Dabei war es durchaus nicht so, dass Lionardo sich nicht hin und wieder mit dem Gedanken beschäftigt hätte, seine Aufzeichnungen zu publizieren oder doch wenigstens aus der enormen Menge des Materials Auswahlen zu destillieren und in Buchform zu veröffentlichen:
»Ob ich all diese Eigenschaften [die ein Erforscher des Körpers braucht] besessen habe oder nicht, werden die 120 Bücher, die ich verfasst habe, mit einem klaren ›Ja‹ oder ›Nein‹ entscheiden. Ich bin dabei weder durch Gewinnsucht noch durch Nachlässigkeit behindert worden, sondern nur durch Zeitmangel. Lebe wohl!«[2]
Auf einem anderen Notizzettel wird deutlich, dass Lionardo sich Mühe gab, Ordnung in seine Aufzeichnungen zu bringen, sich Rubriken überlegte und Einzelblätter zu Sammlungen binden lassen wollte:
»Das Buch über die Wissenschaft von den Maschinen geht dem Buch ›Von den Nutzanwendungen‹ voraus. Laß deine Anatomiebücher binden!«[3]
Im Codex Windsor findet sich eine Anmerkung zu seinen anatomischen Studien, die darauf hindeutet, dass er speziell diese Arbeiten als Buch gedruckt sehen wollte, und seinen Nachlassverwaltern auftrug: »Ich markiere hier, wie die Zeichnungen ordnungsgemäß nachgedruckt werden sollen, und bitte Euch Nachfolger, dass der Druck nicht aus Knausrigkeit …«[4] Hier bricht die Notiz mitten im Satz ab.
Mit der Orts- und Zeitangabe »Begonnen in Florenz, im Haus von Piero di Braccio Martelli, am 22. März 1508« gibt Lionardo einen Hinweis auf seine redaktionelle Tätigkeit, mit der er des Wusts der Notate Herr werden wollte. Allerdings scheint er in dieser späteren Lebensphase die Hoffnung auf inhaltliche Kohärenz schon aufgegeben zu haben und schreibt, leicht resignativ, von einer »Sammlung ohne Ordnung«:
»Dies soll eine Sammlung ohne Ordnung sein, ein Auszug aus vielen Schriften, die ich abgeschrieben habe in der Hoffnung, sie später an den gegebenen Stellen einzuordnen, je nach den Stoffen, die sie behandeln.«[5]
Lionardo hatte also durchaus Publikationsabsichten. Wenn es doch nicht dazu kam, kann man davon ausgehen, dass eine Strategie dahintersteckte. Man könnte Lionardo mit dieser Nicht-, Anti- oder Depublikationsstrategie in eine Reihe mit einigen anderen großen Menschheitsgestalten stellen. Auch ein Sokrates oder ein Jesus haben nichts Publiziertes hinterlassen. Doch das führt gerade aus medialen und medienwissenschaftlichen Gründen in die Irre: In Zeiten der Manuskriptkultur war der Vorgang des Veröffentlichens etwas ganz anderes als im zu Lionardos Zeiten anbrechenden Typozän. Es gehört auf einmal in den Möglichkeitsraum eines schöpferischen Menschen um 1500, überhaupt ein Buch drucken zu lassen und über die Möglichkeit einer Veröffentlichung nachzudenken, die auch eine nennenswerte Verbreitung findet. In der mediengeschichtlichen Epoche davor hieß Veröffentlichung nicht automatisch Verbreitung, und der Kreis derjenigen Menschen, die eine Öffentlichkeit als Adressatin der Ver-Öffentlichung ausmachten, war recht überschaubar. Schon das ist ein Epochenunterschied des Typozäns im Vergleich zum Manuzän.
Lionardo hat seine Notizen nicht nur nicht veröffentlicht, er hat auch einiges unternommen, um sie vor fremden Augen zu schützen. Seine Handschrift ist, wie gesagt, nicht rechts-, sondern linksläufig, das heißt, er hat spiegelverkehrt von rechts nach links geschrieben. Man kann immer wieder lesen, das habe damit dazu tun gehabt, dass Lionardo Linkshänder und die ungewöhnliche Schreibrichtung für ihn darum organischer gewesen sei. Doch recht zufriedenstellend ist diese Erklärung nicht. Mir ist kein anderer Linkshänder bekannt, der aufgrund seiner Linkshändigkeit linksläufig schreiben würde, genauso wenig wie ich je von einem Arabischschreiber gehört hätte, der das linksläufige Arabisch wegen seiner Linkshändigkeit rechtsläufig geschrieben hätte. Auch in seinem zeichnerischen und malerischen Werk scheint Lionardo, soweit man das beurteilen kann, nicht spiegelverkehrt gearbeitet zu haben. Im Gegenteil, er rät Malern
»beim Malen einen Planspiegel zu benutzen und darin dein ganzes Werk oft zu betrachten. Es wird dort umgekehrt erscheinen und so aussehen, als sei es von eines andern Meisters Hand, und darum wirst du die Fehler besser beurteilen können als sonst.«[6]
Welchen Sinn sollte eine solche Vorgehensweise haben, wenn Lionardo ohnehin spiegelverkehrt gemalt hätte, da doch das Betrachten des Kunstwerks im Spiegel dann nur das Objekt oder Modell in seiner realen Ausrichtung gezeigt hätte? Es scheint sich also bei Lionardos Schreibrichtung in seinen Notizen um eine bewusste Codierung zu handeln. Zwar ist der Schlüssel zur Decodierung von Lionardos Notizen nicht sonderlich schwierig zu verstehen. Aber wer überhaupt schon einmal versucht hat, eine fremde Handschrift in größerem Umfang zu entziffern, kann sich vorstellen, wie schwierig das im Falle einer solchen Verschlüsselung ist. Außerdem hat Lionardo nahezu sein komplettes Leben lang diese Codierung verwendet, während sich seine Handschrift wie die jedes Menschen stark verändert hat. In seinen frühen Florentiner Jahren schrieb Lionardo ausladend und ornamental, später eher eng und konzis, was erheblich zur Datierung der Manuskripte beiträgt. Manche Notizen sind flüchtig und mit schneller Hand dahingeworfen, andere geruhsam und mit Überlegung ausgeführt und entsprechend kalligraphischer. Kurzum, der Unbefugten, Nicht-Eingeweihten oder der flüchtigen zufälligen Leserin erschließen sich die handschriftlichen Notizen Lionardo da Vincis nicht oder auf jeden Fall nicht unmittelbar. »Seine Schrift ist schwierig, fremd und (nach Ansicht vieler) ›finster‹«, bemerkt Charles Nicholl.[7]
Die eigenartige Handschrift ist nicht die einzige Form der Verschlüsselung von Lionardos Notizen. Lionardo liebte es, sich in Rätseln, verrätselten Prophezeiungen und allegorischen Vexierspielen auszudrücken. Solche Rätsel, oft auch in Form von Scherzgedichten, waren eine beliebte Form der Unterhaltung in Hofkreisen und der »besseren Gesellschaft«, die große Zahl solcher Texte in seinen Aufzeichnungen deutet aber darauf hin, dass sie nicht ausschließlich zu solchen praktischen Zwecken verfasst wurden:
»Da wird ein grosser Teil der Menschen, die noch am Leben sind, die aufbewahrten Lebensmittel aus den Häusern werfen und sie den Vögeln und Tieren der Erde zur Beute überlassen, ohne sich irgendwie darum zu kümmern [vom Säen].
Viele werden sich ein Haus aus Därmen bauen und sogar in ihren eigenen Därmen wohnen [von den Würsten in den Därmen].
Seelenlose Körper werden uns durch ihre Sprüche lehren, wie man im Guten stirbt [von den Büchern, die uns Lehren verkünden].«[8]
So wortreich Lionardo auch die Welt beschreibt, er selbst kommt in seinen Aufzeichnungen nahezu nicht vor, er machte sich als Person unkenntlich. Stefan Klein nennt ihn einen »Meister des Versteckens«, indem er »statt Menschen Tiere auftreten ließ und selbst die Rolle eines Fabelwesens einnahm« – auch das eine Form der Codierung.[9]
Es finden sich auch Notizen, die über die rechtsläufige Handschrift hinaus einen höheren Grad der Verschlüsselung aufweisen. Aus dem Jahr 1499 hat sich im Codex Atlanticus ein Blatt erhalten, das scheinbar in komplettem Kauderwelsch geschrieben ist: »Suche Ingil, sag ihm, dass du ihn Amorra erwartest und ihn Ilopanna begleitest.«[10] Es war die Zeit der Kriegswirren in Oberitalien, und Lionardo musste sich nach der Vertreibung seines Dienstherren Ludovico Sforza aus Mailand einen neuen Arbeitgeber suchen. Offenbar wollte er sich heimlich dem Söldnerführer Ligny anschließen, der auf dem Weg von Rom nach Neapel war. Die Schlüsselwörter hat Lionardo in Palindrome verwandelt, man muss sie also von hinten nach vorne lesen und erfährt, dass »Ingil« Ligny ist, Amorra für »a Roma« und Ilopanna für »a Napoli« steht.
Lionardo da Vincis Notizzettel und Notizbücher sind das Protobeispiel für Kommunikanten ohne Kommunikate: Sie kommen wie Mitteilungen daher, teilen sich aber nicht mit, sondern tun alles, um den Mitteilungscharakter der Notizen zu desavouieren. Lionardos Art des Notierens ist offenkundig eine Medienpraxis, aber eine, die nicht der Kommunikation dient. Es handelt sich bei diesen Medien also um unkommunikative Medien.
Die Gründe, warum Lionardo seine Kommunikate lieber nicht kommunizieren wollte, sind vielfältig und lassen sich, teils offenkundig, teils ihrerseits verschlüsselt, seinem Zetteluniversum entnehmen. Einige Notizen hat Lionardo offenbar trotz der bereits vorhandenen Codierung physisch zu eliminieren versucht. Im Codex Atlanticus findet sich ein Blatt, das ungefähr aus dem Jahr 1505 stammen soll, auf dem der maestro eine Notiz hinterließ, die er später mit Durchstreichung unkenntlich machen wollte. Gelungen ist ihm dies nicht, so dass man lesen kann: »Als ich den Christus-Knaben machte, habt ihr mich ins Gefängnis gesteckt, und wenn ich ihn jetzt als Erwachsenen zeige, werdet ihr mir noch Schlimmeres antun.«[11] Lionardo hatte einiges zu verbergen, und das kann einer der guten Gründe sein, seine Aufzeichnungen vor der Umwelt nach Möglichkeit geheim zu halten. Zu jenen Umständen, die einer Öffentlichkeit im ausgehenden 15. Jahrhundert nicht mitgeteilt werden sollten, zählt in jedem Fall Lionardos Sexualität. Seine Notiz von 1505 weist zurück auf eine äußerst unangenehme Episode aus Lionardos früher Phase, derentwegen er vermutlich sogar Florenz verlassen musste. Im Jahr 1474 wurde er bei den ufficiali di notte, den »Offizieren der Nacht«, die die Sittenwächter des Stadtstaats waren, denunziert, mit einer Gruppe anderer junger Florentiner Männer »Sodomie getrieben« zu haben, sprich: homosexuell zu sein und das auch ausgelebt zu haben. Im ausgehenden Mittelalter war homosexueller Verkehr als vitium contra naturam, als Sünde gegen die Natur, mit der Todesstrafe belegt, wenn auch im Florenz dieser Zeit die Strafe zumeist eher in einer Geldzahlung bestand. Immerhin reichte die denuncia, die Denunziationsanzeige des uns namentlich bekannten Denunzianten Giovanni Saltarelli bei den Nachtoffizieren (weswegen auch von einer »Saltarelli-Affäre« gesprochen wird), den Ruf des Künstlers nachhaltig und sogar durch die Jahrhunderte zu diskreditieren. Dessen Auftraggeber waren ja in der Regel Kirche und Klöster und deren bevorzugte Motive die Jungfrau Maria und andere Heilige. Nino Smiraglia Scognamiglio, der die denuncia erstmals 1896 publizierte, beeilte sich noch hinzuzufügen, Lionardo sei in dieser Angelegenheit »über jeden Verdacht erhaben«, da ihm »jede Form von Liebe, die gegen die Gesetze der Natur verstößt, fremd« gewesen sei.[12]
In ihrer verschlüsselten Form sprechen die Notizbücher Lionardos hier eine andere und vor allem sehr deutliche Sprache. Im Codex Arundel zum Beispiel findet sich eine wortreiche Liste von Varianten des italienischen Ausdrucks cazzo, der unflätigen Bezeichnung für den männlichen Penis. In den Forster-Notizbüchern gibt es eine Zeichnung, für die Carlo Pedretti die drastische Umschreibung »Il cazzo in corso« (der rennende Schwanz) gefunden hat. Und im Codex Atlanticus wurde kürzlich auf der Rückseite eines Fragments eine Illustration mit zwei Phalli auf Beinen gefunden, die, so Charles Nicholl, »wie Comicfiguren wirken«.[13] Eine dieser Phallusfiguren berührt einen Kreis oder ein Loch, über das der Name »Salai« gekritzelt ist – diese Kritzelei ist offenbar nicht von der Hand Lionardos (sie ist nicht spiegelverkehrt!) und kann als kleiner Seitenhieb oder Kommentar seiner Schüler oder Lehrlinge verstanden werden, denn Salai war der Spitzname von Lionardos Lieblingsschüler Giacomo Caprotti, der vermutlich sein Liebhaber war. Lionardo wird übrigens von allen Zeitgenossen selbst als ausnehmend gut aussehender Mann beschrieben. Für dieses Image tat er einiges: Anders als die anderen Künstler jener Zeit, die schlichte Handwerkerkleidung trugen, trat Lionardo mit einem knielangen, rosenfarbenen Mantel auf und trug mit Edelsteinen besetzte Ringe an seinen Fingern. Die Bildhauerei lehnte er für sich auch deswegen ab, weil man sich dabei schmutzig machte.
Auch in seinem malerischen Werk lässt sich Lionardos Homosexualität nur schwer verbergen. Charles Nicholl sieht eine »verhängnisvolle Nähe zwischen Homosexualität und Spiritualität in seiner Darstellung von Engeln und des jugendlichen Christus«, seine Modelle seien »sexuell begehrenswerte junge Männer« gewesen, und eine »gewisse Homoerotik strahlen alle seine Engel aus«.[14] Am berühmtesten in dieser Hinsicht ist vielleicht Lionardos Gemälde von Johannes dem Täufer mit dem zum Himmel weisenden ausgestreckten Zeigefinger. »Ja, da Vinci verspricht uns den Himmel: Schau auf diesen erhobenen Finger«, soll Pablo Picasso über das Bild gesagt haben.[15] Das Ölgemälde ist auch das beste Beispiel für den von Lionardo zur Meisterschaft gebrachten Stil des sfumato, bei dem durch farb- und deckungsarme Lasuren unzählige Schattenwerte entstehen, die die Übergänge zwischen hellen und dunklen Bildbereichen bis zur Unkenntlichkeit verschwimmen lassen. Es gibt zu dem Gemälde eine so rätselhafte wie umstrittene kleine Studie auf blauem Papier, die in der gleichen Zeit wie Johannes der Täufer zwischen 1513 und 1515 in Rom entstanden sein muss: Auch hier sehen wir einen lockenköpfigen Jüngling mit nach oben gerecktem Finger. Der Jüngling (ein Engel?) legt allerdings ein recht süffisantes Lächeln an den Tag, im Bildzentrum sticht eine betont weibliche Brustwarze ins Auge und etwas tiefer unter dem nichts verhüllenden Schleier der Figur prangt ein mächtiger erigierter Penis. Die Zeichnung trägt heute den Titel Angelo incarnato, also der fleischgewordene Engel. Es gibt eine Lesart, nach der Lionardo damit auf eine wenn auch häretische, um nicht zu sagen, blasphemische Interpretation der biblischen Verkündigungsgeschichte anspielt, der zufolge die Gottesmutter vom Erzengel Gabriel nicht nur gesegnet, sondern sehr manifest geschwängert worden sein soll. Was der Engel der Jungfrau mitzuteilen hatte, war demnach eine fleischgewordene Botschaft. Im Laufe der Überlieferungsgeschichte dieser Zeichnung muss jemand versucht haben, den Penis auszuradieren, was aber nur den Erfolg einer graubraunen Verfärbung ergab, die das Gemächt eher noch stärker betont: Was der reale Kommunikator Lionardo in seinen nicht veröffentlichten Skizzen und Notizen an dem imaginierten Kommunikator (»Himmelsbote«) stehen gelassen hat, das will offenbar später ein keuscher Bibliothekar oder ein verklemmter Sammler zum Kommunikanten ohne Kommunikat machen.
Es soll hier nicht so getan werden, als ob Lionardos Einstellung zur Sexualität der einzige oder auch nur der wichtigste Grund dafür gewesen wäre, aus seinen Notizbüchern unkommunikative Medien zu machen. Seine ganze Arbeitsweise und sein empiristisches Programm setzten ihn auch nach eigenem Bekunden in einen im Falle der Publikation unheilvollen Gegensatz zur herrschenden Meinung, sprich: zur Meinung der Herrschenden: »Ja, ich würde noch viel mehr erzählen, wenn es mir gestattet wäre, die volle Wahrheit zu sagen.«[16] Zu jenem Programm zählten beispielsweise seine anatomischen Studien, die er an Leichen in verschiedenen Hospitalen vornahm. Da die Kirche von der leiblichen Auferstehung der Gläubigen ausging, war die Sektion eines Leichnams eine schwere Sünde und bei