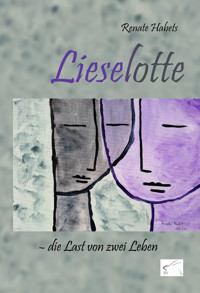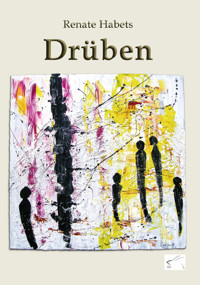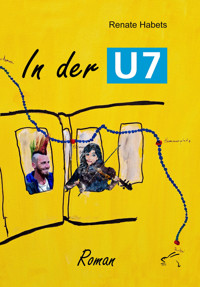4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Judiths Leben scheint vorgezeichnet: aufwachsen in zwar schwerer Zeit, aber eine trotz allem behütete Kindheit und Jugend, danach das Studium, dann Ehe und Familie. Aber so soll es nicht kommen. Das Leben geht seinen eigenen Weg und zwingt die Frau, Abschied von ihren Vorstellungen zu nehmen und einen selbständigen Weg zu suchen, der nicht vorgezeichnet ist. Ein Frauenleben nimmt seinen Lauf, überraschend, lebendig, psychologisch durchdacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edition Paashaas Verlag
Titel: Nur ein Leben
Autor: Renate Habets
Originalausgabe September 2019
Covermotiv: Renate Habets
Covergestaltung: Michael Frädrich
© Edition Paashaas Verlag, Hattingen
Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-049-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d–nb.de abrufbar.
Nur ein Leben
Für Irmela –
Sie weiß, warum …
Teil
Du bist doch ein Mädchen
Kriegsende
Platsch. Gebannt schaute Judith dem Tropfen hinterher, der sich oben an der Decke gebildet hatte. In dem flackernden Licht der Birne, die an ihrem Kabel leicht schaukelte, konnte sie ihn erkennen. Platsch, ein zweiter folgte. An den steinernen Wänden, die aus den hier in der Gegend gebrochenen Quadern bestanden, bildeten sich Wassertropfen. Wie gebannt schaute das Mädchen dorthin. Das lenkte ab. Man musste dann nicht mehr an die zwanzig Personen denken, die mit ihr zusammengepfercht in diesem Kuhstall saßen, seit gestern schon. Eine lange Zeit, sehr lang, wenn man nichts anderes zu tun wusste, als die Wassertropfen zu beobachten. Aber immer noch besser, als vor sich hinzustarren und die Angst zuzulassen, die in einem schwelte.
Alle hier in diesem Raum hatten Angst, das wusste sie. Das konnte sie spüren. Nur der jüngste von ihren fünf Brüdern, Vincent, hatte sich auf dem Schoß ihrer Mutter zusammengerollt und schlief. Mitunter zuckte er im Traum oder sein kleiner Mund öffnete sich leicht, als wolle er etwas sagen. Dann schlief er wieder ruhig weiter. Ihre beiden älteren Brüder, Aron und Lucas, saßen im tiefen Dämmerlicht in der hinteren Ecke des Raumes und hatten ein Blatt Papier mit einer Mühlezeichnung zwischen sich liegen, auf dem sie verschieden gefärbte Steine hin und her schoben. Aber immer wieder schaute einer der beiden auf, blickte zur Mutter und dem kleinen Bruder, und dann verschob er erneut eine der kleinen provisorischen Spielfiguren. In Krieg und Keller schienen sie sich eingerichtet zu haben, eingerichtet in dem Haus, in dem sie nicht besonders willkommen, aber auf das sie in diesen Wirren angewiesen waren. Die Bäuerin, bei der sie untergekommen waren, hockte mit ihren vier minderjährigen Kindern auf den Strohballen neben der Stalltüre. Ihr Jüngster, der achtjährige Karl, hatte sich ganz klein gemacht, damit Judiths Bruder Stephan noch neben ihn passte. Mit ihm, dem Neunjährigen, hatte er sich angefreundet, und sie waren, wo immer es ging, zusammen. Der Großvater und seine Frau saßen ebenfalls hier unten, drehten die Rosenkränze in ihren Händen und murmelten vor sich hin: „Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Gegrüßet seist du, Maria …“
Zwischen ihren beiden unverheirateten Töchtern, den Schwestern der Bäuerin, lehnte sich Gabriel, der Fünfjährige, vertrauensvoll an eine von ihnen, den Daumen im Mund. Außerdem konnte Judith in dem flackernden Licht noch den kriegsuntauglichen Bruder der beiden und die Nachbarn, eine Mutter mit ihren drei Kindern, erkennen.
Einundzwanzig Personen in diesem Raum neben dem Keller, der in Friedenszeiten drei Kühen zum Aufenthalt diente, das war schon arg. Aber hier war man einigermaßen sicher und geschützt, erreichte man ihn doch von der Hauptstraße aus nur über eine enge knarrende Kellertreppe aus Holz mit schiefgetretenen Stufen. Das Gute war, dass er nach hinten raus eine Tür hatte und zu der Hardt hin ebenerdig war, so dass man aus ihm dorthin hätte fliehen können, wenn es notwendig war.
An Fliehen jedoch dachte zu dieser Zeit niemand. 1945 war der Westerwald, in dem sie sich befanden, hart umkämpft. Bisher hatten er und das Siegerland den Krieg nur in Form von Luftangriffen gekannt. Im Frühjahr war er für Köln und viele Großstädte bereits nahezu vorbei, aber im Westerwald kam es zu dramatischen Ereignissen. Hier begann er für die meisten erst zu diesem Zeitpunkt richtig. Viele Soldaten, davon hatte man in den Dörfern gehört, waren in den aussichtslosen Kampf um die Remagener Brücke geschmissen worden. Über 8000 Bewaffnete und riesige Mengen Kriegsmaterial waren von den Amerikanern über den Rhein geschafft worden. Über die Sieg rückten sie unaufhaltsam vor, auch auf dieses kleine Dorf Blickhauserhöhe, in dem man im Kuhstall voller Angst wartete, was geschehen würde. Dass man den Krieg gewinnen könnte, daran glaubte niemand mehr. So waren alle Gespräche verstummt und die Gesichter der Erwachsenen besorgt. Alle kauerten hier tag- und nachtlang in diesem engen Stall, so gut es eben möglich war.
Dabei konnten sie noch dankbar sein, dass sie überhaupt hier sein konnten und einigermaßen beschützt waren. Zumindest waren sie dem Freien und der Kälte entkommen, für eine Weile auf jeden Fall. Sieben Personen, eine Mutter und ihre sechs Kinder. Der dreizehnjährigen Judith war durchaus klar, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, sie, die Mutter und die fünf Brüder.
Wochenlang waren sie über Land gezogen. Judith kam es wie ein ganzes Leben vor. Nachdem die Züge, mit denen sie von Potsdam aus gen Westen gefahren waren, nicht mehr fuhren, hatte die Mutter das Allernotwendigste auf einen winzigen Leiterwagen gepackt, so dass der kleine Vincent gerade auch noch auf ihm sitzen konnte, wenn seine Beinchen ihn nicht mehr weiter trugen. Er war ja erst drei, und die langen Strecken, die sie zurücklegten, konnte er noch nicht laufen. Den anderen Kindern hatte die Mutter das an Tragbarem gegeben, was sie nur irgendwie transportieren konnten. Außer Gabriel, denn auch er war mit seinen fünf Jahren vollauf mit dem Weiterkommen beschäftigt. Dazu trug jedes von ihnen zwei Garnituren der Kleidung, die sie mitgenommen hatten. Alles, was keine und keiner der Wetters – so hieß die Familie – mitnehmen konnte, wurde von der Mutter kurz entschlossen zurückgelassen. Das Leben war wichtiger als irgendwelche Habseligkeiten, mochten sie auch noch so wertvoll sein.
Von kurz hinter Köln an war die Mutter mit den fünf Söhnen und der Tochter Richtung Westerwald gezogen. Dort sollte es noch sicher sein. Den Leiterwagen zog sie hinter sich her, oft den Kleinsten schlafend zwischen den Gerätschaften, die sie auf ihm verstaut hatte. Die übrigen fünf Kinder gingen mal vor, mal hinter ihr, langsam oder schneller, so wie ihre Kräfte es zuließen. Es war ein sehr beschwerlicher Weg, meist bei Regen, der zu Beginn des Jahres 1945 anhaltend niederging und die Wege aufweichte und schwer begehbar machte. Man sah oftmals eines der größeren Kinder, wie sie die Mutter an der Deichsel beim Ziehen unterstützten oder den Wagen von hinten drückten. Der neunjährige Stephan reichte immer wieder seinem kleinen Bruder Gabriel die Hand, damit der Hindernisse besser überwinden oder die Pfützen umgehen konnte. Sie schliefen unterwegs am Wegrand in überdachten Schuppen oder Scheunen, ganz, wie sich ein Schlafplatz finden ließ. Gemütlich und einladend war er nie, aber die Mutter drängte auf Weiterkommen. Sie wollte ihre Kinder in Sicherheit wissen, behaust und nicht ununterbrochen flüchtend auf der Straße. Das glaubte sie auch, ihrem Mann schuldig zu sein, Franz Wetter, der in irgendeinem Lager – sie wusste nicht, wo – als Pfarrer, der nicht schweigen wollte, interniert war. Sie glaubte, es sei besser, Potsdam zu verlassen, als den Russen dort in die Hände zu fallen. Das hatte sie getan und dabei nicht gedacht, dass sie hier, in dem vermeintlich ruhigen Westerwald, nicht sicher vor den Amerikanern sein würde.
Mit ihren Kindern, immer den Leiterwagen hinter sich, irrte sie von einem der Dörfer ins nächste. Irgendwer musste ihnen doch Obdach geben. Es konnte doch nicht sein, dass man sie immer weg- und weiterschickte. Judith hatte beobachtet, dass die Mutter vornehmlich dort anklopfte, wo sie eine mitleidige Seele erhoffte, die ihnen Unterkunft bot. Aber sie wurden nur wieder davon geschickt, oft sogar gejagt. „Schert euch fort! Wir haben selbst nichts!“ Gerade einmal für eine Nacht ließen die Leute sie auf dem Hof, wenn sie Glück hatten. Aber meistens durften sie nicht einmal das.
Hochmütig sahen gerade die Frauen aus, die wie die Mutter als Pfarrersfrau gearbeitet und ihre Männer begleitet hatten. Frauen wie sie selbst, von denen sie am ehesten Verständnis erwartet hatte. Aber diese hatten sich hoch aufgerichtet an die Hoftür gestellt. Nicht einmal den gestampften Lehmboden des abgeschlossenen Platzes hinter dem Zaun hatten sie betreten dürfen, so als hätte die Erlaubnis ihnen ein Bleiberecht gewährt. Schon an dem Eingangstor war ihnen der Zugang verboten worden. Der hoch ausgestreckte Zeigefinger, der in die Weite der Felder, Wiesen und Wälder wies, zeigte ihnen, dass hier nicht ihre Bleibe sein würde. Man schickte sie fort, überall. Eine Mutter und ihre sechs Kinder! Zwischen sechzehn und drei Jahren! Frauen, wie die Mutter eine gewesen war, stellten sich hochmütig an das Tor und wiesen sie schroff ab, ohne Brot, ohne Wasser. Von oben herab blickten sie auf ihre kleine Schar herab, kopfschüttelnd. Sie, die Mutter, die einstmals über mehr als ausreichend Hab und Gut verfügt hatte, musste sich wie eine Bettlerin vorkommen. Aber da waren doch die hungrigen und müden Kinder …
Also zogen sie weiter und versuchten es ein neues Mal. Nur nicht an die Beschämung denken, den Stolz überwinden und erneut bitten. Zumindest schien es Judith so, die sich gut hineinversetzen konnte, was die Mutter für die Kinder auf sich nahm.
Mindestens zwei Wochen waren sie so durch das zunächst noch flache Siegerland Richtung Hügel gezogen, immer verkommener wirkend, immer hoffnungsloser. Da sollte auf einmal eines Tages ihre Qual ein Ende finden. Gegen Abend war es schon. Eine Stunde von Wissen entfern war die kleine Gruppe über den Hügel, Stuhl genannt, auf die Betzdorfer Landstraße gekommen. Hinter der Gaststätte, die gegenüber der Kirche lag, stand ein Fachwerkhaus, das geradezu auf das Jugendheim schaute. Zwei Frauen verließen es gerade und blickten die Frau an, die mit ihren Kindern am Gartenzaun verschnaufte.
„Wo kommt ihr her?“
„Potsdam.“
„Poootsdaaam? Wo wollt ihr denn hin?“
„Irgendwohin. Trocken soll es sein und weg vom Krieg.“
„Das wollten wir auch. Wir sind mit unseren Kindern aus Köln gekommen und wohnen im Jugendheim. Wir haben die Bomben nicht mehr ausgehalten.“
„Die Bomben …“, murmelte die Mutter, „die Kälte und den Hunger. Und das Rumziehen, das gar nicht …“
„Ist dein Mann im Krieg?“, wollte die eine wissen.
„Nein, irgendwo im Lager. Pfarrer …“
Aufmerksam blickte die zweite nun die kleine Gruppe an. „Genügt euch die Scheune zum Schlafen?“
„Klar, Hauptsache, wir kommen ein wenig zur Ruhe.“
Die erste der Frauen drehte sich wieder um, verschwand in der Haustür und kam nach einer Weile mit einer Bäuerin zurück, hinter der ein etwa Achtjähriger neugierig hervorlugte. Sie musterte die Mutter und ihre Kinder abwehrend. Aber als sie den Dreijährigen sah, der erschöpft, verrotzt und völlig verschmutzt auf dem Leiterwagen eingeschlafen war, schien sie so etwas wie Mitleid zu erfassen.
„Brauchst einen Platz?“, fragte sie.
„Oh ja“, kam die leise, kaum hörbare Antwort, „oh ja“, nun schon lauter.
„Kann dir nur die Scheune geben. Kochen kannst du in der Küche. Klo ist neben dem Haus.“
Judith blickte ihre Mutter an, in deren Schmutz so plötzlich ihr schönes Gesicht hervorleuchtete, so dass ihr ganz feierlich zumute wurde. Die würde ja doch wohl … Ja, sie hatte es getan!
„Die Scheune ist gut für uns. Wir sind trocken und haben endlich ein Dach über dem Kopf. Ich danke euch. So sehr danke ich euch.“
Ganz schnell hatten sie ihren Wagen mit den wenigen Habseligkeiten durch das Tor gezogen. Die großen Jungen hatten Stroh zu Lagern zurechtgeschoben. Die Mutter und Judith hatten in der Küche, die die Bäuerin mit allen Evakuierten teilte, ihre Essensreste in einen Topf geworfen und einen Eintopf daraus gekocht. Essen und für eine Weile ein Dach über dem Kopf! Es würde zwar sicherlich mühevoll werden, aber für die sieben Wetters war das an jenem Abend der Himmel gewesen, der Himmel in einer Welt, in der die Amerikaner immer näher rückten und ihre vorläufige Ruhe bedrohten.
Platsch! Ein weiterer Wassertropfen war von der Decke herab getropft. Judith schrak aus ihren Erinnerungen hoch. Sie schaute in dem Dämmerlicht herum und sah, dass nur wenige Minuten vergangen und alle noch mit dem beschäftigt waren, was sie vorher getan hatten. Ein lautes Krachen von der Straße her ließ jede und jeden von ihnen zusammenzucken. Das Murmeln der Großeltern wurde lauter – ängstlicher? –, und die Perlen des Rosenkranzes liefen schneller durch ihre Finger. „Gebenedeit unter den Weibern.“
Die Mutter hatte aufgeschaut und den Kleinen fest an sich gezogen, so als wolle sie ihn vor allem Übel, das dort draußen auf sie lauerte, schützen. Wenn sie doch nur wüssten, was dort geschähe! Judith hatte keine Ahnung, was sie sich eigentlich wünschen sollte. Dass die Amerikaner kämen und all dem ein Ende machten, irgendwie. Oder dass man hier unten sitzenbleibe. Was war besser? Frieden, das wäre am besten! Aber an den glaubte sie nicht mehr, und mit ihr alle anderen auch nicht. Frieden, das war in den sechs langen Jahren ein Fremdwort geworden.
Lauter wurde es nun draußen. Es schien, als bebten die ungeputzten Steinwände des Stalls. Von dem Weg her, der zur Hardt führte, hörte man mitunter Geschrei, auch den Knall eines Schusses, dann wieder tiefe Ruhe. Was dort oben auf der Betzdorfer Landstraße geschah, konnte und mochte sich lieber keiner vorstellen. Das Knattern und Rumpeln von Gerät, das sich wie Wagen oder Autos anhörte, tönte mitunter laut bis in die Tiefen ihres Verstecks. Dann wieder hörten sie überhaupt nichts, keinen Knall, keine Menschenstimmen, kein Rattern. Diese Stille war fast noch beängstigender als der hier unten vernehmbare Lärm.
Judith schien es, als sitze sie seit Wochen und Monaten, eingeschlossen, vom Tageslicht abgeschnitten, im Angstschweiß der zwanzig anderen, die mit ihr hier gefangen waren. Nur das murmelnde Beten ließ menschliche Stimmen hören, alles andere schien unwirklich und kaum ertragbar. Dennoch hielt sie aus, mit den anderen.
„Der Ami ist gefährlich“, hatte die Mutter ihnen zugezischt, als sie das Notwendigste und ihre Kinder zusammenraffte und mit ihnen von der Scheune zum hinteren Eingang des Stalls hastete, wo man sich – das hatte die Bäuerin versprochen – mit den anderen in Sicherheit bringen konnte. Wenn es denn eine Sicherheit war! Sie saß jedoch immer noch dort unten und fürchtete gemeinsam mit den anderen den gefährlichen Ami. Was sie fürchtete, war ihr nicht gesagt worden. Aber die Mutter wusste Bescheid. Wenn sie sagte, er sei gefährlich, dann stimmte das, dann hinterfragte es in diesen schlimmen Zeiten niemand. Zu viel hatte sie gesehen, und zu viel hatte sie mitgemacht. Auch sie hatten zu viel erlebt, sie, die Kinder, bei ihrem Fußweg in den Westerwald, um ein Obdach zu finden, viel zu viel.
Angestrengt lauschte sie nach oben. Plötzlich hörte sie ein lautes Poltern von der Haustüre her, dann noch eines, noch lauter und anhaltender. In diesem Moment riss Judith ihre langen weißblonden Zöpfe nach vorne, klemmte sie zwischen die Oberarme ein, sprang auf und stürzte zu der Kellertür. Hinterher konnte sie nicht mehr sagen, warum sie dies getan hatte. Es war Instinkt, reiner Instinkt, der sie trieb. Bevor sich noch ein aufgeregtes Stimmengewirr in dem Stall erheben konnte – das hörte sie, als sie den Raum bereits verlassen hatte –, hatte sie die widerständige hölzerne Tür aufgestoßen, durchquerte mit drei großen Schritten den winzigen düsteren Flur an den Kellern entlang und war bereits auf der Treppe.
„Judith“, hörte sie noch den Schrei ihrer Mutter, die wohl, Vincent im Arm, zur Stalltür geeilt war, um die Tochter zurückzuholen. Noch einmal, schrill, angstvoll: „Judith!“ Aber sie war durch die tiefe Dunkelheit, die sie nun umfing, bereits zwei Stufen hoch und achtete nicht auf die Rufe, die sie aufzuhalten suchten. „Weiter!“, drängte es in ihr, immer nur: „Weiter!“ Wohin, wozu, diese Fragen hatten keinen Raum in ihr. Sie wusste nur, dass sie vorwärts musste, nach oben. Sehen konnte sie nichts, nur fühlen, wo es weiterging. Krachend flog der Zugang zum Keller, der von einem einfachen hölzernen Brett mit einem Riegel gebildet wurde, nach außen gegen den Aufstieg der Treppe. Keuchend folgte das Mädchen ihm und stand plötzlich auf den Steinen des Dielenbodens, schwankend, so schnell war es nach oben gelaufen. Mitten in einem Lichtstrahl stand es, der von der Betzdorfer Straße her durch die geöffnete Haustür in den Flur schien. Von ihm umflossen verharrte es eine Sekunde. Dann schob sich eine Gestalt, massig und mit leicht gerundetem Rücken, in die Helligkeit. Da stürzte das Mädchen auf sie zu, ohne Gedanken, was zu tun sei, ohne Überlegung, wer das sein könne. Die Zöpfe flogen um seinen Kopf, wie blonde Peitschen, als es vorwärts preschte, leicht gebückt. Judith tat einen gewaltigen Sprung nach vorne und spürte nur einen Bauch, gegen den sie gerannt war. Im gleichen Moment, als ihr Bewusstsein zurückkehrte und sie sich zu fürchten beginnen wollte, fühlte sie sich vom Boden aufgehoben, fest um die Mitte gepackt und herumgeschwenkt, einmal, zweimal, viele Male. Ihre Zöpfe bildeten einen Kreis um das Mädchen, das von den kräftigen Händen durch die Luft geschwungen wurde von…
Schwarz war das, was sie im Aufschauen sah, schwarz mit blitzendem Augeninnern und schneeweißen Zähnen! Es war ein Schwarzer, der aus der Helligkeit gekommen war und das Mädchen aus dem Dunklen aufgefangen hatte. Ein Schwarzer, der erste Schwarze, mit dem sie in eine so nahe Berührung gekommen war.
„We surrender“, hörte man Stimmen von der Straße her, „we surrender!“ „Wir ergeben uns!“
Judith sah das breite Lachen ihres Eroberers, denn das war er ja eigentlich. Die Amerikaner hatten das Dorf genommen, und dieser eine GI hatte die Türe des Fachwerkhauses gesprengt und freute sich nun genauso über das Freiwerden von Hitler wie sie! Ehe er sie vorsichtig zu Boden ließ, drückte sie ihm schnell und verlegen einen Kuss ans Ohr. Dann stand sie gemeinsam mit ihm in dem Lichtstrahl und schaute staunend auf diejenigen, die langsam den Keller verließen: als erstes die Mutter mit dem noch immer schlafenden Vincent auf dem Arm, dann die neugierigen Karl und Stephan, die Bäuerin mit ihren drei Kindern, die Brüder, der Onkel, die Tanten mit Gabriel an der Hand, die Nachbarn und ganz zuletzt Großvater und Großmutter, immer noch den Rosenkranz in der Hand drehend. „Der du von den Toten auferstanden bist.“ Diese alle drängten sich nun auf dem kleinen Fleck vor der Kellertreppe zusammen und hörten das immer lauter werdende „we surrender“ von der Betzdorfer Landstraße, das fast wie ein Siegeslied zu klingen begann.
Erst als die einzelne Glocke der Kirche anfangs zaghaft und dann immer kräftiger zu schlagen begann, trauten sie sich weiter zu gehen und auf die Straße zu treten, wo sich allmählich die Dorfbewohner, die sich vorher alle versteckt gehalten hatten, vor der Kirche zusammenfanden, laut zu rufen und dann zu jubeln begannen.
„Gesegnet seist du Maria“, hörte man in dem Lärm auf einmal die Stimme einer der Tanten, die still inmitten des Trubels stand, Gabriel immer noch fest an der Hand. „Voll der Gnaden“, fielen nun die Nahestehenden ein, und „gebenedeit sei die Frucht deines Leibes“ beteten bereits alle mit gefalteten Händen zu Ehren des Kriegsschlusses und der Schutzpatronin des Dorfes.
Neben der Bank vor dem Fachwerkhaus stand der dunkelhäutige Amerikaner neben der weizenblonden Judith, deren Haar in der Sonne fast weiß wirkte. Der Farbige hatte den Arm um die Schulter der ‚Feindin‘ gelegt und schaute in den Himmel, so als seien seine Gedanken bei einer anderen Familie, einer Familie weit weg auf der gegenüberliegenden Hälfte der Erdhalbkugel. Unweit von den beiden hatten sich die hellschöpfigen Aron und Lucas, Judiths Brüder, postiert und hielten das Paar, Sieger und Besiegte, im beschützenden Blick. Sie konnten ja nie wissen, ob sie die Schwester retten musste! Die übrigen Amerikaner, die mit Panzern und Militärjeeps in Blickhauserhöhe eingefahren waren, verweilten ebenfalls eine Weile und hielten zum Teil die Köpfe gesenkt.
Als das Gebet beendet war, stimmte einer der kriegsuntauglichen Männer „Maria zu lieben“ an, in das der Chor der Dorfbewohner laut einfiel. Auch diesem hörten die Sieger noch zu, dann erhoben sie am Ende des Gesangs ihre Stimmen, riefen einander Unverständliches auf Englisch zu. Die kurze Feierlichkeit auf der Dorfstraße wich der Aufgeregtheit und erwies sich als vergänglich. Mit den Armen fuchtelten die Eroberer herum, wiesen die Dorfbewohner an, in ihre Häuser zurückzukehren. Wer nicht schnell genug war, dem wurde mit einem Schubs geholfen.
Nur Judith stand immer noch völlig bewegungslos im Sonnenlicht vor der Ruhebank. Dann drehte sie leicht den Kopf und schaute den Amerikaner an, der der erste Farbige gewesen war, der sie herumgeschwenkt und später beruhigend den Arm um sie gelegt hatte. Sie schaute ihm geradewegs ins Gesicht, forschend, aber nicht ängstlich. Da strahlte er sie an. Aus der Tiefe seines Herzens tat er dies, so schien ihr. Er lächelte noch einmal breit und vertrauenerweckend, dann schloss er sich den übrigen Soldaten an, die auf ihren Panzern, in ihren Jeeps oder zu Fuß das Dorf verließen, das nunmehr befreit war.
Zwei Tage später hatte die Geschichte noch ein Nachspiel. Mit quietschenden Bremsen hielt ein Militärjeep vor dem Haus gegenüber der Kirche. Ein junger Soldat sprang von dem Sitz und zerrte ein großes Paket von dem Rücksitz. Er trug es zu der Treppe, auf der die Bäuerin stand und nach einem kurzen Wortwechsel zur Scheune wies. „For Judith“, sagte er zu dem neugierigen Stephan, der als erster der Wetters zur Tür gelaufen war und das Paket nun in Empfang nahm. „For Judith“, sagte er noch einmal, drehte sich um, stieg in den Jeep und brauste davon.
Aufgeregt bedrängten die Brüder Judith, die ganz fassungslos an einem provisorischen Tisch stand, an dem sie Kartoffeln geschält hatte. „Mach auf, los, mach auf!“, riefen sie, und als das Mädchen die Kiste geöffnet hatte, war sie voller Schokolade. Schokolade aller Art: Tafeln, Kügelchen, Pfefferminztafeln, schokolierte Früchte. Schokolade aus Amerika „for Judith“. Und Kaffee und Corned Beef. Ihr war klar, dass der Farbige dies schickte, dem sie bei der Befreiung in die Arme gesprungen war, und sie freute sich riesig darüber, auch wenn die Wetters viel eher Reis oder Konserven gebraucht hätten. Die Hälfte des Pakets schleppte sie in das Haus zu der Bäuerin, froh darüber, ihr endlich einmal etwas für ihre Bereitschaft geben zu können. Der fuhr auch einmal ein Lächeln über das Gesicht, als sie die Schokolade sah, so dass Judith auch bei ihr zum ersten Mal das Gefühl hatte, willkommen zu sein.
Bis Oktober blieben die Wetters noch in der Scheune in Blickhauserhöhe, erholten sich dort und richteten ihr Leben ein, so gut es eben ging. Die Bäuerin war zwar nicht viel freundlicher geworden, behandelte sie aber höflich, wenn auch kurz angebunden. Je mehr sich die Verhältnisse nach Kriegsende stabilisierten – soweit sie sich überhaupt stabilisieren konnten –, desto unruhiger wurde die Mutter und drängte darauf, die sichere, aber primitive Unterkunft zu verlassen. Sie wollte nach Berlin, unbedingt, weil sie hoffte, dort über die Landeskirche den Vater zu finden. Er musste noch am Leben sein, da war sie ganz sicher.
So verließen die Sieben an einem hellen Oktobertag das Dorf Blickhauserhöhe im Westerwald und machten sich auf den ungewissen Weg nach Berlin. Irgendwie würden sie schon ankommen, das hatte die Mutter ihnen versichert.
Der Abschied von der Bäuerin war kurz, länger war er von den wenigen Frauen und Kindern, die dort noch evakuiert und noch nicht nach Köln zurückgekehrt waren. Die Zeit der Entbehrung hatte sie zusammengeschweißt, keiner von ihnen war es besser gegangen. Sie hatten miteinander geteilt und waren sich in einigen Fällen sehr nahe gekommen. Karl und Stephan mochten nicht voneinander scheiden. Immer wieder lief der Bauernjunge, der soeben seinen neunten Geburtstag hinter sich gebracht hatte, ein Stück des Weges nach Wissen neben dem Leiterwagen her, auf dem wieder Vincent zwischen den wenigen Habseligkeiten der Familie saß. Oben auf dem Stuhl verabschiedete er sich das erste Mal, bis Schönstein aber konnte er sich nicht von Stephan trennen, sondern lief stumm neben dem so lieb gewordenen Freund her. Am Schloss drehte er sich abrupt um und rannte hastig zurück, ohne sich ein einziges Mal umzuwenden. So sah er nicht mehr, dass sein vertrauter Kumpan stehen geblieben war und hinter ihm her schaute. Nass waren seine Augen sicherlich. Ob er Tränen vergossen hat, konnte Judith nicht sehen, denn er hielt bis Wissen den Kopf steif abgewendet und starrte in die Grasbüschel am Wegesrand.
Mit den Zügen, die wieder verkehrten, und auch langen Zwischenstrecken zu Fuß schlugen die Wetters sich nach Berlin durch, wo sie auch tatsächlich den Vater wiederfanden. Schmal war er geworden, alt wirkte er, dachte Judith, als sie ihn wiedersah. Aber als er seine Frau erblickte, erstrahlte sein Gesicht. Die Eltern blickten einander an, als wären sie nicht diese lange Zeit getrennt gewesen, sondern noch am Beginn ihrer Beziehung.
Kennenlernen
Die Eltern! Aus so unterschiedlichen Welten kamen sie. Waren sie gerade deshalb einander so zugetan? Judith wusste es nicht, aber wie alle dreizehnjährigen Mädchen interessierte sie sich brennend dafür, wie die Eltern sich gefunden und verliebt hatten. In den vergangenen Monaten hatte sie die Mutter immer wieder ausgefragt, hatte sich erzählen lassen, wann immer Zeit dafür gewesen war, und blickte seitdem mit ganz anderen Augen auf das Paar, das mit neuer Kraft sein Leben wieder aufnahm. Im Frieden, aber auch in den Wirren, Nöten und Unsicherheiten der Nachkriegszeit.
Erstaunlich war die Geschichte ihrer Bekanntschaft. Eigentlich hätten sie gar nicht zueinander finden sollen, wenn es nach ihren Elternhäusern gegangen wäre. Zu verschieden waren ihre Herkunft und zu unterschiedlich die Veranlagungen, die sich auch in ihren sechs Kindern wiederfanden.
Der Vater, Franz August Wetter, stammte aus gebildeten Kreisen. Seit mehreren Generationen waren seine Vorfahren an der Universität beschäftigt gewesen. Sein Vater August, ein Rufname mit langer Tradition in der Familie, lehrte als Dozent für Urkundenforschung an der Universität Bonn und hätte sich sehr gefreut, wenn sein einziger Sohn den gleichen Weg eingeschlagen hätte. Diesen aber reizte die Lehre nicht. Zu trocken erschien sie ihm, zu fern von den Menschen, mit denen er umgehen wollte, gesellig, wie er von klein auf gewesen war. Dies war wohl ein Erbteil seiner Mutter Wilhelmine, die von allen Nahestehenden nur Minchen gerufen wurde und ganz darin aufging, für Mann und Sohn ein gemütliches Zuhause zu schaffen.
Nach dem Abitur ging Franz, nachdem er lange, intensive und mitunter heftige Gespräche mit dem Vater geführt hatte, an die Humboldt Universität in Berlin und studierte Theologie. Nicht Professor wollte er werden, was den Vater schmerzte, sondern evangelischer Pfarrer. Mit Menschen wollte er arbeiten, predigen, seinen Glauben tätig weitergeben. Irgendwann hatte der Vater wohl eingesehen, dass dies der Weg des Sohnes sein sollte und ließ ihn an die Berliner Universität ziehen. Sehr bald war er eine Stütze seiner Verbindung, heiterte alle mit seinem fröhlichen Wesen auf und war auf dem besten Weg, zu einem der Mittelpunkte seiner Fakultät zu werden. Berlin genoss er aus vollem Herzen, Stadtkind, das er im tiefsten Inneren war.
Die katholische Helene Clara stammte vom Land. Sie war das dritte und jüngste Kind des Landadeligen Albert von Bütrup, der mit seiner zweiten Frau Hedwig Katharina, einer Adeligen aus Vorpommern, einen großen l-förmigen Gutshof bei Dargun bewirtschaftete. Zwar war seine Frau wesentlich jünger als er – aus erster Ehe hatte er zwei erwachsene Söhne, die in preußischen Diensten standen –, aber die Beziehung war ausgesprochen zufriedenstellend für beide. Er gestattete und finanzierte seiner Frau deren geliebte und zahlreiche Besuche in der Stadt, meist Berlin, wo sie stets mehrere Wochen blieb und Kultur und Geschäfte genoss. War sie dann bei ihm auf dem Gut, lebten sie beide sorglos und ausgeglichen miteinander. Jede und jeder ging seinen Aufgaben nach. Sie trafen sich zu den Mahlzeiten, spielten ab und an Schach und teilten interessiert die Weltneuigkeiten aus den Zeitungen.
Alberts ganzes Glück war die ihm spät geborene Tochter, die so sehr ein Kind seiner Gene war, dass sie am liebsten ihre Zeit mit dem Vater und dem Gesinde mitten in der mecklenburgischen Parklandschaft verbrachte und alles das tat, was ein Landei so tut: reiten, jagen, sich um die Tiere kümmern, durch die Felder schweifen und allüberall nach dem Rechten schauen. Geliebt und verwöhnt von Vater und Mutter, von den beiden älteren Brüdern, die sich über die kleine Schwester herzhaft gefreut hatten, verhätschelt und auf Händen getragen, hielt sie sich lange für das Zentrum des Lebens. Es trachtete ja alles danach, ihre Wünsche zu erraten und bereits zu erfüllen, ehe sie sie überhaupt gehabt hatte. Dargun, das damals noch sehr klein war und keine Stadtrechte hatte, genügte ihr vollkommen. Dort besuchte sie dann auch die höhere Schule. Allmorgendlich wurde sie in der Kutsche dorthin gebracht, winters im Schlitten.
Helene hätte eines jener verzärtelten, verzogenen jungen Mädchen werden können, wie man sie unter den Landadeligen häufiger fand, aber das verhinderten wohl ihre guten Gene. Sie war zwar äußerst selbstbewusst – das blieb bei ihrer Erziehung nicht aus –, dabei aber sehr mitfühlend und an allem interessiert, was ihre Hilfe brauchte. Als Kind hatte sie eine Vielzahl von aus dem Nest gefallenen Vögelchen und verletzten Tieren gepflegt und sich später auch um die Menschen auf dem Gut gekümmert, die ihre Hilfe brauchten.
So war es eigentlich konsequent – nur der Vater hatte nicht damit gerechnet –, dass sie nach Beendigung der Schule keinesfalls das Lebensziel verfolgte, das für ihn so selbstverständlich war. Er hatte bereits einen Sohn von einem der Nachbargüter ins Auge gefasst, der Erbe war und sicherlich eine große Karriere vor sich hatte. Nett war er auch. Das fand seine Tochter zwar auch, aber doch nur als Kamerad und nicht als Lebenspartner, wie es so selbstverständlich zu sein schien. Das zumindest sah der Vater so.
Helene aber hatte ihren eigenen Kopf. Nun erst erkannte er, dass sie die Sturheit aller Ahnen, von der die Verwandtschaft immer wieder erzählt hatte, und damit auch die seinige, geerbt hatte.
„Vater, ich muss mit dir sprechen“, sagte sie eines Abends zu ihm, nachdem sie an sein Büro geklopft hatte.
„Ja, mein Lenchen, was hast du denn auf dem Herzen?“, schmunzelte er ihr gutmütig zu. „Komm her zu mir.“
Sie jedoch blieb nahe der Tür stehen. „Ich will nach Berlin“, stieß sie hervor.
„Ja, natürlich kannst du nach Berlin. Musst ja auch mal was von der Welt sehen. Mutter fährt ja immer dahin, fährste eben mit, kein Problem“, schmunzelte er ihr zu, wunderte sich aber bereits ein wenig, warum sie wie festgewachsen am Eingang des Zimmers blieb.
„Nein, ich will allein nach Berlin“, schoss es aus ihr heraus, und da erfuhr er, mit welchem Plan sie sich bereits seit Monaten trug. Sie wollte nicht nach Berlin, um dort ihren gesellschaftlichen Schliff zu vervollkommnen, wie es für Mädchen ihres Standes üblich war, sondern sie wollte eine Ausbildung machen.
„Krankenschwester will ich werden. Irgendwo hier will ich arbeiten. Im Krankenhaus.“
Der erste Weltkrieg hatte gezeigt, wie notwendig professionelle Lehrgänge für diesen Beruf waren. Einen solchen wollte Helene besuchen, nachdem dieser mittlerweile auch an der Charité eingerichtet worden war.