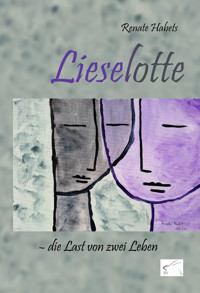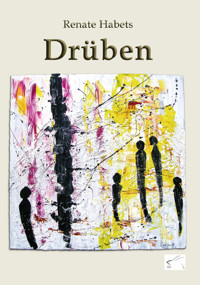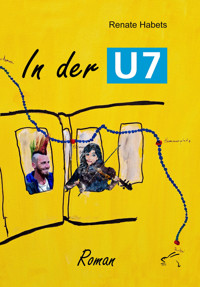6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 85-jährige Freundschaft von Lina und Ingrud findet an der Bernauer Straße in Berlin statt. Einer Straße, die das Schicksal Berlins und seiner Menschen bestimmt, über all die Jahre hinweg. Also auch das Schicksal der Freundinnen und der ihnen Nahestehenden, das so nur dort sein konnte. Dort, an der Bernauer Straße!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Renate Habets
Nur eine Mauer
Inhaltsverzeichnis
Eine Mauer
Danke sagen möchte ich
Über die Autorin:
Impressum
Edition Paashaas Verlag
Titel: Nur eine MauerAutor: Renate Habets
Originalausgabe Mai 2025
Covermotiv: Renate Habets
Covergestaltung: Michael Frädrich
© Edition Paashaas Verlag, Hattingen, www.verlag-epv.de
Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-166-3
Kontaktdaten gemäß der Verordnung 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit (General Product Safety Regulation-GPSR):
Edition Paashaas Verlag, M. Klumpjan, Im Lichtenbruch 52, 45527 Hattingen
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d–nb.de abrufbar.
Renate Habets
Nur eine Mauer
Eine Mauer
ist eine sehr große Waffe.
Es ist eines der schlimmsten Dinge,
mit denen man jemanden schlagen kann.
Banksy
Mauer:
„feste, aus Stein, Beton oder einem anderen Baustoff errichtete, senkrechte Bausubstanz, die als Abgrenzung, Absicherung, Stütze oder Sichtschutz dient und eine gewisse Länge und Höhe aufweist“
www. juraworld.de
Mauern
Schützen
bewahren das Eigene
trennen
begrenzen
schirmen ab
definieren die Zugehörigkeit
nehmen die Sicht
engen ein
verbergen
grenzen ab
„wir“ gegen „die anderen“
Lina
Nein! Waaas habe ich da gehört? Das kann nicht sein, nein.
„Lina“, rede ich mir gut zu, „das kannst du nicht gehört haben. Du musst mal wieder eingeschlafen sein. Das passiert ja immer wieder, seit du alt bist. 89 Jahre alt! So alt wie das Jahrhundert. Aber …“
Ich habe sie doch deutlich gehört, die Worte in der Tagesschau: „Sofort, unverzüglich …“ Sofort? Was war das nur? War da nicht von ‚Reise’ die Rede gewesen.
Von Reise?
Wie elektrisiert fahre ich von meinem Sessel hoch. Viel zu schnell, wie mir der Kreislauf sofort signalisiert. Ich stolpere zu meinem Wohnzimmerfenster und starre nach draußen. Dunkel ist es, aber das muss es im November nach 20 Uhr ja auch sein. Trocken liegt die Straße drei Etagen unter mir. Geregnet hat es heute nicht. Aber richtig finster ist es schon. Oder sehe ich dort hinten einen Lichtschein? Ungewöhnlich, aber nun höre ich auch laute Stimmen, Hupen. Aus den Stimmen wird Geschrei, Gebrüll. Da unten scheint sich etwas zusammenzuballen. Nein, nicht etwas, Menschen! Immer mehr Menschen, Lichter, Rufe, Getümmel unten auf der Straße, die bisher meist allzu still da gelegen ist, seit 28 Jahren. Ich kneife die Augen ein wenig zusammen, damit ich besser sehen kann, denn da unten sind Lichter aufgetaucht, Lichter, die sich hin- und herbewegen. Das sind ja …, tatsächlich, das scheinen Wunderkerzen zu sein, die geschwenkt werden und dabei die Straße in ein unbestimmtes Licht tauchen, dunkel – hell, dunkel – hell. Der Schein von Taschenlampen gesellt sich zu ihnen. Immer mehr Menschen scheinen in kürzester Zeit zusammenzukommen und sich dort zu versammeln, wo bisher das Ende von allem war. Seit 28 Jahren das Ende von allem.
Ganz aufgeregt werde ich dort oben an meinem Fenster im 3. Stock, viel zu hoch über allem, was sich dort zu meinen Füßen abspielt. Aber ich kann nur schauen, staunen und mich wundern über das Geschehen unter mir.
Kann es sein, dass ich doch richtig gehört habe?
„Sofort, unverzüglich …“
„Ingrud!“, murmele ich leise vor mich hin, dann lauter: „Ingrud!“
Und auf einen Schlag sehe ich alles vor mir, alles. 84 Jahre. 84 Jahre Ingrud. Wenn ich mich erinnere, ist alles so gegenwärtig, alles, wie jetzt gerade.
„Mutter, du musst Abstand bringen zwischen deine Erinnerungen und dich“, hat mein Psychologensohn immer wieder gepredigt. „Lass die Dinge nicht immer so nah kommen. Das tut dir nicht gut!“
Aber das hat noch nie funktioniert. Wenn ich mich erinnere, ist immer alles ganz nah, ich bin mitten drin. Abstand gibt es nicht, wie auch jetzt.
Fünf Jahre bin ich alt und fühle mich sehr groß. Mit Mutter gehe ich einkaufen. Sie trägt den Korb und ich eine uralte Leinentasche mit zwei Henkeln, die bereits meiner Großmutter gehört hat. Die schwenke ich fröhlich, bin voll des Hochgefühls, wichtig zu sein und der Mutter eine unentbehrliche Hilfe. Sie überquert mit mir die Bernauer Straße, an der unser Haus steht und geht schnellen Schrittes Richtung Brunnenstraße, in der die neuen Mietshäuser aus dem Boden geschossen sind. Dort, im dritten Haus links, hat unser Kolonialwarenhändler seinen Laden. Kolonialwaren, ein schönes Wort, das ich leise vor mich hinsinge. Frohgemut springe ich hinter Mutter die drei Stufen empor, die in das dunkle Geschäft führen. Der Geruch von Gewürzen schlägt mir entgegen, den ich so sehr liebe. Begierig schnüffele ich beim Eintreten in den Laden. Ich kann nicht genug von diesem Duft bekommen, der für mich wie Parfüm ist, Parfüm, das Weite, Ferne, Abenteuer signalisiert. Mein Blick fällt auf die dunkelbraune Theke mit ihrer Waage und der metallenen Kasse, deren Kurbel so schön tönt, wenn man sie dreht. Mutter wendet sich der Verkäuferin zu, die noch eine andere Frau bedient, die ein Kind an der Hand hält. Ein kleines Mädchen, wie ich mit einem schnellen Blick konstatiere.
Aber mich interessieren die anderen überhaupt nicht, sondern ich wende mich schnell dem riesigen Holzfass zu, das links in der dunklen Ecke des Ladens steht. Gurken schwimmen in der Flüssigkeit, die bis fast zum Hals des Behälters steht.
„Spreewaldgurken“, brumme ich vor mich hin, „oh, ihr schönen Spreewaldgurken.“ Dabei starre ich wie gebannt auf die länglichen, unterschiedlich großen, grünlichen Gemüsezipfel, die es bei uns so gut wie nie gibt. Zu teuer, Delikatessen eben. Nur der Vater bekommt abends mitunter eine zu seinem Brot. Da lässt er mich, „mein Linchen“, von probieren. Nur mich, nicht die Jungs. Ich bin ganz in die Betrachtung dieser Köstlichkeit vertieft, die für mich die Welt in diesen düsteren Laden bringt.
„Aus dem Spreewald“, hat der Vater mir gesagt, „das ist ganz schön weg von Berlin.“
„Lina“, höre ich eine Stimme. Dann, als ich nicht reagiere, sondern den Geschmack der Gurken dort nachempfinde, lauter und bestimmter: „LINA!“
Ich drehe mich um und sehe die Mutter, die eine Hand auf den Unterarm der Frau gelegt hat, die an der Ladentheke steht. Hinter ihr schaut ein Köpfchen hervor. Das Köpfchen des kleinen Mädchens, das ich eben im Vorbeihuschen wahrgenommen habe. Der Rest des Kindes ist hinter der Frau verschwunden.
Mühsam reiße ich mich von meinem Gurkenfass los und gehe ein paar Schritte auf die Mutter zu.
„Das ist Lina“, höre ich sie zu der Fremden sagen. „Eigentlich Helene, wie meine Mutter. Aber alle sagen Lina zu ihr.“ Sie wendet sich mir nun vollends zu. „Das ist die Frau Lafitte. Sag Tag“, fordert sie mich auf, wartet aber nicht ab, sondern spricht gleich weiter. „Die ist gestern in die Brunnenstraße gezogen.“ Und? Ich gucke etwas ratlos die Frau an, die vorsichtig hinter sich greift, einen schmächtigen Körper hervorzieht und vor sich hinstellt: Mädchen, ganz helles Haar, kurz geschnitten, grünes Wollkleid, kein Fleck drauf, schwarze Wollstrümpfe und braune Knopfstiefel. Puh, denke ich und registriere in Sekundenschnelle den dicken Marmeladenfleck auf meiner etwas unordentlich gebundenen Schürze und die Pantinen an meinen Füßen, die ich so sehr liebe. Man kann so schön klappern mit ihnen!
„Du bist also die Lina“, höre ich eine leise, tiefe Stimme. Ihr Deutsch klingt ein wenig anders, als ich es kenne. Härter, nicht so melodisch.
Ja und? Ich bin die Lina, denke ich ketzerisch. Seit fünf Jahren bin ich die Lina!
„Das ist Ingrud“, schiebt sie das Mädchen vor.
Ingrud, was für ein Name. Hab ich noch nie gehört, was …?
Aber ehe ich meinen Gedanken zu Ende führen kann, mischt meine Mutter sich energisch ein. „Die kennt noch keinen hier, die Ingrid.“
„Ingrud“, höre ich eine leise Verbesserung.
Aber das nützt nichts. „Sag ich doch, Ingrid.“ Ingrid sollte es für meine Mutter bleiben. Da konnte man sie nicht belehren – Ingrid. „Da ist die Frau Lafitte froh, dass sie dich kennenlernt.“
Aber, die kennt mich doch gar nicht, schießt es mir rebellisch durch den Kopf.
„Ich hab ihr versprochen, der Frau Lafitte, dass du morgen in die Brunnenstraße kommst, wo die wohnen. Dann könnt ihr euch besser kennenlernen, die Ingrid und du.“
Es war also beschlossen, Widerrede unmöglich. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich bin auch mehr als nur ein ganz bisschen neugierig.
Eine sauber gewaschene weiße Hand streckt sich mir entgegen und ergreift meine stets etwas beschmierte und drückt sie leicht. Ein Händedruck. Der ist bei uns ganz und gar nicht üblich. Zögerlich strecke ich meine geschlossene Faust vor. Man weiß ja nie … Es imponiert mir, dass die Fremde die Hand nicht zurückzieht, obwohl meine verschwitzt ist und klebt, sondern den Handdruck beibehält. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich sofort zustimme, am nächsten Tag in die Brunnenstraße zu kommen. Gut, ein wenig gespannt bin ich auch schon …
So haben Ingrud und ich uns kennengelernt, damals, 1905, beim Kolonialwarenhändler. Ingrud, meine Freundin, „mein besseres Ich“, wie ich heute noch zu sagen pflege. Meine Freundin seit 84 Jahren.
Am nächsten Tag beeile ich mich, mit dem Kartoffelschälen fertig zu werden. Das ist meine Aufgabe bei der Essensvorbereitung. Da bin ich stolz drauf, denn das kann ich gut, seit über einem Jahr schon. Wenn man das kann, ist man groß. Davon bin ich fest überzeugt. Die Jungs brauchen das nicht zu können, ist Frauensache.
„Wasch dir die Hände“, höre ich Mutter rufen, „ehe du rüber in die Brunnenstraße gehst.“
Es ist fast schneller getan als gesagt. Mit meinen Pantinen klappre ich die drei Stockwerke runter und trete auf die sonnenbeschienene Bernauer Straße. Vorsichtig spähe ich nach rechts und links, wie die Mutter mir noch nachgerufen hat, als ich schon an der Wohnungstür gewesen bin.
Die letzten Jahre haben viel Verkehr nach Berlin gebracht. Pferdedroschken, Fahrradboten, auch Autos bevölkern die gepflasterte Straße. Zwischen ihnen hasten die Menschen hin und her: Frauen mit Einkaufskörben, dort trägt ein Mann eine lange Leiter über die Straße, Kinder in Matrosenkleidern hüpfen an der Hand eines Dienstmädchens – das sieht man an der Kleidung – die Randsteine entlang. Die neue Ringbahn zieht ebenfalls viele Menschen an, die man in Richtung der Haltestelle eilen sieht.
Ich lasse mich von dem vielen Verkehr nicht beeindrucken, sondern überquere die Bernauer Straße und hopse, so meine Pantinen das zulassen, auf das erste Haus an der Brunnenstraße zu. Es knallt immer so schön, wenn ich auf das Straßenpflaster treffe.
Die Gegend muss früher ganz anders ausgesehen haben als heute. Da ist man nicht mitten in der Großstadt gewesen, sondern eher auf dem Land. Viele Wiesen und Felder, darauf grasendes Vieh, Heuwagen und Leute, die diese beladen und dabei singen. So zumindest stelle ich mir das vor. Der Vater hat mir davon erzählt, als ich auf seinem Schoß gesessen habe. Nur ich darf auf Vaters Schoß, „das Linchen“. Bin ich schließlich seine einzige Tochter, die er nach den zwei Jungs so ersehnt hat, wie er immer sagt.
Ich überquere also die Bernauer Straße und drücke die Klingel am ersten Haus in der Brunnenstraße, dessen eine Seite zu uns rüber schaut. Ob Ingrud uns wohl sehen kann?
Durch die breite, braune Tür, die oben von einem geschnitzten Blumenkranz geziert wird, trete ich in das steinerne Treppenhaus. Ganz anders als bei uns, ist das Erste, was mir durch den Kopf schießt. Ganz, ganz anders ist es hier. Heller, weiter, “vornehmer“ halt. Das sind die neu erbauten Häuser, die die Felder abgelöst haben. Nicht für die Arbeiter sind die gedacht wie unseres, drüben im Wedding, sondern eher für die, die im Büro arbeiten. „Bürohengste“, wie der Vater leicht verächtlich zu sagen pflegt. „Die arbeiten ja nicht richtig! Immer Anzug und Krawatte.“
Ich klappere die Stufen in die erste Etage hoch und bemühe mich, dabei nicht solch einen Lärm zu machen wie bei uns, ist mir doch ein wenig ehrfürchtig zumute. Ich kenne schließlich nur die Treppenhäuser auf der anderen Seite, Treppenhäuser wie unseres, Holz, dunkel, eng, immer von Kohlgerüchen durchzogen.
In der ersten Etage empfängt Frau Lafitte mich an der Wohnungstür, die breite Glaseinsätze hat, wie ich bewundernd vermerke. Während ich diese noch staunend angaffe, höre ich wieder Frau Lafittes leise Stimme: „Lina, freut mich, dich zu sehen.“
Freut sie? Aber sie hat doch gesagt …
„Komm rein, Ingrud wartet schon auf dich.“
„Na, dann könnte die ja auch wohl an der Tür sein“, spricht eine ketzerische Stimme in mir, während ich mich durch Frau Lafitte in den Flur gezogen fühle. Nicht energisch, wie meine Mutter es wohl getan hätte, sondern schlaff, eher kraftlos.
Da aber kommt das kleine Mädchen von gestern durch den Flur auf mich zu gehüpft und strahlt mich an. „Komm“, ruft es und zieht mich in eines der Zimmer, die von dem Flur abgehen. „Hier wohne ich“, höre ich eine aufgeregt klingende Stimme, „komm rein.“
„Hier“, schaue ich mich befremdet um, „wohnst du?“ Neben dem Fenster steht ein einzelnes Bett, über das eine graue Decke gezogen ist, ein Tisch vor dem Fenster, zwei Stühle, in der Ecke ein Schrank.
„Und wo sind die anderen Betten?“
„Die anderen Betten? Wieso?“ Schweigen breitet sich zwischen uns aus. Dann: „Es gibt keine anderen Betten. Ich wohne hier.“
„Und wo schlafen die anderen?“
„Die anderen?“ Ich höre Unverständnis in der Stimme.
„Na, deine Familie!“
„Mama und Papa haben ein eigenes Zimmer. Und dann haben wir noch ein Wohnzimmer und eine ganz große Küche. Da kochen und essen wir.“
Ich weiß einen Moment lang nichts zu sagen und denke nach. „Wo sind denn deine Brüder?“, frage ich dann, als ich mit meinem Staunen zu einem Ende gekommen bin.
„Äh …, meine Brüder?“
Ich nicke zustimmend. „Deine Brüder! Oder hast du vielleicht Schwestern?“ Ich kenne ja nur meine Familie mit Vater, Mutter und drei Brüdern.
„Ach, so meinst du das, ich bin allein.“
„Allein? … Oh, das ist ja dumm.“ Sofort schließe ich dieses kleine Mädchen, das so allein ist, ins Herz. Sie hat gar keine Brüder wie ich, mit denen man sich streitet, kloppt, wenn es arg kommt, aber auch ganz viel Spaß macht. Und sie, sie hat nur Vater und Mutter!
„Dann bin ich deine Schwester!“
Ingrud greift meine Hand. Sehe ich da Tränen in ihren Augen? „Ja“, glaube ich zu hören, so leise ist es gehaucht, „ja, du bist meine Schwester“, kommt es etwas lauter und wie befreit.
Seit dieser Minute sind wir Schwestern, Ingrud und ich. Ingrud, mein besseres Ich seit 84 Jahren.
Abends fragt die Mutter mich: „Wie war’s drüben?“
Ich drücke mich ganz fest an ihr Bein. „Sie ist allein“, flüstere ich, die sonst immer schreit, um sich durchzusetzen gegen die Brüder. Kurz erwidert die Mutter den Druck, schiebt mich dann zum Ausguss und meint: „Da, schrubb schon mal die Kartoffeln!“
Meinem feixenden ältesten Bruder Gustav strecke ich weit die Zunge raus.
Ingrud
Wieso muss ich heute so viel an Lina denken, ausgerechnet heute? Aber ich kann ja auch nicht viel mehr tun als denken. Meine alten Knochen wollen schon lange nicht mehr so wie früher. Ob das mit der Hüftoperation so gut gegangen ist, wie die immer gesagt haben, weiß ich auch nicht. Immerhin hat man es in der Charité gemacht, damals, als ich hier in der Wohnung gefallen bin und nicht mehr alleine aufstehen konnte. Gut, dass die Nachbarin meinen Schlüssel gehabt und sich gewundert hat, dass ich meine Zeitung nicht reingeholt habe. Die Charité ist ja nicht weit weg von der Brunnenstraße, da hat die Ambulanz mich eben dorthin gebracht. Gottlob. Denen traue ich einfach mehr als den anderen Krankenhäusern.
Ja, seit der Operation humple ich noch deutlicher als vorher. Da waren die Knochen ja wohl auch schon morsch. Aber was will man mit 89 Jahren erwarten? Bin ja froh, dass ich in meine Wohnung in der Brunnenstraße hab zurückkehren können. Seit 84 Jahren wohne ich hier.
Seit 84 Jahren Brunnenstraße, sinniere ich vor mich hin, unglaublich. Wenn auch nicht mehr in dem Haus, wo ich mit Mama und Papa gewohnt habe, das haben DIE abgerissen. DIE brauchten einen ‚Todesstreifen‘. DIE – das denke ich immer, wenn ich an das Staatsministerium denke. „DIE“, das denke ich leider nicht nur, sondern sage es auch. Soll gefährlich sein. Aber ich bin ja eine alte Frau, harmlos und ein bisschen spinnert, mir tut schon keiner was.
Es wird so laut dort unten auf der Brunnenstraße, ungewöhnlich für nach 21 Uhr. Eigentlich gibt es hier nachts keine Unterhaltung, wir sind ein reines Wohngebiet. Aber heute ist das anders. Heute schallen Rufe durch die Straße, man kann das Getrappel vieler Füße hören. Eben habe ich mal aus dem Küchenfenster nach unten auf die Straße geblickt. Ungewöhnlich viele Menschen gingen Richtung … Jetzt fällt es mir auf: Sie sind ja Richtung Bernauer Straße gegangen. Da ist die Welt doch … zu Ende ist dort die Welt. Da dürfen wir ja gar nicht hin. In 28 Jahren gewöhnt man sich schon daran, was man darf und was man nicht darf. Man tut es einfach, wie es erlaubt ist.
Dass Lina mich nicht hat besuchen können in der Charité, das hat wehgetan. Lina, die immer einen flotten Spruch zur Hand hat, nie aufgibt, immer weitermacht, egal, was das Leben bringt. Sie hat nicht kommen dürfen, das war hart. Ich hätte sie so gebraucht! Ihr Lachen, ihren Zuspruch, ihren Optimismus. Das alles hat sie sich bewahrt. Das weiß ich, auch wenn man uns vor langem getrennt hat, vor 28 Jahren.
Ich würde ja gerne auf die Straße gehen, um zu schauen, was dort los ist. Aber das ist viel zu anstrengend für mich, zu unheilschwanger auch. In vielerlei Beziehung. Das hat Helga mir eingeschärft: „Mutter, du gehst nicht alleine raus!“
Erst recht nicht im Dunklen, das ist mir klar.
Wenn Lina hier wäre, dann …
„Ingrud, hör auf zu träumen“, ermahne ich mich, „verliere dich nicht im Fantasieren!“
Plötzlich steht er wieder vor mir, der Tag, an dem ich Lina kennengelernt habe, dort im Haus gegenüber, wo einmal der Kolonialwarenhändler war. Drei Stufen hoch …, wie oft sind wir die emporgestiegen, Lina und ich.
Plötzlich fällt es mir ein: Mutter hat doch damals immer Tagebuch geschrieben. Nur so hat sie es in Deutschland aushalten können. Habe ich irgendwann verstanden.
Die Bücher habe ich nach ihrem Tod nicht weggeschmissen, sondern tief in der Kommode vergraben. Aber ich habe nie in ihren Aufzeichnungen gelesen. Respekt? Takt? Oder gar Angst?
Schlafen kann ich nicht, es ist viel zu laut in der Brunnenstraße. Da könnte ich doch … schießt es mir durch den Kopf, ja, heute muss ich endlich in Mutters Tagebuch lesen. Lesen, wie das damals gewesen ist mit Lina, ob sie was darüber sagt.
Viel zu hastig für meine Verhältnisse bewege ich mich zu der Kommode, muss mich kurz am Tisch abstützen und zur Ruhe kommen. Mein Kreislauf ist auch nicht mehr …
Im dritten Schubfach der Vitrine, versteckt unter unzähligen Schals, die ich seit Jahren nicht mehr getragen, früher aber geliebt habe, finde ich mehrere in Leder gebundene Hefte. Ich greife nach ihnen, blättere und überfliege kurz deren erste Sätze in Mutters unverkennbarer Handschrift. Das, dieses hier ist es. Ich nehme das Heft an mich, verschließe das Fach erneut und setze mich in meinen Ohrensessel, der in der Fensternische steht.
Ich öffne das Heft …
Tivils Tagebuch
Seit wenigen Tagen bin ich nun in Berlin. Henri hat eine Wohnung in der Brunnenstraße gefunden, die auch ganz hübsch ist. Aber sie hilft mir nicht, mich hier zuhause zu fühlen. Hier, mitten in der Großstadt, in Deutschland, in der Fremde. Es ist schwer. Alles ist laut, schrill, voldsom eben. Nicht rolig wie am Fjord. Oh, der Fjord … Werde ich ihn je wiedersehen? Es ist so weit weg, so weit …
Ich spüre, wie mir Tränen in die Augen steigen, durch die hindurch ich Mutters Schrift nicht mehr richtig erkennen kann. Heute verstehe ich viel besser. Wie muss sie gelitten haben, als der Vater nach Berlin gegangen ist, fort von unserem einsamen Häuschen am Fjord, an das ich mich nur schwach erinnere, hin nach Berlin? Berlin, der großen Stadt, der größten in Deutschland, wo das Leben gebraust hat und nicht still vor sich hingegangen ist wie in Norwegen.
Arme Mutter, denke ich und begreife mit einem Mal so vieles an ihr, was mir fremd gewesen ist, ja, sogar mitunter Angst gemacht hat. Aus Liebe zu Vater, ihrem Henri, ist sie nach Berlin gegangen. Ist ihm gefolgt, als er sich dazu entschieden hat. Aber … ist ja nicht nur ihm gefolgt, erkenne ich plötzlich, sondern auch … mir, Ingrud, ihrer einzigen Tochter. Sie hat uns beide nicht im Stich lassen wollen. Dafür hat sie gelitten, wie ich nun lese. Das hat sie wohl auch verändert.
Ich seufze. So vieles an ihr ist mir fremd gewesen. Ich hätte so gerne eine Mutter wie Linas gehabt, aber meine, meine ist so ganz anders gewesen.
Ich verscheuche diesen Gedanken, weil ich spüre, dass er mir heute Abend nicht gut tut. Ich wollte doch …, ich wollte schauen, ob sie was über Linas und mein erstes Treffen schreibt. Die nächsten Zeilen überfliege ich nur, bis meine Augen an einem Abschnitt haften bleiben.
Heute beim Krämer gewesen, gleich drei Häuser gegenüber. Ingrud hab ich mitgenommen, sie muss die neue Umgebung ja auch kennenlernen. Muss es ja auch hier aushalten. War schon eine Weile in dem Laden, als eine Frau in Begleitung eines kleinen Mädchens kam, das sofort zu dem Gurkenfass in der Ecke gerannt ist und da rein gestarrt hat.
Ich hab die Frau gemustert, Arbeiterfrau wohl, wie ich an der Kleidung gesehen habe. Erst hab ich Angst vor ihr gehabt, weil sie so selbstbewusst in dem Laden gestanden ist, aber dann hat sie mich ganz freundlich angelächelt, und wir haben uns „Guten Tag“ gesagt.
Dann sind wir ins Gespräch miteinander gekommen, sie und ich. Meine erste Bekanntschaft in Berlin war diese Frau Haller, die genau gegenüber wohnt, nur über die Bernauer Straße muss man.
Dann hat sie nach dem Mädchen am Gurkenfass gerufen, das unwillig zu uns rüber gekommen ist. Das habe ich an ihrem Gesicht gesehen, wäre wohl lieber für sich geblieben. Aber ich habe eine erste Freundin für Ingrud gefunden, hoffe ich. Lina, so heißt das Mädchen, will morgen zu uns kommen. Ich werde Kekse für sie und Ingrud backen, damit sie immer wieder kommen mag.
Ich bin froh, dass wenigstens Ingrud …
Hier bricht das Schreiben über diesen Tag ab. Mutter ist wohl unterbrochen worden. Aber mir bringt das Tagebuch diesen ersten Tag mit Lina wieder ganz nahe. Ich sehe sie ganz lebhaft vor meinen Augen, wie sie damals gewesen ist: eine kräftige dralle Fünfjährige mit braunen, meist etwas zerzausten Zöpfen. So ganz das Gegenteil von mir. Auf ihre Kleider hat sie nie geachtet, die waren ihr egal. Hauptsache, sie waren bequem und sie konnte sich gut in ihnen bewegen, denn in Bewegung war sie immer.
Ich schmunzle ein wenig, dass Mutter damals eigens Kekse für die erste Begegnung in unserer Wohnung gebacken hat, denn ab dem nächsten Besuch ist das anders geworden. Da hat es immer eine Gurke für jede von uns gegeben, die Lina jedes Mal ganz andächtig verzehrt hat, und oft auch ein Stückchen Hering, wie Mutter es aus Norwegen gekannt hat.
Lina
„Komm rein, Ingrid“, höre ich Mutter wieder sagen mit ihrer kräftigen, für eine Frau sehr tiefen Stimme. „Komm rein, Ingrid“, hat sie dann all die vielen Jahre gesagt, in denen Ingrud bei uns ein- und ausging. Ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, hat Ingrud mindestens doppelt so viel Zeit bei uns verbracht oder noch viel mehr als ich in der Brunnenstraße. Sie hat es geliebt bei uns, obwohl doch alles so eng und beschränkt war. Aber das scheint sie nie gestört zu haben.
Alles ist wieder da.
Sie reagiert bewundernd auf alles, was Gustav, der Älteste von uns, sagt oder tut. Das gefällt dem, der eigentlich ein aufgeblasener Großkotz ist, wie ich finde, natürlich gut. Immer schreit er grinsend und spottend „Ingrid, Ingrid“, nur weil er es so toll findet, ihre Stimme leise widersprechen zu hören: „Ich heiße Ingrud.“ Das nutzt überhaupt nicht, er bleibt bei „Ingrid“, nur um sie zu hänseln und sich wichtig zu tun. Ich könnte ihn umbringen, aber er ist drei Jahre älter und ich ihm körperlich nicht gewachsen.
Gerne ist sie mit Georg zusammen, dem Bruder, der nur ein Jahr älter ist als wir beide. Er ist aber auch viel besser erträglich, dieser stille, nachdenkliche Junge, der, kaum dass er lesen kann, eigentlich nie ohne etwas Lesbares zu sehen ist. Später bringt Ingrud ihm oft eines ihrer Bücher mit, wofür er sehr dankbar ist. Das bringt die beiden eng zusammen. Manchmal bin ich eifersüchtig auf ihn und reagiere richtig zickig.
Ich glaube, am liebsten hat sie Wilhelm, der drei Jahre jünger ist. Als sie zum ersten Mal bei uns ist, ist er schließlich auch erst zwei Jahre alt und hat noch Windeln.
Meine drei Brüder sind auch so etwas wie ihre Brüder. Ich leihe sie ihr auch gerne. Bin ich doch immer verwundert und sehr bekümmert darüber, dass sie nur ein Einzelkind ist und nicht wie ich in einer fröhlichen, lauten, oft auch streitbaren Familie aufwächst. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Leben ohne meine mitunter recht chaotische Sippschaft ist.
„Wieso hast du keine Geschwister?“
„Weiß ich nicht“, ist die Antwort, die nach langem Nachdenken kommt.
„Aber alle haben doch Brüder oder Schwestern.“
Eine unerträgliche Pause. Dann, kaum vernehmbar: „Ich nicht.“
So traurig schaut Ingrud, dass selbst ich, die eigentlich nie zu fragen aufgibt, verstumme.
Dann ist da noch Großmutter, Oma Helene, nach der ich meinen Namen bekommen habe. Ihr Haar ist dünn, ganz weiß und in einem kleinen Knoten am Hinterkopf zusammengefasst, aus dem sich immer wieder einzelne Strähnen lösen, wenn sie den Kopf bewegt. Aber sie bewegt ihn eher selten, sondern sitzt ganz hinten in einem Winkel der Küche neben dem alten durchgelegenen Sofa, wo sie des Nachts schläft. Das ist sicher nicht bequem, aber so hat sie einen Raum für sich, wenn wir alle zu Bett gehen, sie die Stricknadeln, die so sehr zu ihr gehören, beiseitelegt und ausruht vom Tag, an dem kaum einmal eine Atempause in der Küche einkehrt, die unser Lebensmittelpunkt ist.
Ingrud sitzt häufig neben Oma Helene, schaut gebannt zu, wie Socken, ein Pullover-Ärmel oder ein Schultertuch für Mutter aus den Stricknadeln entstehen. Ja, sie lässt sich sogar von Oma zeigen, wie man mit diesen umgeht, die ich zu meiden suche wie die Pest.
Auf jeden Fall ist immer Leben bei uns. Bei Lafittes ist es meist sehr still. Ingruds Mutter, die immer freundlich bleibt, schüchtert mich oft ein, weil sie so sehr in einer anderen Welt zu leben scheint und nicht hier in Berlin. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Heute würde ich sagen, nachdem ich so alt geworden bin und so vieles gesehen habe, dass sie depressiv gewesen ist. Das hat mich geängstigt, weil ich das von zu Hause überhaupt nicht gekannt habe.
Vor meinem Vater hat Ingrud Angst gehabt. Allein seine laute Stimme hat sie beim ersten Kennenlernen wohl auf immer erschreckt. Sie kannte ja nur die gedämpfte Stimme ihres Vaters und hat nie erlebt, dass diese sich erhoben und kräftig geschimpft hätte. Wir Haller-Kinder sind jedoch daran gewöhnt und fürchten uns nicht davor. Uns fehlt etwas, wenn Vaters Organ nicht in der Küche erdröhnt. Wir verziehen uns einfach in ein anderes Zimmer, bis der Ärger vorüber ist. Meist ist es ja Gustav, der Vaters Zorn entfacht hat.
Vater … In Gedanken sehe ich ihn wieder vor mir, diesen kräftigen, hoch gewachsenen Mann mit seinen großen Händen, der Tag für Tag bei AEG an der Werkbank steht mit Hunderten anderer Männer. Ich fühle auf einmal wieder meine kleine Hand in seiner, wie er mit mir stolz durch den Wedding zur Brunnenstraße nach Gesundbrunnen geht und mir „seine Fabrik“ zeigt. Stolz ist er darauf, dass er „in dem größten und bedeutendsten Betrieb ganz Berlins“ arbeitet. Ich stehe mit ihm vor den imponierenden Gebäuden der Turbinenfabrik und bin ganz stolz, dass mein Vater täglich durch das riesige Tor zu seiner Arbeitsstätte geht.
Ich bin so tief in meine Erinnerungen versunken, sie sind erneut so lebendig für mich, als befänden wir uns im Jahr 1905, in dem ich Ingrud kennengelernt habe, dass ich völlig vergessen habe, dass unten auf der Straße “der Bär tobt“, wie die jungen Leute heutzutage zu sagen pflegen. Habe ich von meinen Enkeln gelernt, die leider weit weg in Köln leben und die ich daher viel zu wenig sehe. Aber telefonieren können wir ja gottlob!
Mühsam richte ich mich aus meinem Sessel auf und taste mich langsam zum Fenster. Es geht alles so viel langsamer und beschwerlicher im Alter als früher, wenn Ingrud und ich über die Straße gehüpft sind oder ein Seil geschwungen und versucht haben, nicht von ihm berührt zu werden.
Auf eben dieser Straße drängen sich nun, wie ich sehe, ungewöhnlich viele Menschen. Junge und alte, Männer und Frauen – die Bernauer Straße ist um diese Zeit nach 20 Uhr bevölkert wie selten sonst. Die Autos, die noch auf ihrer Nachhause-Tour sind, stoppen, fahren wieder an, hupen sich aber seltsamerweise nicht an, wie sie das sonst immer tun, wenn ihnen alles zu langsam geht. Nein, im Gegenteil. Da steigt sogar einer aus, wie ich sehe. Sein Auto lässt er mitten auf der Straße stehen, die Schweinwerfer brennen, aber er gesellt sich zu einer Gruppe von Menschen. Lautes Singen dringt in mein Ohr, und immer wieder schneidet der Schein von brennenden Wunderkerzen durch den Abend und macht lustige Muster, Kreise und Linien. Dabei klingt das Singen aber ganz anders als sonst, wenn vom Alkohol enthemmte Männer ihr „Warum ist es am Rhein so schön?“ oder „Das macht die Berliner Luft“ grölen. Es klingt fast ein wenig … andächtig? Merkwürdig, aber es scheint mir das rechte Wort zu sein: andächtig, feierlich.
Dort drüben hüpft eine Gruppe im Kreis, rechts davon scheint eine Massenumarmung stattzufinden, an der sich immer Neue beteiligen.
Und das alles auf der Bernauer Straße, am Ende von Berlin, seit 28 Jahren! Ich verbessere mich in Gedanken. Am Ende von West-Berlin, dort drüben ist ja auch Berlin …
Ingrud
Lina und die Gurken! Ich muss schmunzeln, als ich sie wieder vor mir sehe: pausbäckig kauend, am liebsten Gurken, davon konnte sie nie genug bekommen, ein Zopf völlig gelöst, das braune Haar hängt ihr rechts bis in den Mundwinkel.