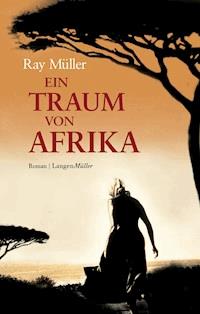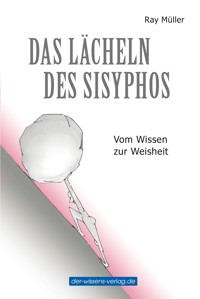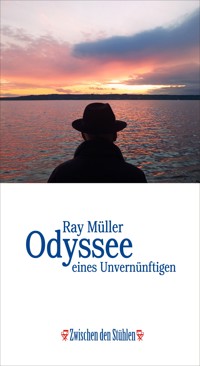
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Mensch erkundet die Welt – mit Filmteam oder allein. Er spürt den magischen Orten dieses Planeten nach, erkundet ferne Länder und fremde Kulturen. Immer wieder setzt er sich aus Neugierde ungeahnten Gefahren aus, mitunter auch denen erotischer Fantasien. Zurück im bundesdeutschen Alltag versucht der Autor, die Erinnerung an seine Abenteuer kritisch zu hinterfragen. Mit Spannung und Witz reflektiert er seine Reisen. Dabei wirft er auch einen frischen Blick auf seine Umgebung zu Hause, in der er sich neu zurechtfinden muss. Am Ende kommt er dabei auch den großen Fragen des Lebens näher: der Magie der Liebe, den Grenzen der Freiheit und dem Sinn des Lebens. Ein Buch für Menschen, die neugierig sind und gerne reisen. Nicht nur physisch, auch in Gedanken, nicht nur in die äußere Welt, sondern auch in die innere.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ray Müller
Odyssee eines Unvernünftigen
Ray Müller
ODYSSEE EINES UNVERNÜNFTIGEN
Zwischen den Stühlen 1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Januar 2022
Zwischen den Stühlen @ p.machinery
Kai Beisswenger & Michael Haitel
Titelbild: Ray Müller
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Kai Beisswenger
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: Schaltungsdienst Lange oHG, Berlin
Zwischen den Stühlen
im Verlag der p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.zds.li
ISBN der Paperback-Ausgabe: 978 3 95765 267 6
ISBN der Hardcover-Ausgabe: 978 3 95765 268 3
ISBN dieses E-Books: 978 39 5765 830 2
Für R & R
Gedanken,
die mit sich selbst spielen
Reisen, um Filme zu machen, um fremde Welten zu entdecken – was findet man am Ende wirklich?
Was empfindet man in dramatischen Situationen, die man eigentlich nicht überleben kann?
Was fühlt man bei einem Hubschrauberabsturz?
Was tut man in der Sahara, wenn man sich in einem Sandsturm verirrt?
Oder in erotischen Fantasien in Singapur?
Können diese in einem Münchner Café zur Poesie werden?
Kann Ehrlichkeit beim Schreiben peinlich werden?
Wo liegen die Grenzen gesellschaftlich verordneter Scham?
Wie lässt sich der bundesdeutsche Alltag ohne Melancholie ertragen?
Kann Letztere vielleicht zur Selbsterkenntnis führen?
Ist der Weg zur Weisheit für jeden offen?
Wenn ja, wo findet man ihn?
Vorwort
Die Wissenschaftler sind sich einig: In Folge der auf uns zukommenden Klimakatastrophe könnte diese Zivilisation in naher Zukunft untergehen.
Vor über fünfundzwanzig Jahren indes, als ein Großteil dieses Textes geschrieben wurde, war dieses Thema von der öffentlichen Wahrnehmung noch weit entfernt. Unbekannt war es allerdings nicht. Doch in jungen Jahren wollten wir diese Welt erleben und genießen. Auch ich gehöre zu der Generation, der vergönnt war, im wohl unbeschwertesten Zeitfenster der Geschichte leben zu dürfen. Fünfzig Jahre kein Krieg (in Europa), ständiger wirtschaftlicher Aufschwung, ständig wachsender Konsum, immer weitere Reisen, immer neue Möglichkeiten. Ein ungewöhnliches Leben also. Aus diesem möchte ich erzählen.
Aber warum ist dieses Leben – eines von sieben Milliarden anderer, überhaupt erzählenswert? Jedes Leben ist einmalig. Ich kann jedoch nur von meinem berichten. Auf meinen Reisen, oft zu sehr entlegenen Orten, wurde ich mit Erfahrungen konfrontiert, die so kurios, überraschend und bewegend waren, dass meine Fantasie sie nicht hätte erfinden können. Deshalb habe ich sie niedergeschrieben. Einige dieser Erlebnisse möchte ich mit Ihnen teilen.
Vielleicht gibt es zwei Kategorien von Menschen, die einen sind Nestbauer, die anderen Nomaden. Ich fühle mich Letzteren zugehörig. Deshalb wollte ich nicht leben, ich wollte erleben. Damit habe ich auch vieles zerlebt, was in dem folgenden Text nicht verheimlicht wird. Er entstand in einer Krise, die ich durch den kreativen Akt ihrer Beschreibung überwinden konnte. Wenigstens weitgehend.
I. Der Unbehauste
Aufgezeichnet vor fünfundzwanzig Jahren
1
Ich habe beschlossen, mich von nun an X zu nennen. Es ist ein Buchstabe, der breitbeinig im Raum steht, mir aber wegen einer anderen Eigenschaft noch besser gefällt. Mit diesem gekreuzten Symbol streicht man Dinge aus, löscht Namen, annulliert Existenzen. Meine ist damit schon im Voraus getilgt, denn das X liegt über keinem Namen mehr, der Auflösungsvorgang hat bereits stattgefunden. Das war die Voraussetzung.
Überdies verfügt X über ein ganz besonderes Flair. Es ist ein Symbol des Verbotenen, des nicht Genehmigten, einer Gefahr der besonderen Art.
Das gefällt mir. Dabei ist an mir nichts Besonderes. Ich bin nur ein Mensch, der nichts mehr zu tun hat und dennoch überleben will. Davon gibt es in der Dritten Welt Millionen, in der ersten, zu der ich aufgrund einer Laune des Schicksals gehöre, inzwischen auch eine beträchtliche Anzahl, über die man aber nicht spricht.
Auch ich spreche davon nicht, ganz besonders ungern spreche ich über mich.
Doch dieser Dialog, der nun beginnt, lässt mir keinen Ausweg. Auch wenn ich weiß, dass es eher ein Monolog ist, zu dem ich mich zwinge, immer wieder. Schreibend kämpfe ich um mein Leben, wenigstens vorläufig noch, das kann sich ändern.
Auf dem Weg vom See hoch zum Haus taucht nach einigen Schritten über den Baumkronen der nächtliche Sternenhimmel auf. Kurz darauf sind zwischen den Bäumen helle Glasfenster zu erkennen. Wie ein leuchtendes Juwel steht es im Wald, das schöne, einsame Haus, in dem ich die Einliegerwohnung gemietet habe und deshalb auch regelmäßig einliege.
Heute ist es später als sonst. Eine gewisse Menge Alkohol hat mich in das Gleichgewicht einer Gleichgültigkeit gehoben, die einen Anflug von Heiterkeit nicht entbehrt. Hinter mir liegt eine längere Diskussion mit S., der ich mich im Wirtshaus ausgeliefert habe. Wieder einer dieser Versuche, mich im Kontakt mit Menschen auch als solcher zu definieren.
Ich sperre die Tür auf und gehe ins Arbeitszimmer. Ein Tritt auf den Fußschalter fährt den Computer hoch. Das Gefühl nicht ganz befriedigter Kommunikation lässt mich zur Tastatur greifen, ich will noch ein paar Zeilen schreiben. Eine notwendige Gesprächsergänzung, um die Lücke zu füllen, die sich durch Zaudern meiner neuronalen Reflexe im schnellen Spiel der verbalen Bälle ergeben haben und die jetzt lästig im Raum steht. Dabei ging es doch nur um ein Buch, das S. geschrieben hat. Allerdings eines mit vielen heimtückischen Widerhaken. Ich tippe, ohne zu denken.
S.
Nun habe ich mich dem Buch weiter ausgesetzt. Ich zeige mich erst wieder, wenn die Wunden vernarbt sind.
Zuerst sieht es so einfach aus. Man muss nur tief durchschnaufen, wenn einem wieder dadaistische oder mit dem Sinnbürzel winkende Kalauer auflauern.
Kaum geht einem die Luft aus, springen sie einen an, die grässlichen Fratzen, die sich hinter dem listigen Grinsen verbergen.
Und dann kommen sie, die zu Tode gequälten Sätze der Hochsprache, die so verbissen ver|zerknotet werden, bis sie zu einem Schwarzen Loch mutieren, dem kein Sinn mehr entfliehen kann und das den hilflosen Leser verschlingt wie eine kosmische Vulva.
Und dann treibt man so dahin im kalten Universum, haut sich den Schädel wund an der gekrümmten Raumzeit und deinen Denkspiralen und sucht verzweifelt nach einem Wurmloch, um der Multidimensionalität der erregten Synapsen zu entfliehen.
Oder wenigstens um sich in die Gravität unseres vertrauten Planeten zurückzuflüchten, wo man zwar dauernd herumspringen muss, um den zurückrollenden Steinen von Sisyphus auszuweichen, aber wenigstens ohne die Last nicht zu Ende denkbarer Gedanken aufatmen kann und eine herbstliche Erektion wieder ihren Namen verdient.
Was du dem Leser alles antust. Als ob das Leben nicht schon genug wäre.
Genau, als ob das Leben nicht schon genug wäre. Jetzt bin ich zufrieden, fast. Nicht schlecht, dieser Text. Den Argumentationsschleifen des Gegners raffiniert angepasst, stilistische Symbiose oder doch nur syntaktische Arschkriecherei? Vielleicht hätte ich Schriftsteller werden sollen. Wäre ich dann etwas geworden – außer älter?
Ich schicke den Kommentar ab. Dann ein Tritt auf den Fußschalter und der elektronische Knecht verstummt.
Und jetzt? Ich gehe vor die Tür und blicke in fetzige Wolken, die sich dem Mond entgegenschleudern. Der Wind biegt die Bäume, das Holz ächzt vor sich hin. Auch ich spüre die Müdigkeit in den Knochen, die mich zweiundfünfzig Jahre um die Welt getragen haben. Wie lange werden Sie das noch tun?
Wieder kommt der Gedanke des Abschieds in mir hoch. Ich ahne, dass die Erregung, die man als Jugendlicher gespürt hat, wenn man Dinge zum ersten Mal tat, nun endgültig Vergangenheit geworden ist. Der Versuch sich zu erinnern: Das erste Mal das Geschlecht einer Frau erspüren, den Finger tief in das feuchte Mysterium versenken. Das erste Mal ins Ausland reisen, sich woanders zu Hause fühlen. Was noch? Das erste Auto, der erste Job, die erste eigene Wohnung?
Nein, nur die starken Emotionen bleiben. Den ersten Film drehen, das erste Mal auf dem EmpireState Building den Kopf in den Wind strecken, das erste Mal den Boden Afrikas unter den Füßen spüren, das Pflaster von Rio, den Sand von Bali. Den Hauch der Fremde in sich einsaugen und spüren, wie er die Sehnsucht stillt. Die Intensität, mit dem man in diesem Augenblick die Energie des Lebens spürt, erfüllt jede einzelne Zelle.
Später dann das erste (und einzige) Stück Land kaufen, das erste Mal vor Gericht stehen. Erstaunlich, wie viele Erstversuche so ein Leben beinhaltet.
Und dann die andere, die dunkle Seite. Das erste Mal von einer Frau verlassen werden, das erste Begräbnis eines geliebten Menschen, der erste Unfall.
Mit dem Surfboard aufs offene Meer hinaustreiben und dem Tod ins Auge sehen. Noch schlimmer: Einem Menschen gegenüberstehen, der töten will.
Und auch das gab es: Das erste und einzige Mal in Peru auf dem Altar der Inkas stehen, mit ausgestreckten Armen den Himmel berühren und sich unsterblich fühlen. Und nun zunehmend der Gedanke an die zur Neige gehenden Zeit.
Wie wird er sein, der Abschied von diesem Planeten?
Der letzte Blick auf das Meer, auf die Berge, auf einen Baum im Herbst?
Wie tief dringen diese Bilder in die Seele ein?
Das letzte Aufbäumen in der Vulva einer nachsichtigen Frau, das letzte Glas Wein, der letzte Sonnenaufgang, der letzte Händedruck?
Wird das Schicksal milde sein und mir das Wissen um die Einmaligkeit der letzten Wahrnehmung ersparen?
Ich drehe mich um und gehe zurück ins Haus. Eines Tages werde ich auch das zum letzten Mal tun, vielleicht schon bald, wenn ich die Miete nicht mehr bezahlen kann. Mit diesem Gedanken und der Hoffnung auf einen gnädigen Schlaf lasse ich mich ins Bett fallen. Schon bald kippt mein Gehirn ins Nichts.
2
Dann ein neuer Tag, er lauert mir auf. X steht vor dem Spiegel. Es ist zehn Uhr und er hat sich erfolgreich zum Aufstehen überlistet. X sieht mich an, gnadenlos, er war immer gnadenlos.
Früher, als ich noch ein geachteter, auch im Ausland nicht unbekannter Filmautor war, konnte ich nicht umhin, eine gewisse Identität mein Eigen zu nennen. Schlecht war das Leben damals nicht. Ich drehte Filme, verbunden mit ausgedehnten Reisen in ferne Länder, ein dynamisches Leben mit aufregenden Frauen, ich konnte nicht klagen. Klagen konnten höchstens die Frauen, die von mir viel, aber nicht alles bekamen. Eines Tages gingen sie dann. Dann spielte das Schicksal von neuem Roulette, wieder war ich die Kugel, die irgendwo landen würde. Jedenfalls bildete ich mir das ein.
Doch seit X auf der Bildfläche erschienen ist, klemmt etwas im Getriebe der Zeit. Außenwelt und Innenwelt haben sich zu einer unsichtbaren Mauer vereint, an der ich mir täglich den Schädel einrenne. Vor lauter Beulen sehe ich aus wie ein genmutierter Klon.
Immer noch stehe ich im Badezimmer und starre auf mein Spiegelbild. Ich kann die Frauen ja verstehen. Würde ich jeden Morgen in dieses Gesicht blicken wollen? Von vorne ist es noch erträglich, von der Seite schon weniger. Zugegeben, die große Nase war schon immer profilprägend. Am schlimmsten hat sich die Ansicht von hinten entwickelt, vor allem aus erhöhter Perspektive: Eine banale Glatze, garniert mit einem Kranz dünner Haare. Der Blick auf dieses Arrangement löst in mir immer tiefe Melancholie aus. Im Grunde müsste ich mich von Frauen nur noch rückwärtsgehend verabschieden, wie früher ein Lakai am Hof des chinesischen Kaisers.
Ich klappe den Toilettendeckel hoch und erleichtere meine Blase. Der Druck erzeugt einen geräuschvollen Strahl, dessen Penetranz mir bei anderen auf die Nerven geht. Vor allem nachts, in Hotelzimmern der unteren Preisklasse. In Frankreich waren solche Räume früher besonders hellhörig. Das Geräusch kam dann aus dem Nachbarzimmer, meist gegen vier Uhr früh, nachdem ich bis dahin hinter der dünnen Wand die ungeschminkte Akustik gallischen Paarungsverhaltens ertragen musste. Erstaunlich, was ein Mann und eine Frau mit ihren Körpern anstellen können, nur Zentimeter von meinem Kopf entfernt. Der Unbekannte »wohnt ihr bei« und das so gründlich wie ausdauernd.
Man könnte auch von penetranter Penetration sprechen.
Ob es in den Zeiten der Bibel auch so geräuschvoll zuging?
Wie laut schrien die Frauen unter Moses oder Nebukadnezar, welche Symphonie des Gurgelns und Ächzens erzwang das stramme Glied eines Hiob oder Hesekiel?
Ich verlasse das Badezimmer und erklimme die Stufen der Treppe hoch ins Wohnzimmer. Die wenig dynamische Gangart offenbart meine Angst vor der Gegenwart, diese Konfrontation möchte ich hinausschieben, mich am liebsten ganz vor ihr drücken und damit dem Jetzt eins auswischen.
Doch es geht nicht, es ging gestern nicht und wird auch morgen nicht funktionieren. Ein neuer Tag hat begonnen, wieder bin ich ihm machtlos ausgeliefert.
Vorsichtig nähere ich mich dem Faxgerät, das hinter der Ledercouch lauert. Wie immer ist es bereit, mir trügerische Hoffnungen oder die üblichen Absagen ins Gesicht zu spucken. Das Gerät grinst mich an.
Es weiß, dass ich mich wieder einmal angeschlichen habe, zwar zögernd, aber doch von einer noch nicht ganz gestillten Erwartung getrieben.
Vielleicht ist ja doch über Nacht eine Anfrage zu einem Projekt, eine hauchzarte Andeutung eines Auftrags durch die elektronische Leitung geflossen, hat sich zu Buchstaben verdichtet und beschlossen, mich einmal mehr zu narren. Doch nichts dergleichen, nicht mal als Narr tauge ich noch.
Der morgendliche Gang ins Arbeitszimmer ist Ausdruck einer Routine, die auch Eingekerkerte am Leben erhält. Ich schalte den Computer an. Knisternd baut sich das Bild auf. Zuerst bahne ich mir den Weg zum elektronischen Briefkasten. Die Oberfläche von AOL konfrontiert mich mit den aktuellen Banalitäten des Tages, bei einer bleibe ich hängen: Sexy Single der Woche: Heike aus Flensburg | 19h live: Knuddelchat nach Feierabend.
Aus purer Neugierde schieb ich den Cursor auf das dämliche Gesicht von Heike und erfahre Hobbys und Leidenschaften der jungen Blonden:
Inline-Skaten, Chatten, Raven und alles, was Spaß macht.
Dazu erlaube ich mir keine Gedankenspiele und klicke den Cursor durch die virtuelle Welt, hin zu meiner Mailbox. Leer ist diese selten, höchstens von Inhalten: Börsentipps aus nicht abstellbaren Rundbriefen, schrille Jackpot-Verlockungen und der Hinweis einer gewissen Samantha, dass ich jetzt ihre tabulosen Fotos herunterladen könnte.
Zum Schluss noch die Mail eines Freundes aus Australien, die ich aber jetzt nicht beantworten will. Immerhin ein Beweis, dass es mich noch gibt.
Ganz so schlecht fängt der Tag also nicht an.
Diese Einsicht motiviert mich zu einer Aktion. Ich beschließe, nach München zu fahren. Dort werde ich die Rolle des unsichtbaren Flaneurs spielen und mich in ein Café setzen. Unter Leuten zu sein, verleiht mir die Illusion, noch am Leben teilzunehmen. In den Monaten der anhaltenden Arbeitslosigkeit mutierte X zu einem gläsernen Golem, der so durchsichtig ist, dass er nicht mehr wahrgenommen wird. Deshalb die Fahrt in die Stadt, der Sprung in die nichts ahnende Bevölkerung, der ich mich aussetze wie ein Gladiator dem schwülen Dunst der Arena. Ob es heute Löwen gibt?
Als ich an der Tür stehe, klingelt das Telefon. Es ist mein Freund Alex, ein passionierter Golfspieler und Fernsehjournalist. Einer der Erfolgreichen also, doch das nehme ich ihm nicht übel. »Wie geht’s?«Eine Frage, der ich nichts entgegenzusetzen habe. Ein Mensch hängt lose, wie die letzte, verfaulte Birne am Baum seiner Existenz und soll das auch noch in Worte fassen.
Ich rette mich in die Wahrheit. »Den Umständen entsprechend.«
Alex ist schlau, deshalb fragt er nicht nach. »Kommst du heute Abend?Es gibt Ente.«Ich zweifle, ob es mir guttut, mich Menschen auszusetzen, deren Leben rundherum in Ordnung ist. Provozierend elegant gelöst und so mühelos, als ob es selbstverständlich wäre.
Meine Antwort ist diplomatisch: »Ich muss nach München. Wenn ich rechtzeitig zurück bin, melde ich mich.«
Eine Notlüge, sie hält mir die Möglichkeit zum Rückzug offen.
3
Ich fahre los. Im Auto fühle ich mich besser. Der Ortswechsel suggeriert Beschäftigung, eine Täuschung, der ich mich gerne hingebe. Länder und Orte zu wechseln war bis vor Kurzem mein Lebenselixier. Das Fremde hat mich immer fasziniert, trotz aller Unwägbarkeiten. Schon früh war ich fasziniert vom Mythos fremder Namen: Singapur, Timbuktu, Surabaya, Mombasa, Shanghai. Diese geheimnisvollen Orte wollte ich kennenlernen und ihre Magie ergründen. Das habe ich auch getan. Warum mich dabei die dunkle Seite manchmal besonders fasziniert hat? Wer aus dem wohlgeordneten Leben deutscher Gründlichkeit kommt, verspürt eine Sehnsucht nach dem Ungeordneten, nach dem Charme des Chaotischen. Zu sehen, dass es auch anders geht, hat mich inspiriert, zumal mir das Gefühl der Angst fremd war. Freiheit war schon immer mein Lebensthema. Raus aus dem schwierigen Elternhaus, einfach weg. So weit weg wie möglich. Ich wollte leben und meiner Neugierde keine Grenzen setzen. Vernünftig war das nicht immer.
Aber Menschen sind das selten, auch nicht auf der Autobahn. Obwohl ich fast hundertfünfzig fahre, überholen mich ständig die Geschosse der dunklen Edelmarken. Jetzt schiebt sich ein riesiger SUV an mir vorbei. Eine dieser Egoprothesen, mit denen Fahrer ihre Wichtigkeit demonstrieren. Vor allem auf dem letzten Teil der Autobahn, wo der Zubringer von Starnberg einmündet, rasen diese Führungskräfte wie ferngesteuert auf ihre Büros zu. An der ersten Ampel begegne ich dann vielen wieder. Die üblichen Anzuggesichter, glatt, ernst, wichtig. So sehen sie alle aus, die ihre Lebenszeit gegen Geld verkauft haben. Da sind mir die kleinen Leute schon lieber, die das zwar auch tun, aber nur weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Ihnen gelingt es mühelos, ohne dreihundert PS auszukommen. Es sind Menschen, von denen niemand spricht, die aber unsere Gesellschaft am Leben erhalten: der U-Bahn-Fahrer, die Kassiererin im Supermarkt, der Schuster an der Ecke, die Krankenschwester.
Wie lächerlich sie doch manchmal sind, die Bürowichte der oberen Hierarchien. In den seltenen Fällen, in denen ich auf Flügen in der Business Class sitze, warte ich immer mit Spannung auf den Moment, in dem sie endlich loslegen dürfen. Ein gedämpfter Piepston und das Anschnallzeichen über den Sitzreihen erlischt. Wie auf Kommando greifen alle zum Aktenkoffer, schälen einen gewichtigen Laptop hervor und stapeln Unterlagen neben sich.
Ich versuche mich dann als Industriespion und werfe verstohlene Blicke in die Dokumente: Deal Memo, Evaluation Sheet, contingency control, support analyst report. Manche studieren die Agenda des nächsten Meetings (Bereichsleitersitzung – Vertrieb Südosteuropa), andere arbeiten an einer Präsentation (Milchtütendesign mit anschließender Marketingkampagne) oder starren auf die grafisch bunt gefächerten Balken, die so nett anzuschauen sind: Verkaufszahlen von Lebkuchen in Korea oder Staubsaugern in Portugal.
Nicht dass mir das banal vorkäme. Die Entscheidungsträger der Wirtschaft, die mit Höchstgeschwindigkeit durch ihr Leben eilen, nicht nur auf der Autobahn, sichern Arbeitsplätze. Meist genügt ihnen auf der Straße kein Auto, sie brauchen als Egoprothese einen übermotorisierten Salon, weil sie sonst die Kälte spüren würden, die auf der Welt herrscht. Oder den knorrigen Sound eines teuren Zweisitzers, der Sportlichkeit suggeriert. Doch mich täuschen sie nicht mit ihrer selbst ernannten Wichtigkeit.
Auch Nieten in Nadelstreifen gehören zum Alltag der Geschäftswelt. Wenn diese überbezahlten Vordenker falsch denken, werden sie nicht bestraft, sondern belohnt. Kommt ein Konzern ins Schleudern, wird eisern gespart, Arbeiter und Angestellte werden entlassen. Der harte Sanierungskurs beeindruckt die Analysten, die Aktie steigt, der Vorstand, der die Misere verursacht hat, verdient kräftig dazu. Im schlimmsten Fall muss er weichen, dann wird sein Trennungsschmerz mit Abfindungen in Millionenhöhe vergoldet.
Wofür? Weil er unsinnige Entscheidungen getroffen hat?
Ich bin überzeugt, unter jeder Berufsgruppe gibt es den gleichen Prozentsatz von Idioten. Ob Arzt, Politiker oder Metzger spielt dabei keine Rolle. Leider scheinen manche, wenn sie einmal oben sind, unantastbar zu sein. Gerade die Versager unter ihnen nehmen sich besonders wichtig, aus Angst, dass man ihre Unfähigkeit eines Tages bemerkt. Bis dahin wollen sie das falsche Spiel mit Vollgas genießen.
Deshalb sind Menschen, die sich für wichtig halten, auch immer in Eile. Obwohl uns allen dieselbe Zeit zur Verfügung steht, nämlich vierundzwanzig Stunden am Tag, haben wichtige Menschen davon immer zu wenig. Auch im Flugzeug.
Gedankenlos kauen sie an den hastig servierten Käsesemmeln, wenn Brösel auf die Tastatur fallen, werden sie mit grimmiger Miene abgeschüttelt.
Niemand lächelt, niemand spricht. Nur vorne links diktiert ein graumelierter CEO gedämpfte Befehle in sein Diktiergerät. Die ganz Entspannten, die mit den fetten Abfindungsgarantien, blättern in der Financial Times und hüsteln ein bisschen. In solchen Momenten spült mir meine Liebe zur Anarchie gerne Szenen subtiler Provokation ins Gehirn. Sollte ich inmitten dieser wirtschaftlichen Elite die Castingunterlagen zu einem pornografischen Film studieren, so ernst wie die neben mir Sitzenden ihre Statistiken?
Nicht dass mich Großaufnahmen aus dem Genitalbereich interessieren oder besonders erregen würden. Ich würde nur vorgeben, Entscheidungsträger einer anderen Branche zu sein und würde entsprechende Notizen machen: »Sandra mit Ballettsex, dann japanisches Bondage, nach dem Mittagessen Julia mit triple penetration.« So wäre ich in der Business Class ein echter Business Man. Immerhin setzt die Pornoindustrie in Deutschland fast eine halbe Milliarde im Jahr um. Ein deprimierender Gedanke.
Nach dem Stau am Ende der Autobahn biege ich auf den Mittleren Ring ein und schließe das Schiebedach. Die Schlange an Lastwagen, die bei jeder Ampel dunkle Dieselwolken auskeuchen, ist endlos. Plötzlich wird es laut. Im offenen BMW-Cabrio, das neben mir auftaucht, durchbricht eine unsichtbare Rockband die Schallmauer.
Am Steuer sitzt eine junge Frau, ihre Hände trommeln den Takt am Lenkrad, ihre blonden Haare werden von einer Baseballmütze diszipliniert. Sie sieht cool aus, doch die schrille Sonnenbrille verleiht ihr den arroganten Touch, den ich nicht mag. Jetzt dreht sie das Radio noch lauter, ihre Hände hämmern noch heftiger auf das Lenkrad. Ist sie erregt? Oder genervt? Sie würdigt mich keines Blickes und das ist gut so.
Hinter der Universität finde ich ausnahmsweise einen Parkplatz. Ich gehe hinunter zum Englischen Garten und kaufe unterwegs die Süddeutsche Zeitung. Am Himmel ballen sich einige Wolken, der Wind ist frisch, aber nicht unangenehm. Nahe am Eisbach setze mich auf eine Anlagebank. Ein älterer Herr mit Stock nimmt auf der Bank neben mir Platz. Er hustet lange und zückt dann die Bildzeitung. Eine Studentin im T-Shirt, unter dem die Brüste anmutig schwingen, bremst ihr Fahrrad ab und kommt vor der Bank zum Stehen. Ich rutsche zur Seite. In diesem Augenblick räuspert sich mein Nachbar. Aus den tiefsten Nischen seines Körpers dringen gepresste Laute. Es klingt, als würde er gleich seine Raucherlunge in die hohle Hand spucken und sie den Umstehenden zur Begutachtung darbieten. Die junge Dame fährt weiter. Kein Wunder.
Mein Blick wandert über die Wiese. Sie ist noch nass vom Regen. Beim Anblick des feuchten Grases spüre ich, wie sich längst Vergessenes in mein Gehirn vortastet. Erinnerungen kommen und gehen, mitunter verschwinden sie für immer. Die Bilder, die mein Blick auf die nasse Wiese und das im Licht glänzende Gras in mir hervorruft, hatten sich Jahrzehnte versteckt. Warum sind sie gerade in diesem Moment lebendig geworden?
4
Unterwegs nach Venedig, in einem alten Käfer. Dämmerung. Neben mir sitzt ein Mädchen. Es hat mich bei meinen ersten Ausflügen ins Reich der Erotik begleitet. Das gab Ärger, deshalb sind wir von zu Hause geflohen. Die letzten Tage habe ich im Obdachlosenasyl geschlafen. Nun bin ich in Italien, sitze am Steuer und genieße die Freiheit. Wir fahren durch Wälder und Wiesen, folgen einer kleinen Landstraße. Es regnet in Strömen, doch es ist warm.
Nach einigen Kilometern schiebt sich ein Gedanke in mein Gehirn: ein erotisches Intermezzo, da draußen, im strömenden Regen. Prasselnde Tropfen auf nackter Haut, eine neue Erfahrung. Meine Begleiterin, jung und neugierig, ist von der Idee sofort angetan. Ich parke am Straßenrand.
Im hohen Gras lassen wir uns fallen, ergeben uns der spontanen Erregung. Wild und ungestüm ringen wir miteinander. Der Regen peitscht unsere Haut, stimuliert unsere Sinne. Es riecht nach Gras und Erde. Und nach uns. Ein Duft, dem wir uns lustvoll hingeben. Nachher liegen wir noch eine Weile bewegungslos da, genießen den Wolkenbruch auf unseren verschwitzten Körpern, spüren jeden einzelnen Tropfen, der auf unserer Haut zerplatzt. Als wir zu frieren beginnen, laufen wir zurück zum Auto, um uns abzutrocknen. Aus Übermut setze ich mich ans Steuer, so wie ich bin. Nackt. Das Mädchen lacht und lässt sich in den Beifahrersitz fallen. Auch nackt. Beschwingt fahren wir los, inzwischen ist es dunkel.
Nach einigen Kilometern blinken blaue Lichter vor uns. Eine Straßensperre? Tatsächlich, Polizeikontrolle. Wir werfen uns einen Blick zu, eher amüsiert, als erschrocken. Kann man unsere Situation erklären? Ich bringe den Wagen zum Stehen. Zwei Uniformen mit Pistolen am Gürtel kommen auf uns zu. Regungslos bleiben wir sitzen. Einer der Männer macht mir ein Zeichen, das Fenster zu öffnen. Sekunden später blendet mich ein greller Lichtkegel. Doch nur kurz, dann lassen die Carabinieri das Licht ihrer Taschenlampen über unsere nackten Körper wandern. Nicht kurz, sondern ausführlich. Was sie sagen, verstehe ich nicht. Aber ich spüre ihre Verlegenheit. Unsere auch. In mir schwirren diffuse Gedanken umher, einer krallt sich ein. Es gibt wohl kein Gesetz, das das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Bekleidung unter Strafe stellt. Sogar im (damals) prüden Italien nicht. Daran hatte der Gesetzgeber nicht gedacht. Sind wir ein öffentliches Ärgernis? Im geschlossenen Wagen kann von öffentlich keine Rede sein. Was dann? Damit sind auch die Carabinieri überfordert.
Die beiden Uniformen tuscheln, einer holt den Vorgesetzten. Wieder die Taschenlampe. Ein grimmiger Blick, dann ein Befehl: »Aussteigen.« Das gilt für uns beide. Einer der Polizisten flüstert dem Commandante etwas ins Ohr. Eine nackte Frau, nachts, mitten auf der Straße? Schon nähert sich von hinten ein anderer Wagen. Jetzt flüstern alle drei nervös, wieder werden Schultern gezuckt, Köpfe geschüttelt. Das Auto hinter uns bleibt stehen.
Der Commandante dreht sich zu mir, sein Gesicht ist noch grimmiger. Er zögert kurz, dann macht sein Arm eine unwirsche Geste: »Weg mit euch.«
Lachend fahren wir los. Mit einem Schluck aus der Rotweinflasche feiern wir unseren Sieg.
5
Hier im Englischen Garten habe ich nichts zu feiern. Dafür kann ich die Zeitung lesen. Allerdings fehlt mir im Augenblick die Konzentration. Wieder einmal frage ich mich, wie weit man Erinnerungen trauen kann. Dieses Misstrauen hat einen Grund: Durch Zufall bekam ich kürzlich wieder Kontakt zu der Dame, mit der ich damals in Venedig war. Ich schickte ihr den kurzen Bericht. Sie war völlig irritiert. Ja, wir waren in Venedig.
Aber die Story mit dem Koitus im Regen und den Zwischenfall mit den Carabinieri hätte ich mir ausgedacht. Typisch Autor eben. Ich war perplex. Wie kann man so ein markantes Erlebnis vergessen? Oder hat sie es nur verdrängt und will es jetzt, nachdem fast ein halbes Jahrhundert vergangen ist, nicht mehr wahrhaben? Keine Frage, die ich beantworten kann. Ich greife wieder nach meiner Zeitung.
Als ich nach einer Weile endlich das Feuilleton aufschlagen will, spüre ich den lästigen Druck in der Blase. Er stellt sich immer dann ein, wenn es unpassend ist, so wie jetzt. Ich sehe mich um. Zu viele Leute. X liebt es, sich unter freiem Himmel zu entleeren, trotzig im Wind zu stehen und der Natur freien Lauf zu lassen. Doch nicht hier. Also mache ich mich auf den Weg zur öffentlichen Bedürfnisanstalt. Ein Wort, das man in den Abfallkübel für semantischen Sperrmüll werfen sollte.
Indes, Bedürfnisse darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Wenn ich daran denke, dass es im Schloss von Herrenchiemsee nur eine Toilette gab, gleich neben dem Ankleidezimmer des Königs, überkommen mich ernste Zweifel bezüglich der hochgepriesenen Baukünste der Wittelsbacher. Mussten die Bediensteten ihr Gesäß im Schlosspark entblößen? Hat das Personal ständig zwischen den Rosen und Hecken uriniert? Zur Zeit des vierzehnten Ludwigs, den der bayerische König so verehrt hat, soll es überhaupt noch keine Toiletten gegeben haben. Deshalb hat man in den Prunkräumen von Versailles einfach auf den Boden gekackt, angeblich hinter einem Vorhang. Bei dem riesigen Hofstaat, den zahllosen Empfängen und Gelagen muss der Geruchsfaktor haarsträubend gewesen sein. Kein Wunder, dass kurz darauf das Parfüm erfunden wurde.
Auch da, wo ich jetzt stehe, riecht es penetrant. Penetrant unangenehm. Öffentliche Pissoirs verdienen den Namen, den sie haben. Neben der Tür ein Graffito. Nicht die übliche Genitalskizze, sondern eine zutiefst philosophische Überlegung:
Ficken, Fressen, Autofahren – gibt es ein Leben vor dem Tod?
Mit dieser Frage im Kopf gehe ich wieder ins Freie. Die Wolken am Himmel haben sich geöffnet, die Herbstsonne taucht die grünen Inseln des Parks in weiches Licht. Ihre Strahlen wärmen auf ganz eigne Art, lassen die Zeit anders verstreichen. Die Radfahrer auf den Kieswegen fahren langsamer als sonst, Hunde können genüsslich unter den Parkbänken schnuppern und werden nicht gleich weitergezerrt. Ein paar Rollstuhlfahrer blinzeln in der Sonne und werfen sich Papierflieger zu, die so lange in der Luft bleiben, bis die heiteren Krüppel sie mit Steinschleudern abschießen. Auch die jungen Schwarzen, die auf der Wiese Volleyball spielen, werfen den Ball in Zeitlupe über das Netz. Manchmal so hoch, bis er einfach stehen bleibt und nicht mehr auf die Erde fällt. Ist das die Antwort auf das Graffito?
Unter den Bäumen beginnt eine Conga zu trommeln, einen ruhigen monotonen Rhythmus, der mit archaischer Lebendigkeit durch den Park pulsiert. War die Trommel nicht das erste Musikinstrument der Menschen?
Sie schlägt einen binären Takt, wie mein Herz. Doch mein Verstand trommelt nicht, er belästigt mich mit düsteren Monologen. Könnte ich diese abstellen, was dann? Ohne zu denken, würde ich einfach sein. Von diesem Zustand sprechen die Weisen der Welt seit Jahrhunderten. Warum ist das so schwer zu erreichen? Das Leben leben, wie es ist. Ohne es ständig ändern zu wollen. Diese Vorstellung gefällt mir. Warum sind wir Menschen, die Himmel und Hölle in uns tragen, immer Konflikten ausgeliefert? Das mag ich, das nicht. Ja|nein, entweder|oder, gut|böse. Ein binärer Rhythmus, der nie endet.
Meine Gedanken wandern zurück, Millionen von Jahren. Wie sah es auf diesem Planeten aus, damals im Urzustand? Ich schaue hoch zum Himmel. Von der Sonne ist nichts mehr zu sehen, sie ist hinter dunklen Wolken verborgen. Doch ich weiß, sie ist da. Das weiß auch die Erde, das wusste sie schon immer.
Seit es den Planeten gibt, empfängt er von der Sonne nicht nur das Licht, sondern von Anfang an auch eine ganz spezifische Information.
Als sich später im Ozean die ersten Mikroorganismen entwickelten, bekamen diese die gleichen Impulse. Welche waren das? Die Abfolge von Tag und Nacht. Es wurde hell, dann wieder dunkel, in regelmäßiger Abfolge. Das klingt banal, ist es aber nicht, wenn man es anders formuliert: Die älteste Information auf diesem Planeten war binär. Milliarden Jahre später hat sich dann eine zweibeinige Spezies entwickelt, deren Organismus nach denselben Impulsen funktioniert: Herzschlag und Atem folgen einem binären Rhythmus. Inzwischen haben diese Wesen Technologien entwickelt, mit denen sie jede Information speichern können. Dabei benutzen sie einen Code, der so alt ist wie der Planet – das binäre System. Vielleicht ist dieser Code inhärenter Bestandteil des Universums. Auch die Bausteine der Atome, die Elektronen, aus denen mein Organismus besteht, sind positiv oder negativ geladen. Materie ist nichts anderes als Energie, die pulsiert. Ich bin nichts anderes als Energie. Doch wo ist diese geblieben?
Ich sollte öfter lachen, am besten über mich. Auch die Welt der Emotionen ist binär, das war schon immer so. Wenn positive Gefühle existieren, muss es auch negative geben. Hell oder dunkel, warm oder kalt, das ist eine angenehm, das andere nicht. So einfach ist das.
Der Rhythmus der Trommel steigert sich, der Park scheint zu vibrieren. So, als wolle mich die Musik zurück ins Leben werfen, dem ich in letzter Zeit immer mehr entkommen bin. An der Conga sitzt kein Farbiger, wie ich zuerst dachte, sondern ein junger Weißer mit Nickelbrille und einer Zigarette, die im Mundwinkel tanzt. Vielleicht ein Musikstudent. Er ist da, um zu üben, ich sitze hier, weil ich Zeit habe, zu viel Zeit. Ist das überhaupt möglich?
Ich weiß, viele würden X beneiden um das unausgeschöpfte Zeitreservoir. Doch sie kennen nicht die Qual des Zeitbesitzers, den Fluch, jede Minute des Tages aus eigener Initiative bestreiten zu müssen. Es ist die bleierne Freiheit eines leeren Terminkalenders, die mich erdrückt.
Deshalb stehe ich auf und gehe weiter. Manchmal frage ich mich, was früher anders war und warum ich diese Person, die ich gewesen bin, verlassen habe.
6
Es hat nicht lange gedauert, bis X sich bei mir zu Hause gefühlt hat.
Mit ihm mutierte ich zu einem Relikt, dessen Existenz sich nicht mehr in der Wahrnehmung anderer reflektiert. Ich wurde zu einem unsichtbaren Wesen. Was war geschehen? Nichts Besonderes. Der Regisseur, der meinen Namen trägt, hatte einige Aufträge abgelehnt, hatte sich in Projekte vertieft, die ihm sinnvoll erschienen, Redakteuren jedoch nicht. Langsam war dieser Mensch ins Abseits gedriftet, ohne dies selbst wahrzunehmen. Vielleicht hatte er zu sehr auf die internationalen Preise und Auszeichnungen vertraut in dem Irrglauben, Leistung sei ein Kriterium für gute Aufträge.
Es war der Person entgangen, dass der Zeitgeist in den Medien sich geändert hatte. Dass es vor allem darum ging, sich geschickt zu verkaufen. Das war cool und gefragt. Dabei waren behauptete Qualitäten oft wichtiger als verifizierbare. In den Redaktionen saßen jetzt smarte junge Leute, die mit einem Fossil wie ihm nichts anfangen konnten und wollten, waren sie doch Teil eines Netzwerks, in dem sie anderen smarten jungen Menschen Aufträge zukommen ließen.
Bald hatte X keine Lust mehr, Manuskripte zu verschicken, die keiner lesen würde. Was er nicht geahnt hatte, war die tückische Reaktion seiner Psyche.
Finanziellen Problemen gegenüberzustehen, darauf war er vorbereitet. Doch dass in ihm schon bald die ersten Krebszellen einer schleichenden Depression wuchern würden, ahnte er nicht.
Als die Beziehung zu seiner letzten Partnerin zu Ende ging, war ihm klar geworden, dass die Einsamkeit, früher geschätzte Zuflucht, jetzt wieder zum Feind werden würde. Da dies nicht seine erste Trennung war, hegte er die Hoffnung, den Schmerz in zumutbarer Intensität hinnehmen und verarbeiten zu können. Leider hatten sich in seiner Psyche bereits erste Metastasen gebildet und produzierten Zustände in seinem Ich, die ihm unbekannt waren.
Es begann mit dem schleichenden Ende der Kommunikation. Ohne berufliche Aktivität und ohne Lebenspartner war er zunehmend dem Schweigen ausgesetzt.
Das war neu für ihn. Er spürte nicht, wie dieses Schweigen zum Nährboden für den Krebs wurde, der in seiner Seele zu wuchern begann.
X war ja keineswegs ein melancholischer Eigenbrötler. Bei Reportagen oder Dreharbeiten galt er als offener, witziger Typ, der mit unterschiedlichsten Menschen umgehen konnte, spielerisch, aber immer kongenial. Australische Büffeljäger, französische Chefköche, peruanische Kokabauern, Zenmeister oder Ziegenhirten, Künstler oder Astronauten, er fand immer den richtigen Ton.
Im Grunde war er ein Chamäleon, das sich jeder Situation an jedem Platz der Welt anpassen konnte. Die geschickte Osmose des jeweiligen Raum-Zeit-Gefüges verlieh seinen Reportagen und Filmen eine besondere Intensität. Die Menschen öffneten sich und ließen ihn an ihrem Universum teilhaben.
Er wiederum brachte ihnen ein behutsames Verständnis entgegen, das nie paternalistisch war, seine Texte waren sensibel und einfühlsam, sie zeugten von einem natürlichen Respekt gegenüber seinen Gesprächspartnern.
All dies verlieh seiner Arbeit die besondere Note, die viele geschätzt hatten.
Bei solchen Überlegungen wurde X klar, dass er vergessen hatte, seine Fähigkeit zur Osmose da zu praktizieren, wo sie den Grundstein für langfristige Beschäftigung hätte legen können: in den Redaktionsstuben. Schon immer hatte er ein getrübtes Verhältnis zu den Vertraulichkeiten, die sich in den Büros öffentlich-rechtlicher Anstalten einstellen konnten. Er misstraute der feucht-fröhlichen Atmosphäre an Geburtstagen, wo es vor Kuchen, Lachsschnitten und Prosecco gerne zu den subtilen Gesten freundschaftlicher Unterwürfigkeit kam, die manche festangestellte Redakteure so schätzen.
Um die Weihnachtszeit vermied er Besuche ganz, denn die in der Ecke gestapelten Geschenke ließen jeden schäbig aussehen, der ohne Wein oder Champagner ein dienstliches Gespräch suchte. Dabei wäre es so einfach gewesen.
Die Filme waren das meist nicht. Das Engagement für anspruchsvolle Projekte erforderte Energie und Hingabe. Einmal hat er sich sogar die Mühe gemacht, Spanisch lernen. Er wollte unbedingt mit einem Filmteam aus Peru arbeiten. Nur mit Einheimischen würde er sich Zugang zu dem geschlossenen Universum verschaffen, das er dokumentieren wollte: ein abgelegenes Dorf in den hohen Anden, in dem bis heute niemand Spanisch spricht, nur Quechua, die alte Inkasprache.
Ein zweiter Film ging über eine Zinnmine in Bolivien, hoch oben in den Anden. Naheliegend ist so ein Thema nicht.
7
Wie manche Geschichte, begann auch diese mit einer Reise. Ich war mit zwei Freunden in Peru unterwegs. In Lima kauften wir ein Ticket für den damals höchsten Zug der Welt. Der Ort, wo er am Ende ankommen würde, war uns egal, es ging um die Fahrt. Sie beginnt auf Meereshöhe, dann kämpft sich die Bahn in Steilkurven langsam höher.
Auf halber Strecke gibt es eine kurze Pause, das Personal wechselt. Eine Schicht fährt immer von unten bis zur halben Höhe, die andere von dort bis zur Endstation. Den Höhenunterschied der ganzen Strecke kann man niemandem zumuten, auch nicht in Peru. Im Zug sitzt auch immer ein Arzt mit Sauerstoffgerät, für alle Fälle.
Es wird eine spektakuläre Fahrt. Am späten Nachmittag kommen wir an. Die Endstation heißt Cerro de Pasco. Wir erfahren, hier ist eine Mine. Die kleine Stadt liegt auf viertausenddreihundert Metern. Kaum sind wir ausgestiegen, spüren wir den eiskalten Wind. Noch nie waren wir in dieser Höhe, noch nie an einem so trostlosen Ort. Anfangs atmen wir schwer und gehen langsam. Hagere, ausgemergelte Gestalten begegnen uns, die Häuser der engen Gassen sind so bedrückend wie die Gesichter der Menschen. Nach kurzer Zeit haben meine Begleiter Probleme mit der dünnen Luft. Einer fährt mit dem Taxi wieder hinab ins Tal, der andere will nur noch ins Hotel und schlafen. Ich bin noch nicht müde und schlendere durch die Gassen. Ärmliche Häuser, ärmliche Menschen. Dem Elend ins Gesicht zu sehen, wenn man davon nicht betroffen ist, ist unangenehm. Nicht immer ist es leicht, damit umzugehen. Ich bin privilegiert, kann jederzeit wieder abreisen. Die Leute, denen ich begegne, können das nicht. Das sieht man ihnen an. Deshalb weiche ich ihrem Blick mitunter aus und lasse meinen über die Dächer wandern. Die mächtigen weißen Gipfel der Anden glänzen im letzten Licht des Tages. Ein kurzer Moment von Romantik, die man wohl nur als Besucher empfindet.
Sobald die Sonne hinter den Bergen verschwindet, wird der Wind noch eisiger. Ich fange an zu zittern, trotz Anorak. Langsam habe ich das Bedürfnis, in mein Hotel zu flüchten. Doch vorher will ich mich aufwärmen. Beim nächsten Lokal bleibe ich stehen. Ich öffne die Tür. Der Raum ist halbdunkel und fast leer, nur zwei Indios sitzen im Eck und heben müde den Blick. Sie sehen einen Ausländer, der zur Theke geht und einen Pisco bestellt, den Standardschnaps des Landes. Was will der Mann hier?
Das frage ich mich auch. Eine zerfurchte Hand stellt ein Bierglas vor mich hin. Es ist klein, aber bis zum Rand gefüllt. Soll ich das etwa austrinken?
Drei Augenpaare beobachten mich. Ich probiere den ersten Schluck – nicht schlecht. Dann den zweiten. Immer noch haben die Männer ihren Blick auf mich gerichtet. Schafft der Ausländer das? Nun hat er keine Wahl mehr. Zwar brennt in seinem Magen ein höllisches Feuer, aber das sieht man nicht.
Ich stolpere zurück auf die Straße und suche mein Hotel, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendwie gelingt es mir. Im Zimmer lasse ich mich sofort aufs Bett fallen. Dabei fällt mein Blick auf ein Magazin der Minengesellschaft. Ich blättere noch ein wenig darin. Das Heft gibt mir einen Einblick in die Geschichte des Ortes, an dem ich bin. Über Jahrhunderte ist die Mine von Cerro die ertragreichste des spanischen Imperiums gewesen, für den König in Madrid eine Goldgrube. Nur Eingeweihte wussten davon. Die Gold- und Silbervorkommen waren so reichlich, dass sich Cerro im neunzehnten Jahrhundert zur zweitgrößten Stadt Perus entwickelte. Es war der erste Ort, der 1830 von der Kolonialherrschaft befreit wurde. Die Eisenbahn wurde bereits 1903 gebaut, bald übernahmen amerikanische Konzerne die Mine. Nun ging es um Silber und Kupfer, später um Zinn und Blei. Alle Metalle wurden im Tagebau abgebaut. Die Umweltschäden waren enorm. Verseuchte Erde, verseuchtes Wasser, von Bleistaub durchsetzte Luft. Als die peruanische Bergbaugesellschaft die Mine in Besitz nahm, änderte sich wenig. Die Häuser hatten immer noch keine Heizung und die Lkws lieferten das Trinkwasser weiterhin zum Fünfundzwanzigfachen des Preises, den die Leute in Lima dafür zahlten.
Das alles wussten wir nicht, als wir in den Zug stiegen. Und jetzt? Was fange ich mit diesem Wissen an? Dieser Frage kann ich nicht mehr nachgehen. Das Heft gleitet mir aus den Händen, ich schlafe ein.
Mitten in der Nacht wache ich auf. Mein Herz rast, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich lege die Hand auf die Brust und erschrecke. Dieses Herz rast nicht, es rattert. In Höchstgeschwindigkeit. Ein Anflug von Panik steigt in mir hoch. Ein Herzinfarkt, in Cerro de Pasco? Es wäre ein Exitus an einem ungewöhnlichen Ort. Also nicht ohne Charme.
Doch nur kurz blitzt dieser Gedanke auf, dann habe ich keine Kraft mehr für Ironie. Regungslos liege ich da, weiß nicht, ob das meine letzte Stunde oder vielleicht schon die letzten Minuten sind. Die Zeit scheint sich quälend zu dehnen. Würde sie im nächsten Augenblick stehen bleiben, endgültig? Irgendwann erlöst mich der Schlaf.
Kaum bin ich am nächsten Morgen wach, wird mir bewusst, dass Alkohol in großer Höhe gefährlich sein kann. Vor allem für Leute, die daran nicht gewohnt sind. Mit einem Kopf, der mir das nun ständig einhämmert, gehe ich hinaus ins Freie. Noch einmal wandere ich durch die engen Gassen. Wieder blicke ich in hagere, ernste Gesichter von Menschen, denen man die Last ihres Lebens ansieht. Ich frage mich, wie unter welchen Bedingungen die Männer in den Stollen der Mine arbeiten. Eine Frage, die mich nicht mehr loslässt.
Nach einer Weile komme ich zu einem Straßenmarkt, wie es ihn in Südamerika überall gibt. Indiofrauen sitzen auf dem Boden, vor ihnen ein paar Kartoffeln oder ein wenig Gemüse. Ihre Gesichter sind mir vertraut. Solche Gesichter habe ich schon öfter gesehen, an anderen Orten, in anderen Bergdörfern. Oft scheinen die Augen dieser Frauen ins Leere zu blicken. Vielleicht drücken sie eine nie erfüllte Hoffnung aus, die sie dennoch jeden Tag den Göttern der Berge als Opfer darbringen. Aus ihrem stoischen Blick springt mich das Leid von Jahrhunderten an, das seit jeher stumm ertragen wird.
Den ganzen Tag über knien sie auf den steilen Terrassen ihrer Felder, wühlen mit den Fingern in der Erde oder sitzen mit ihrem breiten Gesäß auf den Plätzen irgendwelcher Orte, ein winziges Häufchen Tomaten vor sich, ein paar Blätter Koka, eine Zitrone. Überleben mit einem Minimum, überleben unter allen Bedingungen. Wie ihre Männer unten in der Mine.
Was ich in Cerro de Pasco sah, erschütterte mich tief. Ich spürte das Bedürfnis, dies in einem Film festzuhalten. Niemand in unserer behaglichen Wohlstandsgesellschaft kann sich ein so armseliges und mühsames Dasein vorstellen. Ein Film könnte das ändern. Er würde mir die Gelegenheit geben, mehr über diese Menschen zu erfahren und ihren täglichen Kampf ums Überleben zu dokumentieren. Das tat ich dann auch.
Für das Projekt fand ich später einen noch trostloseren Drehort: eine abgelegene Mine in Bolivien, die von der staatlichen Behörde als unrentabel aufgegeben wurde. Die Mineros aber waren geblieben. Sie hatten eine Kooperative gebildet und versuchten nun auf eigene Faust, das noch vorhandene Erz aus dem Berg zu holen. Der Ort lag völlig isoliert auf viertausendzweihundert Meter Höhe. Ein winziger Ort mit kleinen Häusern, die eher Hütten waren. Dort lebten die Frauen und Kinder. Tief unten im Berg klopften die Männer das Zinn aus den Wänden. Die Arbeitsbedingungen in den ungesicherten Stollen waren mörderisch, die Dreharbeiten waren es auch. Der Film gewann später Preise im In- und Ausland. Wen interessiert das heute?
8
Ein Ball trifft mich von hinten am Kopf. Ich drehe mich um, ein kleiner Junge starrt mich erschrocken an, läuft dann zurück zu seiner Mutter. Ich winke ihm zu und lege mir den Ball vor die Füße. Konzentriert versuche ich einen Kick. Er misslingt, wie könnte es auch anders sein.
Ich gehe weiter durch den Park. Was ich an diesem Tag nicht ahnen kann: Viele Jahre später werde ich mit zwei Arbeitern aus der Mine in Bolivien über die gleiche Wiese gehen. Ein unglaublicher Zufall. Kann es in einem Universum, in dem kausale Gesetze herrschen, Zufälle geben? Ich blicke hoch zu den Wolken. Sie ziehen gemächlich dahin, als überlege die Sonne noch, ob es sich lohnt, die Zweibeiner da unten mit ihren Strahlen zu wärmen. Um sie zu motivieren, lege ich mich ins noch feuchte Gras und falte die Zeitung auf, die ich mitgebracht habe. Das vorherrschende Thema in diesen Tagen: die Terrorattacke auf New York. Eine Sternstunde der Journalisten.
Negative Nachrichten sind immer die attraktivsten, das scheint niemanden zu stören. Mich schon, denn es ist einer der vielen Indikatoren, die mir zeigt, wie krank unsere Gesellschaft ist.
Über dreitausend Tote gab es in New York, doch um diese geht es primär nicht. Hätte es an diesem Tag in Bangladesch eine Hochwasserkatastrophe gegeben mit einer Vielzahl von Opfern oder ein Stammesgemetzel in Ruanda, die Meldungen wären nur kleine Notizen gewesen. Die Wertigkeit von Toten ist also höchst unterschiedlich, man könnte von Kursen sprechen, wie bei Aktien. Was die Kurse der 9|11-Opfer so extrem in die Höhe getrieben hat, war die Tatsache, dass die meisten Amerikaner waren und auf amerikanischem Boden starben. Seit dem Bürgerkrieg hatte es so etwas nie mehr gegeben. Dazu kam das optimale Medienkonzept der Täter. Ein nationales Symbol bricht in Zeitlupe zusammen. Wie in einer Endlosschleife haben TV-Anstalten in aller Welt diese Bilder pausenlos wiederholt. Für den Betrachter war es wie eine Szene im Kino, nur schöner|schlimmer, denn es war echt. Und jetzt fallen wieder Bomben.
Das reichste Land der Welt walzt das ärmste platt. Amerika gegen Afghanistan, ein Racheakt. Wie viele unschuldige Opfer, vor allem Frauen und Kinder, es dabei geben wird, werden wir nie erfahren. Sicher werden sie die Zahl der ursprünglichen Toten um das Zehn- oder Hundertfache übersteigen.
Ich sehe mich um und atme tief ein. Der Englische Garten ist ein Shangrila, dessen Geheimnis nicht zu entschlüsseln ist. Ruhe und Frieden sind hier physisch spürbar. Haben die Bayern das verdient?
Bekommen Menschen jemals das, was sie verdient haben?
Wenn die fanatischen Terroristen aus Russland gekommen wären, hätten die USA dann Moskau bombardiert? Nein, Afghanistan ist ein leichtes Ziel. Die Ironie des Dramas ist, dass kein einziger der Täter aus Afghanistan kam.
X faltet die Zeitung behutsam wieder zu. Er ist heute geduldig mit mir.
Neben uns lässt sich eine rothaarige Studentin ins Gras fallen. Sommersprossen, kurze Hose und ein entwaffnendes Lächeln. An ihrer Baseballmütze klemmt ein amerikanisches Fähnchen. Sie kramt einen Stoß englischsprachiger Bücher aus ihrem Rucksack, dann eine verknitterte Herald Tribune.
Ich lächle. »Amerikanerin?«
Sie nickt und blättert in ihrer Zeitung.
»Auf Urlaub oder Studentin?«
Nun hebt sie den Kopf und mustert mich.
»Was denken Sie von diesem schrecklichen Überfall auf Amerika?«
Ich habe wenig Lust auf eine tiefschürfende Diskussion.
»Wir ernten im Leben immer nur, was wir gesät haben.«
Ich sage absichtlich »wir«, um dem Satz die Schärfe zu nehmen.
Meine Gegenüber holt tief Luft und starrt mich wütend an. Dann springt sie auf und packt hastig ihre Sachen. »Okay, verstanden. Wir Juden können ja schon froh sein, wenn uns die Deutschen nicht zu Lampenschirmen verarbeiten. Da sollte man nicht auch noch Mitgefühl erwarten.«
Ihr Gesicht ist rot vor Erregung. Dann spuckt sie mir einen letzten Satz vor die Füße. »You fucking stupid intellectuals.«
Sekunden später sitzt die Erzürnte auf ihrem Fahrrad und rauscht davon.
Ich lege mich ins Gras und schließe die Augen. Wie sich Sprache unauffällig immer neue Bedeutungen zulegt, fasziniert mich schon lange. Vor hundert Jahren konnte ein Lehrer im Wirtshaus noch sagen Heute musste ich ein paar Kinder kräftig ficken. Niemand hätte den Blick vom Bierkrug gehoben. Das umstrittene Wort bedeutete früher »züchtigen«.
Auch bei der von der jungen Amerikanerin gebrauchten Vokabel hat sich die sexuelle Bedeutung längst verabschiedet. Der Begriff ist nur noch harmloses Reizwort, ein gedankenlos hingeworfenes »verdammt«.
Etwas kitzelt mich. Eine Ameise krabbelt über meine Kopfhaut. Ungestört durch lästigen Haaransatz erklimmt sie die schweißglänzende Steilwand meiner sich ständig ausbreitenden Glatze. Ich bewege mich nicht. Besser eine bayerische Waldameise als ein afrikanischer Skorpion.
9
Bei diesen Gedanken fällt mir eine Begegnung in Kenia ein. Wie so oft, wenn ich längere Zeit Englisch spreche, hatte sich die Sprache verinnerlicht, sie war zur zweiten Haut geworden. An diesem Tag versuchte ich, den Bus von Arusha nach Nairobi zu erwischen. Er fuhr gerade los. Keuchend laufe ich nebenher und klopfe an die Scheibe, die Tür öffnet sich. Kaum bin ich ins Innere des Wagens gesprungen, fährt sie ruckartig wieder zu und klemmt mir den Arm ein. Spontan entkommt meinen Lippen das ominöse Fuck!
Ein anglikanischer Priester, der neben der Tür sitzt, dreht sich um: »Right now? Is this an order?«Perplex starre ich ihn an. »I assume this is neither the proper time nor the proper place.«Nicht schlecht, diese Engländer.
Im Grunde mag ich keine vulgären Wörter. Doch manchmal ist es nicht leicht, adäquate Vokabeln zu finden. Wie sollte man das von mir so verehrte weibliche Zentrum der Lust benennen? Medizinische Begriffe törnen ab. Alternativen gibt es kaum. Das Wort »Möse« hingegen gefällt mir.
Wenn man es langsam und genüsslich ausspricht, öffnet sich der Mund zu einem runden O und wird damit zur fleischlichen Metapher für das Angesprochene.
Umso mehr, als dieses Wort auf den Begriff Moos zurückgeht und somit sehr treffend an das erregende Feuchtbiotop erinnert, das zwischen den Schenkeln der Frauen schlummert. Wo sind die sprachlichen Alternativen?
Vagina klingt wie Angina, ist überdies lateinisch, deshalb zu abstrakt, außerdem zu klinisch. Infantile Vokabeln scheiden aus. Was tun?
Andere Sprachen haben es auch nicht leichter. Das französische Wort »chatte« klingt nach einer Falle, die zuschnappt. Die Doppelkonsonanten hacken das Wort ab wie ein Küchenbeil. Auch Engländer und Amerikaner machen es nicht besser. Das primitive »cunt« ist im Ton noch härter.
Oft als Synonym für »Frau« missbraucht ist es extrem abwertend. Die Silbe wird förmlich ausgespuckt, das Wort klingt so gemein, wie es ist.
Sind solche Ausdrücke nicht eine Beleidigung des weiblichen Geschlechts?
Sowohl der französische als auch der englische Begriff bleibt auf Männergespräche und pornografische Texte reduziert, sonst flüchtet man sich ins Lateinische. Eine normale Vokabel gibt es anscheinend nicht!
Was sagt das aus über eine Gesellschaft?
Klingt im Vergleich dazu meine Variante nicht weich wie ein Kosename? Einschmeichelnd, ausgewogen. Mö–se. Zwei Silben, die Harmonie und Ruhe ausstrahlen wie zwei Brüste. Und erst der Umlaut, das Ö – die beiden frechen Pünktchen über dem weit geöffneten Mund. Für mich sind es die Augen des Voyeurs, der sich dem Gral des weiblichen Orakels gegenübersieht und sich ihm in Demut hingibt.
Sie sehen, verehrte Leserin, kein Anlass für Empörung. Fühlen Sie sich vielmehr zart berührt, wenn sich die Vokabel in unser Gespräch einschleichen sollte. Denn das Wort ist, was es sein soll – eine Hommage an Sie!
10
Ich stehe auf. Im Gras entdecke ich eine kleine US-Flagge, die Studentin muss sie bei ihrem überstürzten Aufbruch verloren haben. Ich hebe sie auf und stecke sie ein. Was ich ihr gegenüber nicht erwähnt habe, ist eine Frage, die sich nach der 9|11-Attacke in Amerika niemand gestellt hat: Warum hassen sie uns so? Das wäre naheliegend gewesen. Obwohl ich oft in die USA gereist bin und dort großartige Menschen getroffen habe, ist mir dieses Land in seinen Widersprüchen immer noch unergründlich.
Die offizielle Ideologie ging mir ohnedies nie in den Kopf. Bis vor Kurzem galt der Kommunismus als das Böse an sich, als wäre er ein Konzept des Satans.
Doch im Grunde ist es nur die Ideologie einer Gesellschaftsform, also ein Denkmodell, auch wenn dieses brutal missbraucht wurde. Doch war es in Amerika schon immer ratsam, sich eher als Serienkiller zu bekennen als dem Kommunismus nahe zu stehen. Der Sexualität gegenüber ist die Haltung der Amerikaner ähnlich schizophren. Jeden Tag sehen amerikanische Kinder im Fernsehen alle nur denkbaren Formen von Grausamkeit und Mord, doch Menschen, die sich körperlich lieben, sehen sie nie. Das gilt als unanständig und ist verboten. Wenn im Stadtpark ein Mensch einen anderen zu Tode prügelt, ist das zwar verwerflich, aber nichts Besonderes. Wenn sich zwei Menschen dort erotisch verwöhnen, also etwas tun, was Freude bereitet und niemandem schadet, ist das eine obszöne Straftat. Wie krank ist diese Gesellschaft eigentlich?
Darüber hätte ich mit der Amerikanerin gerne gesprochen. Doch nun ist sie weg, tief gekränkt.
Während ich über die grünen Wiesen gehe, denke ich noch einmal an die Schreckensbilder aus New York. Ich frage mich, warum es so schwer ist, gewisse Dinge zu begreifen. Tatsachen, die so einfach sind, dass sie ein kleines Kind verstehen könnte. Wir alle, sämtliche Bewohner dieses Planeten, wohnen in einem Haus. Oben im fünften Stock wird über alle Maßen gefressen und geprasst, unten wird gehungert.
Ständig lassen wir vor den Augen der anderen in den Aufzügen alle nur denkbaren Luxusgüter zu uns hochfahren, den Überfluss werfen wir aus dem Fenster oder kotzen ihn hinaus. In den restlichen vier Stockwerken des Hauses vegetieren die Menschen vor sich hin, täglich verhungern und verdursten einige. Wie lange kann das gut gehen? Wen kann es wundern, wenn die Verachteten hochkommen und bei uns an die Tür klopfen? Sie werden nicht nur klopfen, sondern diese Tür eines Tages auch eintreten.
11
Ich gehe weiter, hoch zur Straße. Noch einmal tauchen Bilder aus der Vergangenheit in mir auf, Szenen aus der Zinnmine in Bolivien.
Nie wieder habe ich in einer Höhe von viertausend Metern gedreht, nie wieder bin ich Menschen begegnet, die unter so gnadenlosen Bedingungen um ihr Leben kämpfen müssen. In den alten Stollen stehen Vierzehnjährige zehn Stunden am Tag in kaltem Schlamm. Barfuß pressen sie riesige Schlagbohrer, die sie kaum halten können, gegen die Felsenwände. Ihre Väter arbeiten noch tiefer unter der Erde. In dunkle Löcher, zu denen sie nur hinabklettern können, indem sie ihre Ellbogen gegen die engen, nassen Wände spreizen und dann den Körper langsam nach unten schieben, Zentimeter für Zentimeter. Dort sitzen sie dann in der Hocke und schlagen das Erz aus dem Berg. Die Brocken legen sie in einen Sack, binden sich diesen um den Bauch und klettern wieder hoch.
Den ganzen Tag über kauen sie Kokablätter, um den Hunger und die Kälte nicht zu spüren. Nachts husten sie sich die Staublunge aus dem Leib. Und das alles für ein paar Pesos. Kaum einer der Leute wird älter als fünfunddreißig Jahre. Man hat den Eindruck, als quälen sie sich nicht für das Leben, sondern für den Tod. Doch das Grauenvollste ist die Perspektive dieses Lebens. Sie existiert nicht. Jeder Minero weiß, dass seine Kinder genauso enden werden wie er, dass es auch für sie keinen Ausweg gibt. Ein Leben ohne Hoffnung.
Und doch habe ich in Bolivien mit den Mineros und ihren Familien Tage verbracht, die zu den schönsten meines Lebens gehören. Nach der Arbeit, keuchend vor Erschöpfung und Kälte, wollten sie mit uns diskutieren. Über die Welt da draußen, im reichen Europa oder Amerika. Wo an der Börse der Kurs festgelegt wird für das Zinn, das sie aus dem Berg kratzen, wo der Preis für ihr Leben in Aktien und Optionsscheinen gehandelt wird.
Den Mineros war das klar, sie waren politisch erstaunlich gut informiert. Bevor sie uns erlaubten, sie bei der Arbeit zu filmen, stellten sie uns viele Fragen. Nicht nur das, einen Tag lang mussten wir sie mit der Kamera begleiten. Wahrscheinlich wollten sie sehen, wie ernst wir unsere Arbeit nahmen. Also krochen auch wir in die feuchten Löcher hinab, allerdings auch noch mit der Kameraausrüstung. Zum Glück hatte ich ein Team aus Peru, das sich mit den Leuten gut verständigen konnte. Die Frau des Kameramanns, die für den Ton zuständig war, hieß Sonja Llosa. Was ich nicht wusste, sie war eine Nichte des Nobelpreisträgers.
Um in die Löcher hinabzuklettern, hatte sich ihr Mann die Kamera um den Bauch gebunden, ich die Lampe an meinem Fuß festgeschnallt. Die Hände mussten frei bleiben, denn unsere Körper klebten an den nassen Wänden, nur durch die Ellbogen abgestützt. Eine falsche Bewegung und wir wären zwanzig Meter in die Tiefe gestürzt. Die Mineros beobachteten uns schweigend.
Am Abend teilte man uns mit, dass wir den Film drehen konnten. Doch auch dann ging die Diskussion weiter, jeden Abend. Hartnäckige Fragen, immer wieder: Was wir, die Filmemacher, an dieser Produktion verdienen? Was es uns Reichen bringt, wenn wir die Armen filmen?
Die Mineros von Bolivien haben mir geholfen, meinen Beruf besser zu verstehen. Nie zuvor wurde ich gezwungen, meine Arbeit so gnadenlos zu hinterfragen. Dafür bin ich ihnen bis heute dankbar. Nicht nur dafür. Vor Männern und Frauen, die (aus unserer Perspektive) ein aussichtsloses Leben führen, dies aber mit Stolz und Würde tun, habe ich größten Respekt. Bis heute weiß ich nicht, woher sie die Kraft dafür nehmen.
12
An der Leopoldstraße warte ich an der Ampel. Luxuslimousinen und Sportwagen rauschen an mir vorbei. Für uns ein selbstverständlicher Anblick. Doch bei den Mineros in Bolivien wurde mir eines klar: In den westlichen Industrienationen geht es uns nur deshalb so gut, weil es in anderen Ländern den Menschen so schlecht geht. Seitdem frage ich mich, warum das keiner verstehen will. Wir zwingen den Ländern der Erde ein Wirtschaftsmodell auf, das ökologisch tödlich ist. Das wird Konsequenzen haben. Sie werden verheerend sein, aber es scheint niemanden zu kümmern.
Vor welchem Tribunal werden sich die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft eines Tages verantworten müssen? Würden sie einst von den Kindern unserer Kinder angeklagt werden, welche Strafe wäre angemessen für die globale Verwüstung der Erde, für den Genozid an den Menschen?
Vor mir bremst ein Geländewagen mit goldenen Felgen und Breitreifen. Der Versuch, einzuparken. Am Steuer eine zarte blonde Frau im Calvin-Klein-Sweatshirt, auf dem Beifahrersitz ein Katalog für Golfreisen und eine Plastiktüte von Penny. Der Wagen stößt unsanft zurück und prallt auf einen Fiat Panda.
In dem rutschen zwei Bücher vom Sitz, eine Milchtüte kippt um, der Inhalt rinnt auf einen Aktenordner.
Ich gehe weiter. Die letzten Sonnenstrahlen fallen in die Straßenschluchten. Bald werde ich mir ein Nest suchen und mich wärmen.
Wenig später sitze ich im Vorstadtcafé hinter der Universität, ein Ort, wo ich altersmäßig nicht hingehöre. Diese Provokation leiste ich mir.
Schöne junge Menschen bevölkern diesen Platz, ich bin der älteste. Von der Decke hängen diverse Fernseher, es laufen Videoclips, stumm. So belästigt das wirre Zucken der Bilder nur die Augen, nicht die Ohren.
Ich schlürfe meinen Cappuccino und sehe der Bedienung nach, die mit ihrem charmanten Lächeln die Gäste verwöhnt. Soll ich es wagen, sie anzusprechen?
Meine innere Stimme protestiert. Sie weiß, solche Aktionen sind meine Stärke nicht. Zwar bin ich keineswegs schüchtern, doch der erste Satz, der ist mein Problem! Wenn man nur mit dem zweiten anfangen könnte.
Unauffällig ziehe ich meinen Stuhl in die Sonne, setze aber die hier obligatorische Sonnenbrille nicht auf. Bei dem, was ich vorhabe, muss ich mich nicht verstecken. Der Voyeur in mir ist harmlos, ein stiller Beobachter, mehr nicht. Neugierig mustert er die Frauen, die an ihm vorübergehen. Nicht alle, viele nicht, andere dafür genauer, manche sehr genau. An warmen Tagen ist an verlockenden Frauen kein Mangel, jedenfalls auf den ersten Blick.
Den zweiten transformiert meine Fantasie. Mit ihr kann ich die vorüberschreitenden Exemplare nackt sehen. Ein kleiner Trick, der mir erlaubt, jeden dieser Körper in Ruhe zu betrachten, vor allem das magische Dreieck zwischen den Schenkeln.
Eines nach dem anderen wandert nun an mir vorbei, jedes wiegt sich im Rhythmus der Schritte wie Segelschiffe in einer lauen Dünung.
Ja, ich höre Sie schon, verehrte Leserin. Ihre Empörung war zu erwarten. Doch Vorsicht, Sie haben Unrecht. Sie sehen in mir das Machoekel, das ich nicht bin. Wirklich nicht. Denn selbstverständlich gestatte ich Ihnen, meine zutiefst Verehrte, denselben Blick. Außerdem, wenn Sie ehrlich sind, muss ich Ihnen nichts gestatten, denn Sie haben ihn schon.
Gut, vielleicht nicht Sie persönlich, aber andere. Vielleicht ist die herbe Dunkelbraune am Nebentisch, die so lasziv am Bügel ihrer Sonnenbrille lutscht, längst in ähnlichen Gefilden unterwegs.
Vielleicht entblößt sie in diesem Augenblick ihrerseits die vorübergehenden Männer, entkleidet diese ihrer nicht immer ansehnlichen Unterhosen und misst mit Kennerblick Ausmaß und Form der mürrisch umhergetragenen Glieder.
Bitte schön, tun Sie sich keinen Zwang an, ich liebe Frauen mit Fantasie.
Aber lassen Sie mir bitte auch die meine!
Lassen Sie mir den genießenden Blick auf meine Passantinnen und ihre virtuellen Mösen, die hautnah an mir vorübergehen, sich nichts ahnend darbieten und mir den Tag zum Geschenk machen.
Glauben Sie mir, die Varianten an Form und Gestalt, welche die Natur an diesem privilegierten Teil des weiblichen Körpers hervorbringen kann, sind betörend. Vor allem das Schamhaar! Ein unsinniger Begriff übrigens, denn Haare schämen sich nicht. Frauen sollten ihre Geschlechtsorgane dem Betrachter nicht mit Scham, sondern mit Lust präsentieren. Deshalb werde ich dieses deprimierende Wort durch ein adäquates ersetzen, möge das alte im Weihrauch der katholischen Kirche vermodern.
Doch im Grunde ist diese Betrachtung ohnedies obsolet. Schamhaare sind heute out. Gnadenlos wegrasiert. Umso wichtiger der Blick ins Museum der Erinnerung: Natürlich gibt es den Vollbusch, das feste krause Lusthaar, das wie ein Gestrüpp die Pforten des Paradieses verschließt. Gerade schwarze Dreiecke bieten eine schier unendliche Vielfalt an Design und Konsistenz.