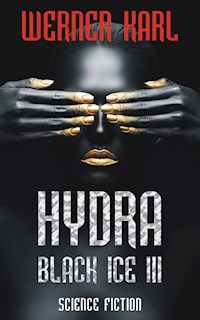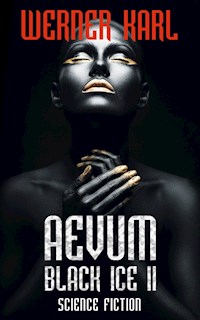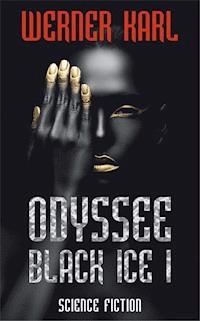
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Black Ice
- Sprache: Deutsch
"Sie ist gut." "Sind Sie sicher?" Misstrauisch beäugte der Gast die Anzeige. "Sie wäre jedes Mal gestorben, wenn sie den Korrekturbutton nicht gedrückt hätte." Der Ausbilder lächelte den Mann mitleidig an. "Ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Dienstzeit je einen besseren Soldaten gesehen zu haben. Sie ist die Beste" "Wie sagten Sie, sei ihr Spitzname in der Truppe?" "Black Ice." "Ich verstehe." Er nickte und ihm war anzusehen, dass er für die Frau gleichermaßen Respekt wie auch Mitleid empfand. "Okay, wir nehmen sie."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Karl
Odyssee
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Weitere Titel des Autors:
Vorwort
Mazzar Heimatsystem
Planet Samboll
Die Fähre der Jäger
Im Orbit
Intermezzo 1
Stampede
Intermezzo 2
Kapitel 5
Koma Eins
Carbon
Intermezzo 3
Allein unter Leichen
Intermezzo 4
Staub und Stein
Wie Phönix aus der Asche
Koma Zwei
Echsen
Laurin
Friedhof im All
Intermezzo 5
Freitag
Naya
Koma Drei
Blackout
Intermezzo 6
Der Faden der Ariadne
Zur Ehre der Toten
Dein Schiff, mein Schiff
Intermezzo 7
Zweifel
Das Narbenspiel
Violetta-System
Intermezzo 8
Planet Violetta III
Eine fremde Hölle
Die Hölle und ihre Bewohner
Schachfigur in Grau
Koma Vier
Sand im Getriebe
Orbit um Violetta III
Symbolismus
Die dritte Partei
Die Hölle hat einen Ausgang
Intermezzo 10
An Bord der BOUNTY
Meuterei
Mensch gegen Mensch
Eine Maus, viele Katzen
Vabanque
Geister
Geisterjäger
Treibgut im All
Das goldene Ei
Die letzten 100 Lichtjahre
Mister White
Maus lockt Katze
In letzter Sekunde
Schlangen
If you want blood
Personenregister (nach Völkern)
Glossar
Nachwort
Danksagung
Bibliographie
Epilog
März 2311
Kapitel 1
Dezember 2315
Kapitel 2
Januar 2316
Kapitel 3
Januar 2316
Kapitel 4
Januar 2316
Kapitel 6
April 2316
Kapitel 7
April 2316
Kapitel 8
April 2316
Kapitel 9
Mai 2316
Kapitel 10
Juni 2316
Kapitel 11
August 2316
Kapitel 12
Juni 2316
Kapitel 13
Juni 2316
Kapitel 14
Juni 2316
Kapitel 15
Juli 2316
Kapitel 16
Juli 2316
Kapitel 17
Juli 2316
Kapitel 18
Juli 2316
Kapitel 19
August 2316
Kapitel 20
August 2316
Kapitel 21
August 2316
Kapitel 22
August 2316
Kapitel 23
September 2316
Kapitel 24
September 2316
Kapitel 25
September 2316
Kapitel 26
September 2316
Intermezzo 9
Kapitel 27
September 2316
Kapitel 28
September 2316
Kapitel 29
September 2316
Kapitel 30
September 2316
Kapitel 31
September 2316
Kapitel 32
September 2316
Kapitel 33
September 2316
Kapitel 34
September 2316
Kapitel 35
September 2316
Kapitel 36
September 2316
Kapitel 37
September 2316
Kapitel 38
September 2316
Kapitel 39
Oktober 2316
Kapitel 40
Oktober 2316
Kapitel 41
Oktober 2316
Kapitel 42
Oktober 2316
Kapitel 43
Oktober 2316
Kapitel 44
Oktober 2316
Impressum neobooks
Weitere Titel des Autors:
Science-Fiction
BLACK ICE (Quadrologie)
Band 1 Odyssee
Band 2 Aevum
Band 3 Hydra
Band 4 Nexus (in Vorbereitung)
The Fantastic Zone (Story-Band)
Fantasy
SPIEGELKRIEGER (Trilogie)
Band 1 Druide der Spiegelkrieger
Band 2 Königin der Spiegelkrieger
Band 3 Dämon der Spiegelkrieger
(Prequel-Trilogie in Vorbereitung)
Menosgada
Driftworld
Details zu den Titeln siehe Anhang
Klappentext:
»Sie ist gut.«
»Sind Sie sicher?« Misstrauisch beäugte der Gast die Anzeige. »Sie wäre jedes Mal gestorben, wenn sie den Korrekturbutton nicht gedrückt hätte.«
Der Ausbilder lächelte den Mann mitleidig an. »Ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Dienstzeit je einen besseren Soldaten gesehen zu haben. Sie ist die Beste.«
»Wie sagten Sie, sei ihr Spitzname in der Truppe?«
»Black Ice.«
»Ich verstehe.« Er nickte und ihm war anzusehen, dass er für die Frau gleichermaßen Respekt wie auch Mitleid empfand.
»Okay, wir nehmen sie.«
Bérénice Savoy ist eine der härtesten Kämpferinnen des Spacetrooper-Korps. Dennoch gerät sie in Kriegsgefangenschaft. Ihr Schicksal scheint besiegelt. Doch unerwartet gelingt ihr die Flucht. Auf ihrer Odyssee durch die Tiefen des Alls lauern zahlreiche Gefahren und Feinde. Und Bérénice ahnt nicht, dass sie Teil eines Planes ist ...
Vorwort
Mein Herz schlägt eindeutig für phantastische Geschichten. Ich will als Leser möglichst spannend unterhalten werden und dabei so manche Überraschung erleben. Als Autor setze ich mir genau das als hohes Ziel. Und es ist nicht leicht, sich selbst zu überraschen. Stellen Sie sich vor, Sie erzählen einen Witz, dessen Pointe Sie natürlich kennen. Lachen Sie da noch mit? Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Aber ich kann hier auf tatkräftige Unterstützung bauen. Manche meiner Protagonisten sitzen mir während des Schreibens auf den Schultern und plärren mir Sätze ins Ohr wie: »Ich will nicht sterben!«, »Du Idiot, was machst du denn mit mir?« oder auch: »Das kann doch nicht wahr sein.« Wenn ich das höre, dann weiß ich: Ich kann mich selbst verblüffen.
Natürlich bietet hier die phantastische Literatur massiv mehr Möglichkeiten, als dies andere Genres vermögen. Aus dem unendlichen Pool von fremden Welten, exotischen Lebewesen, anderen Kulturen, Zeiten und Dimensionen, Katastrophen, religiösen, politischen und militärischen Entwicklungen, Mutationen usw. usw. lässt sich so einiges herausholen, was noch nie ein Mensch zuvor … Sie wissen, was ich meine.
Ich muss allerdings über mich selbst staunen. Denn als ausgewiesener Hardcore-Science-Fiction-Fan waren es nicht weniger als vier Romane, die ich im Genre Fantasy – genauer: Dark-/History-Fantasy (siehe am Ende des Buches) – veröffentlicht habe, bis ich mich an diesen Roman, meinen ersten publizierten SciFi-Roman, gesetzt habe. Wenn Sie gerade über das Wort publiziert gestolpert sind, muss ich gestehen, dass seit mehr als 20 Jahren mein SciFi-Erstling noch immer in der Schublade liegt. Samt zur Hälfte geschriebener Fortsetzung. Und noch ein Geständnis: Es wird eine Trilogie werden; offensichtlich habe ich ein Faible für Trilogien. Mich jucken ungefähr vier bis fünf weitere Romane in den Fingern; dann, endlich, endlich, werde ich mich wohl an den Erstling und seine beiden Fortsetzungen machen. Gnadenlos überarbeiten, damit sie den heutigen Ansprüchen gerecht werden und frei sind von all den Fehlern, die ich 1995 beim Schreiben des Romans gemacht habe.
Mir klingen noch immer die Worte meiner Frau in den Ohren, als ich damals zu Schreibblock und Stift griff (einen PC hatte ich zwar schon, aber irgendwie waren mir damals die fast schon urtümlichen Werkzeuge näher als heute) und zu schreiben begann. »Wem schreibst du denn einen Brief?«, fragte sie. Ich: »Ich schreibe keinen Brief. Ich schreibe einen Roman.« Sie: »Du spinnst.« Genau; Autoren im phantastischen Genre müssen leicht verrückt sein, um andere und sich selbst überraschen zu können.
Der Autor
Mazzar Heimatsystem
Mit ohrenbetäubendem Krachen schlug ein weiterer Raumtorpedo in die TSS EASTWOOD. Das Schlachtschiff der 15. Terranischen Kampfflotte schüttelte sich heftig – nun schon zum dritten Mal –, unter dem fürchterlichen Einschlag eines feindlichen Projektils. Die enorme Druckwelle der Detonation fegte wie ein heißes Schwert durch die Panzerung und schickte Tausende Trümmer als sirrende und pfeifende Schrapnelle durch die benachbarten Räume und Gänge des Schlachtschiffes. Mehr als ein Dutzend Techniker, fast fünfzig Mann Waffenbedienung und ein ganzes Hundert eines Enterkommandos wurden dabei auf der Stelle getötet. Jeder einzelne Torpedo riss ein Loch in die Panzerung, durch das bequem ein Landeshuttle gepasst hätte. Wolken kostbarer Atemluft zischten in die Schwärze des Alls, durchsetzt von unzähligen Bruchstücken und Dutzenden toten und verletzten Mannschaftsmitgliedern.
Zwar trugen alle den in einer Kampfsituation vorgeschriebenen Raumanzug, doch die meisten der rasch davontreibenden Männer und Frauen waren durch die Explosionswirkung schon tot, bevor sie ins All gerissen wurden. Einige wenige Verletzte – und noch weniger Unverletzte – wurden fast augenblicklich das Opfer der wild durcheinander zuckenden Laserstrahlen der Feindschiffe, die für den Einsatz dieser Waffenart nahe genug waren. Entgegen früheren Vorstellungen waren Laserwaffen im All recht unergiebig. Ihr Wirkungsgrad nahm in umgekehrter Proportion ab, je größer die Entfernung zum Ziel war. Schon auf 50 km Distanz kam auch von den leistungsstärksten Lasern nur noch ein Hitzestrahl am Ziel an, mit dem man gerade noch eine Kanne Kaffee hätte kochen können. Doch dieses unerträglich nahe, wie ein flackerndes Gitternetz dicht gewebte Gespinst feindlicher und eigener Strahlenwaffen, gab jedem, der den Schutz der Schiffspanzerung verließ, kaum eine Chance zu überleben. Nicht bei dieser starken Konzentration so vieler Schiffe auf so eng begrenztem Raum.
Jeder Raumanzug besaß selbstverständlich eine Freund-Feind-Kennung und die eigenen Laser-Abwehrsysteme würden selbstredend kein eigenes Mannschaftsmitglied unter Feuer nehmen. Normalerweise. Doch die Mazzar warteten bei dieser Schlacht mit einem neuen und vor allem völlig unerwarteten Fortschritt auf, welche die FF-Kennung nutzlos machte. Sie stießen dichte Trauben von winzigen Störbojen aus, die verblüffend den terranischen Modellen ähnelten. Mit irrwitzigen Geschwindigkeiten und noch verrückteren Flugrouten jagten sie mitten durch die kämpfenden Schiffe. Sie ignorierten dabei feindliche Projektile oder Laserstrahlen. Denn dazu waren sie schlicht nicht in der Lage. Ihre terranischen Pendants hätten dies gekonnt und wären dem Feindbeschuss ausgewichen. Doch die kleineren Modelle der Mazzar waren für Schnelligkeit und Effektivität konzipiert. Und als billiges Massenprodukt. Konkret hieß dies, dass eine Mazzar-Störboje nicht größer war als ein irdischer Fußball. Die Bojen wurden zu Dutzenden, ja zu Hunderten gerammt, getroffen, kollidierten mit sich selbst oder sogar an eigenen Schiffen. Doch dies machten sie locker durch ihre unglaubliche Stückzahl wett. Die Mazzar hatten es schon immer verstanden, in großen Dimensionen zu denken. Vielleicht lag dies schlicht und ergreifend an ihrer eigenen riesigen Zahl und ebensolchen Verbreitung im All.
Die schreckliche Folge der Bojen war, dass sich die Menschen eine Suche nach Überlebenden sparen konnten. Es gab schlicht keine. Die sich mehrfach überlappenden Störwellen verwirrten die Freund-Feind-Kennung und etwa 10 % der von Lasern zerschnittenen Körper starben durch Friendly Fire. Doch niemand an Bord des Terra-Spaceship EASTWOOD hatte eine Möglichkeit, dies jetzt festzustellen oder die Mann-über-Bord-Displays zu beobachten. Und die Besatzungen der restlichen Schiffe der 15. Terranischen Kampfflotte ebenfalls nicht. Alle noch existierenden Einheiten hatten alle Hände voll damit zu tun, ihr eigenes Überleben zu ermöglichen. Egal ob noch im Kampf befindlich, abdrehend oder die erschreckend steigende Zahl der Rauch, Trümmer und Menschen ausspeienden und brennenden Schiffe. Jedes noch aktive Besatzungsmitglied war darum bemüht, alles zu tun, um sich den anrückenden Feind vom Hals zu halten. Kein Mensch dachte auch nur noch daran anzugreifen.
Captain Titus van der Moiren, seines Zeichens Commander der TSS EASTWOOD, hatte es beim Einschlag des dritten Torpedos von den Füßen gerissen. Das war sein Glück gewesen, denn auf die Hauptexplosion des Torpedos folgten die internen Folge-Detonationen getroffener Energiespeicher, Waffenpulks und Schildaggregate. Das war ein Volltreffer gewesen. Was dieser dritte Torpedo angerichtet hatte, sah er unmittelbar um sich herum. Fast die Hälfte der Brückenbesatzung lag gefallen am Boden, wobei gefallen eine mehr als lahme Beschreibung dessen bot, was seinen entsetzten Augen zugemutet wurde. Sein Erster Offizier lag in drei Teilen auf dem blutverschmierten Deck, die einzelnen Körperfragmente mit extrem glatten Schnitten auseinandergesäbelt; das Ergebnis einer durchgedrungenen Laserlanze der Mazzar. Der Signalgast, drei Waffenoffiziere und die komplette Planungsgruppe lagen mit eingeschlagenen Helmvisieren in einer zu regelmäßigen Reihe, teils in, teils neben ihren Andrucksesseln.
Da rächt sich die schnurgerade Bauweise der Brückenpulte.
Mit jäh aufflammendem Zorn sah Captain van der Moiren seine Vorbehalte gegen diese Bauweise auf das Grausamste bestätigt. Ein Projektil flog im All immer schnurgerade, es gab im Weltraum außer für steuerbare Waffen keine ballistischen Kurven! Sollte er überleben, würde er den Schiffsplanern die Hölle heiß machen. Die gleiche Hölle, die er hier erlitt.
Vor den Schotts der drei Zentral-Lifte hatten sich ebenso viele hässliche Haufen ineinander verdrehter Körper zusammengeschoben. Die Druckwelle hatte jeden, der nicht angeschnallt war, wie ein Geschoss durch den Brückenraum katapultiert und dabei weitere Soldaten mit sich gerissen. Doch leider war es unvermeidlich, während eines Gefechtes ausgefallene Besatzungsmitglieder aus ihren Sesseln zu heben und mit den Ersatzleuten weiter zu kämpfen. So ein Wechsel war immer eine gefährliche Sache. Ausreichend Sitzplätze mit den entsprechenden Pulten auch für die Ersatzmannschaft unterzubringen, war schlicht ein Platzproblem und nur bei den wirklich großen Kampfschiffen möglich.
Van der Moiren versuchte aufzustehen, glitt aber auf einer Lache durch die Kälte des Weltraums gefrorenen Blutes aus und knallte der Länge nach auf den Boden. Mühsam stemmte er sich nach oben und torkelte auf das nächste Battle-Scene-Display zu. Er nahm dabei nur unbewusst das rasche Abflauen des Atmosphärensturms wahr, der die Reste der Brückenluft nach außen riss und für eine gespenstische Stille sorgte. Ohne die Atemluft als übertragendes Medium konnte man jetzt nur noch dumpfe Vibrationen und über Schiffsmaterialien getragene Geräusche wahrnehmen. Kadetten verfielen in solchen Situationen oft dem Irrglauben, dass der Kampf an Heftigkeit abflaute. Doch dem war nicht so. Nicht heute. Andere Mannschaftsmitglieder standen ebenfalls auf, nur wenige waren noch – lebend – in ihren Andrucksesseln angeschnallt. Während Captain Titus van der Moiren versuchte, sich einen Überblick zu verschaffen, registrierte er über seinen Helmfunk die Rufe und Meldungen seiner Restmannschaft.
»Antriebe 3 und 5 ausgefallen; 1 höchstens Halblast, 2 und 4 okay.«
»Unser Vorrat an Lenkwaffen ist völlig aufgebraucht, wir haben nur noch die Backbordwerfer und etwa ein Drittel der Laser-Nahverteidigung.«
»Haupt-Funkanlage ausgefallen, redundantes System einsatzbereit und fährt hoch …«
»Reparaturtrupp für Brücke ist unterwegs. Die Schäden …«
Sehe ich selbst, dachte van der Moiren. Weitere Meldungen trafen ein, aber das Wesentliche war gesagt. Er fasste einen Entschluss und tippte auf den All-Stations-Button seiner Funkanlage im Kommandopult.
»Hier ist der Captain«, rief er in sein Helm-Mikro, dessen Signale automatisch auf das Pult übertragen wurden. »Wir haben keine Chance mehr unseren Angriff fortzusetzen …«, sagte er und dachte dabei, wie leer das klang. »Nach unseren Daten steht so ziemlich fest, dass die Flotte nicht nach Mazzar wird durchdringen können.« Die Untertreibung des Jahrhunderts! Er machte einen Seitenblick zum Ersatz des Signalgasts und bekam von der Frau, die noch einmal die Anzeigen geprüft hatte, ein niedergeschlagenes Kopfschütteln zur Antwort.
»Nachdem momentan keine Verbindung zum Flaggschiff besteht und sich auch kein ranghöherer Offizier gemeldet hat, übernehme ich zeitweilig das Kommando: Wir werden den Rückzug antreten.«
Erleichterung machte sich breit.
Der Kommandant trat selbst an die Zweit-Funkanlage und gab den Code All-Ships ein: »Hier spricht Captain Titus van der Moiren von der TSS EASTWOOD. An alle terranischen Schiffe: Wir ziehen uns zurück. Jegliche Kampftätigkeit ist einzustellen. Verlieren Sie keine Zeit, um sich zu sammeln, sondern starten Sie sofort nach Ende dieser Nachricht. Bitte beachten Sie das Protokoll SAR, soweit es Ihnen möglich ist, ohne weitere Verluste zu provozieren. Treffpunkt Omega-12, ich wiederhole: Treffpunkt Omega-12. Dieser Befehl gilt unmittelbar, außer er wird von einem ranghöheren Offizier in den nächsten …«, er blickte kurz auf sein Chronometer, »… acht Minuten aufgehoben. Die Nachricht wird bis zum Eintritt in den Ultraraum permanent wiederholt. Gott mit Ihnen allen. Van der Moiren Ende.«
Acht Minuten war der Zeitraum, den jedes Schiff mit funktionstüchtigem Ultraantrieb brauchte, um die Energiemenge aufzubauen, welche ein Rettungssprung minimal benötigte. Die dabei zurückgelegte Distanz war zwar gering, brachte aber jedes dazu fähige Schiff aus der Kampfzone. Die Sprungautomatik sorgte dafür, dass beim Wiedereintritt in den Normalraum kein größerer Körper – etwa Monde, Planeten oder gar Sonnen – in der Nähe war. Allerdings war das System nicht in der Lage, kleinere Objekte im All wie Kometen und Asteroiden wahrzunehmen. Ein gewisses Restrisiko blieb also. Für Schiffe mit funktionstüchtigem Prallschirm war es ein vernachlässigbares Risiko, für Schiffe ohne Prallschirm sehr wohl.
»Ortung, gibt es SAR-Signale in unserem Aktionsradius?« Er wusste, dass seine Frage nach diesem Gemetzel rein rhetorischer Natur war.
Ein junger Mann mit notdürftig abgedichtetem Raumanzug drehte sich ihm zu, sodass der Captain ihm in die Augen sehen konnte.
»Sir, leider nein. Ich suche schon danach, seitdem ich …«, er schluckte, »diese Station übernommen habe.« Fähnrich Eugene Willard, kam dem Kommandanten der Name des Mannes in den Sinn. Der Fähnrich vermied es, auf den Boden zu seinen Füßen zu blicken. Dort lag der Cheffunker mit zerrissenem Anzug und herausquellendem Fleisch in einer dunkelroten Pfütze.
»Danke, Fähnrich Willard.« Van der Moiren drehte sich um. »Alle Energie auf die Sprungaggregate! Springen bei Erreichen Energielevel!«
Während er zurücktrat und dem weiblichen Ersatzoffizier das Funkpult überließ, beobachtete er die disziplinierte Arbeit der arg geschrumpften Brückenmannschaft.
Das ging ja völlig in die Hose. Wie hatte die Flottenführung nur glauben können, wir würden die Mazzar in ihrem eigenen Heimatsystem schlagen können? Es war doch klar, dass sie ihre Guerilla-Taktik hier nicht praktizieren würden. DAS IST IHRE HEIMAT! Und die wussten sie zu verteidigen. Mehr noch: Sie haben uns geschlagen. Und wie!
Seine Hand fuhr nach oben. Doch anstatt sich am Kinn zu kratzen, was er immer tat, wenn er sein Gehirn mit neuen Aufgaben fütterte, stieß seine behandschuhte Rechte nur an den unteren Rand des Anzughelms. Er ließ den Arm wieder sinken und blickte auf die Anzeigetafel, auf der eine frustrierend kleine Menge an Freund-Signalen aus dem Sektor schoss. Der Kommandant brummelte etwas Unverständliches vor sich hin.
Die Funkerin hob ihren Kopf.
»Sir?«
Ohne sie anzublicken, sprach Captain Titus van der Moiren leise – mehr zu sich selbst – nur wenige Worte. Seine Stimme war eine Mischung aus Wut, Frustration und … Verschlagenheit.
»Wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen …«
Planet Samboll
Bérénice hetzte nun schon die zweite Stunde durch den Dschungel von Samboll und sie war völlig durchnässt, sowohl von außen durch den andauernden Regen als auch von innen durch Schweiß. Doch sie nahm es mit stoischer Ruhe hin. Ihr blieb auch nichts weiter übrig, wenn sie nur die geringste Chance zu überleben nutzen wollte. Und sie wollte. Nein, sie musste. Ihre sehnig-athletische Figur verriet ihre haitianische Abstammung, ihre dunkle, fast schwarze Haut kontrastierte extrem mit ihrer knallroten Gefangenenkluft. Wenn man die recht strapazierten Reste des Anzuges noch als Kleidung bezeichnen wollte. Ihre schwarzen Haare – zu einem Zopf geflochten – hüpften im regelmäßigen Takt ihres Dauerlaufes auf dem Rücken, auf dem sich ein kleines Bündel und eine einfach gefertigte Schwertscheide befanden.
Sie war eine schöne Frau, doch im Augenblick würde ein Beobachter – und sie hoffte, dass niemand sie momentan beobachtete – jetzt nur einen schwarz-roten Schatten durch den dämmrigen Dschungel huschen sehen. Sie war hochgewachsen und ihr Gesicht von einer klassischen Anmut, welche durch den symmetrischen Aufbau von dunklen Augen, vollen Lippen und hohen Wangen nur noch unterstrichen wurde. Sie konnte damit jedoch ein ziemlich großes Repertoire an Grimassen schneiden, was ihr in geselliger Runde weitere glühende Anhänger eintrug.
Doch jetzt war fast jede freie Stelle ihres Körpers von Schnitten, Kratzern und kleinen Wunden übersät, welche ihr Dornen, peitschende Äste, Lianen und anderes Geflecht dieses verfilzten Waldes eingebracht hatten. Sie blutete aus etlichen der kleinen Verletzungen und zusammen mit ihrem Schweiß lief sie geruchsintensiv, wie ein olfaktorisches Leuchtsignal durch den Dschungel. Sie war sich dessen bewusst, konnte aber im Augenblick nichts daran ändern. Sie hoffte, dass der Regen intensiv genug war, um einerseits ihren intelligenten als auch weniger intelligenten Verfolgern die Witterung zu erschweren.
Nach vierzehn Wochen grausamster Gefangenschaft bei den Sambolli hatte sie beschlossen, eher zu sterben, als auch nur noch eine Woche weiter in dieser Hölle gefangen zu bleiben. Und die Chance zu sterben, lag hier im Dschungel nur geringfügig niedriger als im Gefangenenlager. Nun, sie zog eine Chance von 5 % zu Überleben einer von 100 % zu Sterben eindeutig vor. Ihre Mitgefangenen, was konkret das halbe Bataillon der 45. Spacetrooper bedeutete, hatten sich während ihrer Gefangenschaft von anfangs knapp 500 gefangenen Troopern auf 312 reduziert. Ein Trooper-Bataillon zählte normalerweise 1.000 Personen.
Jetzt 311, dachte sie grimmig und wich zum hundertsten Male einer Faustfliege aus, die nach wenigen Metern Verfolgungsflug aufgab und sich ein anderes Opfer suchte, was nicht so groß und so schnell war wie Bérénice.
Die schlanke Frau fühlte, dass sie vielleicht noch eine halbe, höchstens aber eine Stunde das Tempo würde halten können. Danach würde sie sich noch mindestens eine weitere Stunde mit dem Körperschutz beschäftigen müssen, bevor sie sich den dringend benötigten Schlaf gönnen konnte. Aber wie zum Trotz steigerte sie für einige Minuten ihr Tempo, wie um es sich selbst zu beweisen, was sie doch für ein harter Hund war. Als sie das zweite Mal beinahe in eine Rasierer-Falle getreten wäre, bremste sie ernüchtert und frustriert ab und fiel in ihr altes Lauftempo zurück.
Bérénice – von allen Freunden aufgrund ihrer unumstrittenen Schönheit nur Nice und von ihren Nichtfreunden respektvoll Ice genannt – widmete ihrer Umgebung wieder mehr bewusste Aufmerksamkeit. Der samboll´sche Dschungel stellte jeden irdischen Dschungel um ein Vielfaches in den Schatten. Das betraf zuallererst seine Größe, denn der Planet Samboll bestand fast ausschließlich aus Dschungel. Der Rest aus unzähligen Wasserflächen, welche die Bezeichnung Meer nicht im Ansatz verdienten, sondern von großen Seen, Abertausenden kleineren und kleinsten Wasseransammlungen, Strömen, Flüssen und Rinnsalen gebildet wurden. Da sich die höchsten Erhebungen noch unterhalb der Waldgrenze befanden, setzte sich die grüne Landschaft auch dort ungehindert fort. Einzig die Dichte des Pflanzengewirrs lichtete sich oben ein wenig und erlaubte seltene Ausblicke auf das immer gleiche Bild: Grün, soweit das Auge reichte.
Die Richtung, in die Bérénice rannte, war ihr egal. Zumindest für den Moment. Nur so weit weg vom Lager, wie sie nur konnte. Es hatte keine Mauern, Zäune oder irgendwelche anderen Hindernisse gegeben. Die Sambolli kannten ihren Planeten und selbstverständlich den Dschungel – und alles, was darin kreuchte und fleuchte – in- und auswendig. Aber sie kannten die Menschen noch nicht gut genug. Und schon gar nicht eine Frau wie Bérénice Savoy.
Die Sambolli waren entfernt humanoid und zum Erstaunen der Menschen empfanden sie die menschliche Spezies sogar als hübsch. Als mörderischen Todfeind, aber rein optisch als hübsch. Vielleicht trug das dazu bei, dass sie Bérénice nicht zutrauten, eine Flucht zu wagen. Schließlich waren muskulösere, stärkere Männer, in deren Augen echte Gegner, an der Flucht gescheitert. Die Skelette, welche der Dschungel übriggelassen hatte, zierten zu Dutzenden die Wände der Aufseher-Unterkünfte. Der Kommandant machte sich jeden Morgen die Freude, der schrumpfenden Gefangenenschar für eine geschlagene Stunde in brütender Hitze in stiller Andacht die Skelette beim Appell im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen zu führen. Ein besonderes Vergnügen bereitete ihm die Neuplatzierung eines weiteren gescheiterten Fluchtversuches während des Appells.
Bérénice lief trotz der ultrafeuchten Hitze ein kalter Schauer über den Rücken. Sie warf einen kurzen Blick hinter sich, mehr um sich selbst davon zu überzeugen, dass der Schauer nicht auf einen Verfolger gründete, sondern auf das tief empfundene Grauen, welches der Anblick der Skelette immer noch in ihr erzeugte. Sie fiel in einen langsameren Trott, beobachtete noch genauer den dichten Wald.
Sie suchte bereits nach einem Essigbusch für das Nachtlager. Erfahrungsgemäß fanden sich diese hochinteressanten Pflanzen am oberen Hang eines Hügels oder kleinen Berges, in mehr oder weniger deutlichem Abstand zu allen anderen Gewächsen des Dschungels. Es hatte ziemlich lange gedauert, bis die Spacetrooper die Vorzüge dieses Busches erkannten und zu schätzen gelernt hatten. Ein menschlicher Körper, möglichst direkt auf der Haut und komplett mit den flexiblen Blättern des Essigbusches bedeckt, war so in etwa das abscheulichste, was die restliche samboll´sche Flora – und Fauna – kannte. Was bedeutete, dass man recht ruhig in einer Umgebung sich zur Nachtruhe begeben konnte, die nur so von mörderischem Zeug wimmelte. Und man ertrug gerne den penetranten Geruch, der an edlen Weinessig erinnerte.
Nun ja, auch in der Hölle soll es einen Pausenraum geben, grinste Bérénice vor sich hin, als das Gelände anstieg und eine Viertelstunde später die gelbgrün gefleckten Blätter eines Essigbusches auftauchten. Wie erwartet stand der Busch relativ alleine. Er war nicht besonders groß: etwa 2,5 m hoch, dafür aber fast 5 m im Durchmesser. Leider eignete er sich nicht für einen permanenten Schutz, da seine abgepflückten Blätter nach circa einem Tag trotz des vorherrschenden Saunaklimas völlig aushärteten. Dieser Prozess stellte noch eines der einfacheren ungelösten Geheimnisse des Essigbusches dar. Die papierdünnen Blätter wurden dabei steinhart und an den Kanten rasiermesserscharf, was ein längeres Tragen am Körper unmöglich machte. Bérénice indes war es egal, dass sie jede Nacht neue Blätter würde pflücken müssen. Hauptsache, sie konnte sich niederlegen und wieder aufwachen, ohne gefressen worden zu sein.
Bérénice hielt für einen Moment inne, um zu verschnaufen. Und das rettete ihr das Leben, denn so leise sie sich auch bewegt hatte, ihr Dauerlauf verursachte auch auf dem weichen Pflanzenboden tapsende Geräusche. Dazu raschelnde Blätter, der Wind, der eigene Atem. Als durchtrainierte Spacetrooperin mit Hang zu Marathonläufen funktionierten ihre Lungen wie automatische Blasebälge, die gleichmäßig und vor allem leise arbeiteten. Nichtsdestotrotz machte alles zusammen aber ein Geräuschszenario, welches wirklich fast unhörbare Räuber übertönte. Sie stand vielleicht eine halbe Minute still und exerzierte eine Atemübung, die es ihr erlaubte, in kürzester Zeit flacher zu atmen, da hörte sie es. Ein leises Flattern, das ein normaler Mensch sicher irgendeinem exotischen Blattwerk zugeordnet hätte. Bérénice nicht. Dafür war sie schon zu lange auf diesem Planeten.
Mit einer fließenden Bewegung griff sie sich auf den Rücken, zog das einem Katana ähnliche Schwert und warf sich mit dem Rücken an den nächsten Stamm. Sie hielt das Katana beidhändig schräg gesenkt vor sich, als die ledrigen Schwingen des halbintelligenten Flugaffen auch schon aus dem Blätterwerk brachen. Das Wesen hatte erkannt, dass seine Deckung sinnlos geworden war und es – wenn es noch Erfolg haben wollte – sofort angreifen musste, bevor sich sein Opfer völlig auf die neue Situation eingestellt hatte. Die mannslangen Flügel schlugen heftig, um mehr Geschwindigkeit zu erzeugen. Das reißzahnbewehrte Maul öffnete sich gierig. Eigentlich zählte der Flugaffe eher zu einer Fledermausspezies, doch seine Kopfform und sein dichtes Fell hatten ihm – zumindest bei den Menschen – den Namen Flugaffe eingebracht. Bérénice spannte ihre Muskeln. Sie wusste, dass sie nur einen einzigen Schlag würde machen können. Denn wenn der Flugaffe auf sie stürzte, würde er sie mit seinem schieren Gewicht zu Boden drücken und ihr die Handlungsfreiheit nehmen. Einmal in seinen unterarmlangen Klauen, ein Biss seiner Fangzähne, und sie wäre das nächste Skelett an einer Sambolli-Hauswand. Rasch verdrängte sie dieses Bild aus ihrem Kopf.
Der Flugaffe machte jetzt seinen zweiten Fehler: Anstatt seine Flügelklauen in das Fleisch des Menschen unter ihm zu schlagen, reckte er der Frau den Kopf mit seinen Reißzähnen entgegen. Er war auf einen halben Meter an sie heran, als Bérénice in letzter Sekunde einen kleinen Schritt zu Seite machte und mit einem gewaltigen Aufwärtshieb den Kopf vom Leib des Flugaffen trennte. Sie konnte nicht mehr verhindern, dass der Rest des Körpers sie zu Boden riss und wand sich mit aller Kraft unter dem Tier hinweg, um nicht erdrückt oder von ihrem eigenen Schwert verletzt zu werden. Das, was sie nicht verhindern konnte, war, dass eine der Krallen ihr die Seite aufschlitzte. Bérénice ächzte aufgrund des Schmerzes und der Kraftanstrengung und befreite sich mit einem letzten Tritt ihrer Beine von dem Kadaver. Mehr aus antrainiertem Reflex heraus trat sie einen weiteren Schritt zurück, stöhnte erneut, als sie dabei die Wunde mit dem Ellenbogen berührte, und blickte in die Höhe. Sie drehte sich langsam einmal vollständig herum, versuchte dabei sich völlig lautlos zu bewegen und lauschte angestrengt. Flugaffen jagten manchmal auch zu zweit, vor allem wenn es Paarungszeit war. Doch ob dies gerade der Fall war, konnte sie nicht sagen. Sie hoffte es nicht, denn ein zweiter Flugaffe wäre jetzt gewarnt und würde sie nur noch aus dem Hinterhalt anfallen, ohne sich wie dieser vorher durch ein Geräusch zu verraten. Sie hörte nichts. Nun, das hatte noch nichts zu sagen. Entweder war das Vieh tatsächlich alleine, was die Regel war, denn Flugaffen pflegten einen ausgesprochenen Futterneid. Sollte jedoch Paarungszeit sein, dann würde der Partner überaus hartnäckig sein, denn ein Männchen benötigte große Beute um ein Weibchen zu beeindrucken. Und ein Weibchen verlangte über das normale Maß Nahrung, da es sich Fett anfressen musste, um das Junge im Bauch zu versorgen. Doch es blieb still.
Bérénice wandte sich wieder dem Kadaver zu und beobachtete, wie es rings um den toten Körper zu rascheln begann. Mit Ekel beobachtete sie, wie sich erst drei, dann acht, dann immer mehr armdicke Aasmaden aus dem Boden schlängelten und sich sofort an die Arbeit machten. Sie trat ein paar Schritte zurück und hob noch einmal die Augen in die Wipfel. Alles blieb ruhig. Sogar die Aasmaden verzehrten ihre Mahlzeit mit einem fast unhörbaren Schmatzen. Sie hatte doppeltes Glück gehabt; der Flugaffe war alleine gewesen, denn sonst wären die Maden nicht so schnell an die Oberfläche gekommen. Diese Mistviecher konnten selbst durch das dichteste Pflanzenbett jegliches Lebewesen riechen, ob lebendig oder tot. Ein zweiter Flugaffe wäre ihnen nicht entgangen und sie wären im Boden versteckt geblieben.
Sie behielt das Schwert in lockerer Haltung in der Rechten. Mit der Linken bedeckte sie die Wunde. Sie schritt langsam den Hügel hinauf und näherte sich dem Essigbusch. Es war ein kleinerer Hügel, vielleicht zwölf, höchstens fünfzehn Meter hoch, doch jeder Schritt tat ihr weh. Als sie den Busch erreicht hatte, machte sie noch einmal eine komplette Drehung und versuchte im dampfenden Dschungelnebel auffällige Landmarken auszumachen. Vergeblich.
Also gut, dann eben erst morgen früh, dachte Bérénice und steckte das Schwert zurück in die Scheide am Rücken. Sie dankte Gott für Dr. Muramasa, der ihr das Ding geschenkt hatte. Sie sah wieder sein Gesicht vor sich. Traurig, da er ihr sein Schwert gegeben hatte, das er für seine Flucht erschaffen hatte. Aber auch froh, in dem Bewusstsein, dass es ihr sicher mehr helfen würde als ihm. Sie hatte ihn nicht gefragt, wie und woraus er es hergestellt hatte. Sie hatte es dankbar angenommen. Ihre Dankbarkeit hatte sich in stille Verehrung verwandelt, als er ihr eröffnet hatte, warum er es ihr gegeben hatte und nicht selbst damit geflüchtet war. Er hatte sich bei einem seiner Patienten den kyllranischen Narbenkrebs geholt. Eine der wenigen Krebsarten, die manchmal ansteckend war. Doch er hatte auch gelächelt, denn sie hatte nicht nur das Schwert angenommen, sondern – im Gegensatz zu einigen sturen, besserwisserischen Männern, die geflohen waren und nun als Skelettzierden fungierten – auch seinen Rat.
»Wenn Sie Ihre Flucht vorbereiten, Bérénice«, hatte er sie beschworen, »dann legen Sie sich keine Fluchtvorräte an, basteln Sie sich nichts, stehlen Sie nichts!« Sie hatte verwundert den Kopf gehoben und ihn angesehen, als wäre er verrückt geworden.
»Warum nicht, Doktor?«
»Weil die Sambolli echte Kontrollfreaks sind. Der schreckliche Morgenappell dient nicht nur der Zählung der Gefangenen und dem Anblick der Skelette, sondern die Wärter filzen in den Baracken alles, und ich meine alles.« Sein Tonfall war nachdrücklich, ja fast verzweifelt gewesen. Wie oft hatte er gescheitere Flüchtlinge zusammenflicken müssen, die entweder gar nicht das Lager verlassen hatten oder nicht weit gekommen waren. Es waren wenige genug, die überhaupt noch am Leben waren.
»Die spärlichen Lebensmittel, die wir erhalten, sind exakt portioniert. Jegliches Material und Werkzeug wird mehrfach überprüft: wer es bekommt, wie lange er damit arbeitet, was er damit tut und wann er es wem zurückgegeben hat. Die Baracken sind nicht nur deswegen so mickrig, weil es sich aus Sicht der Sambolli nicht lohnt, erträglichere, geschweige denn komfortablere Unterkünfte zu bauen, sondern auch, um zu verhindern, dass die Gefangenen irgendetwas nicht als absolut überlebensnotwendiges Material für irgendwelche Basteleien verwenden könnten.«
Ihr Blick war bei diesen Worten auf das Katana gefallen und sie glaubte zu ahnen, was es ihn gekostet hatte, es geheim herzustellen und – wo auch immer – versteckt zu halten. Umso mehr traf sie die Tragik hinter dieser Waffe. Wahrscheinlich hatte er seit seiner Ankunft im Lager daran gearbeitet, Monat für Monat, wahrscheinlich Jahre. Sie wusste nicht, wie lange Dr. Muramasa schon Lagerarzt war.
»Nehmen Sie es ruhig, ich brauche es nicht mehr. Meine … Flucht benötigt keine Waffen. Und auch die Sambolli können mich nicht aufhalten. In drei, vier … höchstens sechs Monaten werde ich …«
Sie hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und ihn lange und still, von Tränen überströmt, auf die Wange geküsst. Als sie sich getrennt hatten, hatte er glücklich gelächelt. Erst jetzt begriff sie, dass er glücklich war, da sie seine Flucht vollzog und er davon überzeugt schien, dass sie es schaffen würde. Sie hatte damals nur einen leisen Dank flüstern können und das Schwert an sich genommen.
»Danke, Doktor«, sagte sie jetzt erneut im Schatten des Essigbusches und begann ihre spärliche Bekleidung abzulegen. Das Schwert steckte sie locker in Griffweite direkt neben sich in den Boden. Sie zog sich mechanisch aus und ihre Augen beobachteten die Umgebung, gleichzeitig kramte ihr Gehirn eine weitere Szene hervor.
»Wie soll ich im Dschungel überleben, wenn ich nichts mitnehme?«
»Das Wichtigste ist das Katana. Sie bekommen es von mir am Tag Ihrer Flucht, am besten in der Minute, in der Sie abhauen wollen. Nicht vorher! Der Dschungel von Samboll bietet Ihnen alles, was Sie brauchen: Wasser, Nahrung, Deckung. Deckung im doppelten Sinne, erinnern Sie sich an den Essigbusch! Die unglaubliche Vielzahl an Lebewesen macht es sogar Bioscannern unmöglich Sie zu orten. Sie haben ohnehin keinerlei technisches Gerät dabei, was man anpeilen könnte. Der Boden ist so mit Metallen angereichert, dass sogar das wenige Metall des Schwertes unmöglich zu orten ist. Sollten Sie das unwahrscheinliche Glück haben, irgendein technisches Gerät in einer Station, einer Mine oder sonst wo zu finden, benutzen Sie es auf keinen Fall. Nehmen Sie mit, was Sie glauben mitnehmen zu müssen, aber denken Sie daran: Geschwindigkeit ist das Wichtigste! Rennen Sie, bis Sie zu müde sind, einen weiteren Schritt zu tun. Je weiter Sie vom Lager entfernt sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, auf Suchtrupps zu stoßen. Halten Sie die Richtung, orientieren Sie sich an irgendeinem Sternbild, keinem Kompass! Keine Funkpeilung! Sollten Sie ein Funkgerät finden, nehmen Sie es mit, aber funken Sie damit nicht, bevor Sie den Planeten verlassen haben!«
»Den Planeten verlassen? Wie soll ich das schaffen?«
»Später«, hatte er ungeduldig geantwortet. Dr. Muramasa hatte sich in Aufregung geredet. »Wasser finden Sie in Lotus-ähnlichen Blumen. Achtung, es schwimmen immer – immer! – Parasiten darin. Gottlob sind die Dinger daumennagelgroß; nehmen Sie zwei Stöckchen, um sie aus dem Kelch zu fischen, nicht die Finger! Die Biester beißen sofort zu. Und sie dann wieder aus dem Körper zu entfernen, ist ohne chirurgisches Werkzeug nicht zu schaffen. Trinken Sie ohne Angst. Das Wasser ist frisch, auch wenn es lauwarm ist. Es ist sehr gut. Ich habe es hier getestet.«
Sein Blick hatte sich ein wenig getrübt und Bérénice hatte nicht gefragt, wie er es getestet hatte. Schließlich stand ihm keinerlei Laborausrüstung zur Verfügung.
»Folgendes an Nahrung können Sie verzehren: nämlich alles, was fliegt und in den Bäumen haust. Verzichten Sie auf alles, was Sie am Boden finden, insbesondere Aasmaden, die sind voller Bakterien. Auch wenn Ihnen ein Bodentier in seiner Erscheinungsform einem irdischen sehr ähnlich vorkommt und essbar erscheint, verzichten Sie darauf! Es ist fast die Regel, dass diese Tiere von den gleichen Bakterien verseucht sind wie die Aasmaden. Klettern Sie auf die Bäume und holen Sie sich die Eier aus den Gelegen, die können Sie roh essen. Jegliches Fluggetier müssen Sie leider braten und das ist eigentlich das Schwierigste dabei. Denn in dem schwülfeuchten Dschungel werden Sie an der Oberfläche kein trockenes Stück Holz finden. Und eine Rauchsäule aus feuchtem Brennholz ist wie ein Leuchtfeuer für die Verfolger.«
»Wie soll ich dann ein Feuer machen? Eine Laserwaffe habe ich nicht, chemische Zünder …«
»… müssen Sie sich selbst herstellen«, hatte der Doktor lapidar den Satz beendet. »Sie behalten die Knochen der Flugtiere und zerreiben sie nach einer Woche mit einem Mahlstein zu Staub; basteln Sie sich aus Rinde einen kleinen Korb und dichten Sie ihn mit den anfangs elastischen Blättern des Essigbusches von innen ab. In einem größeren Sack – den Sie von mir bekommen – sammeln Sie die Blätter des Körperschutzes, wenn Sie ihn am Morgen abnehmen.« Er schmunzelte dabei, vielleicht hatte er sich die Szene vorgestellt, in der sie ihre atemberaubende Figur im wahrsten Sinne des Wortes völlig entblätterte. Sie hatte ihn dabei durchschaut und war rot geworden.
»Und was soll ich als Brennmaterial verwenden, Dr. Muramasa?«
»Etwa einen halben Meter unter der lockeren Pflanzenschicht finden Sie abgestorbene Wurzeln. Machen Sie trotzdem nur sehr kleine Feuer, nur so viel, wie Sie für den Braten benötigen. Es ist sinnvoll, kleinere Flugtiere zu erlegen, als ein größeres, das ohnehin nur Aasfresser anlockt, bevor Sie es zerlegen, braten, geschweige denn verzehren können. Wedeln Sie beim geringsten Rauch die Fahne so weit auseinander, wie Sie können. Die Chance, dass der Rauch als dampfender Dschungel wahrgenommen wird, ist durchaus gegeben. Sicherer ist es jedoch, wenn Sie auf solche Tätigkeiten verzichten, wenn Sie nicht absolut der Meinung sind, dass Sie im Umkreis von mehreren Kilometern alleine sind. Vergraben Sie alles, was auf Ihr Lager hindeuten könnte. Decken Sie den Boden wieder mit Pflanzenresten zu. Die getrockneten Blätter eines Essigbusches wären zwar trocken genug für ein Feuer, sind aber so hart und dünn, dass ihr Brennwert recht niedrig ist.«
Bérénice hatte sich während dieser Erinnerung daran gemacht, ihren Körperschutz anzulegen. Als ersten Schritt hatte sie aus mehreren Kelchen Wasser zum Waschen verwendet, nicht ohne vorher peinlich darauf zu achten, dass sie alle Parasiten entfernt hatte und sich am Boden des Kelches nicht doch noch welche versteckt hielten. Die letzten drei Kelche löschten ihren Durst. Wie der Doktor gesagt hatte, war das Wasser lauwarm, aber vom Geschmack her vorzüglich. Nackt und sauber, wie sie nun war, schob sie sich so weit in die Mitte des Essigbusches, wie sie nur konnte, pflückte die inneren, weichen Blätter ab und klebte sie auf den neuen, dünnen Schweißfilm, der ihr aus den Poren trat. Die seitliche Wunde entpuppte sich als ein langer Schnitt, der aber nicht so tief ging, dass sie sich Sorgen machen musste. Hier hatte sie besonders auf eine dicke Schicht Blätter geachtet. Wie sie es gelernt hatte, überlappte sie die Blätter großzügig, damit nicht die kleinste Lücke blieb. Als sie damit fertig war, trat sie mit einem dicken Bündel weiterer Blätter aus dem Busch hervor. Sie befolgte einen weiteren Rat des Doktors. Sie entfernte sich mehr als fünfzig Meter den Hügel aufwärts vom Essigbusch, denn auch die Sambolli wussten um dessen Funktion, und mehr als ein Flüchtiger war inmitten eines Essigbusches aufgespürt worden.
Im Dschungel war es ohnehin auch am Tag nicht besonders hell, aber jetzt kündigte sich deutlich die Nacht an. Sie häufte ihre Kleidung zu einem Pack, der ihr als Kopfkissen diente, deckte diesen mit einem halben Dutzend der großen Blätter ab und legte sich den Rest locker um den Kopf und auf das Gesicht.
»Haben Sie keine Angst, sich sozusagen blind in den Dschungel zu legen, Bérénice«, erklang noch einmal Dr. Muramasas Stimme in ihr. »Der Essigbusch ist ein Exot unter der Flora von Samboll. Sein Geruch, selbst eine gewisse Anzahl seiner Blätter, ist jedem Tier und vor allem auch jeder Kriechpflanze so verhasst, dass Sie beruhigt schlafen können. Natürlich schützen Sie die Blätter nicht vor einer Entdeckung durch einen Verfolgertrupp. Ich bin übrigens der Meinung, dass die Pflanze gar keine einheimische samboll´sche Pflanze ist, sondern von Raumfahrern nach Samboll gebracht wurde. Ich kann nicht sagen, ob es die Sambolli selbst oder andere waren. Aber danken Sie – wem auch immer – dafür, dass er es getan hat. Sonst wüsste ich nicht, wie Sie alleine die Nacht überleben sollten. Ein Dschungeltag auf Samboll ist schon schlimm genug.«
Bérénice Savoy erwachte aus ihrem leichten Schlaf durch ein Geräusch, das nicht weiter als zwanzig Schritte entfernt erzeugt wurde. Mit unglaublicher Willensanstrengung zwang sie sich, nicht aufzuspringen, sondern vorsichtig den angewinkelten Arm an ihr Gesicht zu bewegen. Sie lag zwar in einem Dreieck aus dicken Stämmen verdeckt, aber sie wollte nichts riskieren. Sie zählte stumm 60 Sekunden ab, bis ihre Finger lautlos eine Lücke für die Augen geschaffen hatten. Sie blinzelte ein paar Mal und es dauerte weitere kostbare Sekunden, bis sich ihre Augen an das dämmrige grüne Durcheinander angepasst hatten. Dann sah sie am linken Rand ihres spärlichen Blickfeldes ein sandbraunes Fell gerade noch hinter einem Stamm verschwinden. Innerlich seufzte sie auf. Sie kannte das Tier. Es war einem irdischen Pekari sehr ähnlich, hatte sogar ungefähr dessen Größe, allerdings einen langen Hals, auf dem ein giraffenähnlicher Kopf saß. Der halbe Kopf bestand aus einem höchst flexiblen Maul, mit dem es genussvoll junge Triebe gerade der Pflanzen mampfte, die Bérénice als Trinkkelche gedient hatten. Der Rest des Kopfes wurde von zwei übergroßen Augen eingenommen, die misstrauisch die Wipfel beobachteten. Es war ein harmloser Pflanzenfresser, der noch nicht einmal einen menschlichen Namen erhalten hatte.
Kein Wunder, als Gefangener hast du ganz andere Probleme, als außerirdischen Viechern Namen zu verleihen, dachte Bérénice und erhob sich leise. Trotzdem nicht leise genug, denn das Tier senkte den Kopf und rannte davon. Bérénice lächelte, als sie sah, dass das Tier ihr einen vorwurfsvollen Blick zurückwarf und dabei weiterhin die Blätter, die es im Maul hatte, zerkaute. Auch wenn es noch keinen Namen hatte, wusste die Frau, die sich nun vollends aus den zerdrückten Blättern schälte, dass dieses Felltier als äußerst scheu galt und sich deshalb im weiteren Umkreis kein anderes größeres Lebewesen aufhalten dürfte.
Sie hatte trotz aller Beteuerungen des Doktors recht unruhig geschlafen und war auch mehrfach aufgewacht. Entgegen ihrer Erwartung war tatsächlich nichts passiert und sie fühlte sich mäßig erholt. Die Wunde an der Seite hatte sich geschlossen. Sie war zwar noch gerötet, aber eine Entzündung zeigte sich nicht. Sie würde wahrscheinlich wieder aufplatzen, sobald sie sich stärker bewegte, aber das ließ sich nicht ändern.
»Schmieren Sie sich ein wenig Asche aus Ihren Feuerstellen auf Wunden, sollten Sie welche haben«, hatte der Doktor gesagt, aber sie hatte noch keine Asche, dafür umso mehr Hunger.
»Ich bin noch zu nahe am Lager, also kein Frühstück«, murmelte sie sich selbst zu und untersuchte penibel ihre wenigen Kleidungsstücke, bevor sie sie anzog. Sie schüttete die Essigblätter in den Sack des Doktors und steckte das Katana in die Scheide. Neben dem Schwert stellten ihre Stiefel den kostbarsten Besitz dar. Es war der letzte Rest ihres Raum- und Kampfanzuges, den man ihr und auch den anderen Gefangenen gelassen hatte. Alles, was den Sambolli irgendwie seltsam vorgekommen war, hatte man entfernt. Sie nahm einen Schluck aus einem von Parasiten befreiten Kelch und schritt langsam an den höchsten Punkt des Hügels zurück.
»Grün, Grün und nochmals Grün.« Bérénice orientierte sich am Stand der dunkelgelben Sonne. »Das Lager ist im Norden; der Doktor hat gesagt, ich soll immer nach Süden gehen, und jegliches Wasser, das hier auf diesem Breitengrad fließt, strebt gen Süden.« Sie drehte sich in diese Richtung und entdeckte auf Südsüdost am Horizont einen Hügel, der schon eher die Bezeichnung Berg verdiente, wenn er auf diese Entfernung wesentlich aus dem Dickicht hervorragte. Ihr Magen knurrte.
»Jetzt noch nicht, Kleiner«, knurrte sie zurück und machte sich auf den Weg.
Bérénice war nach ihrem Zeitgefühl vielleicht eineinhalb, höchstens zwei Stunden in lockerem Trab unterwegs – den ersten Hunger hatte sie längst überwunden –, als ein Gefühl ihr sagte, dass in diesem Stück Wald etwas anders war. Sie hielt inne, zog lautlos ihr Schwert und rückte an einen Stamm heran. Blicke nach oben, nach allen Richtungen zeigten nichts Auffälliges. Sie atmete zwei, drei Mal tief durch und entspannte sich. Stille, alles ruhig. Sie blieb mehrere Minuten stehen, bis ihr klar wurde, was das Gefühl ausgelöst haben musste. Es war zu still.
Ihr Sichtfeld umfasste im besten Falle fünfundzwanzig, dreißig Meter, da die Bäume und anderes Gewächs zu dicht standen. Sie wagte sich nicht weiter. Ihre Augen suchten ein Versteck, und schließlich entschied sie sich, einen der dickeren Stämme zu erklettern. Erstens erhoffte sie sich davon, einer Bedrohung am Boden zu entgehen, zweitens einen besseren Überblick und drittens die Aussicht auf ein Nest voller Eier. Sie wollte gerade das Schwert in die Halterung zurückschieben, als ihr Magen erneut – und vor allem unangenehm laut – knurrte.
Verdammt, ruhig jetzt, dachte sie und wartete zwei weitere Minuten. Als sich nichts tat, begann sie mit der Kletterei. Sie packte dicke hellgrüne Lianen, vermied die älteren, dunkelgrünen. Noch ein Tipp des Doktors. Die jungen Lianen raschelten nicht und so zog sie sich zügig in eine Höhe von acht oder neun Metern. Sie machte es sich in einer Gabelung aus drei dicken Ästen einigermaßen bequem und hielt erneut inne. Ein Blick nach oben zeigte leere Wipfel, kein Flugaffennest oder anderes Viehzeug. Allerdings sah sie zwei Meter über sich eine sehr runde Blattgruppe. Das könnte ein Nest mit Eiern sein. Als hätte ihr Magen den Gedanken verstanden, meldete er sich zum dritten Mal und Bérénice verfluchte sich selbst, dass sie so lange gewartet hatte, etwas Essbares zu finden. Jetzt konnte das Knurren sie verraten. Wer oder was auch immer dort unten herumschlich, konnte vielleicht so gute Ohren haben, dass es ihm möglich war, ihren Magen zu hören. Bérénice sammelte Speichel, bis ihr Mund voll war, und schluckte dann hinunter. Sie hoffte, das würde den Magen für den Moment stillhalten. Sie probierte es ein zweites Mal, brachte aber nichts mehr zusammen und gab es auf. Allerdings schien es funktioniert zu haben. Der Magen blieb so ruhig wie der Dschungel um sie herum.
Ihre Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt und die scheinbar bequeme Haltung stellte sich zunehmend als nicht optimal heraus. Zumindest ein Fuß war ihr eingeschlafen und gefühllos. Wenn sie jetzt kämpfen oder flüchten müsste, hätte sie eindeutig ein Problem. Sie war gerade versucht, den tauben Fuß zu bewegen, als sich etwas am Boden tat. Sie sah vage die Bewegung aus einem Augenwinkel, bevor sie auch nur ein Geräusch vernommen hatte.
Meine Fresse, das nenne ich lautlos.
Sie schmiegte sich in Zeitlupentempo näher an den Stamm und lugte mit einem Auge um ihn herum.
Ein Sambolli, durchzuckte sie es und beinahe hätte sie einen Überraschungslaut ausgestoßen. Doch die Spacetrooperin kniff die Lippen zusammen. Irgendwie sah der Sambolli anders aus als die Kerle, die sie im Gefangenenlager gesehen hatte. Er stand auf seinen zwei langen Beinen, die ungemein muskulös waren, was ihm eine enorme Geschwindigkeit beim Rennen ermöglichte. Ein Mensch hatte keine Chance, einen Sambolli im Wettlauf zu schlagen. Die Taille war dünner als bei einem Magermodel, die zurzeit wieder in Mode kamen, auch wenn Bérénice dies für Schwachsinn hielt. Der Sambolli schräg unter ihr am Dschungelboden würde in diesem Punkt jeden Schönheitswettbewerb gewinnen. Den Brustkorb formte ein überdimensioniertes Dreieck mit drei riesigen Brustmuskeln. Bérénice Savoy wusste, dass sich unter dem Mittleren die Herzgruppe verbarg, tief eingebettet in steinharte Muskelmasse. Auf einem zwanzig Zentimeter langen Hals saß ein wiederum dreieckiger Kopf, in dem drei Augen waagrecht angeordnet waren. Die beiden Äußeren standen weit am Rand des Gesichtes des Sambolli, sodass dessen Blickfeld atemberaubend groß sein musste. Leider hatte Trooper Savoy bei einer entsprechenden Instruktion vor der Landung auf Samboll nicht besonders aufmerksam zugehört. Es genügte ihr jedoch zu wissen, dass das Wesen unter ihr fast hinter sich blicken konnte. Sich also von hinten an einen Sambolli anzuschleichen, war keine gute Idee. Die Haut – soweit man das wegen der Kleidung und Ausrüstung sehen konnte – war glatt, fast wie bei einer Schlange, allerdings hatten die Sambolli keine Schuppen. Sie regelten ihre Körpertemperatur über eine Vielzahl von kleinen und kleinsten Schlitzen in der Haut, die sich regelmäßig öffneten und schlossen. Das dabei austretende Sekret war deutlich dicker als menschlicher Schweiß und verhinderte im Nahkampf, dass man einen Sambolli fest zu packen bekam.
Ein hervorragender Vorteil, grummelte die Frau im Baum stumm in sich hinein. Also Ringkampf fällt auch aus.
Jetzt, da der Einheimische unter ihr sichtlich entspannt oder zumindest ruhig war, zeigten sich nur sehr wenige Schlitze in verhaltener Aktivität. Strengte sich ein Sambolli an oder war er aufgeregt, war dies völlig anders. Sicherlich auch ein Überbleibsel der Evolution aus primitiveren Tagen, in denen die Sambolli noch keine Kleidung oder moderne Waffen entwickelt hatten.
Die Haare des Wesens glichen schlanken, langen Blättern, auch wenn sie die Farbe von Haselnüssen hatten. Die Haut zeigte ein angenehmes Braun wie gedunkeltes Kiefernholz, in den Achseln und Kehlungen der Arm- und Fußbeugen mit noch dunkleren Schattierungen. Ältere Sambolli, so wusste Bérénice, zeigten blassere und grauere Bräunungen, die bis zum natürlichen Tod nachdunkelten. Allerdings hatte Bérénice noch nie einen toten Sambolli gesehen. Diesen Teil der Instruktion hatte sie jedoch noch sehr deutlich im Gedächtnis. Im Lager hätte sich jeder den Anblick eines toten Sambolli gewünscht.
Die Kleidung – jetzt fiel Bérénice auf, was ihr an diesem Sambolli so anders vorkam – hatte eine gewisse Lockerheit, die sie von den militärischen Kleidungen ihrer Bewacher nicht kannte. Auch das Ding, das er in seinen beiden kräftigen Armen hielt, war keine Militärwaffe, sondern sah eher … privat aus.
Ein Jäger … ein Sportschütze?Ist das möglich? So nahe am Lager? Sie konnte noch keine zwanzig Kilometer weit gekommen sein. War es denkbar, dass sich die Sambolli mit der Jagd als Freizeitbeschäftigung befassten? Warum nicht?
Spacetrooper Bérénice Savoy überlegte fieberhaft. Sollte sie das unverschämte Glück haben, auf einen Zivilisten gestoßen zu sein, der nicht sie, sondern irgendein Viehzeug jagte? Und wenn ja: War er allein oder Teil einer Jagdgemeinschaft? Und wie war er hierhergekommen? Sicherlich nicht zu Fuß, denn die nächste Ansiedlung oder Stadt musste Hunderte von Kilometern entfernt liegen, schließlich waren sie mit dem Gefangenentransport stundenlang geflogen. In gemächlichem Tempo, aber eben sehr lange.
Also hat er oder haben sie ein Fahrzeug! Diese Erkenntnis vertiefte ihr Gefühl, an einen glücklichen Zufall zu glauben. Was jagt der Kerl überhaupt? Sie hatte den Gedanken noch im Kopf schwirren, als sie eine weitere Bewegung, weit entfernt im Dickicht der Bäume, wahrnahm. Doch es war nicht die Beute, sondern ein zweiter Sambolli, und direkt neben diesem schob sich langsam aus dem Blattgewirr ein Dritter. Beide nickten dem Ersten zu und entfernten sich unglaublich langsam voneinander.
Sie teilen sich, um dem Jäger aus zwei Positionen Deckung geben zu können, durchfuhr es Bérénice und sie verfolgte gespannt die Bewegungen der beiden. Der Erste stand unverändert still, nur seine Augen waren hellwach. Die Frau betete darum, dass er nicht zu ihr nach oben blickte. Auf diese kurze Distanz musste er sie sofort sehen. Allerdings blieben seine Augen parallel zum Boden gerichtet. Die beiden anderen Sambolli schienen ihre Ziele erreicht zu haben und hielten an. Die Läufe ihrer Waffen hatten sie die ganze Zeit waagrecht gehalten, nun schwenkten sie ein paar Grad nach oben.
Sie jagen ein Bodentier, und zwar ein großes!
In diesem Moment gab ihr Magen ein langes, fürchterlich lautes Knarren von sich und Bérénice wäre vor Schreck fast vom Baum gefallen. Der Sambolli unter ihr hatte es natürlich gehört und sein Kopf zuckte in ihre Richtung. Doch bevor er auch nur einen Laut von sich geben konnte, wurde die Stille des Dschungels in einer Art und Weise unterbrochen, wie es sich die Menschenfrau nicht hätte vorstellen können.
Ein Ungetüm mit der unerfreulichen Größe von drei Metern bis zur Schulter, der Brustbreite eines ausgewachsenen Elefanten und Beinen, die an dorische Säulen erinnerten, brach durch die Blätterwand der dicht beieinanderstehenden Bäume. Dass es dabei kleine bis mittlere Bäume niederwalzte, störte seinen Lauf nicht im Geringsten. Das Vieh stieß ein Röhren aus, welches einem Ozeandampfer alle Ehre gemacht hätte, gefolgt von einem wütenden Gurgeln. Was das Tier so wütend gemacht hatte, sah Bérénice erst, als es vollständig sichtbar war: In einer Körperseite steckten mehrere kurze Stacheln, die, so wie sie jetzt beobachten konnte, aus den seltsamen Waffen der Sambolli stammten. Die beiden Partner des Jägers schossen einen Stachel nach dem anderen aus ihren harpunenähnlichen Geräten, doch das Monstrum zeigte sich davon völlig unbeeindruckt. Umso mehr war Bérénice vom Verhalten des ersten Jägers beeindruckt. Er hatte sie vielleicht gesehen, ignorierte sie jetzt aber oder wollte sich zuerst seiner Beute widmen. Er blieb einfach stehen und ließ das Tier auf sich zu rennen. Auch er hob zwar seine Waffe, schoss damit aber nicht. Jetzt begriff Bérénice.
Er spielt den Lockvogel! Das Vieh ist so auf den sichtbaren Gegner fixiert, dass es die beiden seitlichen Schützen gar nicht wahrnimmt. Bérénice beugte sich ein wenig vor, um das Geschehen weiter verfolgen zu können, das jetzt teilweise durch den dicken Baumstamm verdeckt wurde, hinter dem sie sich verbarg. Und wieder ließ sich der Sambolli von ihr ablenken. Vielleicht lag es daran, dass er in seiner Konzentration auf die Jagdtrophäe nicht mit dem Anblick eines ihm möglicherweise unbekannten Lebewesens gerechnet hatte. Schließlich war dies seine Jagd, sein Dschungel, sein Planet! Vielleicht war er aber auch nur ein schlechter Jäger, mutig, aber unerfahren. Seine beiden Kameraden schienen zu bemerken, dass etwas nicht stimmte, und schossen mit aufflammender Panik einen Stachel nach dem anderen in die Flanken der anstürmenden Bestie.
Doch es half nichts.
Das Tier ließ sich allein dadurch nicht aufhalten. Bérénice vermutete, dass die beiden auf irgendeine Aktion des Ersten gewartet hatten, die nun nicht kam, weil sie ihn abgelenkt hatte. Sollte er eine bestimmte todbringende Stelle mit seiner Waffe treffen, sollte er mit seinen kräftigen Beinen hoch in die Luft springen; sie wusste es nicht. Ihr Magenknurren hatte er zwar gehört, sie aber nicht gesehen. Ihre Bewegung hatte sie zum Teil aus ihrer Deckung gebracht, und das hatte er gesehen. Er musste völlig überrascht und eventuell sogar verwirrt worden sein.
Auf jeden Fall kam seine Reaktion jetzt zu spät. Das Tier war heran und tat, was es von Anfang an hatte tun wollen: Es walzte mit seinem Körper auf den Sambolli zu, rammte ihn, stemmte sich mit allen Säulenbeinen tief in den Dschungelboden, um seinen Schwung abzubremsen, und ruckte augenblicklich herum. Der am Boden liegende Jäger hatte keine Chance mehr zu einem eigenen Schuss. Seine beiden Partner schossen nun mit aller Verzweiflung Stachel auf Stachel, jetzt auch in den Kopf des Tieres, was sie vorher tunlichst vermieden hatten. Bérénices Gedanken wirbelten wie verrückt. Sicher wäre dies die Trophäe gewesen. Der Kopf des Monsters. Nun krümmte sich der erste Jäger am Boden, vermutlich schwer vom Stoß des Tieres verletzt und kroch – ein verdrehtes Bein hinter sich her schleifend – auf die Waffe zu, welche ihm aus den Händen gefallen war. Er würde sie nicht mehr erreichen. Das Tier war zurück und begann nun auf dem Jäger herumzutrampeln, der sich schon nach dem ersten Tritt nicht mehr rührte.
Das ist meine Chance, erkannte Bérénice und ließ sich aus der Gabelung fallen. Als sie auf den Boden auftraf, rollte sie sich geschickt ab und zog im Aufschwung das Katana aus der Rückenscheide. Mit rasenden Schritten – die tausend Ameisen im linken, gehemmten Fuß zähneknirschend unterdrückend – eilte sie auf einen der beiden Sambolli zu. Der war viel zu überrascht, um auch nur zu begreifen, was da auf ihn zukam. Sein Blick – und seine Waffe – schwenkten zwischen dem Tier und dem neuen Gegner hin und her. Seine Unentschlossenheit kostete ihn das Leben. Bérénice versuchte gar nicht erst, das Herz in der Körpermitte zu durchstoßen. Schließlich verfügte sie nicht über ein echtes japanisches Katana, sondern nur um eine primitive Ausgabe davon. Diese genügte aber immerhin, um den Kopf des Sambolli mit einem blitzartigen, sauberen Schnitt vom dünnen Hals zu trennen. Der Körper stand noch, als Bérénice wie eine Furie auf den letzten Gegner zuschoss.
Doch dieser hatte sich von seinem Schreck erholt. Sein erster Partner war nur noch braunroter Matsch in einer ständig tiefer werdenden Mulde, in der sich das Untier immer noch austobte. Aus dessen Körper ragten mittlerweile mindestens vierzig bis fünfzig Stacheln, die es töten mussten. Aber die Raserei des Tieres verhinderte, dass es selbst begriff, dass es tödlich getroffen war. Der letzte Sambolli hatte seinen zweiten Partner fallen sehen; in zwei Teilen. Er verstand, dass momentan nicht das Tier, sondern dieses dunkelhäutige Geschöpf mit dem Schwert die gefährlichste Bedrohung in diesem Teil des Dschungels darstellte. Er wollte seine Waffe auf Bérénice richten und schaffte es auch. Aber im Magazin des Stachlers war kein einziges Projektil mehr. Im gleichen Augenblick, als die Betätigung des Abzuges ein leises Klicken erzeugte, war Bérénice heran und schlug ihm den rechten Arm von schräg unten nach oben ab. Mit einem senkrechten Hieb hackte sie den Schädel und den langen Hals entzwei. Erst als sie auf die Schulterknochen und das Muskelpaket des Brustkorbs traf, drang ihr Schwert nicht weiter ein.
Mit einem wütenden Ruck zog sie die blutverschmierte Klinge aus dem Brustansatz und rollte sich weiter weg von dem waidwunden Tier. Mit keuchendem Atem und zitternden Beinen beobachtete Bérénice Savoy, wie die Kraft der Bestie erlahmte, sie nach zwei, drei letzten schwachen Tritten innehielt und nach einer quälend langen Pause seitlich wegkippte. Eine Gruppe von Beinmuskeln ließ den ganzen Körper mit einem Zitteranfall erschauern, dann lag er still. Die Kreatur lebte noch, hatte aber mit ihrem primitiven Gehirn nun vielleicht endlich verstanden, dass es keine Gegner mehr gab und ihr eigenes Leben zu Ende ging. Sie atmete schwer, durchzogen von nass klingenden Gurgellauten, die Abstände von Mal zu Mal länger werdend. Der letzte Atemzug zischte wie aus einem defekten Luftballon, dünn und lang gezogen, dann lag sie tot in der Mulde, die sie in ihrer Raserei selbst geschaffen hatte.
Bérénice konnte es nicht glauben: Sie hatte es überlebt. Drei tote Sambolli, ein riesiges Monster ebenso, von dem weder sie noch irgendein anderer Mensch je gehört hatten. Der Dschungel hielt wieder den Atem an, scheinbar traute sich keines der anderen Tiere, einen Mucks von sich zu geben. Wie lange hatte der Kampf gedauert? Drei, vier, höchstens fünf Minuten. Sie fühlte sich, als wären es zwei Stunden gewesen. Ihre seitliche Wunde war wieder aufgeplatzt und rotes Blut zierte die Fetzen ihres Gefangenenanzuges mit frischer Farbe. Sie wusste, dass sich die Stille nicht lange halten würde. Spätestens dann, wenn der Leichengeruch der vier Lebewesen – seltsam in diesem Zustand noch von Lebewesen zu sprechen – zu verführerisch wurde, würde sich ein Wettlauf um die besten Brocken erheben. Die Versuchung, sich selbst von dem riesigen Kadaver das Lendenstück herauszuschneiden, war übergroß. Doch sie hörte schon Dr. Muramasa schimpfen, wenn sie sich auch nur ein Fitzelchen davon holte. Also ließ sie es.
Sie riss sich zusammen, unterdrückte den Schmerz der wieder aufgebrochenen Seite und kletterte ihren Baum erneut hoch, zielstrebig das mutmaßliche Nest vor Augen. Wie zur Belohnung lagen fünf faustgroße Eier darin. Drei stach sie mit der Spitze ihres Katanas an und schlürfte begierig den Inhalt, die beiden anderen verstaute sie tief im Paket ihrer Essigblätter.
Sie wollte sich schon wieder auf den Weg nach unten machen, als der Dschungel erwachte. Die Bilder und Geräusche, die sie in den nächsten Stunden zu sehen und zu hören bekam, sollte sie so schnell nicht wieder vergessen. Es war ihr unmöglich, die Vielzahl der Aasfresser zu bestimmen, die sich über den gedeckten Tisch vor ihr am Boden hermachten. Reißen, Kauen und Schlucken waren noch die angenehmsten Geräusche, die sie vernahm. Nach wenigen Minuten sah sie nicht mehr hin, was sich da alles an der Beute gütlich tat. Sie wollte die beiden verbliebenen Eier essen, aber ihr verging der Appetit bei dem schrecklichen Gelage unter ihr. Also verlegte sie sich auf die Wundpflege und die Beobachtung des Wipfels über ihr. Sie machte es sich diesmal wirklich bequem und war nach einer halben Stunde trotz anderen Vorhabens wieder eingeschlafen.
Trooper Savoy erwachte ohne Anlass und bemerkte als erstes das Fehlen von Schmatz- und Kaugeräuschen, als zweites die erfreuliche Tatsache, dass die Eltern der von ihr verspeisten Eier nicht sie verspeist hatten, was gut hätte passieren können. Vielleicht hatte ja die Ansammlung der Bodenräuber die Flugtiere von einer Landung in ihrem Nest abgehalten. Was wusste sie schon von samboll´scher Fauna?
Bérénice richtete sich auf und betrachtete das Schlachtfeld am Boden. Fein säuberlich abgenagt lagen dort vier Skelette, ein riesengroßes und drei kleinere. Sie packte die wenigen Sachen zusammen, die sie besaß und stieg mit gespitzten Ohren nach unten. Es war nicht ausgeschlossen, dass die Horde der Aasfresser auch Raubtiere anlockte, welche sich von ihnen ernährten. Doch sie hörte nur das mittlerweile vertraute allgemeine Crescendo des Dschungels.
Zuerst das Praktische, dachte Bérénice und nahm eine der Sambolli-Waffen auf. Sie drehte sie vorsichtig nach allen Seiten und konnte nichts Außergewöhnliches an ihr finden. Im Grunde bestand sie wie eine irdische Harpune aus einem langen Schaft, an den eine Spannvorrichtung angebracht war. Dazu ein Auslöser, ein Schulterstück, eine primitive Zielvorrichtung, die eine verteufelte Ähnlichkeit mit Kimme und Korn aufwies, und einen kleinen Sicherungshebel, sodass der Schütze nicht ungewollt einen Stachel abfeuerte. Der deutlichste Unterschied zu einer irdischen Harpune war das Magazin, das parallel zum Schaft knapp darunter angebracht war. Es ließ sich rasch öffnen und fasste – nach den Einrastungen abgezählt – 37 Stachel. Bérénice zählte zweimal nach, es blieb bei 37 Stück.
Nun ja, die Sambolli müssen ja nicht unbedingt das Dezimalsystem kennen, und wenn doch, hat die Zahl der Stachel vielleicht einen ganz anderen Grund, überlegte sie und sammelte dabei alle Projektile, die sie finden konnte. Auch die, welche in dem Monster gesteckt hatten. Nebst den blitzblanken Knochen lagen die Stacheln ebenso sauber im Skelett der Bestie. Sie vermied es dabei, die Spitzen zu berühren, glaubte zwar nicht, dass diese vergiftet sein könnten – sonst wäre das Vieh wahrscheinlich viel eher tot gewesen –, aber sicher war sicher. Als sie ihre Sammlung beendet hatte, wurde ihr ein weiterer Vorteil der Waffe klar: Sie war erstens fast lautlos und zweitens vor allem nicht energetisch; das hieß, sie konnte auch nicht angepeilt werden. Bérénice lächelte zufrieden. Also würde sie das zusätzliche Gewicht nur zu gerne tragen. Neben ihrem Katana als Nahwaffe besaß sie nun eine ebenso nicht energetische Fernwaffe. Ohne Skrupel steckte sie eine Handvoll kleinerer Knochen in den Sack.
Dann blickte sie sich weiter um und ging den ganzen Kampfplatz systematisch ab. Sie wusste eigentlich gar nicht, was sie suchte, aber als sie es sah, tätschelte sie sich in Gedanken selbst die Schulter.