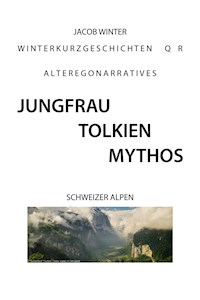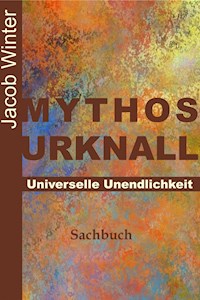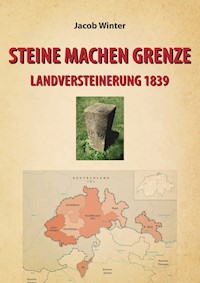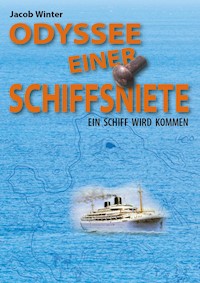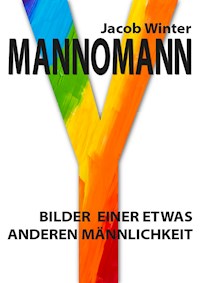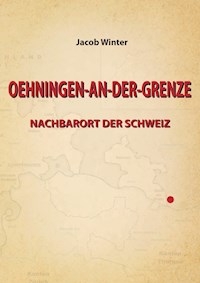
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
OEHNINGEN – AN – DER – GRENZE ist ein spannendes, vielfach illustriertes Sachbuch über die enge Verflechtung der Höri-Grossgemeinde Öhningen mit der angrenzenden Schweiz. Und hier ganz besonders mit dem angrenzenden, touristischen Nachbarort Stein am Rhein. Jacob Winter rückt auf seiner "etwas anderen" Entdeckungsreise die speziellen Besonderheiten dieser hochinteressanten Bodenseeregion in in den Fokus und geht dabei nicht nur ein auf die Ortsteile Öhningen am Stift, Wangen am Untersee und Schienen hoch auf dem Schienerberg, sondern vor allem auch auf die diversen Grenzübergänge und Grenzsteine mit ihrer unglaublichen Existenz seit 1839. Diese unverwüstlichen, steinenen Zeitzeugen begleiten das engmaschige Zusammenleben der beiden so unterschiedlichen Gemeinwesen auf der jeweils anderen Seite der Grenze nun schon seit mehr als 180 Jahren. Und wie dies alles urplötzlich unterbrochen werden kann, haben Anfang 2020 die unerwarteten Corona – Grenzsperrungen bewiesen: "rien ne va plus"! Jacob Winter hat sich viele Mühe gegeben das alles sichtbar zu machen und würde sich freuen, wenn dieses hochintessante Panorama einer wahrlich einmaligen Grenzregion Ihr Interesse finden würde. Natur und Kultur kommen hier in ganz besonderer Art und Weise zusammen und das darf in dieser schnelllebigen Zeit auch mal besonders herausgestellt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OEHNINGEN-AN-DER-GRENZE
NACHBARORT DER SCHWEIZ
KREIS KONSTANZ MIT ÖHNINGEN SOWIE HALBINSELN HÖRI UND BODANRÜCK
HALBINSEL HÖRI MIT ÖHNINGEN UND WANGEN OBEN LINKS HEMMENHOFEN MITTE LINKS UND GAIENHOFEN MITTE VORN
Copyright: Jacob Winter 2020
Titel und Cover: Winter Publishing
Kontakt: [email protected]
epubli Verlag, Berlin
Jacob Winter wurde Ende der Dreissigerjahre im niederländischen Hafenstädtchen Vlissingen geboren. Er hat viele Jahre in den Niederlanden, in der Schweiz und in Deutschland gelebt, ist seit 2018 am Bodensee wohnhaft und vielfach publizistisch tätig.
NB: Trotz intensiver Recherche war es nicht in allen Fällen möglich, die Rechtsinhaber der Bilder und Videos ausfindig zu machen. Berechtigte Ansprüche werden selbstverständlich im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
GROSSGEMEINDE ÖHNINGEN
NACHBARORT DER SCHWEIZ
Zum Ortsteil Öhningen an sich mit dem von weitem sichtbaren Augustiner Chorherrenstift gehören am Untersee noch die Weiler Stiegen und Kattenholz: 1974 kamen die bis dahin selbständigen Dörfer Wangen und Schienen noch dazu: Die heutige Grossgemeinde Öhningen besteht in der Folge aus den Ortsteilen Öhningen, Wangen und Schienen. und grenzt auf der westlichen Landseite an die Schweizer Ortschaften Stein am Rhein und Hemishofen im Kanton Schaffhausen („Ramsener Zipfel“). Am südlichen Untersee grenzt Öhningen an die Schweizer Ortschaften Eschenz, Mammern und Steckborn, alle im Kanton Thurgau – die Landesgrenze verläuft hier in der Mitte des Untersees.
Die Grossgemeinde Öhningen mit etwa 3‘700 Einwohnern und 2818 ha Fläche Grundgebiet ist angesiedelt auf der Halbinsel Höri im Landkreis Konstanz innerhalb des Bundeslandes Baden-Württemberg. Der Ortsteil Öhningen als solcher wurde erstmals als Oningas 788 in einer Schenkungsurkunde des Klosters St. Gallen erwähnt. Der Schenker Iringus übereignete „zum Heil seiner Seele“ seinen Besitz dem Kloster St. Gallen:
Ego in Dei nomen Iringus, dono ad praedicto casa Dei, donatumque permaneat, hoc est in pago Hegausense, in locis nuncupantibus Vuictartingas), feu et in Oningas, b) quicquid …
Aus www.leo-bw.de: 788 Oninga, von Personenname Ono. Frühmittelalterliche Siedlung mit Ortsgräberfeld des 7./8. Jahrhundert östlich des Dorfes. Besitz des Klosters St. Gallen. Später nicht mehr nachweisbar. Vermutlich konfisziertes alemannisches Herzogsgut. Im 10. Jahrhundert im Besitz des Graf Kuno von Öhningen. Öhningen gehörte zum Dotationsgut des dortigen Klosters. Niedergerichtsrechte bis 1535 bei diesem, dann durch bischöfliche Vögte wahrgenommen. Steuer, seit 1622 auch Frevelgericht und Forst als Pfand, seit 1739 als Lehen beim Bischof. Anfall an Baden 1803, im gleichen Jahr zum Amt Bohlingen. 1810-1872 dem Bezirksamt Radolfzell unterstellt, dann Bezirksamt/Landkreis Konstanz.
Das „Historisches Lexikon der Schweiz“ HLS sagt dazu: Das Stift Öhningen liegt auf einer Anhöhe oberhalb des Untersees in der Nähe zum Rheinübergang bei Stein und wurde möglicherweise an der Stelle eines älteren Adelssitzes gegründet. Die Urkunde, in der Kaiser Otto I. (936-973) im Jahr 965 die Stiftung Öhningens und den zugehörigen Besitz bestätigte, ist wahrscheinlich in allen Teilen eine Fälschung des letzten Drittels des 12. Jahrhunderts. Nach diesem unechten Gründungsprivileg hatte Kuno von Öhningen mit Zustimmung seiner Frau Richlind und seiner vier Söhne das Stift kurz zuvor gegründet. Bereits die Gestalt des vermeintlichen Stifters hat für eine noch andauernde Forschungskontroverse gesorgt. Einigkeit besteht lediglich darin, dass Kuno als ein Mitglied des konradinischen Familienverbands anzusehen ist und dass er eine enge Beziehung zum Rheinauer Stifterverband besaß. Die Forschung tendiert des Weiteren dazu, Kuno mit dem von Otto II. (973-983) eingesetzten Herzog Konrad von Schwaben (982-997) gleichzusetzen sowie Richlind als Enkelin Ottos I. genealogisch einzuordnen.
ENGE VEFLECHTUNG VON ÖHNINGEN UND STEIN AM RHEIN
Luftbild von Stein am Rhein vorne und Öhningen links oben mit „Zollamt Öhningen“ – gut erkennbar sind auch „Hotel Grenzstein“ und „Campingplatz Grenzstein“.
Die strategisch günstige Lage des Rheinübergangs aus dem Bodensee in den Hochrhein hat bereits die Römer Ende des 2. Jahrhunderts veranlasst in unmittelbarer Nähe Öhningens eine Rheinbrücke von Eschenz (Tasgetium) über die Insel Werd ans nördliche Ufer zu errichten. Das Bauwerk bestand zwischen Eschenz und der Insel Werd aus einer 217 Meter langen Pfahljochbrücke, bei einem Jochabstand von 15 Metern und einer Breite von 6,4 Metern. Unter jedem Joch wurden zehn Holzpfähle mit 30 bis 45 Zentimetern Durchmesser in die Flusssohle gerammt. Die anschließende nördliche Brücke zwischen der Insel Werd und Arach (auf Höhe CH-Pontonierstraße) wies eine Länge von 220 Metern auf. Da in einem Abschnitt mit einer Länge von 74 Metern keine Pfahlreste gefunden wurden, wird angenommen, dass dort eine Schiffsbrücke vorhanden war.
Bereits Ende des 3. Jahrhunderts entstand im Schutze des Kastellums Tasgetium stromaufwärts, in der Nähe des heutigen Übergangs, eine neue, vermutlich steinerne Brücke: Unter dem Kloster St. Georgen auf der rechten Rheinseite wurden bei Grabungsarbeiten die Fundamente zu einem Brückenkopf gefunden, der der Sicherung des Rheinübergangs diente. Die erste Rheinbrücke an der engsten Stelle des Rheins zwischen Stein am Rhein und dem dazugehörigen Ortsteil „Stein am Rhein vor der Brück“ war übrigens eine seitens des Abtes des Klosters Sankt Georgen urkundlich belegte Holzbrücke aus dem Jahre 1267. Als offener Holzsteg, der auf etwa zehn Pfahljochen ruhte, und einspurig befahrbar war musste dieser Übergang im Laufe der Zeit mehrfach wiederaufgebaut werden. (Wikipedia entnommen)
Merian-Stich der Rheinbrücke im Jahre 1642rechts Insel Werd und Grenzstein ÖhningenStein am Rhein wird hier von Merian mit seinem lateinischen Namen STENIUM ad Rhenum bezeichnet.
Reich ausgestattete Gräber aus dem 7. und 8. Jh. weisen den Ortsteil Öhningen als eine frühe Alemannensiedlung aus. Die Gründung eins Klosters im Jahre 965 durch einen Grafen Kuno, der inzwischen als Herzog Konrad der I von Schwaben (982-997) identifiziert werden konnte, ist wie gesagt zwar mehr oder weniger überliefert aber konnte bis heute nicht eindeutig bewiesen werden. Beim derzeitigen Umbau des Augustiner Chorherrenstifs gab es bei den Erdarbeiten immerhin interessante archäologische Funde zu verzeichnen.
Zur Ausstattung des Öhninger Klosters gehörten auch Besitzungen und Rechte in Orten der heutigen Schweiz, insbesondere im Kanton Schaffhausen. Kaiser Heinrich VI. übertrug 1191 die Schirmvogtei über Öhningen dem Bischoff. von Konstanz und 1535 gelang diesem gar die Eingliederung des Augustiner Chorherrenstiftes. In der französischen Zeit wurde diese Zuständigkeit 1803 wieder aufgehoben. Zahlreiche Verträge zwischen Öhningen. und der Stadt Stein am Rhein regeln den Handel, die Schifffahrt auf Bodensee und Rhein und das Fischereiwesen. Öhningen besitzt 42 ha Wald auf dem Gemeindegebiet von Stein am Rhein und diese 34 ha Wald auf dem Gemeindegebiet von Öhningen.
Die enge Verflechtung zwischen beiden Ortschaften wird gut dokumentiert durch die Tatsache, dass seit 1911 die Stromversorgung von Öhningen durch das „Elektrizitätswerk des Kantons. Schaffhausen“ (EWS) erfolgt. Und sich Im “Abwasserverband Stein am Rhein und Umgebung” (2005) die CH-Gemeinden Stein am Rhein, Hemishofen, Eschenz, Mammern, Wagenhausen mit Öhningen auf unbestimmte Dauer zu einem Zweckverband mit gemeinsamer Abwasserreinigungsanlage ARA in Stein am Rhein zusammengeschlossen haben.
Anlegestelle Öhningen als Zoll-Landeplatz
CH-Fahrgastschiff MS Thurgau am Hochrhein
Aber auch dadurch, dass die „Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG“ (URh) mit Sitz in der Stadt Schaffhausen täglich von Mitte April bis Ende Oktober einen fahrplanmässigen Schiffsverkehr auf dem Hochrhein und dem Untersee zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen (www.ur.ch) betreibt, deren Schiffe u.a. auch in Öhningen und Wangen anlegen. Die Fahrkarten sind auf den Schiffen erhältlich. allerdings zu den wesentlich höheren Schweizer Preisen – für die es jedoch wiederum etliche Vergünstigungsmöglichkeiten gibt Seit die Schweiz am 12.12.2008 gleichfalls Mitglied des Schengenraums geworden ist, gibt es ähnlich wie bei den EU-Staaten keine Personenkontrollen mehr. Die Schweiz hat 2005 – mittels knappem Volksentscheid – die systematischen Personenkontrollen an den Grenzen zu ihren Nachbarländern eingestellt, wobei die Zollbestimmungen für u.a. Zigaretten oder Spirituosen jedoch unverändert blieben.
Wofür es allerdings auch wieder recht großzügige Ausnahmeregelungen in beide Richtungen gibt. Zudem bekommen die Schweizer nach Abstempelung ihrer Einkaufsquittungen vom deutschen Zollamt zudem die deutsche Mehrwertsteuer erstattet – ein zusätzliches gutes Geschäft angesichts des für Schweizer Verhältnisse doch recht niedrigen EU-Preisniveaus. Manche deutsche Supermärkte sind geradezu angewiesen auf ihre Schweizer Kundschaft.
Als Folge der Corona-Pandemie mussten Mitte März 2020 der Hauptgrenzübergang an der Oehningerstraße und der Nebengrenzübergang an der Pontonierstraße jedoch wieder mit Betonpollern blockiert werden – tant pis! Und dies natürlich nicht nur zum Leidwesen des Öhninger Lidl-Marktes an der Höristraße, wo normalerweise die Parkplätze vollgestellt sind mit Autos mit Schweizer Kennzeichen (wie SH/TU/ ZH).
Sondern auch zum Leidwesen vieler Einwohner Öhningens bzw. der Höri, die jetzt die kurze Durchfahrt über Schweizer Gebiet nach Rielasingen/Singen nicht mehr nutzen können und weite Umwege über den kurvigen Schienerberg bzw. die genauso kurvige Untersee-Strecke quer durch die Dörfer machen müssen. Ein erneuter Beweis dafür wie eng Öhningen mit Stein am Rhein verflochten ist.
Denn es darf hierbei nicht vergessen werden dass täglich bis zu 800 Grenzgänger diesen unauffälligen Grenzübergang zwischen Öhningen und Stein am Rhein passieren, sei es weil sie in der Schweiz arbeiten oder auch umgekehrt aber auch wenn sie Gebrauch machen wollen – wie der Autor – vom sehr gut ausgebauten schweizerischen SBB-Eisenbahnnetz (Bahnhof in“ Stein am Rhein vor der Brugg“) mit Verbindungen in alle Richtungen, u.a. auch zum Flughafen Kloten oder zu touristischen (Alpen-)Destinationen. Die nachfolgende Verkehrsverbund-Karte gibt ein wunderbares Bild der vielen gut ausgebauten und vor allem pünktlichen Bahnverbindungen in der Schweiz- und dies ab Stein Rhein in unmittelbarer Nähe.
Bahnnetz Schweiz
Hier zur weiteren Ohningen-Information das Nachbarstädtchen Stein am Rhein mit seinen 3414 Einwohnern (Ende 2018) zu beschreiben, wäre allerdings wie Eulen nach Athen zu tragen: Es wimmelt nur so von solchen, wahrlich hochinteressanten Infoseiten wie tourismus.steinamrhein.ch, www.steinamrhein.ch, www.myswitzerland.com, die alle mit tollem Bildermaterial und Spezialinfos ausgestattet sind. Auch das „Tourismus Stein am Rhein“-Büro in wunderbaren, alten Räumlichkeiten kann sich sehen lassen.
Das mittelalterliche Stein am Rhein (im Ortsdialekt „Staa“) lebt nicht zuletzt vom vor allem im Sommer unermüdlichen Tagestourismus, die Touristen aus aller Welt werden in darauf spezialisierten Reisebussen herantransportiert und sind oft mit asiatischen Touristen in Gruppenstärke besetzt. Ebenso können der Weinanbau und das Angebot an hoch spezialisierten Kleinläden und Restaurants sich blicken lassen. Das Städtchen verfügt mit dem „Riipark Stein am Rhein“ (hier heisst der Rhein auf Schwizerdütsch somit Rii) auch über eine wunderbare Freizeitanlage am Wasser, wo man im Rhein bequem baden kann und es zudem einen Springturm gibt, recht weit weg vom Ufer.
ETWAS STADTGESCHICHTE
Das älteste Stadtrecht Steins stammt aus dem Jahr 1385. Am 22. Januar 1457 gelang es den Stadtbehörden, die Vogteirechte von den Klingenberg zu erwerben und so den Status der Reichsfreiheit zu erlangen. 1459 verbündete sich Stein mit Zürich und Schaffhausen, um sich vor Übergriffen der Habsburger zu schützen. 1468 gab sich die Stadtgemeinde eine Verfassung mit Bürgermeister, Räten, Reichsvogt (Hohes Gericht) und Schultheissen (Niederes Gericht). Die Zünfte hatten keine direkte politische Mitsprache. Stein erwarb bis ins 16. Jahrhundert im Umland ein kleines Untertanengebiet; bestehend aus Hemishofen, Ramsen, Bibern und Wagenhausen.
Am 29. September 1484 begab sich Stein aus finanziellen und politischen Gründen unter die Schutzherrschaft Zürichs und kam so zur Eidgenossenschaft. Es gelang der Stadt infolgedessen nicht, die Schirmherrschaft über das Kloster St. Georgen zu erwerben, da Zürich ihr zuvorkam. Nach der Aufhebung des Stifts in der Reformation baute Zürich als Rechtsnachfolger des Klosters schrittweise seine Landesherrschaft über Stein auf. Die Zugehörigkeit zu Zürich endete in der Helvetik, als Stein im Mai 1798 an Schaffhausen angeschlossen wurde. Zwar versuchte Stein 1802 wieder zu Zürich zurückzukehren, musste aber schließlich mit der Inkraftsetzung der Mediationsverfassung 1803 seine Zugehörigkeit zu Schaffhausen akzeptieren.
Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit kam Stein vor allem eine strategische Bedeutung zu, da es über eine der wenigen Brücken über den Rhein verfügte. Im Schwabenkrieg wurde Stein für die Eidgenossen zu einem Einfallstor in den Hegau. Im Dreißigjährigen Krieg erzwangen die Schweden den Rheinübergang bei Stein auf ihrem Weg nach Konstanz. Die spätmittelalterliche Rheinbrücke wurde bei Kämpfen zwischen Russen und Franzosen während der Franzosenzeit zerstört. Am 22. Februar 1945 wurden durch einen amerikanischen Bombenabwurf neun Menschen getötet und mehrere Gebäude schwer beschädigt. Die überlebenden Opfer wurden in den 1950er Jahren von der amerikanischen Regierung entschädigt.
Man liesst in diesem Geschichtsabriss ungläubig, dass es am 22. Januar 1457 den Steiner Stadtbehörden sogar gelungen ist den Status der Reichsfreiheit zu erlangen, das Städtchen somit nur noch dem deutschen Kaiser direkt unterstellt war. Als reichsunmittelbar, auch reichsfrei, wurden im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reich immer diejenigen Personen und Institutionen bezeichnet, die keiner anderen Herrschaft unterstanden, sondern direkt und unmittelbar nur noch dem deutschen Kaiser Rechenschaft ablegen mussten. Sie wurden als reichsunmittelbare Stände oder Immediatstände bezeichnet.
Genauso ungläubig steht man aber auch vor der Tatsache, dass im Zweiten Weltkrieg Stein am Rhein – wie Schafffhausen und Basel auch – ebenfalls bombardiert worden ist. Am 22. Februar 1945 wurde Stein am Rhein „irrtümlicherweise“ von einem auf 5'000 m Höhe fliegenden B17-Bomber („fliegende Festung“) mit 12 Sprengbomben angegriffen. Vier Frauen und fünf Kinder wurden dabei getötet und 33 Personen verletzt, davon 15 schwer. Der Sachschaden war enorm. Und dies obwohl es in Stein am Rhein keine Industrie gab und die Dächer größtenteils mit Schweizer Kreuzen bemalt waren. Angeblich wüssten, so das US-Oberkammando – die jungen Piloten manchmal nicht was die Schweizer Kreuze bedeuten würden …!
Rathaus Stein am Rhein
Fassadenmalereien
Blick auf Stein am Rhein mit Kloster
„Schifflände“- Kade
Blick auf Burg Hohenklingen und Öhningen (hinten links mit Grenze) sowie Stein am Rhein und Eschenz
„Rhybrugg Stei am Rhy“ (alemannisch) 1974 Länge 111m, Breite 11m, Durchfahrtshöhe 3,60m
ORTSTEIL ÖHNINGEN
AM AUGUSTINER CHORHERRENSTIFT
Augustiner Chorherrenstift
Stift mit Ortsteil Öhningen
Ehemaliges Verwaltungsgebäude als Rathaus
Wappen der Grossgemeinde Ohningen
CANONIA ONINGA Stiftsgeschichte
aus www.oehningen-tourismus.deDas ehemalige Augustiner-Chorherrenstift in Öhningen liegt an prominenter Stelle in einer bemerkenswerten Kultur- und Naturlandschaft auf der Halbinsel Höri. Die Stiftsgründung erfolgte bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Einer Urkunde von Friedrich Barbarossa vom 27. November 1155 ist erstmals zu entnehmen, dass der Kaiser „die Propstei Öhningen“, die Kraft Erbrecht auf ihn gekommen war, der Kirche von Konstanz übertragen hat.
Die imposanten mittelalterlichen Konventgebäude umschließen mit der Kirche den Kreuzhof. Trotz zahlreicher Umbauphasen sind in diesen Gebäuden wesentliche Bauteile von der Spätromanik bis zur Barockzeit erhalten. Diese sind von hohem geschichtlichem Zeugniswert und bilden ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung.
In der Zeit von 1431 bis 1519 führte man eine Gesamterneuerung der Stiftsgebäude durch und 1617 hat der Fürstbischof von Konstanz das Propsteigebäude um ein weiteres Geschoss aufstocken lassen. Barocke Raumdekorationen und Rokokostuck im Konventsaal, der neuen Bibliothek und in vielen Zimmern der Augustiner Chorherren prägen das Innere der Konventgebäude.
Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Stifts, lies der Fürstbischof 1681 errichten. Dieses Gebäude dient heute der Gemeinde Öhningen nach umfangreichen Renovierungs- und Restaurierungsmaßnahmen als Rathaus. Die Stiftskirche St. Hippolyt und Verena, seit 1805 katholische Pfarrkirche, wird heute durch die Neugestaltung des Innenraums nach dem 30-jährigen Krieg geprägt. Die letzte Restaurierung der Kirche fand in den Jahren 1973/74 statt.
Die seit einigen Jahren laufenden, neuen Sanierungsarbeiten des Augustiner Chorherrenstifts kommen jedoch nicht zügig voran. Dies da beim Aushub des vorgesehenen Aufzugschachtes Mauerreste eines ehemaligen Badehauses aus dem Mittelalter aufgetaucht sind. Und da diese angeblich von historischer Bedeutung seien, ist vom Denkmalamt ein sofortiger Baustopp veranlasst worden.
Weiter wirft die Statik der instandgesetzten Fassade unvorhergesehene Probleme auf, indem an einigen Stellen der Putz abplatzt – und dies obwohl das Ganze mehrfach statisch durchgerechnet worden ist: Die hierfür erforderlichen Zusatzkosten sollen angeblich 200‘000 Euro erreichen.
Zusammen mit dem Fehlen eines angemessenes Nutzungskonzepts - wozu sogar die Öhninger Bürger befragt wurden – sind zur Zeit die mit soviel Elan gestarteten Sanierungsarbeiten in erheblichem Masse beeinträchtigt. Übrigens steht das gesamte Zentrum von Öhningen unter Denkmalschutz.
BODENSEE-MALER FALLER
Dem Stift direkt gegenüber wohnt der überaus bekannte Maler Rüdiger Faller, der nicht nur durch seine wunderbaren Höri-Gemalde bekannt geworden ist sondern auch durch seine früheren Dix-Fälschungen. Denn der Künstler Rüdiger Faller war/ist vom berühmten Maler Otto Dix (mit eigenem Museum in Hemmenhofen) geradezu besessen. Das Bestreben, seinem Idol nachzueifern, brachte ihn ins Gefängnis. Über ihn ist viel geschrieben worden und das Internet ist voll mit Faller-Suchergebnissen. Sehr aufschlussreich ist diesbezüglich auch der Faller-Artikel WERK UND WAHN (von Patrick Bauer, Süddeutsche Zeitung Magazin, 18.11.2016).
Die Faller-Biografie von George Tenner und Tobias Faller trägt den (langen) Titel “Im langen Schatten des Otto Dix: Das Leben des Kunstfälschers Rüdiger Faller” (01.07.2014). Bei Amazon heisst es dazu: