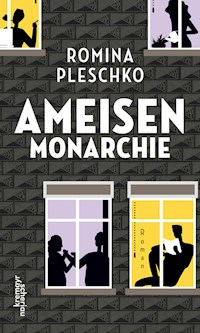Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Romina Pleschko zeichnet ein herrlich entlarvendes Bild der Gesellschaftsstrukturen in einer Kleinstadt und stellt ihr eine Heldin gegenüber, die mit allen Wassern gewaschen ist. Die kleine Elfi ist eine Schelmin. Im Alleingang schlägt sie sich einfallsreich und mit teils unlauteren Mitteln durchs Leben, in ihrem neuen Heimatort Liebstatt am See wird das junge Mädchen schnell als Sonderling abgestempelt. Trotz Elfis gewitzter Bemühungen will die Gemeinde sie nicht als eine von ihnen annehmen, sie bleibt eine Außenseiterin. Jahre später kehrt sie als ältere Frau nach Liebstatt zurück – und wieder wird der Ort zum Feind. Der Bau eines Hotels bedroht die Idylle ihres Seegrundstücks. Will die Gemeinde sie loswerden? Es ist Zeit für Widerstand, findet Elfi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROMINA PLESCHKO
OFFENE GEWÄSSER
ROMAN
KREMAYR & SCHERIAU
für Mutzini
INHALT
LIEBSTATT
STATT LIEB
– »Das ist zwecklos«, hat die junge Ärztin gemeint.
»Rache ist zwecklos. Ihr müsst euren Kampf organisieren, Genossinnen, mit politischem Kampf gewinnt man, aber nicht mit Rache.«
– »Wer denkt denn hier an Vergeltung«, haben wir gesagt.
»Nein, wir wollen bloß ein politisches Zeichen setzen.«
Den Abend drauf brach unten in der Stadt ein Brand aus.
(Nur Kinder, Küche, Kirche,Franca Rame und Dario Fo)
LIEBSTATT
Etwas Gesellschaft wäre nett gewesen, also stahl ich ein Hühnerei aus unserem Einkaufskorb, bettete es in Watte und bat meine Schulfreundin Kathrin, heimlich ihrer Mutter die Rotlichttherapielampe gegen Depressionen zu entwenden. Kathrins sich daraufhin rapide verschlechternde Familiensituation nahm ich in Kauf, ich war bereit, selbst Mutter zu werden, rundum fasziniert von der behaglichen Vorstellung, dass sich ein Küken komplett auf mich prägen könnte. Lieber wäre mir zwar eine Krähe gewesen, eine Krähe würde mehr nach meinem Ebenbild kommen und sähe auch besonders verwegen aus auf der Schulter, aber ich hatte keine Möglichkeit, an ein Gelege zu kommen, mein kleiner Wuchs erlaubte mir nur eingeschränkt, auf Bäumen nach Nestern zu suchen. Hühnereier standen außerdem quasi frei zur Adoption, ich hätte ungern im Baumwipfel gegen eine erboste Krähenmutter gekämpft, mit dem gestohlenen Ei in der Hosentasche.
Nach einigen Tagen fast durchgängiger Rotlichtbestrahlung unter meinem Bett begann das Ei zu stinken und ich ahnte schon, dass meine Mutterschaft unter keinem guten Stern stand, wartete aber trotzdem, bis die Großmutter das Brutarrangement fand und ausgiebig mit mir schimpfte. Ob ich denn blöd sei und nicht wisse, dass Eier aus dem Supermarkt unbefruchtet waren, schrie sie mir dermaßen in Rage ins Gesicht, dass meine Stirnfransen sanft nach links und rechts zur Seite wehten. Das war tatsächlich eine neue Information, musste ich mir zu meiner Schande eingestehen. Über die Lebensumstände der genetischen Vorfahren meines Nachwuchses hatte ich mir keine Gedanken gemacht, alle bisherigen Tagträume fokussierten ausschließlich auf ein flauschiges Wesen, das mir auf ein zart hingehauchtes mütterliches Piepsen hin in die hohle Hand hüpfte.
Die Großmutter warf das übelriechende Ei samt seiner Behausung, einer mit Wattebäuschen ausgekleideten Tupperdose für die sommerliche Essigwurst im Freibad, in den Müll und verlangte 50 Schilling als Ersatz für die Dose von mir.
Den Wunsch nach Gesellschaft jedoch gab ich niemals auf. Kurz danach, endlich ein Stück gewachsen, fing ich an, bereits geschlüpfte Vogelbabys aus ihren Nestern zu entwenden, um das wohl aussichtslose und zudem auch kostspielige Unterfangen des Selbstbrütens zu umgehen. Unser verwinkelt gebautes Wohnhaus beherbergte im Sommer einige Schwalben- und Bachstelzenfamilien in immer denselben Nestern, die jedes Frühjahr routiniert von einem anderen Vogelpaar in Stand gesetzt wurden. Ich hatte in den Sommerferien nichts zu tun und schlenderte mehrmals wöchentlich an der Außenfassade entlang, die Haushaltsleiter und einen Besen unter die schmächtigen Ärmchen geklemmt, offiziell auf der Jagd nach den unzähligen Spinnweben, die Großmutter hasste das Gefühl, eingewoben zu werden in ihrem Lebensraum. Traf ich dabei auf die Frau des Vermieters, war sie so entzückt von meinem hausmeisterlichen Eifer, dass sie mich reich mit Süßigkeiten belohnte.
»Ja was machst du denn da, Elfi, du Fleißige? Schon wieder auf Spinnenjagd?«, fragte sie dann. Ich konnte an ihrem Gesichtsausdruck sehen, dass sie hin- und hergerissen war zwischen der Liebe zu ihrem Besitz und der in ihrer Welt völlig organischen Geringschätzung meiner Existenz als elternlosem Bastard. Mein Äußeres unterschied sich gravierend von dem ihrer Enkelinnen, meine Frisur glich mehr den Vogelnestern, die ich zu überfallen gedachte, und sie legte großen Wert auf ein gepflegtes Aussehen, das wiederum meinte ich an den perlmuttlackierten Fingernägeln zu erkennen. »Exakt. Ich hasse Spinnweben, die verschandeln die schöne Fassade!«, antwortete ich und hatte gewonnen.
Jemand, der die Instandhaltung einer Immobilie so zu schätzen wusste wie sie selbst, der konnte nicht schlecht sein, und gute Arbeitskräfte waren ja ohnehin schwer zu bekommen, da vermochte es die Frau des Vermieters durchaus, über Äußerlichkeiten hinwegzusehen. Sofort griff sie in ihre Handtasche, um meine Leistung in Schokoladentalern auszuzahlen, einer nutzlosen Währung, die sie aber offenbar für originell hielt. Die harte goldene Alufolie schnitt mir beim Auspacken jedes Mal unter die Fingernägel und der eindimensionale Fettgeschmack der Industrieschokolade entschädigte dafür nicht im Geringsten. Schleimig legte sie sich auf Zunge und Gaumen, beeinträchtigte eine präzise Aussprache und ließ den Speichel auf der Stelle bräunlich verschlacken.
»Es ist nicht alles Gold, was glänzt«, hätte ich der Frau des Vermieters gern mitgeteilt, aber ich hatte eng definierte Grenzen für die eigene Naseweisheit und hätte außerdem dabei gespuckt, daher gab ich mich gewöhnlich mit einem überzogen jovialen Dank, sozusagen auf Augenhöhe unter Geschäftsleuten, zufrieden.
Bald nach meiner Ankunft bei der Großmutter hatte ich intuitiv verstanden, wie man die Dinge hier in Liebstatt regelte, die österreichische Provinz funktionierte wenig überraschend ganz anders als das Heimleben in Stuttgart, man maß den unangenehmen Wahrheiten weitaus weniger Bedeutung zu, auch wenn sie einem auf der Zunge lagen.
Die Auswahl des aktuellen Objekts meiner vagabundierenden Liebe traf ich nach zwei Kriterien: Erstens bevorzugte ich Bachstelzen aufgrund ihres kontrastreichen Gefieders und zweitens reduzierte ich Nester gern auf eine gerade Anzahl an Nachkommen. Ungerade Zahlen verursachten nur gemeine Allianzen gegen den einen Übrigbleibenden, diesbezüglich hatte ich schon einschlägige Erfahrungen gesammelt. Die Vogelbabys waren meist noch durchsichtig, früh vergreiste winzige Wesen gänzlich ohne Fähigkeiten, ich konnte die Nahrung in Zeitlupe durch ihre rosigen Körper wandern sehen, wenn ich ihnen mit einer Pinzette etwas Katzenfutter verabreicht hatte. Dazu musste ich die noch weichen Schnäbel vorsichtig an der Spitze aufhebeln, keines meiner Babys hatte einen gesunden Appetit und sperrte den Schnabel von selbst auf. Auch konnte mein Mutterstolz nicht über die omnipräsente Unattraktivität der Schützlinge hinwegtäuschen, nackte Vogelkinder sahen mit ihren Blähbäuchen und der sporadischen Befiederung alle aus wie die deutschen Touristen auf den Campingplätzen am See von Liebstatt, deswegen taufte ich sie Volker, Thorsten oder Ulf, immer ging ich von männlichen Küken aus. Ich variierte auch die Zusammensetzung der Geschwister, zog sie im Duo oder Trio auf, damit sie nicht an Einsamkeit außerhalb des Nestes zugrunde gingen, aber es setzte mich unter schier unerträglichen Stress, wenn sie der Reihe nach verstarben. Die Hoffnung heftete sich als klebriges Konzentrat an die Verbliebenen, immer verzweifelter, umso lethargischer sie wurden. Kein Einziges überlebte trotz sich stetig verbessernder Kenntnisse der Brutpflege (schnell tauschte ich die spitze Pinzette gegen eine stumpfe), der Geruch ihrer rasant einsetzenden Verwesung prägte sich für alle Ewigkeit ein, in der Kopfnote voll penetranter Süße, die einen jedoch durch die unterschwellig stechende Säuerlichkeit sofort unruhig machte.
Oft wachte ich morgens auf und roch den Vogeltod, bevor ich überhaupt die Augen aufgeschlagen hatte, ließ ihn einsickern in mein Bewusstsein, atmete wiederholt tief in den Bauch ein und aus, um nicht gleich die Fassung zu verlieren. Ein unumgänglicher Ritus zugunsten meiner inneren Stabilität, der Tod war niemals etwas anderes als eine Frage der Zeit, das musste man sich regelmäßig in Erinnerung rufen.
Bald entwickelte ich eine traurige Routine auf dem Sektor der Vogelbestattung, sammelte im Freibad Holzstiele von Eislutschern für Grabkreuze, lernte die Grundlagen der Kalligrafie für deren Beschriftung. Die Sinnsprüche mussten platzbedingt prägnant ausfallen, mein Favorit war »Wir sind nur Gast auf Erden«, eine schmucklose Tatsache von bestechender Aufrichtigkeit. Ich begrub die Vögel, eingewickelt in ein Taschentuch und witterungsgeschützt in die Plastikhülle der Taschentuchverpackung gepackt wie in einem kleinen himmelblauen Schlafsack mit dem Kopf nach oben, unter der Himbeerhecke am Gartenzaun und steckte die Grabkreuze uneinsehbar hinter die Zaunlatten auf das Nachbargrundstück. Die Frau des Vermieters nahm es sehr genau mit der regelmäßigen Inspektion ihres Gartens und wäre mir sonst sofort auf die Schliche gekommen.
Natürlich hätte ich auch ältere Vögel aus den Nestern entwenden können, diese wären zumindest physisch schon über die gröbsten Hürden hinweggewesen, aber ich machte mir Sorgen um deren Bindungsvermögen, außerdem fürchtete ich mich vor ihrer Unberechenbarkeit, wenn sie unkontrolliert flatterten und erste Flugversuche starteten. So viel Arbeit, Liebe, selbstlose Hingabe – und dann pickt einem das undankbare Balg zum Abschied noch die Augen aus, bevor es zur wahren Familie zurückfliegt. Mein Herz pochte allein bei der Vorstellung dieser emotionalen Belastung, zur nötigen Selbstaufgabe als integralem Hauptbestandteil der klassischen Mutterschaft hatte ich keinen intuitiven Zugang, es sollte schon etwas dabei herausschauen, fand ich.
Nur ein Mal wurde meine Sehnsucht nach einem Haustier gestillt, ich durfte mir ohne Vorankündigung ein Katzenbaby aussuchen und kann bis heute nicht glauben, dass das wirklich passiert ist, erscheint mir diese Episode rückblickend doch eher wie ein Fiebertraum. Wir waren zu Besuch auf einem Bauernhof im Nachbarort und die Großmutter, befreundet mit der Altbäuerin, ließ sich spontan zur Aufnahme eines ansonsten dem Tod geweihten Katzenkindes überreden, eine reine Laune, eventuell dem an diesem Nachmittag ausgiebigen Konsum von Zirbenschnaps geschuldet, aber nichtsdestotrotz die schönste, die sie jemals hatte.
Also ging ich mit der Bäuerin, an die ich mich aufgrund der immensen Aufregung nur schemenhaft erinnere, in den Heustadl, zügig und ohne mich umzudrehen, vor lauter Angst, dass mir die Großmutter ihre Meinungsänderung nachrufen könnte, und griff beherzt in eine mit alten Decken ausgelegte Kartoffelkiste, um ein Kätzchen nach dem anderen zu inspizieren. Ich küsste sie selig, dem Wahnsinn nahe, wusste überhaupt nicht mehr, was meine Muskulatur anstellte, es hätte sein können, dass ich dabei sabberte und eines der Kleinen vor Überschwang zerquetschte bei diesem unbekannten Anfall intensiver Liebesgefühle. Es roch nach Heu, Urin und Unschuld, wenn ich meine Nase an ihnen rieb, einem wundervollen olfaktorischen Dreigestirn.
Der Auserwählte wurde ein Kater, ich blieb meiner tierischen Geschlechterpräferenz treu, schwarz mit weißen Vorderpfoten. Er drapierte seinen entzückend winzigen Stuhlgang am liebsten in kleinen Portionen auf den Fliesen im Vorzimmer und schrie die Nächte durch, wenn ich ihn bei mir im Schlafzimmer einsperrte und mit Nachdruck dazu bringen wollte, still in meinen zerkratzten Armen zu liegen. »Ruhig Katzinger, ruhig, ich tu dir nichts.« Ich liebte ihn und ich glaube, in ihm hätte sich ebenfalls irgendwann ein stabiles Fundament für die angemessene innerfamiliäre Gefühlserwiderung aufgebaut, aber noch bevor es dazu kam, wurde er, nach nur sieben Wochen in meiner Obhut, von einer Vespa überfahren und achtlos in den Straßengraben vor unserer Einfahrt gelegt, über Nacht eingefroren in einer grotesken Verrenkung, die mir einige Albträume bescherte. Die Nachbarn hatten den Unfallhergang beobachtet, verschwiegen mir als Zugezogener aber den Namen des Mopedlenkers, was mich rasend machte, ich wollte dem Mörder ein Gesicht geben in meiner Vorstellung, meine Rachefantasien konkret adressieren. Gemessen an dem beharrlichen Schweigen hatte ich den Sohn des Betonwerkbesitzers im Verdacht, dieser besaß nämlich zusätzlich zur Vespa auch die unantastbare Loyalität der Liebstätter Bevölkerung, sicherte sein Vater doch trotz regelmäßiger Insolvenzverschleppungen ein Fünftel der Arbeitsplätze im Ort, aber ich konnte die Katzentötung leider nie beweisen, zu deutlich spürte ich die Grenzen meiner Stellung in der Stadt.
An diesem schrecklichen Morgen hatte ich zu allem Überfluss auch noch eine Mathematikschularbeit und nutzte die Gelegenheit, um öffentlich zu weinen, da ich weder den Tod noch derart diffizile Beispiele zur Prozentrechnung vorhergesehen hatte. Mein Lehrer war überfordert von so viel Drama, aber gleichzeitig voller Mitleid. Junge Mädchen, die um Kätzchen trauern, eigentlich eine berechenbare Größe an einer katholischen Privatschule. Später traf er die Großmutter beim Einkaufen und fragte nach, welch schlauer Mann, ob tatsächlich ein Haustiertodesfall zu betrauern war. Auf die Schularbeit bekam ich mein erstes und letztes »Befriedigend« und ich beschloss, mein Herz in Zukunft ausschließlich an emotional ungeübte Wissenschaftler zu vergeben.
Den Verlust meines Haustieres konnte ich lange nicht überwinden, verzweifelt klammerte ich mich an dieses unwirkliche kurze Glück der Vergangenheit und bestellte ohne großmütterliche Autorisierung ein Kätzchen aus dem Frühlingswurf der Bauernhofkatze meiner Klassenkollegin Lisi, die mir Wochen später tatsächlich ein dem verstorbenen täuschend ähnliches Katzenkind auf dem Parkplatz vor der Schule überreichte. Ich schmuggelte es in meinem Handarbeitskoffer, in den ich ein paar Luftlöcher mit einer Stricknadel gebohrt hatte, im Schulbus nachhause, tunkte es am Heimweg in den Bach neben unserem Grundstück, zerraufte mein Haar (ich hätte wissen müssen, dass das eine Nummer zu viel war) und schilderte der Großmutter unter Tränen die vermeintliche Rettungsaktion des vermeintlich verlassenen Kätzchens. Welch Wunder, dass es aussah wie mein kürzlich verstorbenes! Ein Zeichen! Durfte man einen derart deutlichen Wink des Schicksals ignorieren?
Die Großmutter glaubte mir keine Sekunde lang, war aber beeindruckt von meiner Gabe zur Improvisation. Dennoch fiel ihre Reaktion anders aus, als ich erwartet hatte. Ich solle das Kätzchen am nächsten Tag wieder zurückbringen, befahl sie mir erstaunlich ruhig. Den Rest des Tages, ich war nach der Scham über die Enttarnung dieser Scharade schnell wieder mutig geworden, jammerte und bettelte ich vergeblich, sie war nicht zu erweichen. Die Schande bei der Rückgabe führte zu einem Bruch der Freundschaft zwischen Lisi und mir, obwohl sie es nicht direkt ausformulierte, machte sie mich doch verantwortlich für das nun endgültig fixierte Schicksal des Katzenbabys. Ein Haustier bekam ich nie mehr, auch wenn ich hartnäckig blieb, die Großmutter hatte mit diesem Thema abgeschlossen.
Ich verursachte Aufwand genug in den zwei Jahren, die ich schon bei ihr in Liebstatt am See lebte, das überschaubare Gehalt als Mitarbeiterin im Konsum Supermarkt reichte bei Weitem nicht, um uns beiden den gewünschten Lebensstandard zu ermöglichen. Die Großmutter träumte von echten Pelzen und echten Perlenketten, einer gut gefüllten Schmuckschatulle oder wenigstens von einer vorzeigbaren Enkelin, aber schon als Baby sei ich unansehnlich gewesen, in einem herausragenden Ausmaß, ganzkörperbehaart bis auf eine Mönchstonsur, lang und dünn wie ein Wurm und obendrein schielend. Ein Wesen, dessen Physiognomie verzweifelt versuchte, jegliche Aufmerksamkeit von ihm fernzuhalten und dabei so hoffnungslos übertrieb, dass sich einfach nur die Art der Beachtung änderte, bedauerlicherweise aber nicht zur Gänze ausblieb. Bei den raren Gelegenheiten, zu denen mich die Großmutter in Deutschland besucht hatte, sei sie immer entsetzt gewesen, wie wenig entzückend ein kleines Menschlein sein könne. Auch hätte ich meine optischen Defizite nicht durch ein einnehmendes Wesen zu kompensieren vermocht, im Gegenteil, jedes Mal, wenn sie sich über den Kinderwagen gebeugt habe, hätte ich unverzüglich angefangen, das Gesicht zu verziehen und zu wimmern. Gott sei Dank hätte ich mich etwas gemausert, meinte sie versöhnlich zum Abschluss der während meiner Anfangszeit in Liebstatt fast jeden Abend wortgleich stattfindenden Nacherzählung unserer frühen Begegnungen. Jetzt müsse ich nur noch diesen grauen Unterton in meiner Haarfarbe loswerden, das sei wirklich die freudloseste Schattierung von Braun, die sie sich vorstellen könne.
Die Großmutter hatte mich einige Monate nach dem Prozess gegen meine Eltern mit dem Taxi aus Stuttgart direkt zu ihrer Wohnung in Liebstatt bringen lassen, das Kinderheim war einverstanden gewesen, ich bildete mir sogar ein, etwas wie Erleichterung bei meinen beiden Betreuerinnen zu spüren, als sie mich mit einer Sporttasche, in der sich zwei Hosen, vier T-Shirts, zusammengesammelte Unterwäsche, die zum Großteil gar nicht mir gehörte, und meine Papiere befanden, auf den Rücksitz des alten Mercedes setzten. Eigene Unterwäsche und fremde Papiere wären mir lieber gewesen, ich war so wund, ich hätte jede Identität dankend angenommen, die auch nur den geringsten Abstand zu meiner eigenen Lebensrealität verheißen hätte.
Die Verabschiedung verlief distanziert, ich schmiegte mich noch in einem Anfall von kindlicher Sentimentalität an den ausladenden Busen der etwas freundlicheren Betreuerin, zog aber meinen Kopf sofort zurück, als sie sich versteifte. Auf der fünfstündigen Fahrt ohne Pause entdeckte ich in Ermangelung anderer Beschäftigungen meine große Liebe zu Nikotin, denn der Taxifahrer rauchte Kette und lüftete nur spärlich, er blieb aber standhaft und spendierte mir keine Zigarette, nicht einmal einen winzigen Zug, obwohl ich ihn bei jedem Autokennzeichen, das ein »Z« enthielt, danach fragte. Meine Augen tränten von den dichten Rauchschwaden und vielen Gefühlen, eine entlastend beliebige Mischung, wie ich fand. Gefühle, die in Rauch aufgehen, transportiert durch Tränen fragwürdiger Herkunft.
Ich hatte das Kinderheim gemocht, ich schätzte seine Ereignislosigkeit, die immer gleichen Strukturen und die gedeckten Farben des Interieurs, aber die Großmutter war entsetzt gewesen bei ihrem einzigen Besuch und hatte auf der Stelle geschworen, mich hier rauszuholen, damit ich nicht ins Milieu abrutschte, mit einem strengen Seitenblick auf meine beiden Zimmerkolleginnen, die beim Wort »Milieu« dümmlich kicherten.
Noch auf der Fahrt nach Liebstatt am See beschloss ich, alsbald mit dem Rauchen anzufangen und nie wieder damit aufzuhören, das Rauchen einfach als Religionsersatz zu betrachten, mit dem nötigen Ernst und einer aufrichtigen Hingabe. Ich wollte eine Art Ritual entwickeln, bei dem ich mit dem Rauch gleichzeitig auch alle schlechten Gedanken loswurde, sie nach tiefer Inhalation einfach hinausschicken aus meinem Körper, leichter werdend. Im Kopf ging ich alle mir bekannten Zigarettenmarken durch und war mit keiner zufrieden, »Milde Sorte« erschien mir als zu inkonsequent, am Ende schwankte ich immer noch zwischen »Lucky Strike« und »Roth Händle«, final entscheiden wollte ich mich erst nach einer zeitnahen Verkostung. Es beruhigte mich, einen Plan zu entwerfen, wie ich in der mir bis dato nur von sporadischen Kurzbesuchen bekannten österreichischen Provinz an Zigaretten kommen könnte, in Stuttgart wäre das kein Problem gewesen, ich hätte nur meine Zimmerkolleginnen fragen müssen.
Die beiden waren etwas älter als ich gewesen, seit Jahren im Heim und immer diensteifrig bereit, mich mit Illegalem zu versorgen, auch Ungewolltem, wie beispielsweise alten Pornozeitschriften aus den Cafés in der Stadt. Ich betrachtete die Bilder in den widerwärtig abgegriffenen Heften mit neutralem Schutzumschlag aus dünnem Karton aus reiner Höflichkeit, mit geradem Rücken auf der Stuhlkante sitzend, und konzentrierte mich darauf, ruhig weiterzuatmen und bei Sinnen zu bleiben, während die Luft immer schneller um mich herumkreiselte.
Der Taxifahrer fing gar nicht erst ein Gespräch mit mir an, was ich zu schätzen wusste, ich hätte ohnehin die halbe Konversation verhustet. Ich studierte seinen Nacken genauer als irgendetwas sonst in meinem bisherigen Leben, stundenlang schaute ich auf die zwei kleinen Hautfalten in seinem Nackenspeck, borstig graumeliert behaart, die Haarschneidemaschine hatte nicht alles gleichmäßig erwischt, an den drei Haarlängen konnte man die Schneidefrequenz (ungefähr alle vier Wochen) errechnen. Einige Haarfollikel waren gar entzündet, rötliche Herde, von denen strahlenförmige, unregelmäßige Kratzspuren wegführten. Um auch weiterhin nicht gestört zu werden, rutschte ich an den Rand der Rückbank und sank so ein, dass die Kopfstütze des Vordersitzes genau mein Gesicht verdeckte und ich nur teilweise durch den Rückspiegel zu sehen war.
Im Nachhinein hätte ich gern ein Foto gehabt von diesem Taxifahrer, meinem Fährmann Charon, und gewusst, was er nach diesem Auftrag seiner Familie, falls existent, erzählt hatte. Eine Taxifahrt in dieser Größenordnung konnte nicht alltäglich für ihn gewesen sein, inklusive Grenzübertritt und dem damals noch damit verbundenen Aufwand, die Rechnung musste horrend ausfallen, es hätte mich zudem interessiert, was ihm von der Heimleitung über mich berichtet worden war, aber es schien beinahe so, als hätte er Angst vor mir, sein Blick blieb immer starr auf die Straße oder kurz auf den Aschenbecher gerichtet. Es dauerte eine Zeit, bis ich verstand, warum die meisten Erwachsenen besser nicht allzu viel mit mir zu tun haben wollten, und es war ihnen eigentlich auch nicht zu verübeln. Daher musste ich mir seine Vorderansicht zur Gänze imaginieren, meine Fantasie war bedauerlicherweise nicht zu mehr fähig als leicht abgewandelten Varianten des Grundtypus Vitus Mostdipf aus den Oberösterreichischen Nachrichten, der einzigen Tageszeitung, die meine Eltern in Deutschland gelesen hatten. Ein Start ins Leben wie eine Karikatur.
Die Großmutter machte es mir nach meiner Ankunft so angenehm wie möglich. Ich bewunderte, mit welcher Geduld sie meinen zahlreich geäußerten Wünschen rasch und kommentarlos nachkam, wir beide wussten unausgesprochen, dass diese Phase auch zeitnah wieder zu einem Ende finden würde, zu wenig entsprach jene Dienstbarkeit ihrem eigentlichen Naturell, ein imponierender Kraftakt für die Großmutter, weshalb ich noch eine Spur dankbarer war. Sie kochte mir täglich so viele weiche Eier, wie ich essen konnte, und beschwerte sich nicht über meine Maßlosigkeit. Im Heim hatte es nur sonntags ein Ei gegeben, und immer mit einem grünlich durchgekochten Dotter, was ich zutiefst verabscheute, mich aber nicht davon abhielt, jedes Wochenende erneut simultan zum Abschlagen der Eierspitze auch meine Hoffnung auf Perfektion mit zu köpfen. Ich habe ja nichts zu verlieren, dachte ich dann, wer weiß, vielleicht hatte ich eines Tages ja endlich dieses Glück, von dem mir andere immer erzählten.
Der Eidotter musste goldgelb sein, umgeben von festem Eiweiß, ich wollte gierig mit einem in Streifen geschnittenen Toastbrot hineinstechen und die cremige Flüssigkeit auftunken, bevor sie stockte, nur unterbrochen vom manischen Nachsalzen bei jedem einzelnen Bissen. Die Großmutter beherrschte das Eierkochen perfekt, eine viel zu oft unterschätzte Könnerschaft, ich selbst brauchte Jahre, um mir diese Fertigkeit anzueignen, die Eigenheiten unterschiedlich großer Eier und des Kochvorgangs richtig abzuschätzen.
Auch meinen Drang nach produktiver Arbeit mit messbaren Ergebnissen wusste sie gut zu lenken, gemeinsam säten wir Erdäpfelhälften in den Balkonkästen, ich pflegte sie mit Hingabe, und im Spätsommer ernteten wir jede Menge Erdäpfel, so klein, dass sich weder das Schälen noch das Zerteilen mit dem Messer lohnten. Sie schmeckten himmlisch, ordentlich gebuttert. Seit dieser Erfahrung habe ich eine unauslöschliche Vorliebe für Miniaturlebensmittel, sie rühren mich allesamt in ihrer Winzigkeit.
Außerdem durfte ich die kostbaren Glasfiguren der Großmutter aus der Vitrine nehmen und sie vorsichtig abstauben, ja ich schaffte es sogar, keine dabei kaputtzumachen. Sie sammelte Katzen in allen Stilen und Größen, filigran mundgeblasen oder grobschlächtig aus einem Stück gefertigt, ich liebte diese Sammlung von Anfang an, ihre Existenz nährte fälschlicherweise meine Hoffnung, die Großmutter irgendwann doch noch von einer echten Katze zu überzeugen. Ich prägte mir ihre Anordnung in der Vitrine gut ein, um keine Fehler beim Wiedereinsortieren zu machen.
Gemeinsam legten wir Klebefallen für die Ameisen in der Küche aus, die diese geschickt umgingen, was mich jeden Morgen bei der Kontrolle verärgerte. Die sporadisch festgeklebten Insektenleichen verursachten mir ein schlechtes Gewissen, da ich dazu neigte, Einzelschicksale überzubewerten. Wir redeten nicht viel, über Stuttgart oder den Prozess sprachen wir nicht, schon gar nicht über meine Eltern, ich mochte die Idee von zwei verschiedenen Welten, denen es unmöglich gemacht wurde, sich zu vermischen, solange man nicht selbst unvorsichtigerweise einen Anlass dazu bot. Die Lust, meine Vergangenheit mit Worten zu perforieren wie die Eidotter, war überschaubar, auch die Großmutter schwieg diesbezüglich.
Lieber führte sie mich durch das Ortszentrum, das mir mit seiner optischen Idylle sofort zu Herzen ging. Liebstatt war ein Traum von süßer Klebrigkeit, dabei sauber bis in alle Ritzen, sogar die Brunnenfigur auf dem Stadtplatz wurde regelmäßig mit einem Hochdruckreiniger zum Glänzen gebracht, alle Stadtbewohner grüßten sich freundlich auf der Straße, zumindest alle anderen, wenn auch nur selten jemand die Großmutter und mich. Zu Beginn siegte jedoch regelmäßig die Neugierde, dann stellten mir einzelne Stadtbewohner seltsame Fragen, die ich allesamt ebenso seltsam beantwortete.
»Na, wohnst du jetzt hier bei deiner Oma?«
»Sicher.«
»Ist schon schön hier, das Fleckerl, oder?«
»Sicher.«
Die Gespräche kamen nicht wirklich in Fluss, aber das war ich von Erwachsenen gewöhnt, die meisten vermochten ja schon kaum mit dem eigenen Nachwuchs zu kommunizieren, ohne in unerträgliche Falsettstimmen zu fallen.
Ich konzentrierte mich fürs Erste ausschließlich auf die landschaftlichen Gegebenheiten, in dieser Hinsicht hatte Liebstatt wirklich viel zu bieten, da konnte man ohne Weiteres über die sprachlichen Unbedarftheiten der Bevölkerung hinwegsehen.
Die scharfkantigen Berge säumten einen dunkelgrünen See, von dessen Trinkwasserqualität ich mich bei jedem Spaziergang aufs Neue versichern musste. Das Wasser schmeckte nach nichts, wenn man einen Schluck davon nahm, nur kalt, das fand ich immer wieder erstaunlich, eigentlich erwartete ich eine geschmackliche Prägung durch die Natur, etwa nach Schlamm, Algen oder gar latent nach Fisch, was mich auch nicht weiter gestört hätte. An der Promenade hielten wir uns nie so lange auf, wie ich es wünschte, um kleine hässliche Muscheln von Steinen zu kratzen oder Baumrinden als Schiffchen segeln zu lassen, viel zu fortgeschritten war die Gewöhnung der Großmutter an die Schönheiten der Region, sie zog es ins Innere des Ortes.
Die Schaufenster der Geschäfte bestachen durch ausgeklügelte Dekorationen, regelmäßig saisonal verändert, mir schoss jedes Mal das Glück in den Rumpf, ganz schwindelig wurde mir, wenn ich bemerkte, dass sich die Auslagen seit dem letzten Spaziergang verändert hatten. Die Großmutter und ich konnten ewig an den Fensterfronten vorbeischlendern, ich machte mir Wunschlisten voller Spielsachen, indem ich mit dem Zeigefinger auf das Schaufensterglas tippte wie in eine Kasse. Das will ich, das auch und das, das, das. Sie machte sich ebenfalls Wunschlisten voller Perlenschmuck und geschnitzten Kamee-Broschen aus Elfenbein, sie tippte zwar nicht, aber ich konnte es an ihren Augen sehen, unsere Eintracht war kurz und herrlich, abgelenkt durch potenzielle Konsumgelegenheiten gönnten wir uns diese willkommenen Verschnaufpausen von der Realität und ihren zahlreichen logistischen Widrigkeiten.
Denn vorerst hatte die Großmutter werktags keine andere Möglichkeit, als mich mit an ihre Arbeitsstelle in den örtlichen Supermarkt zu nehmen, da am Ende des laufenden Schuljahres kein Schulplatz mehr für mich zu bekommen war. Ich fügte mich dort entgegen ihren Erwartungen sofort gut ein, als wäre ich wie geschaffen für den Lebensmittelhandel, meine einzige Aufgabe bestand hauptsächlich darin, möglichst unsichtbar und vor allem unhörbar zu sein, oft sortierte ich hinten im Lager die Trockenwaren nach Ablaufdatum oder entwirrte Faschingsschlangen und Weihnachtsgirlanden in den Kisten für die saisonale Dekoration. Ich dürfe niemanden stören oder gar von seiner Arbeit abhalten, das schärfte mir die Großmutter täglich aufs Neue ein, sonst sei die Abmachung mit der Filialleitung hinfällig und ich müsse den ganzen Tag unbeaufsichtigt in der Wohnung verbringen – eine Drohung, die ich ernst nahm, ich fühlte mich bei Weitem noch nicht bereit für kulinarische Autonomie, meine Selbstversorgungskompetenz endete bei Butterbroten, und auch das nur, wenn die Brotscheiben schon vorgeschnitten waren. Außerdem nahm meine Fantasie überhand, musste ich irgendwo zu lange allein ausharren, der knarzende Fußboden wurde dann plötzlich ebenso zur Bedrohung wie die von den Möbeln geworfenen Schatten, es war nicht unüblich, dass in solchen Situationen eine kraftraubende Lähmung einsetzte, mir kalter Schweiß die Kleidung durchnässte und ich es nicht einmal schaffte, auf die Toilette zu gehen, sondern von mir selbst immer distanzierter den Moment abwartete, in dem meine Blase dem Druck nicht mehr standhalten konnte. Also bemühte ich mich, den Anforderungen der Großmutter zu entsprechen, und konnte in meiner rasch erlernten Unsichtbarkeit nicht umhin, die Gespräche der Mitarbeiter in ihren Pausen zu belauschen, und hoffte immer, dass der Ladendetektiv einen neuen Fall zu berichten wusste. Er war die mit Abstand interessanteste Person im Supermarkt, ein optisch unauffälliger Mann, der nur aufblühte, wenn er jemanden des Diebstahls überführen konnte.
Meine Lieblingsgeschichte war die vom Tiefkühldieb, einem alten Witwer aus dem Nachbarort, offenbar geistig verwirrt, der bis zum Bezahlvorgang erfolgreich eine Packung Tiefkühlcremespinat unter seinem Altherrenhut versteckt hatte, aber schlussendlich an der Kassiererin scheiterte, welche die Preise seiner zur Tarnung legal gekauften Waren derart langsam in die Kassa tippte, dass der Eisklotz auf seinem unbehaarten Oberkopf zu einer Ohnmacht führte, aus der ihm ein peinliches Erwachen bevorstand. Er bekam Hausverbot, aber in Anbetracht seines mitleiderregenden Allgemeinzustandes nach der Verwitwung sah man von einer Anzeige ab. Ich übte danach wochenlang heimlich, ebenfalls eine Ohnmacht herbeizuführen, indem ich mir Tiefkühlware unter ein Baseballkäppi packte, hatte aber nie Erfolg, da mein dichtes Haar offenbar eine zu gute Dämmfunktion abgab.
Damit die Großmutter ungestört in die Pause gehen konnte, musste ich über Mittag immer ein kleines Nickerchen machen, auf einer Arztliege von der Art, über die normalerweise aus hygienischen Gründen eine Bahn kratziges Papier gezogen wurde, ich habe bis heute keine Ahnung, was die im Lager des Supermarktes zu suchen hatte. Es gab dort viele Dinge, die Fragen aufwarfen, weil sie im Alltag eines Lebensmittelgeschäfts unbrauchbar waren, wie eben diese Arztliege, diverse Schaufensterpuppen oder eine Kiste voll venezianischer Masken mit gerupftem Federnsaum. Das Lager als solches machte mir schon wirklich Angst, dazu hätte es keinerlei gruseliges Zubehör bedurft, ich musste in eine komplette Starre fallen, um zum einen nicht von der Liege zu rutschen und mich zum anderen an die derangierten Schaufensterpuppen zu assimilieren, die vereinzelt herumstanden, keine von ihnen mit vollständigen Körperteilen.
Ich wollte in diesem Szenario nicht durch unbedachte Bewegungen auf mich aufmerksam machen, wollte vermeiden, die Puppen zum Leben zu erwecken, und studierte dazu eine flache Atmung ein, die mich meist auch tatsächlich einschlafen ließ. Wenn ich nach