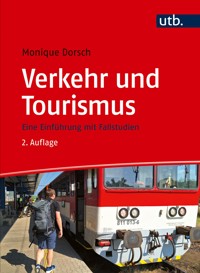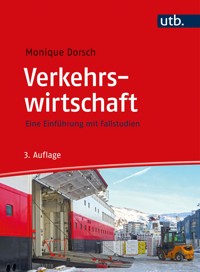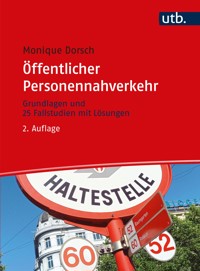
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neue ÖPNV-Konzepte vernetzt gedacht und erklärt Dieses Lehr- und Fallstudienbuch bietet sowohl eine theoretische Einführung in die Thematik "Öffentlicher Personennahverkehr" als auch 25 Fallstudien mit Lösungen. Im Zentrum der Theorie stehen die strategischen Aktionsfelder der Verkehrsunternehmen und -verbünde sowie die jeweiligen Rahmenbedingungen. Die gewählten Beispiele – überwiegend aus Deutschland und Österreich – weisen durchwegs eine hohe Komplexität auf. Geeignete Instrumente zur Analyse und Lösung solcher Problemstellungen bietet die Methodik des vernetzten Denkens. Daher erläutert die Autorin zudem die Anwendung der diesbezüglichen Instrumente. Zu jeder Fallstudie wird ein Lösungsvorschlag angeboten. Ein Vorteil dieses Buches zum öffentlichen Nahverkehr ist, dass die Fragestellungen zu den einzelnen Fällen je nach Interesse und Schwerpunktsetzung auch variiert werden können, was die Fälle universeller einsetzbar bzw. anwendbar macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
utb 5236
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Prof. Dr. Monique Dorsch lehrt Verkehrswirtschaft an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und ist Autorin mehrerer einschlägiger Lehr- und Fallstudienbücher.
Monique Dorsch
Öffentlicher Personennahverkehr
Grundlagen und 25 Fallstudien mit Lösungen
2., aktualisierte und überarbeitete Auflage
Umschlagmotiv und Buchfotos: © Monique Dorsch
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
2., aktualisierte und überarbeitete Auflage 2023
1. Auflage 2019
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838559704
© UVK Verlag 2023
– ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5236
ISBN 978-3-8252-5970-9 (Print)
ISBN 978-3-8385-5970-4 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-5970-9 (ePub)
Vorwort
Tagtäglich befördern öffentliche Verkehrsmittel Millionen von Menschen und bringen diese zur Schule, zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen, zu Freizeiteinrichtungen oder zu Freunden und Verwandten. Für regelmäßige Verkehrsmittelnutzer bedeutet dies ein Leben mit dem Fahrplan – in Ballungsgebieten i.d.R. dicht getaktet, im ländlichen Raum mitunter sehr stark ausgedünnt. Problembereiche gibt es überall, seien es Verspätungen, Überlastungserscheinungen oder eine schlechte Anbindung. Gleichzeitig wurden und werden innovative und wegweisende Konzepte realisiert, teilweise unter schwierigen Voraussetzungen. Ein Blick über den Tellerrand lohnt sich dabei allemal, müssen doch auch Regionen, Städte und Gemeinden in unseren Nachbarländern Lösungen zur Bereitstellung angemessener Mobilitätsalternativen finden.
Das vorliegende Buch versteht sich als Kombination von Lehr- und Fallstudienbuch. Es bietet zunächst eine theoretische Einführung in die Thematik „Öffentlicher Personennahverkehr“, wobei auf die strategischen Aktionsfelder der Verkehrsunternehmen und -verbünde sowie auf die Rahmenbedingungen eingegangen wird. Daran schließt sich ein Fallstudienteil mit 25 Fallstudien samt Lösungen an.
Die gewählten Beispiele weisen durchwegs eine hohe Komplexität auf. Geeignete Instrumente zur Analyse und Lösung solcher Problemstellungen bietet die Methodik des vernetzten Denkens. Daher wird einführend die Anwendung der diesbezüglichen Instrumente anhand eines Beispiels erläutert.
Übersichten am Beginn des Buches zeigen, wo die jeweiligen Schwerpunkte der Fallstudien liegen. Zu jeder Fallstudie wird ein Lösungsvorschlag angeboten, der allerdings – wie bei Fallstudien üblich – natürlich nicht die einzige mögliche Lösung ist. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Fragestellungen zu den einzelnen Fällen je nach Interesse und Schwerpunktsetzung durchaus auch variiert werden können, was die Fälle universeller einsetzbar bzw. anwendbar macht.
Als leidenschaftliche Nutzerin öffentlicher Verkehrsmittel ist es für mich immer wieder spannend, neue Konzepte auch aus Kundenperspektive zu testen und damit deren Praxistauglichkeit zu untersuchen. Vielleicht wecken die vorgestellten Beispiele bei den Lesern ebenfalls die Lust, das eine oder andere Angebot einmal auszuprobieren. Viel Vergnügen bei der gedanklichen oder auch tatsächlichen Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wünscht Ihnen
Monique Dorsch
Inhalt
Vorwort
Fallstudien-Schwerpunkte
Teil A – Öffentlicher Personennahverkehr im Überblick
1Zum Stellenwert des ÖPNV
2Rechtliche Rahmenbedingungen
3Von strategischen Überlegungen zur operativen Umsetzung
3.1Strategische Entscheidungen
3.2Marketing und Zielgruppenbestimmung
3.3Ermittlung der Nachfrage
3.4Qualität des ÖPNV
3.5Bedienformen
3.6Netz und räumliche Erschließungsqualität
3.7Fahrplan und Angebotsqualität
3.8Tarife
3.9Vertrieb und Information
3.10Anlagen des ÖPNV
3.11Verkehrssysteme und Fahrzeuge
3.12Barrierefreie Mobilität
4Organisation und Finanzierung
4.1Organisation des ÖPNV
4.2Finanzierung des ÖPNV
5ÖPNV der Zukunft
5.1ÖPNV und demographische Entwicklung
5.2Auswirkungen der Corona-Pandemie
5.3Herausforderung Personalbedarf
5.4Anforderungen an einen modernen ÖPNV
6Literaturempfehlung
Teil B – Arbeit mit Fallstudien
1Zur Bearbeitung von Fallstudien
2Instrumente des vernetzten Denkens
Teil C – Öffentlicher Personennahverkehr in Fallstudien
1Die Stadt gehört Dir. – Wiener Linien
2Erfolgreicher Stadtverkehr – Die Züri-Linie
3Emissionsreduktion in den Innenstädten – Eine Chance für den O-Bus?
4Autonom fahrende Busse – Die optimale Ergänzung?
5ÖPNV im Ehrenamt – Bürgerbusse im Vogtland
6Barrierefrei durch die Stadt – Beschaffung neuer Straßenbahnen
7Stadtbahn 2020 – Ausbau des Straßenbahnnetzes in Dresden
8Die Straßenbahn kommt – Neubauten in Schweden und Dänemark
9Die erste U-Bahn der Schweiz – Metro Lausanne
10Eine länderverbindende U-Bahn – Die Öresund-Metro
11Seit über 15 Jahren im Takt – S-Bahn Tirol
12Neues Nahverkehrsflaggschiff der ÖBB – Der Cityjet
13Alte Trasse erfolgreich wiederbelebt – Die Vinschgerbahn
14Wasserstoff als alternativer Antrieb – Die Zillertalbahn
15Vom Umland umsteigefrei in die City – Das Chemnitzer Modell
16Aus 2 mach 1 – Die Traunseetram
17Gondeln im städtischen Verkehr – Urbane Seilbahnen
18Vertaktet durchs Vogtland – Der PlusBus
19Mobil am Wochenende – Das „Vreizeitnetz“ im Vogtland
20Ein grenzüberschreitendes Nahverkehrssystem – Das EgroNet
21Elektronisches Fahrgeldmanagement – (((eTicket Deutschland
22Ein alternatives Tarifsystem – Der „Südtirol Pass“
23Unentgeltlich unterwegs – Die Altstadt-Bim in Graz
24Erlebnis- und Vorteilskarten – Mobil in der Ferienregion „Meraner Land“
25Mobilität als Wettbewerbsvorteil von Hochschulen – Semestertickets
Fallstudien-Schwerpunkte (1/3)
Fallstudien-Schwerpunkte (2/3)
Fallstudien-Schwerpunkte (3/3)
Teil A
Öffentlicher Personennahverkehr im Überblick
1Zum Stellenwert des ÖPNV
„Was ist öffentlicher Verkehr? Mit Bussen und Bahnen des öffentlichen Verkehrs zu fahren heißt, zu Zeiten, die einem nicht richtig passen, mit Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat, zu einer Haltestelle zu fahren, die eigentlich nicht das Ziel der Reise ist.“1
Rund 31 Mio. Fahrgäste nutzten 2019 täglich den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).2 Aufgrund der Corona-Pandemie war in den Jahren 2020 und 2021 ein starker Rückgang bei den Fahrgastzahlen zu verzeichnen. Die Nutzerzahlen langen in diesen Jahren bei etwa zwei Drittel des Jahres 2019. Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen sowie das 9-Euro-Ticket führten 2022 zu einem Anstieg der Fahrgastzahlen, wenngleich die Vor-Pandemie-Werte noch nicht erreicht wurden.3
In den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs sind 310.600 Beschäftigte in öffentlichen und privaten Unternehmen zur Erfüllung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge tätig, wobei jeder hier bestehende Arbeitsplatz zwei weitere in Deutschland nach sich zieht.4
ÖPNV in Ballungsgebieten …
… und im ländlichen Raum
Insbesondere in Ballungsräumen ist zu ihrer verkehrsbezogenen Entlastung die Sicherung der Mobilität von Relevanz. In den Regionen soll der ÖPNV zur Schaffung annähernd gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen. Täglich sind dafür rund 60.000 Busse und Bahnen in Deutschland im Einsatz, wobei die Linienbusse mehr als die Hälfte davon ausmachen. Durch Fahrten mit diesen Verkehrsmitteln können täglich etwa 20 Mio. Autofahrten ersetzt werden.5 Die Systemvorteile von Bus und Bahn ermöglichen eine Entlastung der Umwelt und eine Reduzierung klimarelevanter Emissionen. Von Bedeutung ist hierbei insbesondere der Schienenpersonennahverkehr, der – durch Fahrzeuggröße und entsprechende Vertaktung – eine effiziente Abwicklung großer Pendlerströme ermöglichen kann.6
Im Rahmen der Erhebung „Mobilität in Deutschland“ wurde folgender Modal Split, gegliedert nach Raumtypen, ermittelt:
Tabelle 1-1 Modal Split nach Raumtyp7
Nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung des ÖPNV als Wirtschafts- und Standortfaktor. Viele der direkt bzw. indirekt aus dem ÖPNV resultierenden Arbeitsplätze weisen eine regionale Bindung auf und können somit nicht ins Ausland verlagert werden.8
Auch die Produktion von Fahrzeugen für den ÖPNV hat Auswirkungen auf die Beschäftigung. Durch die Herstellung von Kleinserien, die auf spezielle Anforderungen von Betreibern und genehmigenden Behörden angepasst werden müssen, ist ein Automatisierungs- bzw. Standardisierungsgrad wie in der Automobilindustrie nicht möglich. Zudem ist die Instandhaltung der Fahrzeuge sowie auch der Infrastruktur beschäftigungsintensiv.9
1 Dziekan, Katrin: Öffentlicher Verkehr, in: Schwedes, Oliver (Hrsg.): Verkehrspolitik – Eine interdisziplinäre Einführung, Wiesbaden 2011, 317
2 vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 124 vom 8. April 2020, https://www.destatis.de, 02.01.2023
3 vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 152 vom 7. April 2022, https://www.destatis.de, 02.01.2023; Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 401 vom 21. September 2022, https://www.destatis.de, 02.01.2023
4 vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Daten & Fakten: Statistik zum öffentlichen Personennahverkehr und Schienengüterverkehr in Deutschland, https://www.vdv.de, 02.01.2023
5 vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Daten & Fakten Personen- und Schienengüterverkehr, http://www.vdv.de, 09.09.2020
6 vgl. Dorsch, Monique: Verkehrswirtschaft, Plauen 2005, 102ff; Daduna, Joachim; Bornkessel, Steffen: Pendlerverkehre als Herausforderung an den öffentlichen Schienenpersonennahverkehr, in: Lasch, Rainer; Lemke, Arne (Hrsg.): Wege zu einem zukunftsfähigen ÖPNV, Berlin 2006, 185ff
7 erstellt nach: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Mobilität in Deutschland, Berlin 2018, 17
8 vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Daten & Fakten Personenverkehr, http://www.vdv.de, 29.01.2019
9 vgl. Union Internationale des Transports Publics: Der ÖPNV schafft grüne Arbeitsplätze und fördert ein integratives Wachstum, Brüssel 2013, 4
2Rechtliche Rahmenbedingungen
Der öffentliche Verkehr lässt sich gliedern in den öffentlichen Personenfernverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr. Bei letzterem kann weiter differenziert werden in Regional- und Stadtverkehr, die wiederum als öffentlicher Straßenpersonennahverkehr oder Schienenpersonennahverkehr auftreten können.
Abbildung 2-1 Systematisierung des öffentlichen Personenverkehrs10
Während im Fernverkehr rund ein Drittel der Verkehrsleistungen im öffentlichen Personenverkehr erbracht wird, sind die anderen beiden Drittel dem Nahverkehr zuzurechnen. Anders aber als der Fernverkehr unterliegt der Nahverkehr einer besonderen rechtlichen und politischen Reglementierung.
Zum ÖPNV werden „Betriebe, die den Personenverkehr in Ballungsgebieten, innerhalb von Gemeinden, von Gemeindeverbänden oder von Regionen betreiben“11, gerechnet. Nach § 8 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) versteht man unter ÖPNV „die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, Obussen und Kraftfahrzeugen im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt.“ Zum ÖPNV zählt nach § 8 Abs. 2 des PBefG auch „Verkehr mit Taxen oder Mietwagen, der eine der in Absatz 1 genannten Verkehrsarten ersetzt, ergänzt oder verdichtet.“
Nach § 2 Abs. 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes wird der Schienenpersonennahverkehr analog dazu definiert als „die allgemein zugängliche Beförderung von Personen in Zügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Zuges die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt.“
ÖPFV: EC, Kirchberg/Tirol
ÖSPV: Stadtbus, Namur
SPNV in der Region: Regionalbahn, Vogtland
SPNV in der Stadt: Straßenbahn, Zagreb
ÖPNV-Definitionen in Nachbarländern
Anders als in Deutschland, verzichtet man in Österreich hierbei auf genaue Entfernungsbzw. Zeitangaben und definiert wie folgt: „Unter Personennahverkehr […] sind Verkehrsdienste zu verstehen, die den Verkehrsbedarf innerhalb eines Stadtgebietes (Stadtverkehre) oder zwischen einem Stadtgebiet und seinem Umland (Vorortverkehre) befriedigen.“12 In Abgrenzung dazu versteht man unter Personenregionalverkehr „nicht unter den Anwendungsbereich der Bestimmung des Abs. 1 fallende Verkehrsdienste […], die den Verkehrsbedarf einer Region bzw. des ländlichen Raumes befriedigen.“13
Anstelle des Begriffs Nahverkehr ist in der Schweiz die Bezeichnung Ortsverkehr gebräuchlich. Davon abgegrenzt werden Regional- und Fernverkehr.14
Für die im ÖPNV eingesetzten Schienenfahrzeuge gelten unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. Während Straßenbahnen und U-Bahnen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen (BOStrab) unterliegen, greift bei S-Bahnen und Regionalbahnen, die den Eisenbahnen zuzurechnen sind, die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO).
Das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) definiert Eisenbahnen als „öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen (Eisenbahnverkehrsunternehmen) oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben (Eisenbahninfrastrukturunternehmen).“15
Nach dem Unternehmenszweck werden Eisenbahnverkehrsunternehmen und Eisenbahninfrastrukturunternehmen unterschieden. Hauptaufgabe der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist das Erbringen von Transportdienstleistungen. Zu den Aufgaben von Eisenbahninfrastrukturunternehmen zählen die Bereitstellung und der Unterhalt von Schienenwegen, Fahrplankonstruktion sowie das Betreiben von Betriebsleit- und Sicherungssystemen.16
Als öffentliche Eisenbahnen gelten all jene Eisenbahnverkehrsunternehmen, die „gewerbs- oder geschäftsmäßig betrieben werden und jedermann sie nach ihrer Zweckbestimmung zur Personenoder Güterbeförderung benutzen kann“17 sowie alle Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die „Zugang zu ihrer Eisenbahninfrastruktur gewähren müssen“.18 Ebenso zählen Betreiber von Schienenwegen, sofern sie Zugang zu ihren Schienenwegen gewähren müssen, zu den öffentlichen Eisenbahnen.19 Alle übrigen Eisenbahnen stellen nicht-öffentliche Eisenbahnen dar.20 Anfang 2023 existierten ca. 500 öffentliche und ca. 130 nicht-öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen und Fahrzeughalter in Deutschland.21
Eisenbahnen des Bundes sind „Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden.“22Nichtbundeseigene Eisenbahnen, die auch als Privatbahnen bezeichnet werden, sind demzufolge Eisenbahnen, die sich nicht überwiegend in der Hand des Bundes befinden.
Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz, RegG) gilt die Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Leistungen des öffentlichen Personenverkehrs als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der öffentlichen Hand obliegt damit eine gewisse Verantwortung in Bezug auf die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung. Dabei muss die Daseinsvorsorge nicht von der öffentlichen Hand selbst erbracht, sondern es müssen lediglich Rahmenbedingungen zur Erbringung der Leistungen durch Dritte sowie zur Kontrolle geschaffen werden. Daseinsvorsorge im Bereich des Verkehrs stellt eine zumindest mittelfristig ausgelegte Politik des Staates dar. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Subsidiarität und wird von den Aufgabenträgern auf der jeweils zuständigen gebietskörperschaftlichen Ebene übernommen.
Die meisten Landesnahverkehrsgesetze definieren den ÖPNV als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch die kommunalen Aufgabenträger (kreisfreie Städte, Landkreise). Freiwilligkeit heißt in diesem Zusammenhang, dass der Aufgabenträger (im Rahmen der Nahverkehrsgesetze) über die Art und den Umfang der Aufgabenerfüllung entscheidet.
Bei der Erstellung von Verkehrsdienstleistungen unterliegt der ÖPNV verschiedenen Grundpflichten, die im Personenbeförderungsgesetz verankert sind.
Betriebspflicht: Für den Zeitraum, in dem der Betrieb genehmigt ist, muss der Unternehmer diesen aufnehmen und entsprechend der öffentlichen Interessen sowie gemäß dem aktuellen technologischen Stand aufrechterhalten.23
Beförderungspflicht: Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist der Unternehmer grundsätzlich verpflichtet, Fahrgäste zu befördern. Zu diesen Voraussetzungen zählen die Einhaltung der Beförderungsbedingungen und die Durchführung der Beförderung mit den regelmäßig eingesetzten Fahrzeugen. Keine Beförderungspflicht liegt vor, wenn besondere Umstände, die der Unternehmer nicht beeinflussen kann, eine Beförderung verhindern.24
Tarifpflicht: Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, verbindliche Tarife festzulegen, zu kommunizieren und gleichmäßig anzuwenden. Die Tarife bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Genehmigungsbehörde.25
Fahrplanpflicht: Anfangs- und Endpunkte einer Linie, deren Verlauf inklusive Haltestellen sowie die jeweiligen Abfahrtszeiten müssen in einem Fahrplan enthalten sein.26
Vergleichbare Regelungen bestehen in Österreich und der Schweiz.27
Ziel der Novellierung des Personenbeförderungsrechts 2021 war, eine gesetzliche Basis für das Angebot neuer digitaler Mobilitätsdienstleistungen bzw. Geschäftsmodelle des Gelegenheitsverkehrs bereitzustellen, die sich bisher im Graubereich befanden bzw. über Sondergenehmigungen liefen. Dazu gehören beispielsweise app-basierte Sammelfahrten, welche in Konkurrenz zu Taxibetrieben treten. Durch die Neuregelung soll zum einen digitalen Geschäftsmodellen mehr rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit geboten werden, zum anderen soll weiterhin ausschließlich das Taxigewerbe spontan Fahrgäste aufnehmen dürfen.28
10 erstellt nach: Dziekan, Katrin: Öffentlicher Verkehr, in: Schwedes, Oliver (Hrsg.): Verkehrspolitik – Eine interdisziplinäre Einführung, Wiesbaden 2011, 318; Kummer, Sebastian: Einführung in die Verkehrswirtschaft, Wien 2010, 373
11 Brauer, Karl M.: Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs – Erster Teil: Tätigkeitsbestimmungen der Verkehrsbetriebe, Berlin 1991, 60
12 § 2 Abs. 1 Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs 1999
13 § 2 Abs. 2 Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs 1999
14 vgl. Art. 16 Bundesgesetz über die Personenbeförderung (Personenbeförderungsgesetz) vom 20. März 2009 (Stand 1. März 2018)
15 § 2 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz
16 vgl. Pachl, Jörn: Systemtechnik des Schienenverkehrs, Wiesbaden 2011, 4
17 § 3 Abs. 1 Satz 1 Allgemeines Eisenbahngesetz
18 § 3 Abs. 1 Satz 2 Allgemeines Eisenbahngesetz
19 vgl. § 3 Abs. 1 Satz 3 Allgemeines Eisenbahngesetz
20 § 3 Abs. 2 Allgemeines Eisenbahngesetz
21 vgl. Eisenbahn-Bundesamt: Liste der in Deutschland genehmigten öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen (21.02.2023), https://www.eba.bund.de, 10.03.2023; Eisenbahn-Bundesamt: Liste der in Deutschland genehmigten nicht-öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie Fahrzeughalter (gem. § 31 AEG) (21.02.2023), https://www.eba.bund.de, 10.03.2023
22 § 2 Abs. 6 Allgemeines Eisenbahngesetz
23 vgl. § 21 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz
24 vgl. § 22 Personenbeförderungsgesetz
25 vgl. § 39 Personenbeförderungsgesetz
26 vgl. § 40 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz
27 vgl. § 20 Bundesgesetz über die linienmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 1999; Art. 12-15 Bundesgesetz über die Personenbeförderung vom 20. März 2009 (Stand 1. März 2018)
28 vgl. Bundesministerium für Digitales und Verkehr: Moderne Personenbeförderung – fairer Wettbewerb, klare Steuerung (26.07.2022), https://bmdv.bund.de, 06.01.2023; Umweltbundesamt (Hrsg.): Personenbeförderungsgesetz-Novelle 2021 – Kurzbewertung der Ergebnisse aus Umweltsicht, Dessau-Rosslau 2021, 5ff
3Von strategischen Überlegungen zur operativen Umsetzung
3.1Strategische Entscheidungen
Die strategische Ausrichtung eines Verkehrsunternehmens kann mithilfe von qualitativen und quantitativen Konzeptstrategien, Wettbewerbs- und Kooperationsstrategien beschrieben werden.
Tabelle 3-1 Strategische Ausrichtung29
Im Rahmen der qualitativen Konzeptstrategien geht es um die Definition von Netzstruktur und Produktpalette:
Das Netz, als entscheidende Komponente des Angebots, kann der Erschließung der Fläche dienen oder sich auf Hauptachsen konzentrieren.
Die Produktpalette kann eine einheitliche Leistung oder differenzierte Leistungen (z.B. unterschiedliche Komfortklassen) bieten. Eine einheitliche Leistung bringt den Vorteil der Standardisierung der Prozesse und einer effizienten Abwicklung mit sich. Für den Nachfrager bleibt das Angebot leicht verständlich und überschaubar. Mit steigender Reisedauer und -entfernung nimmt auch das Bedürfnis nach einer zielgruppenspezifischen Ausrichtung und verschiedenen Zusatzleistungen zu.30
Bei den quantitativen Konzeptstrategien stehen Bedienungshäufigkeiten und Kapazitäten, die zusammen die Gesamtproduktion des Unternehmens ergeben, im Mittelpunkt:
Bei der Erarbeitung der Fahrpläne sind die Daten der Fahrzeuge und Strecken (z.B. Höchstgeschwindigkeiten), Stationen (z.B. verfügbare Gleisanlagen) sowie zum Personal (z.B. Dienstpläne) zu berücksichtigen. Daraus und aus der Nachfrage resultierend kann ein gestraffter Fahrplan oder ein dichter Fahrplan angeboten werden. Mit gestrafften Fahrplänen lassen sich Beförderungswünsche bündeln; dichte Fahrpläne kommen dem Wunsch der Fahrgäste nach möglichst großer Flexibilität entgegen.
Die Ermittlung der Kapazität eines Verkehrssystems erfolgt durch Multiplikation der Anzahl der Fahrten laut Fahrplan mit der Fahrzeugkapazität. Je nach Nachfrage kommen dabei große oder kleine Fahrzeuge zum Einsatz. Auch die Traktionsfähigkeit der Fahrzeuge ist hier von Bedeutung. Allerdings lassen sich Kapazitäten dadurch nur sprunghaft steuern. Große Fahrzeuge führen zu geringen direkten Betriebskosten pro Passagier. Bei kleinen Fahrzeugen sind diese Kosten entsprechend höher; allerdings lassen sich so häufigere Verbindungen anbieten. Ebenso von Bedeutung sind Komfort und die für die Fahrgäste angestrebte Sicherheit (vgl. Sitzplätze vs. Stehplätze).31
Bezüglich des Wettbewerbs sind Preis- oder Qualitätsorientierung bzw. konservatives oder innovatives Verhalten denkbar:
Bei einer Konzentration auf den Preis sollen Nachfragesteigerungen durch eine möglichst günstige Beförderungsleistung realisiert werden. Erreicht wird dies i.d.R. durch eine Einschränkung bzw. den Verzicht auf über die reine Beförderung hinausgehende Serviceleistungen. Qualitätsorientierung hingegen zielt auf einen die Beförderungsleistung ergänzenden Mehrwert ab, der eine Unterscheidung zur Konkurrenz darstellt und den die Kunden auch bereitwillig zahlen.
Während marktwirtschaftliche Unternehmen eher innovativ tätig sind, um im Wettbewerb bestehen und ihre strategische Ausgangsposition ausbauen zu können, sind staatlich eingebundene Betriebe – auch aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen – eher durch konservatives Verhalten gekennzeichnet.32
In Bezug auf das Marktverhalten können je nach Form und Intensität unterschiedliche Kooperationsstrategien, wie z.B. strategische Allianzen, verfolgt werden. Dabei gilt es, Synergieeffekte (wie vereinfachte Koordination, leichtere Kundenansprache oder Kostenreduktion) durch Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern umzusetzen.33
3.2Marketing und Zielgruppenbestimmung
Lange Zeit wurde die Bedeutung des Marketings für öffentliche Verkehrsbetriebe unterschätzt. Man war der Ansicht, ein entsprechendes Angebot spreche für sich. Übersehen wurde dabei aber Folgendes: „Größtes Zugangshemmnis zum ÖPNV ist die unzureichende Information über das ÖPNV-Angebot, woraus sich ein negatives ÖPNV-Image ergibt mit der Folge, dass die Nutzung des PKW Vorrang vor dem Öffentlichen Verkehrsmittel erhält.“34
Um ein angemessenes Angebot in Städten und Regionen bereitzustellen, dauerhaft erfolgreich zu sein und effizient mit den bereitgestellten finanziellen Mitteln arbeiten zu können, müssen nicht nur bestehende Kunden gehalten, sondern auch neue Zielgruppen gewonnen werden.35 Dazu bedarf es eines abgestimmten Marketing-Konzepts.
Marketing kann definiert werden als „eine umfassende Philosophie und Konzeption des Planens und Handelns […], bei der – ausgehend von systematisch gewonnenen Informationen – alle Aktivitäten eines Unternehmens konsequent auf die gegenwärtigen Erfordernisse der Märkte ausgerichtet werden, mit dem Ziel der Befriedigung von Bedürfnissen des Marktes und der individuellen Ziele.“36
Marketing beginnt lange vor dem eigentlichen Verkauf und wirkt über das Kaufereignis hinaus. Es kann als Bindeglied verschiedener Aktivitäten (z.B. Marktforschung, Produktentwicklung, Werbung, Distribution, Preispolitik) verstanden werden, die auf die Befriedigung der Kundenbedürfnisse und die Erfüllung der Unternehmensziele hinarbeiten.
Unter Marketing-Mix versteht man aufeinander abgestimmte strategische Entscheidungen in Bezug auf Produkt bzw. Dienstleistung, Preis, Distribution und Kommunikation mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Kunden einer ausgewählten Zielgruppe möglichst optimal in Hinblick auf ihre Kaufentscheidung anzusprechen. Die Variationsmöglichkeiten bei der Zusammenstellung eines Marketing-Mix sind zahlreich.
Die Produktpolitik – vielfach auch „das Herz des Marketings“ genannt – ist einer der wichtigsten Bestandteile des gesamten Marketinginstrumentariums. Sie stellt gemeinsam mit den drei anderen wesentlichen absatzpolitischen Instrumenten Kommunikationspolitik, Distributionspolitik und Kontrahierungspolitik eine zentrale unternehmerische Aktivität dar. Dies trifft gleichermaßen auf den Konsumgüter-, Investitionsgüter- und Dienstleistungsbereich zu. Speziell in letzterem werden die klassischen vier Ps ergänzt durch Personalpolitik („Personnel“), Ausstattungspolitik („Physical Facilities“) und Prozesspolitik („Process Management“).
Überträgt man dies auf den ÖPNV, lassen sich die Themenschwerpunkte Verkehrsangebot (Produkt, Ausstattung, Prozess), Tarif, Vertrieb, Kundenkommunikation und Personal identifizieren:
Produktpolitik: Linienführung und Liniennetz, Fahrplan;
Ausstattungspolitik: Haltestellen, Fahrzeuge, Information und Service;
Prozesspolitik: Zugangs-, Warte-, Fahr-, Umsteige- und Abgangszeiten;
Preispolitik: Tarifgestaltung (genehmigungspflichtig), Preisdifferenzierung, Fahrausweisgestaltung;
Distributionspolitik: Absatzwege, Absatzorgane;
Kommunikationspolitik: Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring;
Personal: Qualifikation, Kundenorientierung.37
Mit Humor Aufmerksamkeit erzeugen, Berliner Verkehrsbetriebe
Begleitende Werbung zur Einführung eines preiswerten Jahrestickets, Verkehrsverbund Tirol
Ein Dank an zahlende Kunden in Oslo, Ruter
Anregung zum Umstieg auf den ÖPNV, Verkehrsverbund Tirol
Entscheidend für die Erarbeitung und erfolgreiche Umsetzung von Marketingmaßnahmen sind umfassende Kenntnisse zu den Zielgruppen. Ziel einer Segmentierung der Nachfrage ist das Erkennen homogener Gruppen und die Bereitstellung der notwendigen Informationen für eine zielgruppenorientierte Marketingpolitik.
Öffentliche Verkehrsmittel werden täglich von den verschiedensten Menschen genutzt, die bezüglich ihrer sozio-demographischen, psychographischen und verhaltensbezogenen Merkmale Unterschiede aufweisen. Diese Menschen gilt es in homogene Teilgruppen aufzuspalten und möglichst zielgerichtet anzusprechen.
Eine Marktsegmentierung wird zunächst häufig nach der Verkehrsmittelnutzung vorgenommen, woraus sich für den ÖPNV grob die Gruppen der Nichtkunden, Gelegenheitskunden und Stammkunden ableiten lassen. Bei letzteren kann eine weitere Unterteilung z.B. nach Fahrtzweck (vgl. Ausbildungs- und Berufsverkehr) oder nach soziodemographischen Merkmalen (vgl. Kinder und Jugendliche, Senioren) erfolgen.38
Wenig Mobile
nur selten unterwegs, kein Pkw
Fahrradfahrer
im Alltag überwiegend Fahrradnutzung, kein Pkw
ÖPNV-Captives
im Alltag überwiegend ÖPNV-Nutzung, kein Pkw aus Kosten- oder anderen Gründen
ÖPNV-Stammkunden
im Alltag überwiegend ÖPNV-Nutzung, mit Pkw oder bewusster Verzicht
Multimobile
im Alltag multimodal unterwegs, Pkw-Besitz oder -Verfügbarkeit
ÖPNV-Vermeider
Pkw-Besitz oder -Verfügbarkeit, gute ÖPNV-Anbindung, aber abgeneigt
MIV-Captives
Pkw-Besitz oder -Verfügbarkeit, schlechte ÖPNV-Anbindung
Tabelle 3-2 Segmentierung nach der Verkehrsmittelnutzung39
Erkenntnisse zu den Zielgruppen werden überwiegend aus statistischen Quellen gewonnen, ohne dabei ein konkretes Bild von einem typischen Fahrgast zu bekommen. Um Kundenbedürfnisse wirklich befriedigen zu können, ist aber eine Betrachtung des Angebots aus Perspektive der (potenziellen) Kunden erforderlich. Typische Kunden müssen hierbei für alle beteiligten Entscheidungsträger plausibel und einprägsam dargestellt werden.40
Eine Möglichkeit dazu bietet die Persona-Methode, bei der ausgehend von internem wie externem Datenmaterial fiktive Nutzer entwickelt und beschrieben werden. „Bei dieser Methode werden stereotypische Fahrgäste konstruiert, die ähnlich realer Fahrgäste unterschiedliche Verhaltensweisen, Profile und Ziele besitzen. Eine Persona entspricht dabei nicht einer konkreten realen Person, sondern stellt einen typischen Fahrgast dar, der aus verschiedenen Eigenschaften und Verhaltensweisen zusammengesetzt wird. Eine konkrete Beschreibung dieser fiktiven Persönlichkeit in Form einer Erzählung trägt zur Verständlichkeit und Einprägsamkeit der Persona bei. Im Gegensatz zu traditionellen Zielgruppen wird der Fahrgast auf diese Weise nicht nur anhand seiner demografischen Merkmale oder Kaufvariablen eingeordnet, sondern erhält mit individuellen Zielen und sozialen Merkmalen einen greifbaren Charakter.“41
Bei der Entwicklung von Personas im ÖPNV-Sektor kann man sich von folgenden Themenkomplexen leiten lassen: Nutzungshäufigkeit, Ortskenntnis, Angebotskenntnis, Fahrtzweck, genutzte Fahrscheine, demographische Daten, mögliche Einschränkungen.42 Auf diese Art und Weise bekommen die Kunden ein Gesicht. Entscheidungsträgern fällt es leichter, das ÖPNV-Angebot und etwaige Defizite mit den Augen von Kunden zu sehen. Zudem werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen besser deutlich.
3.3Ermittlung der Nachfrage
Nachfrage bezeichnet den Wunsch nach spezifischen Produkten oder Dienstleistungen und wird dabei von der Fähigkeit und Bereitschaft, diese zu erwerben, begleitet. Um die Nachfrage nach Verkehrsdienstleistungen analysieren, prognostizieren und darauf aufbauend verkehrspolitische Maßnahmen planen zu können, sind zunächst genaue Informationen über das Verkehrsverhalten der Individuen notwendig. Dabei fließen – je nach Fragestellung – Informationen über Häufigkeit, Ziel, Zweck und benutztes Verkehrsmittel einzelner Wege ein. Zudem sind Daten über die Merkmale von Wegen und Verkehrsteilnehmern zu erfassen.
Die Nachfrage im ÖPNV kann mithilfe von Fahrgastzählungen, -befragungen oder auch automatischen Zählsystemen ermittelt werden. Ebenso lassen sich Verkaufsstatistiken der Fahrscheine auswerten. In regelmäßigen Abständen geben z.B. Aufgabenträger, Verkehrsverbünde oder Eisenbahnverkehrsunternehmen solche Analysen in Auftrag bzw. führen sie selbst durch. Die dabei erhobenen Daten lassen sich in verschiedenen Kennzahlen darstellen:
Anzahl Fahrgäste: Bei einer reinen Fahrgastzählung wird nicht erfasst, ob und wie oft der Fahrgast umgestiegen ist und dabei unterschiedliche Verkehrsmittel verschiedener Anbieter im Bedienungsgebiet genutzt hat. Aufschlussreicher wäre hier eine – allerdings wesentlich aufwendigere – Befragung.
Personenkilometer: Dieser Wert stellt das Produkt aus der Anzahl der Fahrgäste und ihrer durchschnittlichen Reiseweite dar. Dabei lassen sich die Werte leichter den jeweiligen Linien und Verkehrsunternehmen zurechnen.43
Bei neu zu konzipierenden Linien bzw. Netzen kann man allerdings auf derartige Daten nicht zurückgreifen, sondern muss Fahrgastpotenziale abschätzen.
Das Verkehrsaufkommen in einem Gebiet resultiert aus verschiedenen Faktoren. Dazu zählen z.B. die Bevölkerungsstruktur, die Bebauungsart, die Art und Anzahl sozialer, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, vorhandene Arbeitsplätze, das bestehende Verkehrsangebot und die Verkehrsmittelwahl der Einwohner sowie die Lage des Gebiets und seine Einbindung in das überregionale Verkehrsnetz.44
Abbildung 3-1 Das Verkehrsaufkommen beeinflussende Faktoren in einem Gebiet45
In Großstädten geht man davon aus, dass etwa 20 % aller Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt werden; in Mittelstädten liegt der Anteil bei ca. 10 %, im ländlichen Raum bei 5 %.46 Als Richtwerte können – je nach Stadtgröße – auch folgende Angaben zum Fahrtenaufkommen dienen:
Stadtgröße
Fahrtenaufkommen
Großstadt (über 400.000 Einwohner)
0,55-0,75 Fahrten/Einwohner/Tag
Großstadt (bis 400.000 Einwohner)
0,40-0,60 Fahrten/Einwohner/Tag
Mittelstadt (bis 100.000 Einwohner)
0,20-0,40 Fahrten/Einwohner/Tag
Kleinstadt (bis 30.000 Einwohner)
0,10-0,30 Fahrten/Einwohner/Tag
Tabelle 3-3 ÖPNV-Fahrtenaufkommen nach Stadtgröße47
In der Literatur werden 200 Einwohner als Mindestgröße für die Anbindung eines Gebiets an den ÖPNV genannt. Dabei sollten rund 80 % im Einzugsbereich der betreffenden Haltestelle wohnen.48
3.4Qualität des ÖPNV
Die Qualität des ÖPNV kann anhand der Bedienungsqualität und der Beförderungsqualität gemessen werden.
Die Bedienungsqualität resultiert aus der räumlichen und zeitlichen Bedienung. Von Bedeutung sind dabei das räumliche Beförderungsangebot, die Anbindung bzw. Erreichbarkeit einer Region. Die Qualität der zeitlichen Bedienung leitet sich aus Faktoren wie Bedienungshäufigkeit, Betriebszeiten und Betriebstagen, der zeitlichen Abstimmung des Angebots, dem Platzangebot bzw. dem Besetzungsgrad von Fahrzeugen sowie einer angemessen Angebotsdifferenzierung ab.
Die Beförderungsqualität wird demgegenüber von den Gebrauchswertmerkmalen bestimmt. Dazu zählt beispielsweise, wie Fahrzeuge und Haltestellen ausgestattet sind, wie Vertrieb und Information organisiert sind, wie man bei Störungen reagiert oder inwieweit die Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Personen Berücksichtigung finden.
Qualität des ÖPNV
Bedienungsqualität(Qualität der räumlichen und zeitlichen Bedienung)
Beförderungsqualität(Summe der Gebrauchswertmerkmale einer Beförderungsleistung)
Erschließungsqualität
Angebotsqualität
räumliches Beförderungsangebot
Anbindung
Erreichbarkeit
zeitliches Beförderungsangebot (d.h. Bedienungshäufigkeit, Betriebstage, Betriebszeit)
zeitliche Angebotskoordinierung (d.h. Anschlussplanung und -sicherung)
Platzangebot
marktgerechte Angebotsdifferenzierung
Ausstattung von Haltestellen und Fahrzeugen
Anschluss- und Betriebsstörungsmanagement
Information und Vertrieb
Anforderungen an das Personal im Fahr- und Vertriebsdienst
Belange mobilitätseingeschränkter Personen
Sicherheit
Tabelle 3-4 Qualität im ÖPNV49
Die Kundenzufriedenheit mit deutschen ÖPNV-Anbietern wird jährlich in einem ÖPNV-Kundenbarometer ermittelt. Dabei werden neben Aspekten des Nutzungsverhaltens und der Soziodemographie die wichtigsten Leistungsmerkmale des ÖPNV abgefragt. Dazu gehören
allgemeine, den ÖPNV insgesamt betreffende Merkmale (z.B. Linien- und Streckennetz, Anschlüsse, Taktfrequenz, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, Informationen bei Störungen und Verspätungen, Tarifsystem, Preis-Leistungs-Verhältnis, Fahrkartenverkaufsstellen, Freundlichkeit des Personals, Internetauftritt, Aktivitäten zur Umweltschonung) sowie
spezifische Merkmale, die sich auf die Fahrzeuge (z.B. Sauberkeit und Gepflegtheit, Komfort und Bequemlichkeit, Platzangebot, Information im Fahrzeug, Sicherheit, Zugang und Nutzung für mobilitätseingeschränkte Personen) und
die Stationen (z.B. Sauberkeit und Gepflegtheit, Komfort und Ausstattung, Sicherheit, Zugang und Nutzung für mobilitätseingeschränkte Personen) beziehen.50
3.5Bedienformen
Unter Verkehrsbedienung versteht man „die Möglichkeit, Fahrziele durch ein Netz öffentlicher Verkehrsmittel zu erreichen.“51
Vorherrschende Bedienungsform im ÖPNV ist der Linienverkehr. Nach dem Personenbeförderungsgesetz wird Linienverkehr definiert als „eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können. Er setzt nicht voraus, daß ein Fahrplan mit bestimmten Abfahrts- und Ankunftszeiten besteht oder Zwischenhaltestellen eingerichtet sind.“52
Beim klassischen Linienverkehr werden gemäß Fahrplan beide Richtungen einer Linie über die gesamte Länge befahren und dabei alle Haltestellen bedient. Die Fahrgäste müssen ihre Fahrtwünsche nicht anmelden. Dadurch kann es aber auch dazu kommen, dass bei Fahrten nur sehr wenige oder gar keine Fahrgäste befördert werden. Die Einrichtung von Linienverkehren bietet sich dann an, wenn mit einer regelmäßigen Nachfrage zu rechnen ist.53 Sonderformen des Linienverkehrs stellen die Beförderung von „Berufstätigen zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (Berufsverkehr), Schülern zwischen Wohnung und Lehranstalt (Schülerfahrten), Personen zum Besuch von Märkten (Marktfahrten), Theaterbesuchern“54 dar. In das novellierte Personenbeförderungsgesetz zusätzlich aufgenommen wurde der Linienbedarfsverkehr, welcher „der Beförderung von Fahrgästen auf vorherige Bestellung ohne festen Linienweg zwischen bestimmten Einstiegs- und Ausstiegspunkten innerhalb eines festgelegten Gebietes und festgelegter Bedienzeiten dient“.55
Vom Linienverkehr abzugrenzen sind der Gelegenheitsverkehr und der freigestellte Verkehr. Unter Gelegenheitsverkehr wird die „Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, die nicht Linienverkehr nach den §§ 42, 42a, 43 und 44 ist“ verstanden.56 Er tritt in den Formen Verkehr mit Taxen, Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen, Verkehr mit Mietomnibussen und mit Mietwagen sowie als gebündelter Bedarfsverkehr auf.57 Bei freigestellten Verkehren handelt es sich um Beförderungsfälle, die von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes freigestellt sind, z.B. die Beförderung mit Kraftfahrzeugen durch oder für Schulträger zum und vom Unterricht.58
In Bezug auf die räumliche Erschließung eines Gebietes lassen sich verschiedene typische Linienformen unterscheiden:
Eine Durchmesserlinie führt durch das Stadtzentrum hindurch und verbindet dabei Ziele jenseits des Stadtrandes. Für Fahrgäste mit derartigen Fahrtwünschen besteht also keine Umsteigenotwendigkeit. Allerdings können bei diesen i.d.R. recht langen Linien Verspätungen nur schwer abgebaut werden.
Eine Radiallinie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrten im Stadtzentrum enden und dort Umsteigemöglichkeiten bestehen. Anders als bei der Durchmesserlinie sind die Fahrten hier vergleichsweise kurz, so dass – auch durch die eingeplanten Wendezeiten an den Zielhaltestellen – Verspätungen leichter abgebaut werden können.
Eine Ringlinie stellt oft eine Ergänzung zu bestehenden Linien dar. Schwierig erweist sich das Festlegen von Anfangs- und Endpunkt.
Eine Tangentiallinie führt am Stadtzentrum vorbei und verbindet außerhalb gelegene Ziele. Dadurch wird der eher dichte Verkehr in den Innenstädten gemieden.
Aufgabe einer Zubringerlinie ist es, Kunden aus dem Umland bis zu Stationen der städtischen Verkehrsmittel (z.B. Straßenbahn, S-Bahn) zu befördern.59
In der Praxis setzen sich Netze i.d.R. aus einer Mischung verschiedener Linienformen zusammen.
Abbildung 3-2 Linienformen zur räumlichen Erschließung60
In Abhängigkeit von der Tageszeit können bei den Linien abweichende Streckenführungen auftreten, beispielsweise um Schulen oder Unternehmen einzubinden in den jeweiligen Hauptverkehrszeiten. Ebenso ist es im Bahnverkehr möglich, aus verschiedenen Richtungen kommende Züge zu vereinen oder aber Züge zu teilen und an unterschiedliche Ziele weiterfahren zu lassen („Flügeln“).
Hinsichtlich der zeitlichen Bedienung können verschiedene Linienarten unterschieden werden: Eine Stammlinie weist einen festen Linienweg auf und wird ständig bedient. Eine Nachtliniebeschreibt einen nur nachts befahrenen Linienweg. Dabei wird versucht, eine gute Abdeckung mehrerer tagsüber befahrener Linien zu erreichen. Weniger wichtig ist dabei die Reisezeit. Eine Sonntagslinie stellt eine Linie im Ausflugsverkehr dar. Eine Einsatzlinie verkehrt nur bei besonderen Anlässen (z.B. Großveranstaltungen).61
Eine Sonderform des Linienverkehrs stellt die Schnellbuslinie dar, die Quell- und Zielgebiet ganztags auf direktem Weg (ggf. ohne Zwischenstationen) miteinander verbindet. Abweichend davon weist die Eilbuslinie im Quellgebiet viele Haltestellen auf, um von dort aus Fahrgäste direkt ins Zentrum zu befördern. Die Linie wird in dieser Ausprägungsform in der Regel am Morgen und in umgekehrter Richtung am Abend bedient.62
Nachtlinie: Bushaltestelle in Wien
Einsatzlinie: Shuttlebus zur Niederösterreichischen Landesausstellung
Um in dünn besiedelten Gebieten oder in Zeiten schwacher Nachfrage ein Angebot aufrechterhalten, aber dennoch Einsparungen erzielen zu können, wurden bereits vielerorts flexible Bedienformen eingeführt. Dabei handelt es sich um vom klassischen Linienverkehr abweichende Bedienformen, die entweder eine räumliche oder zeitliche Flexibilisierung vorsehen und grob in Bedarfslinienbetrieb, Richtungsbandbetrieb und Flächenbetrieb unterschieden werden können.
Wie auch beim Linienbetrieb ist die Strecke beim Bedarfslinienbetrieb vorgegeben. Um eine Fahrt antreten zu können, muss jedoch eine Anmeldung erfolgen. Je nach Vorliegen von Fahrtwünschen wird die Strecke ganz, nur teilweise oder gar nicht bedient.
Wesentliches Merkmal des Richtungsbandbetriebs ist, dass zwar Start- und Zielhaltestelle feststehen, der konkrete Verlauf einer Fahrt sich aber aus den angemeldeten Beförderungswünschen ergibt. Dabei sind z.B. Linienabweichungen und -erweiterungen möglich.
Abweichend davon ist der Flächenbetrieb nicht richtungsgebunden. Quell- und Zielort werden auf direktem Weg verbunden. Der Fahrtverlauf hängt von den jeweiligen Einstiegsorten und Fahrtzielen der (angemeldeten) Fahrgäste ab.63
Abbildung 3-3 Alternative Bedienformen64
Darüber hinaus ist es möglich, flexible Bedienformen fahrplangebunden oder nicht fahrplangebunden zu gestalten. Dabei kann ein Fahrplan mit festen Abfahrtszeiten an allen Stationen oder aber nur für die Starthaltestelle festgelegt sein. Bei einer fahrplanungebundenen Variante wählt der Fahrgast bei Anmeldung seine Abfahrtszeit selbst.65
Mit der Realisierung alternativer Bedienformen lassen sich verschiedene Ziele verfolgen, die letztendlich zur Bereitstellung eines nachhaltigen Mobilitätsangebots beitragen:
Soziale Ziele
hohe Erreichbarkeit des ländlichen Raums mit ÖPNV
regionale Daseinsvorsorge für möglichst viele Bürger und alle Bevölkerungsgruppen
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch für Menschen ohne Auto
leistbares ÖPNV-Angebot
Wirtschaftliche Ziele
Wirtschaftlichkeit des ÖPNV-Angebots
Einnahmensicherung durch attraktives ÖPNV-Angebot
angemessener, effizienter Einsatz von öffentlichen Geldern/Fördermitteln
Ökologische Ziele
Reduzierung von MIV
nachhaltiger Modal Split
Tabelle 3-5 Ziele bei der Realisierung alternativer Bedienformen66
Auf Relationen, auf denen klassischer Linienverkehr nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, haben sich vielerorts schon Bürgerbusvereine gegründet. Diese setzen Bürgerbusse, von ehrenamtlichen Fahrern geführte Kleinbusse, ein, mit denen dann Linienverkehr angeboten wird.67 Auf diese Art und Weise lassen sich Angebotslücken im konventionellen ÖPNV schließen. In die Umsetzung eingebunden sind i.d.R. Gemeinden bzw. Landkreise, Verkehrsbetriebe und Ehrenamtliche, die sich meist in einem Bürgerbusverein organisieren.68
Um in Schwachlastzeiten dennoch Linienverkehr anbieten zu können, kommen oftmals auch Taxis zum Einsatz. Hierbei ist es auch möglich, dass das Linientaxi vom Linienweg abweichende Fahrtziele bedient und somit eine Differenzierung des Linienverkehrs vorliegt.69
Auch beim Anruf-Sammeltaxi werden Fahrgäste wie im Linienverkehr von einer vorgegebenen Haltestelle in einem abgegrenzten Bedienungsgebiet nach Fahrplan und Tarif – i.d.R. bis zur Haustür – befördert. Haltestellen ohne Fahrtwunsch werden nicht angefahren. Dadurch können mehr Bedarfshaltestellen im Bedienungsgebiet aufgenommen werden. Anders aber als im klassischen Linienverkehr muss für jede Fahrt eine Anmeldung vorliegen. Häufig gilt hier ein besonderer Tarif bzw. wird ein Servicezuschlag verlangt.70
3.6Netz und räumliche Erschließungsqualität
Ein Liniennetz im ÖPNV kann definiert werden als „Gesamtheit aller Verkehrswege und Linien in einem bestimmten Verkehrsgebiet. Liniennetze entstehen aus der räumlichen Verknüpfung einzelner Linien an ausgewählten Haltestellen.“71
Das Hauptnetz einer Region dient dazu, die Relationen mit einem hohen Verkehrsaufkommen abzudecken und dieserart die Zentren der Region (Oberzentren, Mittelzentren und wichtige Unterzentren) miteinander zu verbinden. Das Hauptnetz wird i.d.R. durch den Schienenpersonennahverkehr getragen. Dort, wo eine Anbindung an den Schienenverkehr nicht (ausreichend) vorhanden ist, erfüllt der Regionalbusverkehr eine unterstützende Funktion.72
Das Ergänzungsnetz beinhaltet alle Linien, die nicht Bestandteil des Hauptnetzes sind. Es dient insbesondere der Erschließung der Fläche im ländlichen Raum sowie der Verknüpfung mit den Zentren und erfüllt hier jene Aufgaben, denen das Hauptnetz nicht gerecht werden kann. Die Bedienung kann dabei im Linienbetrieb (vgl. die oft dominierende Schülerbeförderung73) oder im Bedarfsbetrieb erfolgen.74
Um ihren Aufgaben und den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, müssen Haupt- und Ergänzungsnetz verschiedene Anforderungen erfüllen:
Merkmale Hauptnetz
Merkmale Ergänzungsnetz
Linienführung
eindeutiger Linienweg
auch Routenvarianten
Zeitliche Bedienung
Regelmäßigkeit (Takt), Mindestbeförderungsgeschwindigkeit, Schnellverkehr
Bedienung an allen Wochentagen, Grundangebot auch in Neben- und Schwachverkehrszeiten
bedarfsgerechte individuelle Fahrtlagen
Anstreben von rhythmisierten Angeboten
Erschließungs- und Verknüpfungsfunktion
Direktverbindung benachbarter Zentren (bzw. günstige Umsteigeverbindung)
direkte Erreichbarkeit des Oberzentrums bzw. maximal ein Umsteigevorgang im Hauptnetz
Systemanschlüsse an festgelegten Verknüpfungspunkten
gemeindeinterne Erschließung sowie ergänzende gemeindeübergreifende Verkehre
Zubringerfunktion zum Hauptnetz (Gemeindehauptorte und wichtige Umsteigepunkte), dabei Anschlussoptimierung
Zielgruppen
Berufs- sowie Freizeit- und Versorgungsverkehr
Beitrag zur Feinerschließung sowie Schülerbeförderung
Schwerpunkt Schülerbeförderung; Ziel: Integration freigestellter Schülerverkehre
Übernahme zusätzlicher Funktionen im Versorgungs-, Freizeit- und Berufsverkehr
Tabelle 3-6 Haupt- vs. Ergänzungsnetz75
Hauptnetz: Gera Hbf, Verknüpfung von SPNV und Busverkehren
Hauptnetz: Saalfeld (Saale), Schnittstelle am Bahnhof
Ergänzungsnetz: Bushaltestelle, Dachsteinregion
Ergänzungsnetz: Schulbushaltestelle in Kürbitz
Bei der Festlegung bzw. Optimierung der Netzstruktur kann die Erschließung der Fläche oder aber die Konzentration auf Hauptachsen im Mittelpunkt stehen. Entscheidungskriterien sind dabei – insbesondere aus Kundenperspektive von Bedeutung – die erschließbaren Regionen, die Reisezeiten, die Notwendigkeit von Umsteigevorgängen; ebenso relevant sind aber aus betrieblicher Perspektive die zu absolvierenden Fahrzeugkilometer sowie Gestaltungsmöglichkeiten des Personaleinsatzes.76 Fahrgäste bevorzugen üblicherweise Direktverbindungen, die kurze Fahrzeiten aufweisen. Allerdings ist es nicht möglich, alle Quell- und Zielhaltestellen in einem Netz durch Direktverbindungen zu verknüpfen. Es geht also vielmehr darum, eine sinnvolle Bündelung der Fahrtwünsche vorzunehmen.77 Unter einer zweckdienlichen Linienführung ist demnach eine Linienführung zu verstehen, die Knotenpunkte, öffentliche Einrichtungen, Siedlungen, Unternehmen usw. sinnvoll anbindet und sich dabei an den Hauptfahrgastströmen orientiert. Beim Vergleich der Haus-zu-Haus-Zeiten zwischen motorisiertem Individualverkehr und ÖPNV schneidet der ÖPNV regelmäßig schlechter ab. Umso wichtiger sind daher angemessene Zugangs-, Reise- und Umsteigezeiten.
Um bedürfnisgerecht und rentabel arbeiten zu können, sollte das Netz aber auf jeden Fall an die Siedlungsstruktur angepasst werden. Dicht besiedelte Gebiete können demnach auch ein dichteres Netz als periphere Räume aufweisen. Je nachdem, ob es sich um Bestandteile des Haupt- oder Ergänzungsnetzes handelt, unterscheiden sich auch die Weglängen zur nächsten ÖPNV-Haltestelle. In Abhängigkeit von der Größe des Ortes geht man dabei von folgenden durchschnittlichen Entfernungen zur nächsten Haltestelle aus:
Gemeindeklasse
Bus/Straßenbahn
SPNV
Oberzentrum (> 70.000 Einwohner)
300-500 m
400-800 m
Mittelzentrum (> 20.000-70.000 Einwohner)
300-500 m
400-800 m
Unterzentrum (5.000-20.000 Einwohner)
400-600 m
600-1.000 m
Gemeinde (< 5.000 Einwohner)
500-700 m
800-1.200 m
Tabelle 3-7 Haltestelleneinzugsbereiche (Luftlinie)78
Die räumliche Erschließungsqualität, die aus der Anzahl und der Lage der Linien und Haltestellen innerhalb eines bestimmten Gebietes resultiert79, dient der Beurteilung des dieserart geschaffenen Netzes. Im Rahmen der Haltestellenplanung gilt es dabei, den Zielkonflikt zwischen kurzen Haltestellenabständen und kurzen Reisezeiten zu lösen.
In und zwischen Oberzentren und Kreisstädten ist die Erschließung i.d.R. gut. Großstädte sind auf den ÖPNV angewiesen, hier sind auch Nachfragezuwächse zu verzeichnen. Bezüglich der Bedienformen herrscht konventioneller Linienbetrieb vor. In der Fläche geht es häufig um eine Mindestbedienung im Ergänzungsnetz. Neben konventionellem Betrieb setzt man dabei zunehmend auf alternative, nachfrageabhängige Bedienformen.
Im Laufe der Zeit kann es erforderlich werden, Liniennetze zu überarbeiten, z.B., weil neue Wohngebiete und Einkaufszentren entstanden sind, Schulen oder Betriebe geschlossen wurden. Dadurch entstehen veränderte Verkehrsströme, die in der Netzplanung zu berücksichtigen sind. Aber auch Vorgaben der Aufgabenträger können zu einer Überarbeitung des Netzes führen. Die gewachsenen Netze sind häufig sehr komplex, so dass bei der Netzplanung bzw. -überarbeitung nicht bzw. nur begrenzt auf mathematische Optimierungsverfahren zurückgegriffen werden kann.80
3.7Fahrplan und Angebotsqualität
Gemäß § 40 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz sind öffentliche Verkehrsunternehmen verpflichtet, Fahrpläne zu erstellen und zu veröffentlichen. Enthalten sein müssen dabei Anfangs- und Endpunkte einer Linie, deren Verlauf inklusive Haltestellen sowie die jeweiligen Abfahrtszeiten.
Fahrpläne nehmen eine zentrale Rolle im öffentlichen Verkehr ein. Mithilfe von Fahrplänen definieren die Verkehrsunternehmen ihr Angebot gegenüber den Reisenden. Fahrpläne können somit auch als Produktdefinition verstanden werden, auf deren Grundlage sich ein potenzieller Fahrgast für oder gegen eine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln entscheidet. Gleichzeitig dienen Fahrpläne dazu, den Betriebsablauf zu organisieren und einen reibungslosen und zuverlässigen Ablauf zu garantieren. Ein Fahrplan für eine einzelne Strecke darf nicht herausgelöst betrachtet, sondern muss stets im Zusammenhang mit den Fahrplänen anderer Strecken gesehen werden.
Analog zum Netz sollte ein bedürfnisgerechter Fahrplan entwickelt werden, der der Siedlungsstruktur und der jeweiligen Nachfragestruktur gerecht wird. Aber auch Auflagen des Bestellers nach einer Mindestbedienung (z.B. Ein- oder Zweistundentakt) spielen bei der Fahrplangestaltung eine Rolle.
Dabei werden folgende Ziele verfolgt: Minimierung der Reisezeiten, Maximierung der Fahrplanstabilität, Optimierung der Fahrzeuganzahl, Kapazitätsmaximierung, Optimierung des Energiemanagements.81
Die Angebotsqualität bezieht sich auf die Qualität der zeitlichen Bedienung. Bestimmende Faktoren sind in diesem Zusammenhang die Bedienungshäufigkeit, Betriebszeiten und Betriebstage sowie die zeitliche Abstimmung des Angebots (vgl. Anschlusssicherung).82
Je nach Siedlungsstruktur weisen ÖPNV-Angebote unterschiedliche Bedienungshäufigkeiten bzw. eine dichtere oder weniger dichte Vertaktung auf. Kurze Fahrzeugfolgezeiten verkürzen die Wartezeiten an den Haltestellen, sind aber gleichzeitig mit einem hohen Fahrzeugeinsatz verbunden.83 Während in Großstädten Takte von wenigen Minuten als notwendig betrachtet werden, erscheint in Randlagen vielleicht ein Halbstunden-, Stunden- oder Zweistundentakt sinnvoll. Wichtig für den Fahrgast sind in jedem Fall eine regelmäßige und gut merkbare Taktung bzw. merkbare Fahrzeiten, so dass die Konsultation des Fahrplans überflüssig wird (vgl. Taktfahrplan).
Gestraffte Fahrpläne bieten den Vorteil, Fahrtwünsche bündeln, Fahrzeuge besser auslasten und dadurch geringere Kosten pro Sitzplatz realisieren zu können. Verdichtete Fahrpläne wiederum kommen den Kundenbedürfnissen nach zahlreichen bzw. flexiblen Fahrtmöglichkeiten entgegen.84
Typische Fahrzeugfolgezeiten (die je nach Stadt bzw. Region ggf. auch unter- oder überschritten werden können) in Minuten fasst folgende Tabelle zusammen:
Verkehrsmittel
Fahrzeugfolgezeiten
Bus
10-120 min
Straßenbahn
10-30 min
Stadtbahn
10-30 min
U-Bahn
5-15 min
S-Bahn
20-60 min
Tabelle 3-8 Typische Fahrzeugfolgezeiten85
Rendez-vous-Technik bei der Plauener Straßenbahn, Haltestelle Tunnel
Integraler Taktfahrplan in der Schweiz, Bahnhof Gstaad
Bei größeren Fahrzeugfolgezeiten sollten bei sich kreuzenden Linien die Umsteigezeiten optimiert werden, so dass hier für den Fahrgast nicht zusätzlich lange Wartezeiten entstehen. Dies kann sich schwierig gestalten, wenn dabei mehrere Umsteigepunkte auf einer Linie einzubeziehen sind. Insbesondere im Nachtverkehr größerer Städte setzt man dabei auf eine Rendez-vous-Technik, bei der sich mehrere Linien an einer Umsteigestation treffen und nach einer bestimmten Zeit gemeinsam von dort wieder abfahren. Wird diese Technik auch außerhalb des Nachtverkehrs und generell im Netz angewendet, spricht man von einem integralen Taktfahrplan.86
Auch der Bedienungszeitraum (Betriebszeiten und Betriebstage) richtet sich nach dem Fahrgastaufkommen und variiert je nach Nutzer- und Siedlungsstruktur. Ältere Fahrgäste sind beispielsweise zu anderen Tageszeiten unterwegs als junge Menschen. In Städten ist im Vergleich zum ländlichen Raum auch am späten Abend noch eine relativ hohe Nachfrage zu verzeichnen. Um dennoch in peripheren Räumen nicht gänzlich auf ein ÖPNV-Angebot in Tagesrandlagen verzichten zu müssen, bieten sich auch hier die alternativen Bedienformen an. Ebenso unterscheidet sich üblicherweise das Fahrgastaufkommen an Werk-, Sonn- und Feiertagen bzw. in Schulzeiten und Ferienzeiten, was in den Fahrplänen zu berücksichtigen ist. Angebotsanpassungen können hierbei durch Fahrplanverdichtungen (bzw. -kürzungen) oder den Einsatz von Fahrzeugen mit unterschiedlichen Kapazitäten vorgenommen werden.
Entscheidend bei der Gestaltung von attraktiven Fahrplänen sind neben der Reisegeschwindigkeit auch Pünktlichkeit und Anschlusssicherung.
Die durchschnittlichen Reisegeschwindigkeiten sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.
Verkehrsmittel
Reisegeschwindigkeiten
Bus
10-15 km/h
Straßenbahn
20-25 km/h
Stadtbahn
25-35 km/h
U-Bahn
30-40 km/h
S-Bahn
bis 40 km/h
Tabelle 3-9 Reisegeschwindigkeiten87
Ein Anschluss liegt dann vor, wenn Fahrten verschiedener Linien fahrplanmäßig derart aufeinander abstimmt sind, dass ein Fahrgast an einer Umsteigehaltestelle bei angemessenen Umsteigewegen und ohne größere Wartezeiten von einem auf das andere Verkehrsmittel übergehen kann – unabhängig davon, welchem Verkehrsunternehmen bzw. Verkehrssystem diese Linien zuzuordnen sind.88
Die Deutsche Bahn macht das Vorliegen eines Anschlusses von der Einhaltung der Übergangszeit abhängig. Diese „stellt einen Zeitraum dar, der für Reisende erforderlich ist, um von einem ankommenden auf einen abbringenden Zug zu wechseln.“89
Bei im Fahrplan ausgewiesenen Anschlussverbindungen geht der Fahrgast davon aus, dass diese gewährleistet werden. Doch nur wenn Fahrpläne eingehalten werden, lassen sich Anschlüsse auch erreichen. Weniger ärgerlich ist ein verpasster Anschluss bei einer kurzen Fahrzeugfolgezeit. Voraussetzung dabei ist jedoch auch, dass über aktuelle Abfahrtszeiten informiert wird.
Aus der Linienführung und den Zugangs-, Reise- und Umsteigezeiten resultiert letztendlich die Verbindungsqualität.90
Darüber hinaus sind das Platzangebot bzw. der Besetzungsgrad und auch eine der Nachfrage entsprechende Angebotsdifferenzierung von Relevanz.91
Das im Fahrplan ausgewiesene Angebot bildet die Grundlage für den Wagenumlaufplan, der den Einsatz der vorhandenen Fahrzeuge auf den einzelnen Linien beinhaltet. Bei der Erstellung des Wagenumlaufplans sind verschiedene Restriktionen zu berücksichtigen: So sollten die eingesetzten Fahrzeuge der zeitlich schwankenden Nachfrage angepasst sein und den Fahrgästen ausreichend Platz bieten. Durch den Wechsel eines Fahrzeugs auf eine andere Linie dürfen keine Verspätungen entstehen. Ebenso einzubeziehen sind Fahrerablösepunkte. Bei Einsatz verschiedener Fahrzeugtypen ist zu beachten, dass das Fahrpersonal zum Führen der Fahrzeuge qualifiziert ist. Darüber hinaus sind regelmäßige Instandhaltungsarbeiten im Betriebshof zu berücksichtigen. Bei Vorhandensein mehrerer Betriebshöfe ist sicherzustellen, dass die jeweils zugeordneten Fahrzeuge diese erreichen.92
3.8Tarife
Der ÖPNV unterliegt der Tarifpflicht, d.h., die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, verbindliche Tarife festzulegen, zu kommunizieren und gleichmäßig anzuwenden. Diese Tarife müssen durch die zuständige Genehmigungsbehörde genehmigt werden.93
Ein Tarifsystem (Fahrpreise samt Tarifbestimmungen) sollte überschaubar und begreifbar sein und für die verschiedenen Nutzergruppen mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen (vgl. Vielfahrer vs. Gelegenheitsfahrer oder Einheimische vs. Touristen) ansprechende Angebote bereithalten. Bemängelt werden in der Praxis hierbei häufig die fehlende Übersichtlichkeit und Verständlichkeit. Eine einfache Handhabbarkeit des Tarifsystems ist jedoch eine wichtige Zugangsvoraussetzung für die Nutzung des ÖPNV, gerade auch für Ortsunkundige oder Fahrgäste, die den ÖPNV eher selten in Anspruch nehmen. Gleichzeitig erleichtert dies unternehmensseitig Beratung, Verkauf und Kontrolle.
Im Bereich des ÖPNV kommen in Deutschland verschiedene Tarifsysteme zur Anwendung: Dies sind der Deutschlandtarif (ehemals Nahverkehrstarif der Deutschen Bahn sowie die TBNE94-Tarife) und die Tarife der Verkehrsverbünde.95 Der 2022 eingeführte Deutschlandtarif gilt bei Nutzung des Schienenpersonennahverkehrs, sofern kein Verbund- oder Landestarif greift, d.h. bei Fahrten über ein Verbundgebiet hinaus oder von einem in ein anderes Bundesland.
Die Deutschlandtarifverbund-Gesellschaft fungiert als Dachorganisation für die Tarifgestaltung und -weiterentwicklung sowie die Einnahmeaufteilung im Schienenpersonennahverkehr. Die früheren Aufgaben des Tarifverbands der Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen fallen damit weg.
Kriterien, die bei der Ermittlung von Fahrpreisen herangezogen werden, können die zurückgelegten Kilometer, die Anzahl der durchfahrenen Haltestellen, Teilstrecken oder Waben sein. Dabei sind innerhalb eines Tarifsystems auch Mischformen möglich.
Tabelle 3-10 Tarifformen96
Abbildung 3-4 Fahrschein-Vielfalt
Basierend auf diesen Tarifen werden verschiedene Fahrausweisarten ausgegeben, die unterschiedlich stark in Anspruch genommen werden:
Fahrscheinart
Nutzung
Einzelfahrschein, Tageskarte, Kurzstrecke
43 %
Mehrfachkarte, Streifenkarte
9 %
Wochenkarte, Monatskarte ohne Abo
3 %
Monatskarte im Abo, Jahreskarte
9 %
Jobticket, Semesterticket
6 %
anderes
4 %
fahre nie mit ÖPNV
26 %
Tabelle 3-11 Genutzte Fahrscheinarten im ÖPNV97
Aufgrund der Komplexität von Tarifsystemen und mit dem Ziel, neue Nutzer für den ÖPNV zu gewinnen, wird schon lange über eine Vereinfachung von Tarifstrukturen diskutiert. In diesem Zusammenhang spielen vergleichsweise preiswerte Pauschalfahrausweise, die als Monats- oder Jahreskarten ausgegeben werden, eine bedeutende Rolle. Dabei wird regelmäßig auf das 365-Euro-Ticket in Wien bzw. vergleichbare Angebote anderer österreichischer Bundesländer sowie das 2021 eingeführte Klimaticket Österreich verwiesen.
Klimaticket Österreich
Das „KlimaTicket Ö“ zum Preis von 1.095 Euro (ermäßigt 821 Euro) berechtigt ein Jahr lang zur Nutzung aller Linienverkehre (öffentlicher und privater Schienenverkehr, Stadtverkehre, Verkehrsverbünde) in einem bestimmten Gebiet. Nicht eingeschlossen sind dabei bestimmte touristische Verkehre (z.B. Skibusse oder Bergbahnen).98 Neben dem österreichweiten Ticket gibt es zu entsprechend reduzierten Preisen regionale Klimatickets seit 2021 in Oberösterreich, Wien/Niederösterreich/Burgenland, Vorarlberg sowie seit 2022 in der Steiermark, in Salzburg, Kärnten und Tirol.99 Darüber hinaus werden bislang schon verfügbare preisgünstige Jahreskarten, wie das 365-Euro-Ticket in Wien weiterhin angeboten.
Finanziert wird das österreichweite Klimaticket über die Erlöse der Ticketverkäufe. Hinzu kommt ein Zuschuss aus dem Bundeshaushalt (für 2022 160 Mio. Euro). Die regionalen Tickets werden mit 100 Mio. Euro bezuschusst, wobei eine Mittelaufstockung vorgesehen ist.100
Der Vorverkauf des Tickets begann am 1. Oktober 2021, erster Geltungstag war der 26. Oktober 2021 – Österreichs Nationalfeiertag. Basierend auf bisherigen Verkaufszahlen von Zeitkarten hatte man mit etwa 110.000 verkauften Tickets ein Jahr nach der Einführung gerechnet. Tatsächlich waren schon im Oktober 2021 mehr als 125.000 Tickets verkauft worden. Genau ein Jahr später wies die Verkaufsstatistik über 200.000 verkaufte Tickets aus.101 Die erfreulich hohe Nachfrage zeigte aber auch bald die Engpässe im Angebot auf. In Österreich wird zwar schon seit Jahren massiv in den Ausbau des Schienennetzes bzw. des öffentliches Verkehrs insgesamt investiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ballungsräume. Ziel ist es, ein dichteres und komfortableres Verkehrsangebot zu schaffen.102 Allerdings ist das Ausbauprogramm längst noch nicht abgeschlossen, und es sind nicht alle Regionen gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die landesweite Nutzbarkeit des Tickets kommt also nicht allen potenziellen Fahrgästen zugute. Zudem führten übervolle Züge auf den Hauptachsen hin und wieder zu Unmut.103
2022 wurde in Deutschland das 9-Euro-Ticket eingeführt, welches in den Monaten Juni bis August zur Nutzung aller öffentlichen Nahverkehrsmittel berechtigte. Ursprünglich zur Entlastung der Bürger – v.a. der Berufspendler – bei den hohen Treibstoffpreisen gedacht, entwickelte sich das Ticket zum Verkaufsschlager für jedermann.
Die Bundesregierung erhoffte sich durch das Ticket einen positiven Imageeffekt für den ÖPNV, die Gewinnung von Neukunden und damit verbunden dauerhafte Nachfragesteigerungen. Zudem wollte man in dieser Art „Feldversuch“ herausfinden, wie groß die Nachfrage durch derartige pauschale Niedrigpreise werden kann.104
Die Beliebtheit des preisgünstigen Tickets zeigte sich bereits am Pfingstwochenende 2022. Trotz zusätzlich eingesetzter Fahrzeuge kam es zu überfüllten Zügen bzw. konnten nicht alle reisewilligen Passagiere mitgenommen werden. Da es sich bei zahlreichen Nutzern des Tickets um Gelegenheits- oder Neukunden handelte, die sich mit dem System Eisenbahn nicht auskannten, entstand zusätzlicher Beratungsaufwand.105 Damit einher ging ein erhöhter Personalbedarf bei verschiedensten Berufsgruppen – ob Triebfahrzeugführer und Kundenbetreuer oder auch Reinigungskräfte und Instandhaltungspersonal. Überstunden beim Bahnpersonal waren daher unvermeidlich.106 Hierbei werden die Probleme des Ansatzes deutlich: Ohne zuvor in den angebotsseitigen Ausbau investiert zu haben, nahm man in Kauf, dass die Nachfrage drastisch ansteigt und Kapazitäten nicht ausreichen werden.
Insgesamt wurden ca. 52 Mio. Tickets verkauft. Darüber hinaus konnten ca. zehn Mio. Abonnement-Kunden davon profitieren. Einerseits wurde diese gestiegene Nachfrage als großer Erfolg gefeiert.107 Andererseits hat sich das Mobilitätsverhalten der Menschen dadurch kaum nachhaltig verändert. Umfragen zufolge planen nur wenige, sich nach Ende des Aktionszeitraumes häufiger für den ÖPNV zu entscheiden.108 Während des Gültigkeitszeitraums wurde nicht der Zug statt des Pkws genutzt, sondern es fanden zusätzliche Ausflugsfahrten mit der Bahn statt: „Dem Klima hat die Aktion also kaum etwas gebracht. Die Deutschen fahren Zug aus Vergnügen, nicht aber als Ersatz fürs Autofahren.“109
Große Vorteile brachte das Ticket den Nutzern in gut vernetzten, städtischen Gebieten. Im ländlichen Raum sah dies anders aus. Bei unattraktivem Fahrplanangebot führte das preiswerte Ticket nicht zwangsläufig zu einer sprunghaften Nachfragesteigerung. Statt kurzzeitig mit 2,5 Mrd. Euro Bundesmitteln einen Nachfrageboom auszulösen, wären Investitionen in den schrittweisen und nachhaltigen Ausbau des ÖPNV wesentlich sinnvoller.110 Außerdem zeigte sich, dass leicht verständliche Tarife, die unabhängig von Verbundgrenzen gelten, Neukunden anlocken können.
Dauerhaft sind derart niedrige, pauschale Fahrpreise von öffentlicher Seite jedoch nicht finanzierbar. Zu niedrige Preise setzen auch ein falsches Signal, denn ÖPNV-Angebote sind hochwertige Dienstleistungen. Es gibt zudem genügend Nutzer, die finanziell in der Lage sind, teurere Zeitkarten zu bezahlen, so dass eher über eine Unterstützung für Geringverdiener nachgedacht werden sollte.
Ohne die kapazitativen und strukturellen Probleme des ÖPNV mit ausreichenden Mitteln anzugehen, setzte die Politik anschließend auf ein Nachfolgemodell, das 49-Euro-Monatsticket, im Abonnement verfügbar und monatlich kündbar. Als größte Schwierigkeit wurde die Finanzierung des Tickets betrachtet. Scheinbar völlig außer Acht gelassen wurde dabei aber, dass sich am grundsätzlichen Verkehrsangebot nichts geändert hatte und ländliche Räume nach wie vor bei der ÖPNV-Bedienung wesentlich schlechter gestellt sind. Schlimmstenfalls könnte es sogar zur Ausdünnung von Angeboten kommen, sollten Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen zum Ausgleich von fehlenden Fahrgelderlösen ausbleiben. Bedingt durch die monatlich mögliche Kündigung des Abos bleibt für die Verkehrsunternehmen auch ein großer Unsicherheitsfaktor bezüglich der Regelmäßigkeit der Fahrgeldeinnahmen. Zu kritisieren ist zudem, dass auf eine rein digitale Ticketvariante gesetzt wurde, wobei die App-Version dominiert. Entsprechende Chipkarten, auf denen sich digitale Tickets ebenfalls speichern lassen, werden allerdings nicht von allen Verkehrsverbünden angeboten, so dass Menschen ohne Smartphone vom Ticketerwerb ausgeschlossen werden. Nach mehrmaligem Verschieben des Starttermins hatte man sich schließlich auf den 1. Mai 2023 geeinigt. Bis Ende März 2023 war jedoch noch nicht geklärt, ob die EU den Ticketplänen der Bundesregierung überhaupt zustimmt.
Im Rahmen von Tarifkooperationen lassen sich Synergieeffekte für die beteiligten Verkehrsunternehmen bzw. für den Fahrgast erzielen. Dabei gibt es verschiedene Formen:
Bei einer Verkaufsgemeinschaft werden jeweils auch die Fahrscheine der Kooperationspartner verkauft.111
Die partielle tarifliche Zusammenarbeit reicht darüber hinaus und umfasst auch die gegenseitige Abstimmung von Beförderungsentgelten und Beförderungsbedingungen: Bedienen mehrere Verkehrsunternehmen dieselben Streckenabschnitte, können die Fahrausweise gegenseitig anerkannt werden. Fährt ein Fahrgast im SPNV auf einer Relation, die sich aus zwei von verschiedenen Verkehrsunternehmen (Deutsche Bahn und eine NE-Bahn) bedienten Strecken zusammensetzt, handelt es sich um den sogenannten Anstoßverkehr. Dabei werden nach den Regeln des Anstoßtarifs (TBNE-Tarif) für beide Teilstrecken die Preise ermittelt und addiert. Für die NE-Bahn ist dieser Tarif vorteilhaft, da er ihr zu einem gerechteren Anteil am Fahrpreis verhilft. Der Fahrgast zahlt so allerdings einen höheren Preis. Übergangstarifefinden bei Fahrten aus einem bzw. in ein anderes Verbundgebiet Anwendung. Bei der Durchtarifierung wird für die gesamte Strecke ein Fahrschein verkauft, unabhängig davon, wie oft der Fahrgast umsteigen muss. Bei einem Gemeinschaftstarif gilt auf einer von mehreren Verkehrsunternehmen gemeinsam betriebenen Linie nur ein Tarif.112
In einer Tarifgemeinschaft schließen sich die ein Gebiet bedienenden Verkehrsunternehmen zusammen, um ein einheitliches (und damit einfacheres) Tarifsystem zu schaffen und dadurch Nachfragesteigerungen hervorzurufen.113
Bei einer Verkehrsgemeinschaft kooperieren die Unternehmen zudem bezüglich Netz und Fahrplangestaltung. Allerdings wird hierbei keine wie bei einem Verkehrsverbund übliche übergeordnete Organisation geschaffen.114
3.9Vertrieb und Information
Der Vertrieb von Fahrausweisen kann auf direktem oder indirektem Wege durchgeführt werden. Der direkte Vertrieb obliegt dem Verkehrsunternehmen, wobei zwischen einem zentralen und einem dezentralen Vertrieb differenziert werden kann. Der indirekte Vertrieb findet über Dritte statt. Bei allen genannten Varianten existiert eine persönliche und eine unpersönliche Form (siehe folgende Tabelle).
Einer Statistik des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen zufolge werden beim Fahrer und an Automaten hauptsächlich Einzelfahrscheine bzw. Tages- und Mehrtageskarten gekauft. Zeitkarten werden vor allem im Abonnement erworben oder aber über Verkaufsstellen. Handy- oder Onlinetickets werden bislang vergleichsweise selten genutzt, wenn, dann vor allem für Einzelfahrscheine bzw. Tages- und Mehrtageskarten.115
Tabelle 3-12 Vertriebskanäle im ÖPNV116
Fahrscheine für Fern- und Regionalverkehr im Kundenzentrum oder am Automaten, Bergen
Fahrscheinautomat im Fahrzeug, Traunseetram
Je nach Größe und Struktur des bedienten Gebietes (vgl. Ballungsgebiet vs. ländlicher Raum) werden verschiedene Vertriebskanäle bzw. Kombinationen genutzt. Welche Vertriebswege zum Einsatz kommen, hängt dabei vor allem vom erforderlichen organisatorischen Aufwand, den dadurch entstehenden Kosten und dem erzielbaren Nutzen für das Verkehrsunternehmen und für die Fahrgäste ab.
Entscheidungskriterien bei der Wahl der Absatzwege
Kosten
Zeit
Qualität
Vertriebslogistik (Fahrscheine, Geld)
verlorene Umsätze
Provisionen
Dauer des Vertriebsvorgangs (kundenseitig, unternehmensseitig)
Wartezeiten
Vertriebsstellen
Qualifikation
Öffnungszeiten, Verfügbarkeit
Tabelle 3-13 Wahl der Absatzwege im ÖPNV117
Der Fahrschein stellt nicht nur die Berechtigung zur Nutzung eines Verkehrsmittels durch den Fahrgast dar, sondern enthält auch sämtliche erforderlichen Tarifinformationen und garantiert dem Verkehrsbetrieb entsprechende Einnahmen. Vertrieb und Tarif sind über den Fahrschein also eng miteinander verbunden.118
Über lange Zeiträume hinweg waren auf Papier gedruckte Fahrscheine üblich. Mit dem Ziel der Rationalisierung entwickelte man ab den 1980er Jahren Magnetkartensysteme, die als zuverlässiger galten und detailliertere Informationen liefern sollten. Etwa zehn Jahre später begann die Ära der Chipkarten: „Im Fokus hat hier die Flexibilität der Tarife, die Möglichkeiten neuer Vertriebswege und Marketingplattformen sowie die Verbesserung des Komforts für den Fahrgast gestanden.“119 Allerdings waren diese Systeme zunächst nicht standardisiert bzw. kompatibel zueinander, was man als Nachteil erkannte und deshalb eine Standardisierung (vgl. VDV-Kernapplikation für das (((eTicket Deutschland) vorantrieb.
Elektronisches Fahrgeldmanagement „ist ein Dachbegriff, unter dem sich unterschiedliche, sehr heterogene Technologien versammeln, die zum Erwerb einer Fahrberechtigung und/oder der Inanspruchnahme und Abrechnung von Fahrleistungen im ÖPNV und dem Clearing zwischen den beteiligten Betreibern eingesetzt werden.“120
Dabei existieren verschiedene Verfahren:
Tabelle 3-14 Verfahren des elektronischen Fahrgeldmanagements121
Lesegerät integriert in Fahrscheinautomaten an der Haltestelle, Bergen
Lesegerät am Bahnsteig, Kopenhagen Hovedbanegård
In Bezug auf die automatisierte Fahrgelderhebung lassen sich wiederum verschiedene Verfahren unterscheiden:
Check-in/Check-out: Der Fahrgast meldet sich mittels Speichermedium vor dem bzw. beim Einstieg in ein Fahrzeug an einem Erfassungsgerät an und beim Ausstieg ab. Dadurch wird die gefahrene Strecke ermittelt und der Fahrpreis berechnet.
Check-in