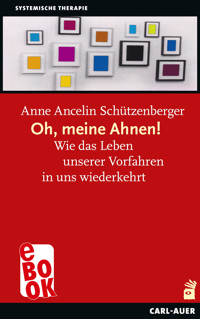
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Therapie
- Sprache: Deutsch
Oh, meine Ahnen! Ist es möglich, Ereignisse von unseren Ahnen zu "erben"? Wie können Therapeuten solche generationenübergreifenden Verbindungen identifizieren? In diesem Buch erklärt Anne Ancelin Schützenberger ihren einzigartigen psychogenealogischen Therapieansatz und liefert die entsprechenden klinischen Beispiele. Die Autorin geht davon aus, dass wir als einzelnes Glied der Geschlechterfolge nicht darüber entscheiden, ob und wann von unseren Ahnen erlebte Ereignisse und Traumata auch uns im Verlauf unseres Lebens heimsuchen. Das Buch enthält faszinierende Fallbeispiele und Familienstammbäume ("Genosoziogramme"), die illustrieren, wie Klienten scheinbar irrationale Ängste, psychische und sogar körperliche Probleme überwunden haben, indem sie die Parallelen zwischen ihrem eigenen Leben und dem Leben ihrer Vorfahren aufdeckten und begriffen. Schützenberger stützt sich auf vier Jahrzehnte Erfahrung als Therapeutin und Analytikerin und vermittelt mit diesem Buch faszinierende Einsichten in den einzigartigen Stil ihrer therapeutischen Arbeit. Die Autorin: Anne Ancelin Schützenberger (1919–2018) war Professorin für Psychologie an der Universität Nizza und Mitbegründerin der International Society for Group Psychotherapy. Darüber hinaus war sie international als Trainerin für Gruppenpsychotherapie und Psychodrama bekannt. Ihr Beitrag über die Theorie der Wiederkehr des Lebens der Vorfahren in unserem Leben stieß auf großes Interesse beim Fachpublikum und in der Presse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Tochter Hélène und meineEnkelkinder Aude, Pierre und François.
Für meine AusbildungskandidatInnen, PatientInnen und StudentInnen mitherzlichem Dank, dass ich von ihnen soviel lernen durfte über das Weitergeben, Lernen und Wiederholen von Generationzu Generation.
Carl-Auer
Oh, meine Ahnen!
Anne Ancelin Schützenberger
Wie das Leben unserer Vorfahren in uns wiederkehrt
Aus dem Französischen übersetzt von Hanna Neufang unter Mitarbeit von Dr. Albrecht Mahr
Elfte Auflage, 2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Karsten Trebesch (Berlin)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Tom Levold (Köln)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Schefer (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Burkhard Peter (München)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Elfte Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0237-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8541-3 (ePub)
© der deutschen Ausgabe 2001, 2025
Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel
„Aïe, mes aïeux!“
© Desclée de Brouwer, 1993, Paris
© La Méridienne, 1993, Paris
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Lebendige Vergangenheit – Der Papagei des Großvaters
Vorwort zur französischen Erstauflage
Teil 1 Die transgenerationale Methode
1 Eine Genealogie der transgenerationalen Methode
Vom Unbewussten zum Genosoziogramm
Bereits Freud …
Jung, Moreno, Rogers, Dolto und einige andere
Meine professionelle Herkunft
Der verkannte Moreno
Genogramm und Genosoziogramm
Freud und „Das Unheimliche“
2 Familientherapie und das Genogramm/Genosoziogramm
Die Palo-Alto-Gruppe
Die strategische systemische Therapie
Die strukturelle systemische Therapie
Die analytische Familientherapie
3 Unsichtbare Loyalitäten
Die Konzepte von Ivan Boszormenyi-Nagy
Parentifizierung
Der Familienmythos oder die Familiensaga
Die „Familienbuchführung“: Grundsicherheit und Ungerechtigkeit
Heimlicher Groll
Ungerechtigkeit des Schicksals
Transgenerationales Entsetzen, Traumata durch den „Luftzug der Kanonenkugel“
„Das ist ungerecht …“ Die erlittene Ungerechtigkeit, die „wahre Gerechtigkeit“ (real justice)
Die passive Aggressivität
4 Psychosomatisches/Somatopsychisches
Die „Körper-Geist-Verbindung
Transgenerationale Bindungen und die Buchführung der Verdienste und Schulden
Erlebte Ungerechtigkeit
„Geschenke mit Zähnen“
Das „Goldene Buch“ des Heiligen Nikolaus
Wir stammen alle von „gemischten Paaren“ ab
Das Individuum und die Familie
Die synchrone Landkarte der Familienereignisse
Eine kontextuelle und integrative Methode
Familienregeln
Ein loyales Mitglied einer Gruppe sein
Kontext und Klassenneurose – Schulversagen
5 Die Gruft und das Phantom
Das nicht gestehbare, unsagbare Geheimnis
Die Schmetterlingsjäger
6 Ursprung und Tod
Hergé und Tintin
Unbewusste familiäre Wiederholungen an einem Jahrestag: Der Unfall des Witwers
Die Krankheit des adoptierten Kindes
Geheimnisse um den Tod der Eltern und die eigene Herkunft: Kinder von Kz-Häftlingen
Das Beispiel von Robert – Trennungen und Geheimnisse
Völkermord und erlittene Ungerechtigkeit: Sklaverei, Deportation und Flucht und die Psychischen Spuren erlittenen Unrechts
Die Erinnerung bleibt erhalten
7 Meine Forschungen zu Genosoziogramm und Jahrestag-Syndrom
Die Entdeckung des Jahrestag-Syndroms
„Kinder und Hunde im Haus wissen alles“
Austausch
Meine persönliche Art zu arbeiten
Das Jahrestag-Syndrom
„Unsichtbare Loyalitäten“ und „Fraktale“
8 Wie erstellt man ein Genosoziogramm?
Vereinbarte grafische Symbole
Biographische Rekonstruktion: Anhaltspunkte, Schlüssel, Gedächtnis – Ecksteine und Grenzen der Methode
Die Basis der Identität: Vorname und Familienname – „Wie heisst du?“
Der Faden der Ariadne – Die Bedeutung des Vornamens
Die Bedeutung des historischen, kulturellen und ökonomischen Kontextes
Der Lebenskontext – Studium, Reisen, Aufenthalte in fernen Ländern; kodierte und chiffrierte Vornamen
Sind wir alle Mischlinge? – Wir sind alle Erben zweier Kulturen
Uneheliche Kinder – Beispiele von sozialer Scham in Familien
Ziele des Genosoziogramms
9 Meine klinische Praxis der transgenerationalen Methode
Eine Gruppe, Marie und die anderen
Seine Identität wieder finden – Die Weitergabe
Die Widerstandskraft
Die „unbeugbaren Kinder“, die alles überstehen, und die Probleme ihrer Herkunft
Die Grundsicherheit – Die Lebenskraft
Wie kann man herausfinden, woher man kommt?
Wie geschieht Weitergabe?
Transgenerational und intergenerational – Das neu entdeckte Gedächtnis: Lebendiges Gedächtnis oder ererbte Gedächtnislücken
Teil II Fallstudien mit vereinfachten Genosoziogrammen
10 Das Jahrestag-Syndrom und die unsichtbare Familienloyalität
Charles: Jahrestag-Syndrom und unsichtbare Familienloyalität
Marc: Familiäre Wiederholung von Unfällen
Nicht vergessen, zu vergessen
Das Beispiel von Jacqueline: Der Völkermord an den Armeniern
Mit dem Körper sprechen
Valérie und Roger: Gibt es eine „Vererbung“ bei Autounfällen?
11 Die Familienkonstellation und das Syndrom des doppelten Jahrestages
Jahrestag-Zeit mit erhöhter Anfälligkeit und mit Stress
Zwei Brüder, nur einer überlebt
Lucien und Frau André: Der genealogische Inzest
Die Familie Martin-Leroux: Dreifacher genealogischer Inzest
Zweimal „die junge Frau Ravanel“: Ein ungelöster genealogischer Inzest
Doppelte Verschwägerung
„Unechte“ Brüder und Schwestern, die unter dem gleichen Dach aufwachsen oder: Die Patchwork-Familie
12 Vermächtnisse und Familienstruktur
Die Familie Mortelac: Tod von kleinen Kindern über mehrere Generationen
Prophezeiungen und Verwünschungen in der Geschichte
Wirkungen eines „starken Wortes“ – Der Fluch Catos: „Karthago muss zerstört werden!“
Delenda: Der Zorn eines Vaters und das Geschlecht eines Kindes
Der Priester: Die Wirkung eines „starken Wortes“
Ein falsch verstandenes starkes Wort
Van Gogh, Dalí und Freud: Das „Ersatzkind“ und das „Ausgleichskind“
Cendrine und einige andere: Ein Jahrestag mit Hinweischarakter
Vier andere Beispiele
Ein Ostermontag (1965) / Nach einem zufälligen Tod in Sewastopol (1855)
Noelle: Konflikte wegen Habitus und Nahrungsmittelidentität
13 Schlusswort Die menschliche Kanope
Anhang
Anhang 1
Definition der Gruft und des Phantoms nach Nicolas Abraham und Maria Török
Die Arbeit des Phantoms im Unbewussten
Dyade und Angst
Anhang 2
Die statistischen Untersuchungen über das Jahrestag-Syndrom von Joséphine Hilgard (Arbeiten aus der Zeit 1952–1989)
Statistik
Anhang 3
Über die Seele der Frau
Anhang 4
Beispiel aus der Literatur von einem Inzest in Stellvertretung
Anhang 5
„Ich erinnere mich“ Spuren familiärer Erinnerung von unvollendeter Trauer
Anhang 6
Traumata durch den „Luftzug der Kanonenkugel“
Anhang 7
Inzest und Inzest-Typ 2
Anhang 8
Das Jahrestag-Syndrom
Anhang 9
Zwei klinische Fälle von Jahrestag-Syndrom: Myriam oder: Der Bericht einer Materialisierung eines Familienunbewussten
Das Familiengeheimnis
Noella oder: Einsame Geburtstage mit dem Skalpell
Anhang 10
Freud oder: „Ça parle sur l’autre scène“
Anhang 11
Jahrestag-Syndrom, „teleskopartiges Zusammenschieben von Zeit“ und nationale, transgenerationale Traumata in der Geschichte
Kosovo: 28. Juni 1389 – 28. Juni 1914 – 28. Juni 1989
Anhang 12
Ko-Unbewusstes in Familien und Gruppen (J. L. Moreno) Soziales und interpersonales Unbewusstes (Erich Fromm, Karen Horney, S. H. Foulkes)
Anhang 13
Schema eines Genosoziogramm für eine normale Familie
Mein Stammbaum mit meinen Geschwistern
Anhang 14
Einige historische Daten
Literatur
Über die Autorin
Vorwort
Das in diesem Buch zusammengefasste Lebenswerk der Autorin eröffnet unserem Verständnis von persönlichen Leiden und Krankheiten, Familien, ethnischen Gruppen und dem Schicksal von Nationen ganz neue Dimensionen und überraschende Lösungsmöglichkeiten.
Unsere Vorfahren und Ahnen – das erscheint uns oft als vergangen, verstaubt oder gar lästig. So heißt denn auch der Originaltitel des Buches, Bestseller in Frankreich: „Aïe, mes aïeux!“, wörtlich: „Oh je, meine Ahnen!“, ein familiärer Ausdruck für „Gott oh Gott!“, „Kinder, Kinder!“. Doch Anne Ancelin Schützenberger öffnet uns auf höchst spannende Weise die Augen für die Tatsache, dass wir gebunden und verstrickt sind in Ereignisse, die oft viele Generationen zurückliegen. Schwere seelische und körperliche Belastungen, Unfälle, Scheitern in Liebes- und Arbeitsbeziehungen, all das kann aus einer unbewussten Verbindung mit unseren Vorfahren herrühren, deren Leben und Schicksal in uns weiterwirkt. Und das Buch lehrt uns, wie wir diese Kräfte bewusst machen und dazu nutzen können, ein erfüllteres Leben zu gestalten. An einer Fülle überzeugender Beispiele aus Praxis, Kulturgeschichte und Politik sind die Befunde für den Leser gut nachvollziehbar.
Anne Ancelin Schützenberger ist Psychoanalytikerin, Psychodrama-Therapeutin und Familientherapeutin der Schule von Ivan Boszormenyi-Nagy. In ihrer langjährigen Lehr- und Forschungstätigkeit als Psychologie-Professorin an den Universitäten von Nizza und Paris fand sie, dass weit zurückliegende und vor allem traumatische Ereignisse im familiären Unbewussten unter Umständen über mehrere Jahrhunderte weitergegeben werden, um sich an „Jahrestagen“, d. h. zu bestimmten Zeiten und Anlässen, in unklaren Symptomen oder in schweren Krankheiten bei Nachfahren zu manifestieren – so als sei das Trauma in einem zeitlosen Raum aufbewahrt und immer „sprungbereit“ geblieben. In mehreren Schritten, mitunter über viele Generationen sinkt ein ungelöstes Trauma (Tod, Verlust, Schuld) immer tiefer ins Familien-Unbewusste. Es wird vom zunächst „Nicht-Gesagten zum Geheimnis, dann zum Nicht-mehr-Gewussten und schließlich zum Nicht-mehr-Denkbaren“, sprich: zu einem immer wiederkehrenden Symptom, das sich als seelische und körperliche Not, als ein namenloser Nachhall von weit Zurückliegendem aufdrängt und in der Gegenwart weder erinnert noch vergessen werden kann.
Das Genosoziogramm
Um solchen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, benutzt A. Schützenberger die von ihr entwickelte Form des „Genosoziogramms“, ein sehr detailliert ausgearbeiteter und weit zurückreichender Familien-Stammbaum. Auf großen Papierbögen werden alle nahen und entfernteren Angehörigen mit Geburts- und Todestagen und den Daten wichtiger Lebensereignisse notiert wie Heirat, Scheidung, Adoption, Krankheiten, Unfälle, Krieg oder Vertreibung. Vermerkt werden Umzüge, Ausbildungen, Berufe, Erfolge und Scheitern, Begünstigte und Benachteiligte bei Erbschaften oder Schenkungen. Mit Farben, Symbolen und Stichworten wird verdeutlicht, wer mit wem unter einem Dach gelebt hat, zu wessen Vor- oder Nachteil wer gekommen oder gegangen ist, wer welche besonderen Interessen oder politischen Bindungen hatte und in welche sozialen und größeren geschichtlichen Ereignisse die Familie zu den verschiedenen Zeiten eingebunden war.
Dabei forscht der Klient oft intensiv bei Standesämtern nach, bei kirchlichen Behörden, in Zeitungs- und Gemeindearchiven, in Geschichtsbüchern oder in genealogischen Dateien (z. B. im Internet), um Informationslücken zu füllen.
Das Jahrestag-Syndrom
Mit einiger Übung kann das Genosoziogramm dann wie eine Familien-Partitur gelesen werden, in der Wiederholungen schwerer Schicksale, Loyalitäten zu unbetrauerten Familienmitgliedern oder Identifikationen mit Benachteiligten ins Auge springen oder vermutet werden können. Wegweisend dabei ist vor allem die Übereinstimmung von Daten: Das Trauma erzwingt seine spätere Wiederholung häufig zum gleichen Datum, an dem es selbst ursprünglich eintrat. Erkrankungen, Unfälle oder Selbstmordversuche treten oft zu exakt dem gleichen Zeitpunkt – Monat, Tag, manchmal sogar Uhrzeit – auf, wie sie vor vielen Jahren und Generationen bei einem Vorfahren geschehen sind. Diesen Sachverhalt nennt die Autorin das „Jahrestag-Syndrom“.
Vorsorge für Perioden systemischer Anfälligkeit
A. Schützenberger bezeichnet jene Daten und Zeiten, die uns mit besonderen Schicksalen von Vorfahren verbinden, „Perioden der Anfälligkeit“ (périodes de fragilisation), Phasen, in denen wir unter Umständen gefährdet sind aus dem unbewussten Bedürfnis heraus, uns den Leiden der betreffenden Vorfahren anzugleichen. Die Symptome von Anfälligkeitsperioden reichen von diffusem Unwohlsein über Erkrankungen bis hin zu Unfällen und Suizidalität.
Die Autorin empfiehlt auch deshalb, sich mit dem eigenen Genosoziogramm und mit den in uns weiter wirkenden Schicksalen vertraut zu machen.
Die Folgen von Krieg und Genozid
Ausführlich beschäftigt sich das Buch mit den Folgen von schweren kollektiven Traumata, deren Fortwirken A. Schützenberger bei ihren Klienten fand. Die Verbindung von französischer Revolution oder der letzten beiden Weltkriege mit Angstsymptomen und Erkrankungen in der dritten bis neunten nachfolgenden Generation und deren Milderung oder Heilung durch eine generationenübergreifende Therapie werden eindrucksvoll beschrieben. Weitere Beispiele beziehen sich auf die Sklavendeportation von Afrika nach Nord- und Südamerika, den Völkermord an den Armeniern 1915 und den Holocaust, dessen Folgen – so scheint es – auch in Frankreich erst jetzt langsam wahrnehmbar werden. Am Beispiel der Kreuzzüge und ihren Folgen vor allem im Kosovo-Konflikt wird die geschichtliche Tragweite blinden systemischen Ausgleichs deutlich. In einem Teil der arabischen Welt werden die acht Kreuzzüge zwischen 1096 und 1270 nach wie vor als versuchte Vernichtung des „ungläubigen“ Islam durch die christlich-katholische Welt wahrgenommen, was bis heute zu Ausgleichshandlungen drängt.
Wo schweres unbetrauertes Unrecht geschah, bleibt es offenbar im Zustand eines dauernden Jetzt erhalten und drängt blind auf ausgleichendes, neues Leiden, bis Einsichts- und Heilungsschritte möglich werden.
Zur therapeutischen Praxis
In der therapeutischen Anwendung arbeitet A. Schützenberger mit dem Herzstück ihres Ansatzes, dem Genosoziogramm, auf zweierlei Weise. Sie erarbeitet mit dem Klienten minutiös dessen bedeutungsvolle Lebens- und Ahnengeschichte, die oft über mehrere Jahrhunderte zurückreicht, unbewusst wiederholte Muster von Leiden und Ausgleich identifizierbar macht und zu der Einsicht führen kann: Ich kann damit aufhören. Eindrucksvoll ist dabei die geschulte und für den Leser nachvollziehbare und erlernbare Intuition, mit der sie gegenwärtige Vorfälle und deren geschichtliche Quelle verknüpfen kann und ihre Klienten unbeirrt zum Nachforschen auffordert.
Die so gewonnenen wichtigen Einsichten werden dann in einem zweiten Schritt psychodramatisch nachvollzogen. Die Urahnen kommen noch einmal zu Wort, altes Unrecht wird anerkannt, Schmerz, Trauer, Wut und Schuld finden ihre rechtmäßigen Eigentümer wieder.
Das Buch ist ein „eye opener“ gleichermaßen für Laien wie für Fachleute im therapeutischen, sozialen und vor allem auch im politischen Feld, wo die unbewusste Fortwirkung von Vergangenem und die darauf gegründeten Entscheidungen besonders weitreichende Folgen haben. Es leistet einen wichtigen Beitrag für die gegenwärtige Entwicklung von Psychotherapie und Sozialwissenschaften an vorderster Front, indem es aufzeigt, dass weitreichende Systemkräfte über Zeit- und Raumgrenzen hinaus Feldwirkungen entfalten, deren Ausmaß wir erst zu ahnen beginnen, deren Kenntnis und bewusste Verwendung aber wichtige Veränderungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen anstoßen können. Dabei wird es vor allem um die Möglichkeit gehen, in der therapeutischen, sozialen und politischen Arbeit viel weitergefasste Kausalzusammenhänge wahrzunehmen und sie zu einer Quelle für unkonventionelle und kraftvolle Lösungen zu entwickeln.
So wünsche ich diesem Buch auch im deutschsprachigen Raum eine große Leserschaft und viele bereichernde Aha-Erlebnisse.
Dr. med. Albrecht Mahr
Psychoanalytiker, Facharzt für Psychotherapeutische Medizin Leiter des Instituts für Systemaufstellungen, Würzburg
Lebendige Vergangenheit – Der Papagei des Großvaters
Die Toten sind unsichtbar, sie sind nicht abwesend.
Hl. Augustinus
Vorwort zur französischen Erstauflage
Es war im Sommer, an einem schönen Morgen. Ich war in den Ferien bei einem befreundeten Kollegen in Südfrankreich.
Ich war früh aufgewacht und leise in den Garten gegangen, um den Sonnenaufgang auf den Bergen hinter Sainte-Beaume zu beobachten. Da ich die Gewohnheiten des Hauses nicht kannte und niemanden stören wollte, blieb ich ruhig unter einer Pinie sitzen, in der Nähe des Pools. Alles war still und friedlich und erinnerte an das Gedicht Baudelaires: „Lust und Schönheit … Anmut, Pracht und tiefe Ruh“.
Plötzlich rief von fern eine gebieterische Stimme: „Zu Tisch! Zu Tisch! Schnell, schnell! Zu Tisch!“ Die Hunde sprangen auf und rannten los, ich hinterdrein, in das große Esszimmer. Dort – war niemand.
Die Stimme wiederholte: „Zu Tisch! Monique, schnell zu Tisch!“ „Und sitz gerade!“ (Unwillkürlich richtete ich mich auf.) Es war eine männliche Stimme, bestimmt, selbstbewusst und gewohnt, Befehle zu erteilen.
Die Hunde folgten dieser Stimme und hielten bei ihr an vor … dem Käfig des Papageis. Dort machten sie Platz, warteten aufmerksam, eine ganze Weile, dann aber drehten sie um und legten sich wieder an ihre alte Stelle. Ich war ebenso verwirrt wie sie und kehrte langsam zu meinem Platz unter der Pinie zurück.
Später, beim richtigen Sonntagsfrühstück, das sehr angenehm, entspannt und herzlich war, erklärte mir mein Freund Michel, dass er beim Tod seines Großvaters dessen 100 Jahre alten Papagei geerbt hatte. Und manchmal sprach dieser Papagei so, wie man früher in der Familie gesprochen hatte. Das klang so echt, dass sogar die Familienmitglieder sich zuweilen täuschen ließen.
Manchmal war es der Großvater, ein Arzt, der seine Familie, besonders die Enkelkinder, zu den Mahlzeiten rief, manchmal war es der eine oder andere aus der Familie oder von ihren Freunden. Niemand wusste, was die Erinnerung des Papageis in Gang setzte, noch wessen Stimme oder welche Sätze herauskommen würden.
Für meine Freunde war „die Familie“ immer gegenwärtig. Welche Nähe, welche Wärme, welche Vertrautheit mit den Vorfahren brachte dieser Papagei! Welch eine Kontinuität in der Reihe der Generationen und welche Gewissheit der Verbundenheit mit ihnen! Aber auch, welche Geheimnisse konnten vielleicht durch seine Stimme enthüllt werden, welche Tabus oder Schwierigkeiten ans Licht kommen.
Die Stimme des Papageis verkörperte die Vergangenheit, die lebendige Vergangenheit, die lebt und auf die Gegenwart einwirkt.
Diese Erfahrung öffnete für mich den Zugang zur gegenwärtigen Vergangenheit, zum „Vergehen und Werden“ (allant-devenant), wie die französische Analytikerin Françoise Dolto den Prozess der Veränderung und des persönlichen Wachstums in der Therapie beschreibt.
„Der Tote greift nach dem Lebenden“, so sagen die Notare nach einem römischen Sprichwort.
Wir setzen die Kette der Generationen fort und zahlen die Schulden der Vergangenheit. Solange die Rechnung noch nicht beglichen ist, drängt uns wissentlich oder unwissentlich eine unsichtbare Loyalität zur Wiederholung entweder einer angenehmen Situation oder eines traumatischem Ereignisses, eines ungerechten oder gar tragischen Todes und seiner Folgen, ob wir es wollen oder nicht.
Anne Ancelin Schützenberger
Teil 1Die transgenerationale Methode
1 Eine Genealogie der transgenerationalen Methode
Vom Unbewussten zum Genosoziogramm
Das Leben eines jeden Einzelnen ist ein Roman. Sie und ich, wir leben als Gefangene in einem unsichtbaren Spinnennetz, einem Netz, das wir zugleich selbst weben. Wenn wir unsere Wahrnehmung erweitern könnten und etwas entwickeln, was Theodor Reik (1990) unser drittes Ohr nennt, so wie östliche Philosophien von einem dritten Auge (vgl. etwa de Rosny 1999) sprechen, dann könnten wir lernen, das zu hören, was schwierig zu hören ist, und das zu sehen, was schwierig zu sehen ist. Dann könnten wir die Wiederholungen und die bedeutungsvollen Zufälle in unserer Familiengeschichte erfassen und besser verstehen, wir könnten diese hören und sehen, und das Leben jedes Einzelnen würde viel klarer. Wir würden uns bewusster, wer wir sind und wer wir sein könnten. Gibt es denn keine Möglichkeit, diesen unsichtbaren Fäden, diesen „Triangulationen“ in unserer Familienstruktur, diesen Wiederholungen schwieriger Situationen zu entkommen?
In gewisser Weise sind wir weniger frei, als wir glauben. Aber wir können unsere Freiheit wiedergewinnen und mit der Wiederholung aufhören, wenn wir verstehen, was vor sich geht, wenn wir diese Fäden in ihrem Kontext und ihrer Komplexität erfassen. Dann können wir endlich unser eigenes Leben leben und nicht das unserer Eltern oder Großeltern oder z. B. eines verstorbenen Bruders, den wir bewusst oder unbewusst „ersetzen“.
Diese komplexen Bindungen können gesehen, gefühlt oder geahnt werden, wenigstens teilweise, aber meistens spricht man nicht davon: Sie werden erlebt, gehören aber zum Unaussprechlichen, Undenkbaren, Unsagbaren, Geheimnisvollen.
Es gibt eine Möglichkeit, auf diese Bindungen und unsere Wünsche Einfluss zu nehmen, damit unser Leben so wird, wie wir es uns wünschen, sodass es unseren wirklichen Wünschen, unseren tiefsten Bedürfnissen entspricht (und nicht dem, wie „man“ uns gern hätte).
Wenn es weder Zufall noch Notwendigkeit gibt, dann kann man doch seine Chance wahrnehmen, sein Schicksal in die Hand nehmen, „das ungünstige Geschick abwenden“ und die Fallen vermeiden, die sich aus der unbewussten Wiederholung von Generation zu Generation ergeben.
Man kann über das, was bewusst von Generation zu Generation weitergegeben wird, hinausgehen und das ans Licht bringen, was transgenerational übermittelt wird, das ist das, was ohne „assimiliert“ zu sein, weitergegeben wird, weil es niemals verbalisiert wurde und unter den unausgesprochenen Familiengeheimnissen verborgen bleibt.
Es ist Aufgabe der psychotherapeutischen Arbeit und Ausbildung, uns dazu zu verhelfen, dass unser Leben Ausdruck unseres eigentlichen Wesens ist. Der Psychotherapeut, der sich selbst entdeckt hat und sich selber kennt, ist besser in der Lage, auch das zu hören, wahrzunehmen, zu sehen, beinahe zu erraten, was sein Klient kaum ausdrückt. Schmerzen, Krankheit, Schweigen, die „Sprache des Körpers“ – sie sollen manchmal das Scheitern, das Versäumnis, die Wiederholung, die „Unglücke“ und existenziellen Schwierigkeiten zur Sprache bringen. Dann versucht der Therapeut, demütig, mit seinem ganzen Wissen – bei dem es mehr darum geht, zu sein, in Beziehung zu sein und den anderen zu verstehen, als um ein technisches Können und theoretisches Wissen – go-between, „Bindeglied“, zu sein, Mittler oder Mentor an der Schnittstelle zwischen dem „Ich“ und dem „Selbst“ des Klienten, zwischen dem, der auf der Suche nach sich selber und seiner ihm eigenen Wahrheit ist, und seinem accoucheur oder seiner „Hebamme“, wie Sokrates die therapeutische Rolle nennt.
Bereits Freud …
Ausgehend von seiner eigenen Problematik und von seinem eigenen Leiden, seinen Ängsten und Fragen, hat Freud (vgl. Gay 1999) diese „andere Szene“, das „schwarze Loch“ entdeckt, das jeder in sich trägt, sein „Nichtgesagtes“ oder „Nichtausgedrücktes“, diese klaffende Lücke, das „schwarze Loch, das mit anderen in Verbindung steht“, mit den Mitgliedern der Familie, nahen Bezugspersonen und mit der Gesellschaft als ganzer. Er entdeckte ebenfalls die intrapsychische und interpersonale Umgebung als den Kontext, den Rahmen, der uns bildet und formt, so wie er uns auch blindlings zu angenehmen oder tragischen Erfahrungen führt, uns manchmal sogar „schlimme Streiche“ spielt.
Kann man einen tieferen Sinn finden in diesen harmlosen und banalen Dingen des täglichen Lebens, dem Vergessen, Versehen, den Fehlleistungen, Träumen und impulsiven Handlungen? Welche Bedeutung sollen wir unserem Verhalten und unseren Reaktionen geben, vor allem unseren Krankheiten, Unfällen, wichtigen Lebensereignissen und den „normalen“ Ereignissen, wie Heirat (wie oft, in welchem Alter), Beruf, Anzahl der Kinder, Fehlgeburten, Todesalter? Können wir diesen Ereignissen eine Bedeutung geben ohne die Hilfe eines (guten) Therapeuten?
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Vielleicht können wir ihnen keine Bedeutung geben, aber indem wir ihnen Beachtung schenken und sie im Gedächtnis behalten, werden wir uns verstohlen diesem „Etwas“ nähern, das in uns wirkt. Möglicherweise werden Sie in sich das Talent entdecken, zu schreiben wie so einige englische Autoren oder Klavier zu spielen oder zu gärtnern. Vielleicht geben sie sich auch die Erlaubnis zu studieren oder (endlich) Freude am Leben zu haben.
Es ist selbstverständlich, dass eine Arbeit über drei oder fünf Generationen zum Unbewussten hinführt, so wie es sich zeigt – und damit auf Freud und die Psychoanalyse verweist. Ich möchte den Leser einladen, Freud zu lesen, besonders seine Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, die Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, die Fünf Psychoanalysen und Das Unheimliche; außerdem Groddeck (1988): Das Buch vom Es.
Wir können die historischen Wurzeln der transgenerativen Methode entdecken, wenn wir uns Freuds Bemerkungen anschauen, in denen er über die Wahl der Vornamen seiner Kinder spricht: „Ich hielt darauf, daß ihre Namen nicht nach der Mode des Tages gewählt, sondern durch das Andenken an teure Personen bestimmt sein sollten. Ihre Namen machen Kinder zu Revenants“ (Freud 1969–1975b, S. 468 f.; Hervorh.: A. A. S.).
Freud schreibt an anderer Stelle: „… daß die archaische Erbschaft des Menschen nicht nur Dispositionen, sondern auch Inhalte umfaßt, Erinnerungsspuren an das Erleben früherer Generationen“ (1969–1975g, S. 546).
„Es kann zunächst niemandem entgangen sein, daß wir überall die Annahme einer Massenpsyche zugrunde legen, in welcher sich die seelischen Vorgänge vollziehen wie im Seelenleben eines Einzelnen. Wir lassen vor allem das Schuldbewußtsein wegen einer Tat über viele Jahrtausende fortleben und in Generationen wirksam bleiben, welche von dieser Tat nichts wissen konnten.
Wir lassen einen Gefühlsprozeß, wie er bei Generationen von Söhnen entstehen konnte, die von ihrem Vater mißhandelt wurden, sich auf neue Generationen fortsetzen, welche einer solchen Behandlung gerade durch die Beseitigung des Vaters entzogen worden war“ (1969–1975f, S. 440).
Die Geschichte der Psychoanalyse (vgl. Marthe 1989; Roudinesco 1986) ist bei weitem kein langer, ruhiger Fluss. Wie bei allen Forschungen und wichtigen Entdeckungen gibt es Zusammenstöße, Interpretationen, Erklärungen, tastende Versuche, Entfremdungen, Ausschlüsse, Versöhnungen, Augenblicke der Erleuchtung.
Jung, Moreno, Rogers, Dolto und einige andere
Ich muss an dieser Stelle, in einem Buch über mehrgenerationale Therapie, erwähnen, dass Freud in Totem und Tabu von einer „Massenpsyche“ spricht und Jung vom „kollektiven Unbewußten“ (vgl. Jung 1986; 1988a).1
Der Bruch Freuds mit seinem „Kronprinzen“ – so nannte man Jung in der Gruppe um Freud – war extrem heftig: Um sich zu hassen, muss man sich sehr geliebt haben. Kurz vor seiner Emeritierung und vor seinem Tod schreibt Bruno Bettelheim von der Orthogenic School der Universität von Chicago, dass der Grund für diesen Bruch der Vorwurf von Freud war, Jung verhalte sich unethisch Patienten gegenüber – besonders gegenüber der jungen Sabina Spielrein. Jung dagegen erklärte die Entfremdung mit theoretischen Differenzen hinsichtlich der Triebtheorie.
Wie dem auch sei, Jung ergänzt die Arbeiten Freuds durch die Entwicklung des Begriffs vom „kollektiven Unbewußten“, einem ererbten transpersonalen Unbewussten, das von allen geteilt wird, und des Konzepts der „Synchronizität“, wonach zwei kausal nicht miteinander verbundene Ereignisse, die beide für eine Person eine besondere Bedeutung haben, sich zeitlich gleichzeitig ereignen.
Nach Jung macht uns das kollektive Unbewusste zu dem, was wir sind. Es wird von Generation zu Generation in der Gesellschaft weitergegeben und lässt die menschliche Erfahrung anwachsen; es ist angeboren, daher existiert es jenseits von Verdrängung und persönlicher Erfahrung. Selbstverständlich hat ein solches Konzept große Auswirkungen auf die psychoanalytische Theorie und die klinische Praxis.
Obwohl mein Standpunkt aufgrund meiner freudianischen Ausbildung klar ist, denke ich, dass die Zeit für einen Streit der Schulen vorbei ist: Es ist nicht meine Absicht, für oder gegen Jung Stellung zu beziehen. Aber was man hervorheben muss, ist seine Idee von der Weitergabe von Generation zu Generation und von der Synchronizität, der räumlichen und zeitlichen Gleichzeitigkeit von Ereignissen.
Man könnte sagen, wenn Freud derjenige war, der das Unbewusste, das Nichtausgedrückte, die „Massenpsyche“entdeckt hat, und wenn Jung das kollektive Unbewusste eingeführt hat, dass es Moreno war, der Vater des Psychodramas und der Gruppentherapie, der das Postulat des Ko-Bewussten und des Ko-Unbewussten in Familien und Gruppen aufstellte. Er beschreibt, dass ein einziges Bewusstes und Unbewusstes von mehreren Personen, die eng miteinander verbunden sind wie in einer Familie, einem Chirurgenteam oder in einer Gruppe in gefährlicher Mission, geteilt wird. Ungefähr zur gleichen Zeit, in den Jahren 1960 bis 1970, erforschten Françoise Dolto2, Nicolas Abraham und ihre Schüler und auch Ivan Boszormenyi-Nagy das komplexe Problem der transgenerationalen Weitergabe von ungelösten Konflikten (Hass, Rache, Blutrache), von Geheimnissen, von „Nichtgesagtem“, von vorzeitigen Todesfällen und der Wahl eines Berufes.
Wissen baut sich durch Ansammeln auf, und ganz plötzlich tritt ein neues Feld in Erscheinung. Wenn man eine Psychoanalyse macht, geht man voran, man arbeitet an seinen Gefühlen und Erinnerungen und weiß oft nicht, wohin das führen wird, und auf einmal enthüllt sich die Bedeutung.
Das ist, als ob unerwartet ein capiton, eine Polsternaht – so hätte Lacan gesagt –, auf mehrere Schichten von unbewussten Erinnerungen und Erfahrungen trifft, und indem er bzw. sie sie alle verbindet, leuchtet der Sinn hell auf.
Alle Therapeuten, seien sie Psychoanalytiker oder einer anderen Richtung zugehörig, sind Teil einer Kette von Vorgängern, der sie sich durch die Theorie, die sie vertreten, verbunden fühlen. Aber oft steht die klinische Praxis im Gegensatz zur Theorie, und wir machen Konzessionen, auch wenn sie noch nicht anerkannt sind.3 Was wichtig ist, ist die Art, wie der Therapeut seinen „Klienten“4 empfängt, ihm zuhört, ihn versteht und ihn beobachtet. Der Therapeut muss den Klienten, seine Weise zu denken und zu fühlen, „verstehen“. Grinder und Bandler (1983, dt. 1997) haben betont, von welcher Bedeutung es ist, die gleichen Wahrnehmungskanäle zu benutzen, empathisch5 zu sein, sodass das Unbewusste des einen mit dem Unbewussten des anderen kommuniziert.6 So entsteht das, was Moreno das „Ko-Unbewußte“ nennt. Der brillanteste und kenntnisreichste Therapeut wird niemals ein wirklicher Therapeut sein, wenn er nicht in der Lage ist, den Klienten in seinem je eigenen Kontext und Bezugsrahmen zu verstehen.
Deshalb ist es oft so, dass die Dinge geschehen, wenn die Worte ungesagt bleiben, dass viele wichtige Dinge an der Türschwelle ihren Ausdruck finden.
Die Therapeuten haben Recht, wenn sie sagen, dass Therapeut sein kein Beruf ist wie jeder andere: Man lernt ihn nicht, er wird weitergegeben. Er ist ebenso eine Kunst wie ein Wissen und eine Weise, in der Welt zu sein.
Meine professionelle Herkunft
Bei diesem Stichwort „Weitergabe“7 möchte ich von meiner eigenen professionellen Herkunft sprechen. Ich wurde in der freudschen Psychoanalyse ausgebildet von Robert Gespien, damals Direktor am Musée de l’Homme in Paris, und von Françoise Dolto – und im Psychodrama von J. L. Moreno (Beacon, N. Y.), und von James Enneis, St. Elisabeth’s Hospital, Washington, D. C. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass es mir manchmal gelingt, aus einem „Frosch eine Prinzessin“ (siehe Bandler u. Grinder 1998) zu machen.
Folgenden Therapeuten verdanke ich sehr viel: Leon Festinger, Margaret Mead, Gregory Bateson, Erwin Goffman, Carl Rogers und auch der Palo-Alto-Gruppe Ray Birdwhistell, Paul Watzlawick und Jürgen Ruesch und auch Louis und Diana Everstine. Aber vor allem Moreno hat mich beeinflusst und mir die Möglichkeit gegeben, eine gewisse kreative Fantasie zu entwickeln, und den Wunsch, „dem andern zu begegnen“, und die Hartnäckigkeit, denen zu helfen, die leiden.
Der verkannte Moreno
In Frankreich hat Moreno niemals die gebührende Anerkennung für seine Beiträge als Begründer der Rollentheorie, der Soziometrie und als Vater des Psychodramas und der Gruppentherapie erfahren. Das hat viel mit seinem Kampf gegen die Psychoanalyse zu tun. Seine Haltung Freud gegenüber – beinahe selbst ein Psychodrama – zeigt sich in seiner polemischen Auseinandersetzung mit Abraham Brill auf dem 1. Kongress der Amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie 1932, und in seiner Monographie Das Psychodrama Sigmund Freuds, die er 1967 veröffentlichte.8 Im Grunde sind Freud und Moreno zwei schöpferische Persönlichkeiten, deren Werke sich ergänzen. Moreno schrieb 1956, aus Anlass des 100. Geburtstages von Freud, wenn die Psychologie des 20. Jahrhunderts Freud gehört habe, so werde die des 21. Jahrhunderts Moreno gehören. Sieht das nicht nach einem Vatermord aus mit dem Ziel, sich von ihm zu unterscheiden und ihn zu übertreffen?
Moreno hat zur „Entdeckung“ der Sprache der unbewussten Inhalte beigetragen, die sich ja auf ihre Weise mitteilen, auf der Couch oder ohne diese, von „irgendwoher“ in der Zeit, einer kreisförmig verlaufenden Zeit. Heute erforscht man sie mithilfe des Genosoziogramms und der transgenerationalen Methode. Man kann Moreno zu Recht als einen der Gründerväter bezeichnen.
Unter Morenos wichtigsten Ideen für diese Forschung möchte ich zuerst den Begriff des tele nennen. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet „auf Entfernung“. Tele meint eine unbewusste Kommunikation positiver oder negativer Art zwischen räumlich voneinander entfernten Personen in einer „Mischung aus Empathie“, Weitergabe und „wirklicher Kommunikation“.
Als wichtig möchte ich auch das „soziale Atom“ (dies ist sozusagen ein Kern mit seinen Trabanten auf den Elektronenbahnen) erwähnen, Morenos Weise, die bedeutsamen Beziehungen im Leben eines jeden Einzelnen als Diagramm darzustellen. Dieses Diagramm erfasst alle Personen, aus denen die „persönliche Welt des Subjekts“ besteht: seine Familie, seine Freunde, seine Bekannten, seine Nachbarn, seine Arbeitskollegen und Sportsfreunde, alle die, die in seinem Leben durch Liebe oder durch Hass präsent sind, gleich, ob sie noch leben oder schon gestorben sind. Das Subjekt oder der Protagonist schreibt im Allgemeinen alle Personen an eine Tafel oder auf ein Blatt Papier und nimmt eine räumliche Anordnung vor, die der „sozialen Distanz“9 zwischen den einzelnen Personen entspricht.
So kann man z. B. in dieser Darstellung eine Schwiegermutter, die einen ärgert, zum Teufel schicken, hier würde das heißen: nach jenseits der Tafel, und neben sich eine Großmutter schreiben, die man sehr geliebt hat und die in einem sehr lebendig ist, auch wenn sie schon tot ist. Normalerweise schreibt sich beim sozialen Atom das Subjekt als Erstes auf und positioniert sich an eine bestimmte Stelle („Das bin ich, hier“), aber es gibt auch Personen, die erst das ganze Diagramm fertig stellen und dann ihren Platz in der Herkunftsfamilie einnehmen.
Das soziale Atom zeigt das Bild eines Lebens, seiner Verästelungen, seiner Interessen, seiner Träume und Ängste.
Man könnte sagen, dass das soziale Atom ein Genosoziogramm10 im Hier und Jetzt ist.
„Morenoianer“ ergänzen es durch das affektive soziometrische Netz, die komplexen Ketten zwischenmenschlicher Beziehungen, und den soziometrischen Status, d. h. das Maß des Geliebt- und Geschätztwerdens eines Menschen innerhalb einer Gruppe. Das soziale Atom repräsentiert diese affektiven Projektionen. In Who shall survive (1934) definiert Moreno das soziale Atom, diese Darstellung der persönlichen Welt eines Menschen, als den „internen und externen Kern der Personen, die dem Subjekt emotional verbunden sind“.
Genogramm und Genosoziogramm
Auf den Arbeiten Morenos aufbauend, entwickelte Henri Collomb (1977) die Technik des Genosoziogramms, welches wir in diesem Buch darstellen werden. Er brachte diese Technik von Dakar mit an die Universität von Nizza im Jahr 1978.
Das Genosoziogramm erlaubt eine bildhafte soziometrische Darstellung des Familienstammbaums mit seinen charakteristischen Angaben von Namen, Vornamen, Orten, Daten, Anhaltspunkten, Bindungen und den wichtigsten Lebensereignissen, wie: Geburten, Hochzeiten, Todesfällen, bedeutsamen Krankheiten, Unfällen, Umzügen, Berufstätigkeiten, Pensionierungen. Das Genosoziogramm ist eine kommentierte Darstellung des Stammbaums (Genogramm). Mithilfe soziometrischer Pfeile macht es die verschiedenen Arten von Beziehungen des Subjekts zu seiner Umgebung und auch die Bindungen zwischen den verschiedenen Personen deutlich: zur gleichen Zeit leben, miteinander wohnen und handeln, Dyaden, Triaden, Ausschlüsse … Man sieht, „wer mit wem unter einem Dach lebt“ und „wer aus der gleichen Schüssel isst“, wer wessen Kinder aufzieht, wer fortgeht und wohin, wer dazukommt (durch Geburt oder Zuzug) in dem Augenblick, in dem ein anderer weggeht (stirbt oder auszieht), wer wen in der Familie ersetzt und wie Dinge geteilt werden … vor allem nach einem Todesfall (Erbteile, Schenkungen), man erkennt die Bevorzugten und die Benachteiligten, ebenso die Wiederholungen und die „Ungerechtigkeiten“ in der Familienbuchhaltung.
Einige Therapeuten schreiben den Ursprung des Genogramms einer Konferenz über Familientherapie zu, die Murray Bowen 1967 veranstaltete; aber man könnte auch sagen, dass das Genogramm aus den ersten Reflexionen Morenos über die komplexen familiären Bindungen hervorging – und dem Konzept seines sozialen Atoms –, wenn auch die verschiedenen Praktiker der systemischen Familientherapie und des Genogramms diese „historische Genealogie“ nie zurückverfolgt haben.
Die, die es anwenden, erforschen die Beziehungen, die Bindungen und die Bedingungen und Folgen in einem Familiensystem.
Ich arbeite mit dem Genosoziogramm sehr viel mehr in der Tiefe, in einem vollständigeren Kontext, und oft rekonstruiere ich die Vergangenheit über zwei Jahrhunderte, das sind sieben bis neun Generationen, hinweg, manchmal sogar noch weitreichender.
Die psychosoziale und psychoanalytische Betrachtung und die Wahrnehmung der Veränderungen beim Klienten, z. B. bei seinem Atemrhythmus, vertiefen und bereichern die Ergebnisse des Genogramms und machen es zum Genosoziogramm. So kann man das Gesagte und das Nichtgesagte ans Licht bringen, die gegenwärtigen und die vergangenen sozialen und emotionalen Beziehungen und Bindungen. Man arbeitet besonders mit dem, was durch nonverbale Kommunikation ausgedrückt wird, und erforscht auch in dem, was verbal gesagt wird, die Auslassungen, das Vergessene, die Brüche, die Wendepunkte, die „gebrochenen Herzen“, die gleichzeitigen Ereignisse und das zufällige Zusammenfallen von Daten bezüglich Geburt, Tod, Hochzeit, Trennung, Unfällen, Auftreten von Krankheiten, Versagen bei Examen, Versöhnungen. Man berücksichtigt Geburtstage oder wichtige Daten in der persönlichen Welt des Klienten, seines Familiensystems, seines „sozialen Atoms“, seiner sozialen und wirtschaftlichen Umgebung und seiner persönlichen psychischen Realität, um ihm zu helfen, dass er sein Leben besser versteht und ihm einen Sinn geben kann.
Freud und „Das Unheimliche“
Manchmal erscheinen Dinge, die in der Psychotherapie gesehen und gehört werden, sogar erfahrenen Therapeuten als sehr fremd. Aber wenn man sie öfter hört, von verschiedenen Kranken, und wenn man sie dann hört ohne vorgefasste Meinung, wenn man mit aufmerksamem Ohr, neutral und wohlwollend zugleich, all dem zuhört, was ein menschliches Wesen erzählen kann, dann können diese Dinge Sinn haben, subjektiven Sinn für das leidende Subjekt. Sie können auch Sinn haben für den Therapeuten, vor allem, wenn dieser Therapeut das, was an Neuem und Unerwartetem auftauchen kann, nicht mit einer vermutlich vereinfachenden Theorie zudeckt. Dann – nur dann – können sich neue Paradigmen eröffnen und zu klinischen Fakten werden, die in einem neuen Bezugsrahmen Sinn haben und so zu wissenschaftlichen Fakten werden können.
Freud schreibt in Das Unheimliche (1969–1975e, S. 244)11:
„Man kann … zusammentragen, was an Personen und Dingen, Sinneseindrücken, Erlebnissen und Situationen das Gefühl des Unheimlichen in uns wachruft, und den verhüllten Charakter des Unheimlichen aus einem allen Fällen Gemeinsamen erschließen … das Unheimliche sei jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht … Ich bemerke noch, daß diese Untersuchung in Wirklichkeit den Weg über eine Sammlung von Einzelfällen genommen und erst später die Bestätigung … gefunden hat.“
Freud definiert das Unheimliche als „die unerwartete Wiederkehr von Elementen, die bereits seit langem hätten überwunden oder ausgemerzt sein sollen – Reste primitiven Glaubens, eine Wiederkehr des Archaischen –, oder von Elementen, die hätten verdrängt sein sollen, da sie mit Grauen und Widerwillen verbunden sind, mit der Qual und dem Schrecken dieser Zeit, in der wir leben“ (ebd., S. 271; geschrieben am Ende des Ersten Weltkrieg, veröffentlicht 1919).
Im Unheimlichen können wir wie Maria Török12 die lang andauernde und quälende Wirkung eines Familiengeheimnisses sehen, etwa eine quälende Angst – oder die unerwartete Rückkehr des Verdrängten – oder die Traumata der Schrecken des Krieges (Freud selber musste bei Verdun Verwundete versorgen).
Ich denke, dass bei Freud eine der theoretischen Grundlagen zu finden ist, um das zu untermauern, was ich und andere transgenerationale Therapeuten bei bestimmten Symptomen festgestellt haben – nämlich bei Ängsten, Phasen von „Todeskälte“ (ähnlich dem Raynaud-Syndrom) und Entsetzen und/oder bei wiederholten Albträumen von Nachfahren derer, die Katastrophen und die unzähligen Schrecken der Kriege überlebt haben. Diese Symptome erscheinen oft in Zeiten der Erinnerung an diese Ereignisse und/oder an den Jahrestagen dieser Ereignisse. Die Symptome sind da, gleichgültig, ob über die Fakten, wie Kriegserinnerungen, Konzentrationslager, Bombardierungen, Erdbeben, in der Familie gesprochen wird oder nicht, ob sie verheimlicht werden, als Geheimnis oder Tabu behandelt werden, das zwar historisch bekannt ist, aber kein Thema in der Familie sein darf.
1In einem Artikel in einer amerikanischen Zeitung aus dem Jahr 1980 diskutierte Bruno Bettelheim die „wahren“ ethischen Gründe des Bruches von Freud mit Jung und die Untersuchung über die Klagen traumatisierter Patienten, besonders von Sabina Spielrein. Freud billigte nicht, dass ein Therapeut mit seinen jungen Klienten und Klientinnen ausging – ein Vorwurf, den Jung zurückwies. Siehe zu diesem Thema auch Spielrein (1986).
2Françoise Dolto machte ihre Analyse in Paris (1934–1937) bei René La Forge, der das transgenerationale Feld eröffnet.
3Siehe La Famille (1991). In diesem Lehrbuch über die psychotherapeutische Methode und die Methode der systemischen Familientherapie sagt Robert Pessler: „Die Psychoanalytiker und die Familientherapeuten nähern sich einander an, ohne sich jedoch zu vermischen, wenn es um die Behandlung von Familien in der klinischen Praxis geht … In der klinischen Praxis kann die Polarisierung und der gegenseitige Ausschluß überwunden werden.“
4Carl Rogers hat diesen Terminus eingeführt. Er bevorzugt ihn vor den Termini „Subjekt“ und „Kranker“, um auszudrücken, dass der „Klient“ einen Rat möchte oder dass in der Therapie eine freie Beziehung besteht.
5Empathie ist nicht gleichbedeutend mit Sympathie.
6Das „Ko-Unbewußte“ von Moreno wurde vielleicht schon von Freud geahnt, als er von der frei schwebenden Aufmerksamkeit des Therapeuten spricht.
7Anm. der Übersetzerin: „Transmission“ wird meist mit „Weitergabe“ übersetzt, gelegentlich auch mit „Übermittlung“.
8Einzelheiten bei Marineau (1989).
9Die „soziale Distanz“ ist ein Konzept der Sozialpsychologie. Sie gibt an, wie nah gefühlsmäßig oder wie weit entfernt eine Person sich von einer anderen erlebt, die geographische Entfernung nicht gerechnet. Brasilien und sein Karneval z. B. steht den Bewohnern von Nizza näher als Deutschland oder Belgien – oder mein verstorbener Großvater ist mir näher als mein Nachbar im Haus.
10Genosoziogramm, von Genealogie (Familienstammbaum) und von Soziogramm (Darstellung von Beziehungen, Bindungen); d. h. also der Familienstammbaum mit seinen markanten Fakten, den wichtigsten Lebensereignissen und den affektiven Bindungen, die grafisch hervorgehoben werden. Das Genogramm ist schon ein kommentierter Stammbaum mit einigen Anhaltspunkten. Es wird vor allem in der systemischen Therapie verwendet und von Soziologen, die keine Psychoanalytiker sind und die von daher Lebensberichte weniger nach verborgenen oder unbewussten Bindungen „durchsuchen“. Das ist das, was wir beim Genosoziogramm tun: Wir erstellen ein detaillierteres und fundierteres Genogramm.
11Freud geht aus von einem Text von E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann, nachzulesen in Freud (a. a. O.).
12Text von Freud, der von Nicolas Abraham, Maria Török und ihren Schülern wieder aufgenommen wurde.
2 Familientherapie und das Genogramm/Genosoziogramm
Als die Familie als neues Konzept in der therapeutischen Szene auftauchte und es üblich wurde, mit Film und Video zu arbeiten, wurde deutlich, welchen Stellenwert Bindungen und Weisen der Kommunikation für die Gesundheit oder Krankheit einer Familie haben. Diese Erkenntnisse ermöglichten es auch, das Konzept des Genosoziogramms zu entwickeln und zu verfeinern und als Handwerkszeug für Diagnostik und Behandlung zu benutzen.
Das, was wir Familientherapie nennen, basiert auf den Untersuchungen von Frieda Fromm-Reichmann13 (1889–1957), die etwa 1948 anfing, über Psychosen und besonders Schizophrenie nachzudenken. Sie arbeitete mit schizophrenen Patienten und deren Familien, filmte diese und ließ sie filmen von Anthropologen und Psychiatern.
Wenn der Traum nach Freud „der Königsweg zum Unbewussten“ war, so gab die Familie des Schizophrenen und ihre Interaktionen – die gefilmt und in Zeitlupe studiert wurden – die Möglichkeit, die innere Welt von Familien mit ihren spezifischen Weisen verbaler Kommunikation und nonverbalen Ausdrucks zu entschlüsseln.
In der Nachfolge von Frieda Fromm-Reichmann versammelten sich etwa 1956 an der Stanford-Universität und in Palo Alto andere Forscher um Gregory Bateson, Jay Haley, John Weakland, Don Jackson und später Paul Watzlawick und die berühmte Familientherapeutin Virginia Satir und begannen, diese Aspekte familiärer Interaktion zu erforschen (vgl. etwa Perceval 1961; Haley 1990; Watzlawick, Beavin u. Jackson 1990; Satir 1997). Man könnte sagen, es war eine glückliche Fügung von Umständen, dass sich so viele hoch qualifizierte Leute aus den verschiedenen Forschungsrichtungen in Palo Alto zusammengefunden hatten, um sich auszutauschen und ihre Standpunkte zu vergleichen. So hatte sich die Palo-Alto-Gruppe gebildet: Die meisten Forscher verbrachten ihr Sabbatjahr in Palo Alto als fellows am Institute for Advanced Study in the Behavioral Science.
Die Palo-Alto-Gruppe
Die so genannte „Gruppe von Palo Alto“ formulierte die Hypothese vom Double-bind. Darunter versteht man eine schwere Störung in der Kommunikation der Familie: Es werden Botschaften gegeben, diese sind aber sehr widersprüchlich. Sie sind so strukturiert, dass man verbal eine Sache bejaht, gleichzeitig aber durch die Körpersprache z. B. etwas völlig anderes ausdrückt. Beide Aussagen schließen sich aus oder blockieren sich. Das ist eine „doppelte Botschaft, die doppelt bindet“. Wenn die Botschaft also ein ausdrücklicher Befehl ist, ein Gebot, dann muss man ihr daher nicht gehorchen, um ihr zu gehorchen.
Aber es ist auch verboten, davon zu sprechen oder gar die Tatsache anzusprechen, dass die Botschaft verwirrend, widersprüchlich und „bindend“ ist.
Jemand, der sich in einer Double-bind-Situation befindet, riskiert also, bestraft zu werden oder sich schuldig zu fühlen, wenn er die Dinge „richtig“ wahrnimmt. Er wird von seiner Familie als „schlecht“ oder „verrückt“, als „designierter Patient“ bezeichnet, weil er gezeigt hat, dass es einen Widerspruch – eine Unvereinbarkeit – gibt zwischen dem, was er sieht, wahrnimmt, und dem, was er sehen und fühlen sollte. Die Palo-Alto-Gruppe betrachtet in vielen Fällen bei schizophrenen Kindern die Eltern oft als kränker als das Kind und meint, eigentlich müssten die Familie und die familiäre Kommunikation behandelt werden, damit das Kind gesund werden kann.
Diese klassische Familientherapie, die die Palo-Alto-Gruppe entwickelte, stützt sich in ihrer Theorie auf die Idee des „Systems“ und der „Homöostase“, d. h. auf einen Ausgleich der Kräfte und auf „Familienregeln“. Die Praktiker des Mental Research Institute (MRI), wie Watzlawick, Whitaker und Napier, sprechen bereits vom „Geist“, der während der Therapie aus der Vergangenheit des Patienten auftaucht (vgl. Le fantome de grand-mère in Napier et Whitaker 1980), sie verweisen auch schon auf die systemische Familientherapie.
Die strategische systemische Therapie
Es gibt auch einen intergenerationalen Zweig der Familientherapie, dazu gehören Murray Bowen, Ivan Boszormenyi-Nagy, Maurizio Andolsi, Helm Stierlin. Sie haben das Konzept der Delegation entwickelt, z. B. einer Schuld: Man gibt die „heiße Kartoffel“ weiter an die nächste Generation.





























