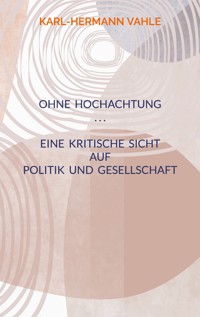
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Januar 2009 brach ich mir beim Füttern meiner Tiere ein Bein. Infolgedessen verbrachte ich die folgenden Wochen meist im Haus. Während dieser Zeit lief oft das Radio und ich verfolgte die Nachrichten aufmerksamer als sonst. Viele Entwicklungen in Politik und Gesellschaft kamen mir jetzt widersinnig vor oder schienen in eine falsche Richtung zu laufen. Ich engagierte mich zu dieser Zeit selbst kommunalpolitisch als Gemeindevertreter und mir fiel auf, dass es auch auf dieser Ebene Parallelen zur "großen" Politik gibt. So begann ich, darüber nachzudenken und mir Notizen zu machen... Einleitung Die Menschen tun oft nicht das, was sie im Grunde genommen für richtig halten. Aufs falsche Pferd gesetzt Die Menschheit hat Prozesse angestoßen, die unumkehrbar sind und ist so auf eine Einbahnstraße geraten. Politik - der Weg in den Abgrund Der Endzweck von Politik sollte sein, die Weichen für eine lebenswerte Zukunft zu stellen, doch es geht nur um Macht. Politik wird kaum die Zukunftsprobleme der Menschheit lösen. Die kollektive Verblödung Unsere Gesellschaft ist verblödungsgefährdet. Politik und Medien versuchen, aus den Menschen mainstream-konforme Meinungskonsumenten zu machen. Von der Energie zum Klima Die Atmosphäre wird zur Wärmefalle. Der Weltenergieverbrauch hängt von der Anzahl der Menschen und deren Lebensstandard ab. Andauerndes Wachstum ist mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit nicht vereinbar. Die Verlärmung der Welt Unser Lebensraum verlärmt zunehmend, vorwiegend verursacht vom Individualverkehr. Der Staat muss die Gesundheit seiner Bürger schützen. Lärmvermeidung muss vor Lärmschutz gehen. Fortschritt und Vernunft Wirklicher Fortschritt zeigt sich in den sozialen und kulturellen Bereichen des menschlichen Daseins. Lebensqualität ist nicht das gleiche wie Lebensstandard. Ein allzu frühes Heranführen an das Leistungsprinzip stellt für Kinder eine Einengung ihrer natürlichen Entwicklung dar. Die ungleiche Verteilung des Wohlstandes in unserer Welt nimmt zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Karl-Hermann Vahle wurde 1955 in Sandesneben, Schleswig-Holstein, geboren. Er absolvierte zunächst eine Berufsausbildung zum Elektromechaniker. Ein Studium des Flugzeugbaus an der Fachhochschule Hamburg schloss er mit dem akademischen Grad Diplom-Ingenieur ab. Im Anschluss nahm er seine berufliche Tätigkeit als Projekt-Ingenieur bei MBB (später Deutsche Airbus GmbH) in Hamburg-Finkenwerder auf.
Vahle lebt auf einem Bauernhof in Siek, der bis 1971 von seinen Eltern als landwirtschaftlicher Betrieb geführt wurde. Heute unterhält er den Besitz als Resthof mit Tieren, Stall und Weide. In seiner Heimatgemeinde war er 23 Jahre als Gemeindevertreter kommunalpolitisch tätig. Er liebt romantische Klaviermusik und ist wissenschaftlich und philosophisch interessiert.
Dem Andenken meiner Eltern gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Aufs falsche Pferd gesetzt
Verkehrswegekonzept
Der Zweck des Geldes
Politik – der Weg in den Abgrund
Nukleare Mächte
Neue Weltordnung?
Politik und Rechtsstaat
Wer’s glaubt, wird selig
Politisches Selbstverständnis
Politische Verantwortung
Sie quatschen und quatschen
Politikverdrossenheit
Die Qual der Wahl
Politik – ein Auslaufmodell?
Die kollektive Verblödung
Mediales Blendwerk
Politische Untertöne
Die digitale Welt
Die Masche mit der Motivation
Heimische Idylle
Scheinwelten
Von der Energie zum Klima
In der Wärmefalle
Klimaneutrale Energie
Weg aus der Klimakrise
Die Verlärmung der Welt
Lärmender Straßenverkehr
Tempolimit und Artikel 2 GG
Richtlinie in der Praxis
Limiter, die nicht limitieren
Lärmschutz statt Lärmvermeidung
Flucht nach vorn
Maßnahmen ohne Nutzen
Fortschritt und Vernunft
Lebensqualität oder Komfort
Der schnöde Mammon
Traum und Wirklichkeit
Wird die Welt besser?
Einleitung
Seit jeher haben Menschen Großes im Sinn und setzen sich hohe Ziele. Alle streben nach idealen Verhältnissen, alles soll besser werden. Wir wollen vieles erreichen: höhere Bildung, steigenden Wohlstand, gerechtere Sozialsysteme, mehr Frieden in der Welt. Aber auf unserem Marsch in eine bessere Zukunft verlieren wir schnell die Orientierung. Wir meinen, den Weg zu kennen, schaffen es aber nicht, in der Spur zu bleiben. Wir geraten auf Nebenschauplätze, doch das Naheliegende wird nicht getan. Das Erreichte hinkt unseren Ansprüchen weit hinterher – die Ziele werden verfehlt. Was ist schiefgelaufen?
Unser Scheitern hat meistens einen einfachen Grund: Wir tun nicht das, was wir eigentlich für richtig halten. Wir drücken uns drum herum, Probleme an den Wurzeln zu packen. Stattdessen suchen wir nach Ersatzlösungen oder doktern an Symptomen herum. Aber die eigentlichen Grundübel bleiben oft unangetastet. Denn konsequentes Handeln unter Beachtung allgemeingültiger Prinzipien passt uns häufig nicht ins Konzept. Wir müssten umdenken, wenn nicht gar unseren durchgeplanten Lebensentwurf überprüfen. Doch wer lässt sich schon gerne auf so einen Handel ein. Die Menschen sind genetisch auf persönlichen Erfolg programmiert, nicht auf nachhaltigen Erfolg der Allgemeinheit. Die Unterordnung der eigenen Interessen zugunsten einer zukunftsfähigen Welt ist unpopulär und steht im Gegensatz zu den Konventionen einer karriereorientierten Gesellschaft.
Warum halten die Menschen den Dauerstress für eine üble Erscheinung unserer Zeit, machen sich aber selbst durch ihre ständige Erreichbarkeit über die neuen Kommunikationsmedien zu Mitgliedern einer getriebenen Gesellschaft?
Alle wissen, dass die ersten Lebensjahre eines Kindes in der Geborgenheit eines vertrauten Elternhauses entscheidend für seine zukünftige Entwicklung sind. Trotzdem geht der Trend dahin, Kinder schon im Säuglingsalter in die Krippe zu geben.
Jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass ein fortwährendes Wachstum in einem begrenzten Umfeld ins Chaos führen muss. Doch sehen die meisten Menschen im dauerhaften Wachstum die Voraussetzung für Wohlstand und Fortschritt.
Die Reihe von Thesen und Antithesen ließe sich beliebig fortsetzen, die Menschen handeln offensichtlich wider besseres Wissen. Elementare Grundsätze werden zwar allgemein bejaht, aber bitteschön nur dort, wo eigene Interessen nicht berührt werden. Außerdem ist es unbequem, sich mit eigener Denkweise gegen den allgemeinen Trend zu stellen. Diesen Mut bringen nur wenige Menschen auf. Schwimmt man gegen den Mainstream, gerät man leicht ins gesellschaftliche Abseits. Querdenker ziehen zwar leicht die Aufmerksamkeit auf sich, aber nur selten die Akzeptanz.
Ein Prinzip der wissenschaftlichen Arbeit ist es, einen gegebenen Sachverhalt mit so wenigen Parametern wie möglich hinreichend zu beschreiben. Im übertragenen Sinne sollte dieses Prinzip auch für das individuelle sowie gemeinschaftliche Leben gelten. Weniger Kompliziertheit – mehr Einfachheit, weniger Ausnahmen – mehr Allgemeingültigkeit, weniger Heuchelei – mehr Ehrlichkeit.
Ein Bundespräsident dürfe kein Vereinfacher sein – so Frank Walter Steinmeier anlässlich seiner Nominierung für das Amt des Bundespräsidenten. Gemeint hat er wohl, dass er weder pauschalisieren, polarisieren noch ideologisieren werde. Ein guter Vorsatz, aber warum sagt er es denn nicht mit diesen Worten? Stattdessen rückt er den Begriff „Vereinfachung“ in ein schlechtes Licht. Im eigentlichen Sinne des Wortes bedeutet Vereinfachung aber so viel wie Verdeutlichung und Veranschaulichung und ist daher positiv zu bewerten. Gerade die Politik sollte sich auf diese Eigenschaft als Grundlage ihres Handelns besinnen. Und gerade die Demokratie ist auf ein einfaches und eindeutiges Regelwerk als Voraussetzung für ihre Stabilität angewiesen. Denn die kompromissorientierte Politik einer Demokratie läuft ohnehin Gefahr, praktikable und effiziente Lösungen zu blockieren – eine prinzipielle Schwäche demokratischer Strukturen.
Aufs falsche Pferd gesetzt
Seit es Menschen auf der Welt gibt, entwickeln sie ihre sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfelder. Am Anfang haben sich übergeordnete Prinzipien ergeben, aus denen dann detaillierte Strukturen abgeleitet wurden. Damit wurden Weichen gestellt, die den Zug der Entwicklung auf ein Gleis geleitet haben, das nur noch schwer oder gar nicht mehr gewechselt werden kann. Infolgedessen bleiben viele Grundkonzepte erhalten, obwohl sie aufgrund geänderter Gegebenheiten nicht mehr zukunftsweisend sind. Die Menschen müssen mit Konzepten leben, die, einmal auf den Weg gebracht, für immer Bestand haben. Dieser etwas abstrakt klingende Sachverhalt soll im Folgenden an zwei Beispielen erläutert werden:
Verkehrswegekonzept
Der Mensch als beseeltes Lebewesen hat das Vermögen zur koordinierten Ortsbewegung. Anfangs lief er quer durch die Landschaft, um sein Ziel zu erreichen. Irgendwann merkte er dann, dass es bequemer ist, immer wieder die gleiche Route zu nehmen, nämlich die des geringsten Widerstandes. Daraus sind dann im Laufe der Zeit Wege und Straßen entstanden, die für beide Richtungen benutzt wurden. Begegnungen waren auch nicht weiter problematisch, solange es sich um Fußgänger, Ochsenkarren und Pferdegespanne handelte.
Heute aber bewegt sich der Verkehr auf den Straßen mit erheblich größeren Geschwindigkeiten. Das Konzept der Verkehrswege mit Gegenverkehr hat sich jedoch nicht verändert. Infolgedessen begegnen sich heutzutage Fahrzeuge auf Landstraßen mit relativen Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h – die Einhaltung des Tempolimits von 100 km/h mal vorausgesetzt. Und das bei einem Abstand von nur wenigen Metern. Ganz zu schweigen von der Gefahr beim Überholen auf der Spur des Gegenverkehrs. Kleinste Unachtsamkeiten oder Lenkfehler führen hier oft zu schweren Unfällen. Wie könnte man dieses Gefahrenpotential entschärfen?
1. Man ändert das Verkehrswegekonzept so ab, dass es keine Gegenverkehre mehr gibt:
Mit den Autobahnen hat man da einen ersten Ansatz gemacht. Das gesamte Straßennetz auf diese Konzeption umzustellen, wird jedoch nicht realisierbar sein. Das anfängliche Konzept der Straßen mit Gegenverkehr bleibt also bestehen, obwohl es sich mit Hinblick auf das enorme Unfallpotential eigentlich verbietet.
2. Man schaltet das durch menschliches Versagen bedingte Risiko aus, indem man die Lenkung des Fahrzeuges einer ausgereiften Automatik überlässt:
Diese Technik wird irgendwann kommen, aber eine mächtige Auto-Lobby wird darauf achten, dass der Mensch die „Lenkungshoheit“ über sein Fahrzeug nicht verliert. Ist doch das selbstbestimmte Fahren ein Argument zur Rechtfertigung des Individualverkehrs.
3. Die Maximalgeschwindigkeiten auf den Straßen werden so weit reduziert, dass Kollisionen im Gegenverkehr keine fatalen Folgen hätten:
Diese Möglichkeit hat aufgrund des zunehmenden beruflichen und wirtschaftlichen Wettbewerbs keine Aussicht auf Realisierung.
4. Man stellt den Individualverkehr in seiner Gesamtheit in Frage:
Völlig undenkbar. Der Individualverkehr ist unverzichtbar für das Funktionieren des freien Marktes und sichert hunderttausende von Arbeitsplätzen. Den Individualverkehr in einer Zeit in Frage zu stellen, in der händeringend nach Möglichkeiten zur Intensivierung des wirtschaftlichen Wachstums gesucht wird, verbietet sich von selbst.
Also wird man auch weiterhin mit dem Gefahrenpotential leben müssen, das vom Individualverkehr in Verbindung mit unserem Straßensystem ausgeht. Unvorstellbar, die Menschen haben ein System der Mobilität entwickelt, in dem eine Gefahr für Gesundheit und Leben billigend in Kauf genommen wird.
Das gilt natürlich genauso für den Schienenverkehr. Das Eisenbahnunglück von Bad Aibling am 9. Februar 2016 hat auf schreckliche Weise gezeigt, welche Gefahren in der Eingleisigkeit für beide Fahrtrichtungen lauern. Bei einem frontalen Zusammenprall zweier Züge auf eingleisiger Strecke wurden 11 Menschen getötet, 85 wurden verletzt. Wie immer nach solchen Katastrophen wird mit Nachdruck nach der Unfallursache und nach etwaigen Schuldigen gesucht. Aber auch wenn sich menschliches Versagen als Ursache herausstellen sollte, bleibt das nur eine vorgeschobene Erklärung. Wo Menschen arbeiten, passieren leider auch Fehler, das liegt in der Natur der Sache. Die eigentliche Ursache für dieses Unglück liegt aber in der eingleisigen Streckenführung für beide Fahrtrichtungen.
Der Zweck des Geldes
Vor der Einführung des Geldes als Zahlungsmittel gab es den Tauschhandel als Grundprinzip geschäftlicher Beziehungen. Wenn man einen bestimmten Gegenstand erwerben wollte, musste man im Gegenzug etwas zum Tausch anbieten, das sich im eigenen Besitz befand. Das waren in der Regel Dinge, die aufgrund persönlicher Fähigkeiten selbst hergestellt wurden. Nach und nach entstanden so die handwerklichen Berufe. Eine positive Begleiterscheinung dieser Geschäftsgrundlage war, dass sich niemand mit einer größeren Menge bestimmter Güter eindeckte, als er für sich selbst oder seine Familie benötigte. Maßlose Bereicherung machte keinen Sinn, denn für den Überfluss gab es keine Verwendung. Und man musste für jeden begehrten Artikel ja auch eine wertgleiche Sache in den Handel einbringen.
Die Einführung des Geldes spaltete die Gesellschaft in zwei Klassen: Die arbeitende Klasse, die mit der Herstellung und dem Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen ihren Lebensunterhalt verdiente. Und die Klasse des Geldadels, die ihr Vermögen „arbeiten“ ließ und so ihren Reichtum stetig vermehrte. Das wiederum verschaffte ihr Einfluss und Macht in Gesellschaft und Politik. Den arbeitenden Menschen redete man ein, sie könnten es ebenfalls zu Reichtum bringen. Sie müssten ihre Produkte und Dienstleistungen nur billiger anbieten als andere. So entstand das Konkurrenzdenken. Ein interner Kampf der arbeiteten Klasse zum Vorteil der besitzenden Klasse. Ein perfider Mechanismus, mit dem bis heute das arbeitende Volk getäuscht wird.
Das existenzielle Dasein der produktiven und der nicht produktiven Bevölkerung grenzte sich zunehmend voneinander ab. Die soziale Stellung und das Ansehen in der Gesellschaft definierten sich nicht mehr über Fleiß und Können, sondern über Cleverness und geschäftlicher Raffinesse – eine gesellschaftspolitische Fehlentwicklung.
Das Geld als Zahlungsmittel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das Geld ermöglicht den Menschen den Zugriff auf Güter, die für sie auf Basis des Tauschhandels nicht erreichbar wären. Das ist der entscheidende Vorteil des Geldes als sachunabhängiger Vermögenswert. Geld ist ein Zahlungs- und Tauschmittel und bildet einen fiktiven Gegenwert zu einer Sache.
Kredit- und Börsengeschäfte, also der Handel mit Geld und Währungen, stellen dagegen eine Zweckentfremdung des Geldes dar. Das Geld ist nicht mehr Gegenwert einer Ware, sondern wird zur Ware selbst. Finanzdienstleister verschaffen sich mit Hilfe von sogenannten „Finanzprodukten“ Zugriff auf Bankguthaben und Spareinlagen. Die Gelder werden dann an Dritte verliehen, die diese Kredite dann mit Zinsen bedienen müssen. Die immer wieder gehörte Rechtfertigung für derartige Geldgeschäfte, auf diese Weise Menschen helfen zu wollen, ist reine Heuchelei. Kreditgeschäfte dienen einzig und allein dazu, über ein parasitäres System von Zins und Zinseszins das vorhandene Kapital in einer Gesellschaft von „unten“ nach „oben“ umzuverteilen. Am oberen Ende dieser Kette stehen die Finanzeliten dieser Welt, am unteren Ende die Verlierer unserer Gesellschaft. Dieses „Geschäftsmodel“ ist der eigentliche Grund für die permanente Vergrößerung der ökonomischen und sozialen Diskrepanz zwischen Arm und Reich. Der Mann an der Werkbank weiß nicht, wie er seine Familie über den nächsten Monat bringen soll, und profitwitternde Banken locken ihn dann auch noch in die Schuldenfalle.
Darüber hinaus ist so ein verfehlter Gebrauch des Geldes im ökonomischen Sinne als Betrug zu werten. Kreditgeschäfte tragen primär nämlich nichts zum Bruttosozialprodukt bei. Die Finanzeliten dieser Welt schaufeln Geld auf ihre Konten, ohne den geringsten Gegenwert dafür zu schaffen. Und was unternimmt die Politik gegen diesen Missbrauch? Gar nichts, unsere freiheitlich – demokratische Grundordnung lässt das zu.
Die ehemalige Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel forderte auf dem Welt-Frauen-Gipfel in Berlin im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 mehr Kleinkredite für Frauen in den Entwicklungsländern. Welch widerlicher Gedanke, jetzt auch noch die ohnehin benachteiligten Menschen in den Entwicklungsländern in die wirtschaftliche Abhängigkeit von Kreditsystemen lotsen zu wollen. Nichts offenbart mehr die scheußliche Verschmelzung von Staatspolitik und Finanzwelt.
In der islamischen Welt gibt es das Zinsverbot, aus dem Verleih von Geldern dürfen keine Renditen erwirtschaftet werden. In diesem Kontext ist die islamische Lehre dem westlichen Wertekonsens überlegen. Sicherlich ist auch dies ein Grund für die Zerwürfnisse zwischen den westlichen Staaten und der islamischen Welt. Und wie verfährt die christliche Kirche als westliche Moralinstanz in dieser Angelegenheit? Auch sie hatte einmal das Zinsprinzip als Einnahmequelle abgelehnt. Leider hat die Kirche diesen Grundsatz verworfen.
Topmanager in Industrie und Bankgewerbe erhalten oft Jahresgehälter, für die unser Mann an der Werkbank hunderte Jahre arbeiten müsste. Diese völlig unverhältnismäßigen Bezüge lassen sich objektiv nicht begründen. Kein Mensch kann eine Leistung erbringen, die ein Gehalt von 10 Millionen Euro jährlich rechtfertigen würde. Auch der Hinweis auf die so übergroße Verantwortung für Konzern und Belegschaft erweist sich als Pseudobegründung. Fehlentscheidungen führen allenfalls zur Auflösung des Arbeitsvertrages, was in der Regel noch mit der Zahlung einer segensreichen Abfindung einhergeht.
Die Entartung des Geldes vom Tauschmittel hin zum Handels- und Spekulationsobjekt hat in der modernen Gesellschaft zu tiefen moralischen Verwerfungen geführt. Aber nicht die Existenz des Geldes an sich ist der Grund dafür, sondern die maßlose, dem Menschen innewohnende Gier. Schon Mahatma Gandhi formulierte treffend: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier.“ Es wäre Aufgabe der Politik als regulierende Kraft gewesen, dieser Gier Einhalt zu gebieten und einen moralisch vertretbaren Umgang mit dem Geld zu ermöglichen. Dann hätte die im Grunde geniale Idee eines universellen „Vermögensträgers“ sich zum Vorteil für die ganze Gesellschaft entwickeln können. Aber die Politik hat in dieser fundamentalen Angelegenheit völlig versagt. Sie hat es nicht geschafft, den Gebrauch des Geldes auf seinen eigentlichen Zweck als Tauschmittel zu begrenzen und seinen Missbrauch zur Vermehrung des Reichtums aus sich selbst heraus zu verhindern.
Politik – der Weg in den Abgrund
Wie lässt sich Politik beschreiben? Ganz einfach: Die Politik verkauft das Volk für dumm, versinkt im Korruptionssumpf, versagt auf ganzer Linie und legt alle paar Jahrzehnte die Welt in Schutt und Asche. Das ist zu drastisch formuliert, sagen Sie? Also gut, man kann es auch weniger bissig ausdrücken: Die Weltpolitik erhebt den Anspruch, die Voraussetzungen für eine friedliche Koexistenz der Völker auf unserem Erdball zu schaffen. Sie sieht sich als Friedensstifter und Löser von Menschheitsproblemen. Doch genügt die Realität diesem Anspruch? Wohl kaum, eher das Gegenteil ist der Fall: Die Politik selbst ist Ursache der Menschheitsprobleme. Zählt man Kriege zu den größten Übeln der Menschheit, muss man dieser Auffassung zustimmen. Denn Kriege, die ihre Ursache in unterschiedlichen Weltanschauungen haben, sind ohnehin politisch motiviert. Und Kriege, mit denen hegemoniale oder territoriale Ansprüche durchgesetzt werden sollen, gehen auf entsprechende politische Willensbildungen zurück. In beiden Fällen waltet die Politik als Auslöser der Konflikte. Es ist deshalb völlig abwegig zu behaupten, die Politik wäre um den Weltfrieden bemüht.
Auch die Frage nach der Kriegsschuld ist müßig, zumindest im Falle der ideologisch motivierten Konflikte. Alle großen ideologischen Systeme erheben für sich den Anspruch auf die „edleren“ politischen und gesellschaftlichen Strukturen. Daraus leitet sich der jeweilige Führungsanspruch der Weltmächte ja gerade ab. Gegenseitige Schuldzuweisungen am Ausbruch eines Krieges sind deshalb irrelevant. Sie dienen nur als Vorwand zur Rechtfertigung der eigenen Kriegsabsicht.
Nukleare Mächte
Jedes Mal, wenn Nordkorea wieder einen Atomtest durchgeführt oder eine Trägerrakete getestet hat, entrüstet sich die Völkergemeinschaft, insbesondere die der westlichen Welt. Nach ihrer Auffassung verstößt Nordkorea mit diesen Tests gegen das Völkerrecht und Auflagen der Vereinten Nationen. Mit ähnlicher Empörung würde man reagieren, wenn es sich um iranische Tests handeln würde. Diese Länder werden diktatorisch regiert und man wirft ihnen vor, andere Regionen zu provozieren und durch aggressives Verhalten die Stabilität der Weltgemeinschaft zu gefährden. Solche Länder werden von US-Amerika als „Schurkenstaaten“ bezeichnet – ein Begriff aus Zeiten der Bush-Regierung. Hierzu zählen Länder, die sich dem Einfluss der westlichen Welt widersetzen und allen Verhandlungen mit ihr eine Absage erteilen. In Konsequenz werden sie von der westlichen Welt, insbesondere von den USA, sanktioniert. Doch mit welcher Begründung eigentlich? Sind Atomtests und Raketenstarts das Vorrecht einiger weniger Staaten? Und wenn ja, welcher Staaten?
Nach dem Atomwaffensperrvertrag gehören die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China zu den offiziellen Atommächten. Diese Länder waren schon vor 1967 im Besitz von Kernwaffen und sind zugleich die Vetomächte der Vereinten Nationen. Darüber hinaus zählen Israel, Indien, Pakistan und seit 2005 auch Nordkorea zu den faktischen Atommächten. Diese vier Staaten haben den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet, und Israel hat bis heute nicht zugegeben, im Besitz von Kernwaffen zu sein. Die Weltgemeinschaft hat sich inzwischen daran gewöhnt. Nun soll aber unbedingt verhindert werden, dass über die fünf offiziellen Atommächte hinaus weitere Länder an der Entwicklung kerntechnischer Anlagen arbeiten. Insbesondere gilt das für den Iran, der behauptet, nur an der friedlichen Nutzung der Kernenergie interessiert zu sein. Ob man das nun glaubt oder nicht – mit welchem Recht soll es autonomen Staaten untersagt werden, die Kernkraft zu nutzen? Will man ihnen auch die Forschung auf diesem Gebiet verbieten? Das ist wohl kaum begründbar, auch wenn die Vereinten Nationen das gerne so hätten.





























