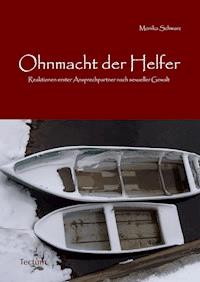
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Verbalisieren erlebter sexueller Gewalt stellt für die Opfer eine stark belastende Situation dar. Aus diesem Grund wählen sie als Gesprächspartner oft Menschen, von denen sie sich Schutz, Beistand und emotionale Wärme erhoffen. Doch wehe, wenn die Helfer dem Opfer zu nahe stehen... Monika Schwarz untersucht zum ersten Mal Reaktionen auf erlebte sexuelle Gewalt mittels einer anonymen Opferbefragung. Dabei legt sie den Fokus nicht nur auf die Opfer, sondern beleuchtet auch ihr familiäres, partnerschaftliches und weiteres soziales Umfeld. Ihre Erkenntnis: Soziale Arbeit sollte sich nicht nur den ersten Opfern sexueller Gewalt widmen, sondern auch - und verstärkt - ihren ohnmächtigen Helfern!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Monika Schwarz
Ohnmacht der Helfer. Reaktionen erster Ansprechpartner nach sexueller Gewalt
© Tectum Verlag Marburg, 2010 ISBN 978-3-8288-5636-3
Bildnachweis Cover: © Ulrike Krug
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2543-7 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Ich möchte zu Beginn des Buches all denjenigen Personen danken, welche im Sinne Erich Frieds bereits aufgehört haben zu lernen. Durch die Beendigung des Schweigens wurde mir die Möglichkeit gegeben, erste Aufdeckungssituationen nach sexuellen Gewaltübergriffen wissenschaftlich zu untersuchen. Durch den Mut, das Schweigen zu durchbrechen, wurde nachgewiesen, wie bedeutsam es für Betroffene ist, über das Erlebte zu sprechen und wie verletzlich sie in diesen Situationen sind.
Dieses Buch soll keine Vorwürfe gegenüber Mütter beinhalten – vielmehr soll es beitragen, dass Soziale Arbeit die Notwendigkeit erkennt, Unterstützung und Bestärkung nicht nur für primäre Opfer sexueller Gewalt bereitzuhalten!
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Historische Entwicklung
2.2 Begriffsbestimmung
2.3 Ausmaß
2.4 Verbreitete Irrtümer
3. Empirische Untersuchung
3.1 Struktur
3.1.1 Entdeckungszusammenhang
3.1.1.1 Forschungshintergrund
3.1.1.2 Vorliegende Studien
3.1.2. Begründungszusammenhang
3.1.2.1 Theorie- und Hypothesenbildung
3.1.2.2 Stichprobenwahl
3.1.2.3 Methodenwahl
3.1.3 Verwertungszusammenhang
3.2. Qualität der empirischen Forschung
3.2.1 Hauptgütekriterien
3.2.2 Nebengütekriterien
3.3. Repräsentativität
3.4 Dateninterpretation - Auswertung der Erhebung
3.4.1 Stichprobenbeschreibung
3.4.2 Ergebnisse zur 1. Hypothese
3.4.3 Ergebnisse zur 2. Hypothese
3.4.4 Weitere Befunde
4. Theoretischer Hintergrund der Erkenntnisse
4.1 Betrachtungsgrundlagen
4.2. Erklärungsmodelle
4.2.1 Systemtheoretisches Erklärungsmodell
4.2.1.1 System Familie
4.2.1.2 Rollen innerhalb der Familie
4.2.1.3 Systemeigene Homöostase
4.2.2 Psychoanalytisches Erklärungsmodell
4.2.2.1 Mütterliches Trauma
4.2.2.2 Auswirkungen auf mütterliche Reaktionen
4.2.3 Behavioristisches Erklärungsmodell
4.2.3.1 Modellernen
4.2.3.2 Auswirkungen auf mütterliche Reaktionen
5. Ansprüche an die Soziale Arbeit
5.1 Relevanz
5.1.1 Theoretische Anforderungen an die Soziale Arbeit
5.1.2 Praktische Anforderungen an die Soziale Arbeit
5.1.2.1 Die fördernde Dimension
5.1.2.2 Die intervenierende Dimension
5.1.2.3 Die fordernde Dimension
6. Fazit
Literatur
Anhangverzeichnis
1 Einleitung
Sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen ist eine Verletzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Jedes Kind kann, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, Opfer sexueller Gewalt werden. Seit den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ist sexuelle Gewalt ein viel erörtertes Thema. Innerhalb dieser Fachdiskussionen wandelten sich anhand der durchgeführten Studien die angewendeten Definitionen sowie Betrachtungsperspektiven. Besonders die Rollen der Mütter von Opfern sexueller Gewalt unterliegen einer ambivalenten Bewertung. In manchen Publikationen, wie beispielsweise von Fürniss, wird mütterliches Verhalten als Hauptursache sexueller, innerfamiliärer Gewalt formuliert. Er begründet diese Übergriffe mit sexuellem Ungehorsam von Müttern, welche die Väter zwingt, Töchter als verfügbare Partnerinnen wählen zu müssen.1 Dieser Annahme liegt ein familiendynamisches Modell zugrunde, welches sexuelle Gewalt immer als Auswirkung einer Dysfunktionalität von Familien betrachtet. Bei dieser Betrachtung werden jedoch die Fälle extrafamiliärer Gewalt außer Acht gelassen. Jäckel beschreibt mütterliche Verhaltensweisen als gewaltbegünstigende Reaktionen. Für sie ist die Annahme grundlegend, dass viele Mütter ihren Töchtern nach der Offenbarung nicht glauben, um den Täter vor Anschuldigungen und möglichen Erpressungen zu schützen.2 Es wird zum Beispiel auf diese Weise ein Bild von abhängigen, schwachen, angstbesetzten Müttern vermittelt, welche sich ihrer Gefühle für die Opfer nicht bewusst sind.
Innerhalb der vorliegenden Diplomarbeit sollen mögliche Reaktionen erster Ansprechpartner nach sexueller Gewalt thematisiert werden. Es wird diesbezüglich mittels einer quantitativen Studie untersucht, wie oft Mütter als erste Ansprechpartnerinnen fungieren und wie deren Verhalten in Aufdeckungssituationen aussieht. Ferner werden zwei Hypothesen bezüglich möglicher Einflussfaktoren auf die Reaktionen erster Ansprechpartner formuliert und untersucht. Im vierten Kapitel sollen theoretische Argumentationen die evaluierten Erkenntnisse untermauern und mögliche Begründungen für das Verhalten erster Ansprechpartner darlegen. Die dabei vorgestellten psychologischen sowie soziologischen Theorien sind sehr umfangreiche, komplexe Themenfelder. Da eine detaillierte, alles einschließende Darstellung dieser Modelle den Rahmen der hier vorliegenden Ausarbeitung überschreiten würde, wird ausschließlich eine kurze Erläuterung der verschiedenen Konzepte vorgenommen. Im darauffolgenden Kapitel dieser Ausarbeitung sollen Anforderungen an die Soziale Arbeit verfasst werden. Das wichtigste Merkmal dieser abschließend formulierten Ansprüche soll eine denkbare Umsetzbarkeit durch jeden, in der Opferhilfe aber auch in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen, Sozialarbeiter darstellen.
In diesem Buch wird eine thematische Auseinandersetzung mit Frauenbzw. Mütterrollen stattfinden. Obgleich im Sinne der Gleichbehandlung beider Geschlechter eine Anpassung der Schreibweisen geschehen sollte, wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Schreibform benutzt. Diese ist jedoch selbstverständlich wertfrei und geschlechtsneutral zu verstehen.
1 Fürniss nach Gahleitner, 2000, S. 61.
2 Vgl. Jäckel, 1988, S.34.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Historische Entwicklung
Die Beschäftigung mit dem Thema der sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen und Kindern beinhaltet die Frage nach der Wertschätzung dieser Personen. Bereits in der Bibel sind Textstellen zu finden, in denen Frauen und Kinder als das Eigentum des Mannes betrachtet wurden. So steht beispielsweise im Alten Testament: „Der alte Mann ging zu ihnen hinaus und sagte: ’Nicht doch, Brüder, tut nicht so etwas Gemeines! Dieser Mann ist mein Gast, ihr dürft ihm nicht diese Schande antun. Ich bringe euch meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und dazu die Frau des Fremden; mit denen könnt ihr treiben, was ihr wollt. Aber an diesem Mann dürft ihr euch nicht so schändlich vergreifen.’ Als die Männer keine Ruhe gaben, nahm der Levit seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus. Sie vergewaltigten sie die ganze Nacht über und ließen sie erst in Ruhe, als der Morgen dämmerte.“3.
Wie erkennbar wird, galt die männliche Macht über Frau und Kind seit Menschengedenken als selbstverständlich. Weibliche Familienangehörige stellten bereits im Alten Testament Sachwert und Eigentum des Mannes dar. Auch Nachweise später folgender Zeitepochen belegten, dass der körperlichen Unversehrtheit von Frauen und Kindern wenig Interesse entgegen gebracht wurde. So fanden zum Beispiel Kinder in geschichtlichen Aufzeichnungen des Mittelalters kaum Beachtung. De Mause beschrieb diesbezüglich, dass unzureichende Kinderpflege, sowie Kindstötungen und sexuelle Ausbeutungen an der Tagesordnung gewesen wären.4 Kinder galten bis in die Zeit der Renaissance hinein als kleine Erwachsene. Sie mussten zum Familienunterhalt beitragen, hatten jedoch keine Rechtsposition inne. Die Einstellung Kindern gegenüber war unter anderem auch aufgrund der hohen Kindersterblichkeitsrate eher vom Schicksalsglauben als von gefühlsmäßigen Bindungen geprägt. Erst seit der Epoche der Aufklärung und der ebenfalls im 18. Jahrhundert stattfindenden Etablierung der Pädagogik wurde begonnen, Kindheit als eigenständige Lebensphase zu betrachten. Seit dieser Zeit galten Kinder als eigenständige Wesen, welche aufgrund ihrer Unselbständigkeit in vielen Lebensbereichen Hilfe und Schutz benötigten. Resultate dieser gewandelten Einstellung gegenüber Kindern sind beispielsweise die Gründungen von Hilfsorganisationen und Vereinen welche die Sorge für vernachlässigte Kinder übernahmen. So wurde 1829 die Gesellschaft zum Schutz sittlich vernachlässigter Kinder ins Leben gerufen. Später gründete sich 1898 in Berlin der Verein zum Schutz der Kinder gegen Ausbeutung und Misshandlung. Parallel zur Entdeckung der Kindheitsphase sowie zum daraus resultierenden Versuch, die Kinder vor schädlichen Einflüssen zu schützen, veränderten sich die gesellschaftlichen Normen bezüglich der kindlichen Sexualität. Es entstand das Wunschbild des unschuldigen, sündenfreien, asexuellen Kindes, was zur christlichen Sittlichkeit erzogen werden sollte. Ungeachtet dieser allgemeinen Wunschvorstellungen gab es weiterhin zahlreiche sexuelle Übergriffe auf Kinder, weswegen Niemeyer in seinem Erziehungsratgeber 1813 vor den „eigentlichen Verführungen“5 warnte, welche durch: „ … ältere Personen, männliche und weibliche Bediente, Friseurs, Wollüstlinge, Spaßmacher, junge Gespielen, die selbst schon verführt und verdorben sichs zum Geschäft machen, andere in Geheimnisse ihrer verstohlenen Lust einzuweihen, oder wohl gar – horrendum dictu! – durch Lehrer und Erzieher“6 durchgeführt wurden. Diese gesellschaftliche Doppelmoral bestand bis in das 20. Jahrhundert hinein. Auch Freud erkannte Ende des 19. Jahrhunderts die Diskrepanz zwischen dem geforderten normativen Erziehungsziel und der tatsächlichen Realität. Bei vielen seiner hysterischen Patientinnen ergaben Therapiegespräche ursächliche Schlüsselszenen in der Kindheit, welche von sexuellen Übergriffen gekennzeichnet waren. Aus diesen Tatsachen resultierend konstruierte er 1895/1896 die Verführungstheorie. Die Veröffentlichung dieser Erkenntnisse vor dem Wiener Verein für Psychiatrie und Neurologie brach jedoch gesellschaftliche Tabus, weswegen er von seinen Kollegen daraufhin als kompetenter Wissenschaftler abgelehnt wurde. Ein Jahr später widerrief er die Hysterie-/Verführungstheorie und verkündete den Ödipuskomplex als theoretisches Ursachenmodell psychischer Erkrankungen.
Es ist anhand dieser Sinneswandlung Freuds erkennbar, dass sexuelle Übergriffe auf Kinder weiterhin stattfanden, jedoch in der Öffentlichkeit nicht thematisiert werden sollten. Bange schreibt bezüglich der bis in das 20. Jahrhundert hinein reichenden Tabuisierung: „Die Geschichte der Forschung zum sexuellen Mißbrauch ist fast so spannend wie ein Kriminalroman. Schaut man auf die letzten 100 Jahre zurück, zeigt sich ein interessantes Wechselspiel: Nach dem sich wiederholenden Versuchen, sexuelle Ausbeutung von Kindern zu problematisieren, wurde das Thema in Deutschland immer wieder unter den Teppich gekehrt.“7.
In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden nicht nur grundlegende Erkenntnisse in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften neu definiert, sondern es entstand parallel dazu, auch aufgrund des Fortschreitens weiblicher Emanzipation, eine gesellschaftspolitische Debatte, welche auch die Kritik an den bestehenden sexuellen Normen beinhaltete. Die zweite Frauenbewegung thematisierte sexuelle Gewalt an Kindern und Frauen öffentlich als Folge patriarchaler Gesellschaftsstrukturen. Um die tradierten Rollen zu verändern, berichteten immer mehr Frauen über Gewalt, die ihnen im Laufe ihres Lebens widerfuhr. Dies hatte zur Folge, dass das Thema sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Frauen immer mehr mediale aber auch wissenschaftliche Beachtung bekam. So gründete sich in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die erste Selbsthilfegruppe „Wildwasser“. Frauenzeitschriften veröffentlichten Artikel, innerhalb derer Frauen ermutigt wurden, offen über die ihnen zugefügte sexuelle Gewalt zu informieren.8 Die zahlreichen Briefe der Leserinnen wurden zum ersten Mal in einem Buch veröffentlicht.9
Innerhalb der Debatte um das Thema sexuelle Gewalt vollzogen sich seit 1970 verschiedene Wechsel der Perspektiven. Wurden zunächst nur fremde Männer als Täter betrachtet, so erweiterte sich der Focus später auch auf innerfamiliäre sexuelle Übergriffe. Ferner wurden im Laufe der Zeit auch Frauen als Täterinnen sowie Jungen als Opfer sexueller Gewalt thematisiert. Sexuelle Gewalt gegenüber Kindern wird bis in die Gegenwart wissenschaftlich untersucht und unter verschiedenartigen Gesichtspunkten thematisiert. Diese Verschiedenartigkeit bedingt jedoch auch Unterschiede in Hauptaugenmerken sowie der Definitionen einzelner Autoren, was im folgenden Kapitel bearbeitet werden soll.
2.2 Begriffsbestimmung
Die Frage, wie sexuelle Gewalt definiert werden kann, wird in der Fachliteratur vielfältig beantwortet. Es gibt keine generelle, allgemeingültige Begriffsklärung und somit findet der Leser in wissenschaftlichen Publikationen je nach theoretischem und ideologischem Hintergrund des jeweiligen Autors unterschiedliche Definitionen. Ferner werden in den einzelnen Werken unterschiedliche Fachausdrücke, wie „sexueller Missbrauch“, „sexuelle Ausbeutung“ oder „Inzest“ benutzt, welche nachfolgend kurz erläutert und bezüglich ihrer Verhältnismäßigkeit diskutiert werden sollen.
Die Bezeichnung „Missbrauch“ in Verbindung mit sexuellen Handlungen gegenüber Minderjährigen impliziert, es gäbe einen richtigen und legitimen Gebrauch von Kindern. Darüber hinaus suggeriert die Benutzung dieses Begriffes eine Objektstellung von Minderjährigen, da nur Objekte aber nicht Personen gebraucht beziehungsweise missbraucht werden können. Bei dieser Begrifflichkeit tritt letztendlich der Gewaltaspekt in den Hintergrund, da dieser nicht explizit deklariert wird. Trotz der genannten Kritikpunkte hat sich diese Bezeichnung in der öffentlichen Diskussion sowie in der Fachliteratur etabliert und wird meist benutzt. Der Begriff Inzest, wie beispielsweise von Rijnaarts in ihren Werken verwendet, bedeutet tatsächlich „Geschlechtsverkehr zwischen Blutsverwandten, zwischen Geschwistern oder zwischen Eltern und Kindern“10. Dieser Begriff konkretisiert lediglich den Ort des Geschehens als innerfamiliär, was jedoch nicht in jedem Fall von sexueller Gewalt zutreffend ist. Ferner wird mit dem Gebrauch des Begriffes Inzest ebenfalls die Thematisierung der bestehenden Gewalt außer Acht gelassen. In der hier vorliegenden Arbeit wird vorrangig die Umschreibung sexualisierte Gewalt verwendet, da immer ein Zusammenhang zwischen Autoritätsgefälle, Ungleichheit und sexuellen Übergriffen besteht.
Um eine möglichst weitreichende Definition sexueller Gewalttaten zu erhalten, sollen zunächst einige typische Charakteristika dieser Handlungen aufgezählt werden.
Um sexuelle Gewalt ausüben zu können, muss ein Macht- oder Autoritätsverhältnis zwischen Opfer und Täter bestehen. Dieses Verhältnis muss in Form eines Gefälles sein, wie es beispielsweise zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, einem Mann und einer Frau oder auch zwischen Therapeut und Patient auftreten kann. In vielen Fällen ist darüber hinaus ein psychisches oder materielles Abhängigkeitsverhältnis Grundlage für gewalttätige Übergriffe. Es wird in jedem Fall psychische und physische Gewalt angewendet, welche Sexualität als Mittel zum Zweck benutzt. Sexuelle Gewalt geschieht ohne willentliches Einverständnis des Opfers. Bei Kindern liegt aufgrund ihrer Unerfahrenheit kein informiertes, absichtliches Einverständnis vor, da sie bezüglich einer Erwachsenensexualität und deren Folgen weder Erfahrungen noch hinreichende Kenntnisse besitzen. Kinder befinden sich auf infantilen Entwicklungsstufen und können daher im Vorfeld nicht beurteilen, ob sie sexuelle Handlungen mit Erwachsenen mögen oder nicht. Es wird aus diesem Grund davon ausgegangen, dass sexuelle Handlungen Erwachsener an Kindern immer ohne deren willentliche Zustimmung erfolgen. Sexuelle Gewalttaten sind bewusste und oftmals im Vorfeld lange Zeit geplante Handlungen. Die Täter können sexuelle Übergriffe auf Kinder einerseits durch Androhung von Gewalt, andererseits auch mittels Vortäuschung von Fürsorge oder Zuwendung erwirken. Der manipulative Einsatz von Zuwendung tritt häufig im Zusammenhang mit innerfamiliärer Gewalt zutage. Außerfamiliäre sexuelle Übergriffe werden mehrheitlich mittels Androhung von psychischer sowie physischer Gewalt initiiert. Sexuelle Gewalttaten unterliegen immer einer Geheimhaltungspflicht. Die Verschwiegenheit wird dem Opfer zumeist ebenfalls durch Androhung von Gewalt oder Anregung von Schuld- und Schamgefühlen auferlegt.Gahleitner definiert ferner die Art der Handlungen, die Folgen, den Altersunterschied zwischen Täter und Opfer sowie die Verletzung sozialer Regeln als Definitionskriterien.11 Bezogen auf die Art der Handlungen gilt es zu erwähnen, dass das Tätigkeitsspektrum extrem breit gefächert ist. Bange beschreibt zwar ausführlich mögliche Praktiken bei sexuellen Übergriffen12, jedoch könnte diese Liste beliebig erweitert werden, wobei die Berichte der Betroffenen teilweise die normale Vorstellungskraft übersteigen.13 Der Altersunterschied wird in einigen Untersuchungen als relevant für die Definition sexueller Gewalt bezeichnet. Dabei wird oftmals ein Altersunterschied von mindestens fünf Jahren zwischen Opfer und Täter als eine Voraussetzung für diese Definition betrachtet. Durch diese Festlegung werden jedoch sexuelle Übergriffe durch Gleichaltrige oder geringfügig Ältere nicht berücksichtigt, weswegen das Kriterium hier keine Verwendung finden soll. Auch die möglichen oder auftretenden Folgen sollen an dieser Stelle nicht als Definitionsgrundlage beachtet werden, denn es wurde durch Untersuchungen nachgewiesen, dass sexuelle Handlungen an Kindern nicht immer gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Deegener beschreibt als eine mögliche Ursache von Symptomlosigkeit einen „wenig intensiv erlittenen Mißbrauch“14





























