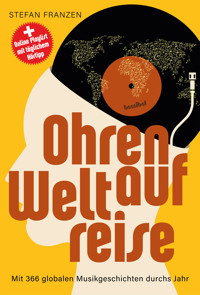
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Klangschätze unseres Planeten - als täglicher Begleiter Journalist und Radioautor Stefan Franzen spürt seit vielen Jahren den Tönen abseits von Rock, Pop, Klassik nach und erkundet die musikalischen Besonderheiten ganz verschiedener Kulturen. Auf seinen Reisen nach Brasilien und Ghana, nach Istanbul und Katalonien, ins norwegische Eis und auf englische Folk-Festivals tauchte er vor Ort in die Musikkultur ein, entdeckte aber auch Verblüffendes in nächster Nachbarschaft. In Hunderten von Gesprächen lernte er Stars und unbekannte Talente kennen. Nun hat er seine Begegnungen und Erkenntnisse zu einem Kalendarium gebündelt: Anhand globaler Kurzgeschichten entsteht ein spannender Begleiter durchs Jahr, gewürzt mit lebendigen Interview-Zitaten und aufschlussreichen Anekdoten. Warum entstand die Bossa Nova auf dem Klo? Was ist ein indischer Raga, ein arabischer Maqam? Wie kam die Rumba in den Kongo? Wie hört sich Inuit-Gesang an? Und ist der Fado Portugals wirklich so traurig? Solche Fragen werden ganz nebenbei beantwortet auf diesem Streifzug um den Erdball, den Künstler-Geburtstage, kulturelle und politische Weltereignisse flankieren. 366 Mosaiksteinchen bilden eine alternative Musikgeschichte der Erde: mit Bobby McFerrin, Anoushka Shankar, Gilberto Gil und Angélique Kidjo, aber auch mit George Harrison, Kate Bush und Caterina Valente! »Als ich in den 1960ern Musik entdeckte, war ich noch wie vom Donner gerührt. Mein ganzer Körper wurde Ohr. Heute ist Musik überall so verfügbar, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Wir müssen wieder lernen: Das, was wir gerade hören, hat uns so noch nie erreicht. Ich möchte wieder überrascht werden von Musik.« Bobby McFerrin »Als ich in den 1960ern Musik entdeckte, war ich noch wie vom Donner gerührt. Mein ganzer Körper wurde Ohr. Heute ist Musik überall so verfügbar, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Wir müssen wieder lernen: Das, was wir gerade hören, hat uns so noch nie erreicht. Ich möchte wieder überrascht werden von Musik.« Bobby McFerrin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Franzen
Ohren auf Weltreise
www.hannibal-verlag.de
Der Autor
Stefan Franzen, geboren 1968, erkundet als Autor von Radiosendungen (SWR, SRF, Deutschlandfunk, WDR), Journalist für Fachzeitschriften (Jazz thing, Folker) und Programmtexter für Philharmonien seit 30 Jahren die Musikkulturen aller Erdteile. Er ist Kurator und Beirat bei Festivals und Jurymitglied beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Seine besondere Liebe gilt der Szene Brasiliens und Portugals.
Impressum
Erstausgabe 2024
© 2024 by Hannibal
Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
ISBN 978-3-85445-774-9
Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-773-2
Cover Design: Michael Bergmeister, www.bw-works.com
Grafischer Satz: Thomas Auer
Deutsches Lektorat und Korrektorat: Dr. Matthias Auer
Hinweis für den Leser:
Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.
Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.
Printed in Germany
Die Reiseroute
Zitat
Widmung
Vom Glück globalen Hörens
Playlists
JANUAR
FEBRUAR
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DEZEMBER
Danke
Am Wegesrand (Anmerkungen)
Fotonachweise
Das könnte Sie interessieren
Zitat
„Als ich in den 1960ern Musik entdeckte, war ich noch wie vom Donner gerührt. Mein ganzer Körper wurde Ohr, es war, als ordnete sich meine molekulare Struktur neu. Heutzutage müssen wir uns neu erziehen. Wir müssen uns ausdrücklich dazu bewegen, an einen Platz zu gehen, wo Musik gemacht wird. Wir müssen wieder lernen, die Augen zu schließen, ruhig zu werden. Uns vergegenwärtigen, dass das, was wir gerade hören, uns so noch nie erreicht hat. Ich möchte wieder überrascht werden von Musik.“
– Bobby McFerrin
Widmung
für Marlies – für Herbert
nicht nur, weil sie mir meine erste Platte geschenkt haben.
Vom Glück globalen Hörens
„Der Weltraum – unendliche Weiten“: Das geheimnisvolle Intro aus der Kultserie Raumschiff Enterprise kennen wir alle. Der Weltraum – das ist vor allem aber auch unendliche Stille. Im Vakuum hört man nach dem Maßstab menschlicher Ohren: nichts. Auch wenn uns viele Science-Fiction-Filme mit vorbeibretternden Raumschiffen das Gegenteil vorflunkern. Schätzen wir uns also glücklich, dass wir auf einem Planeten mit Atmosphäre leben, in der sich Schall fortpflanzen kann – nicht nur als Geräusch oder Lärm, sondern auch als Musik. Okay, es gibt Schnittmengen, wie schon Wilhelm Busch wusste.
Manchen sind kleine Teilstrecken in diesem weitverzweigten musikalischen Wegenetz genug. Des einen Herz schlägt für Symphonien, eine andere begleitet Deutsch-Rap durch den Alltag. Eine interessiert sich ausschließlich für Oper, der zweite nur für irischen Folk, die dritte für Jazz. Bei mir ist das anders. Vielleicht ist meine Neugier auf Töne von überallher so groß, weil ich musikalisch in eine etwas ungünstige Epoche hineingeboren wurde. Während der Großtaten der Rockmusik in den Sechzigern und Siebzigern war ich noch ein bisschen zu klein. Meine Pubertät begleitete dann die lustige Neue Deutsche Welle, und Mitte der Achtziger wurde Pop oft richtig langweilig. Es war ein Glücksgefühl, eine Art Erlösung, als sich gegen Ende des Jahrzehnts etwas tat: Musikerinnen und Musiker reckten ihre Ohren zu anderen Erdteilen hin, experimentierten mit unerhörten Klängen. Dafür gab es auch schnell ein Verkaufsetikett: „Weltmusik“. Oft war das ziemlich postkolonialistisch behaftet: Man bediente sich der Klänge aus Afrika, Lateinamerika und Asien eben als Zierwerk, Begegnungen auf Ohrenhöhe waren anfangs in der Minderzahl. Aber dieser Worldpop sorgte auch dafür, dass einige bereit waren, den Ur-Stoff zu entdecken: Flamenco und Fado, Salsa und Samba, Raga und Maqām. Ein Ur-Stoff, der sich selbst ständig weiterentwickelt, alles andere als museal war und ist. Zu diesen Entdeckergeistern zähle ich auch mich – bis heute.
Bald 40 Jahre nach der Erfindung der „Weltmusik“ wird nun oft ihr Ende beschworen. Die Rasanz der globalen Vernetzung hat längst andersartige Töne hervorgebracht, eine „Weltmusik 2.0“. Die wird nur noch selten von Studiopulten in Paris, London oder New York gesteuert, sondern überall von Laptops zu Hause. Sie findet längst mehr auf YouTube und in Social Media statt als auf CD, kommt aus den migrantisch geprägten Vorstädten Europas, entsteht in den Metropolen Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Gleichzeitig graben junge DJs und Plattensammler heftig nach altem Afro-Funk, Latin-Sounds oder Gypsy-Pop der 1960er und 70er. Ein Gegengift zum Zeitalter kühler Technisierung: Der warme Sound einer Platte ist wieder gefragt – auch bei den Jungen. Kategorien werden immer überflüssiger. Die Weltmusik-Themen von einst gibt es durchaus weiterhin, vom Tuaregrock über Bossa Nova bis Balkan Beatz. Daneben aber eine unüberschaubare Menge neuer Stile und die Besinnung auf gut abgehangenen Pop anderer Erdteile. Und man muss und sollte das alles endlich nicht mehr „Weltmusik“ nennen.
Wenn Sie mit Ihren Ohren auf Weltreise gehen, werden Sie feststellen: Dieses Buch ist ganz weit weg von einem Lexikon einer wie auch immer gearteten Musik der Welt. Die Routen, die wir entlangfahren, sind nicht so gesteckt, dass kein Land zu kurz kommt oder jedes Genre unbedingt berücksichtigt wird. Sie finden hier auch keine trockene theoretische Abhandlung, die Musiksysteme erschöpfend erklärt – das kann die im Anhang gelistete Literatur besser. Vielmehr halte ich meine Ohren immer dahin, wo sie kleine spannende Geschichten erlauschen können. An stilistische Grenzgebiete besonders gern. An den sanften Zaun zum Jazz, zur Klassik, zum Pop. Er hat überhaupt keinen Stacheldraht, und man kann ruhig immer mal wieder drübersteigen – auch wenn das hier eben kein Buch über Jazz, Klassik oder Pop ist.
An- und aufregend, bereichernd, manchmal sogar beglückend – so sollen diese kurzen Stopps auf unserer globalen Reise sein. Sie können Ihnen nur als ein erstes akustisches Aufblitzen dienen, Sie neugierig machen. Ein akustisches Rundum-Sorglos-Wellness-Paket ist Ohren auf Weltreise aber nicht. Dieses Buch erscheint in einer Zeit, in der blinder Hass, Kriege und Krisen die Nachrichten beherrschen. Oft berichtet die Musik, die Sie hier entdecken können, auch von Rassismus und neokolonialem Gebaren, von Genozid und einer bedrohten Natur. So ist die Welt im Jahre 2024 – in fernen Gefilden und auch vor unserer Haustür. Doch auch aus niederschmetternden Ereignissen kann große Musik entstehen, die nicht nur machtlos kommentiert, sondern sich einmischen will.
Sie werden außerdem merken: Unsere Reisebegleitung ist mehrheitlich weiblich. Das geschah ungeplant. Es ist offenbar so, dass viele der aufregenden Klangnuancen auf diesem Planeten, viele der engagierten Stimmen von Sängerinnen und Instrumentalistinnen stammen. Ein „Quotenproblem“ gibt es in der globalen Musik nicht.
Keineswegs nur ein Nebengleis ist auf diesen Seiten die spirituell gefärbte Musik. Auf religiöse oder gar konfessionell gebundene Klänge kommt es mir dabei nicht an, obwohl wir auch da hin und wieder mal einen Kurzstopp einlegen. Mich interessiert weniger die Musik, die in fester Überzeugung von einer göttlichen Existenz ruht. Sondern die, die sucht und fragt, zweifelt und verzweifelt, manchmal ahnt, sich glühend sehnt, manchmal wieder allen Glauben verliert. So entsteht nach meiner Überzeugung eine Kunst, die berühren und erschüttern kann. Geschichten, die einem mal das Herz herausreißen, es aber auch ein kleines bisschen heilen können. Und das vermag auch ganz stille Musik – denn in der Stille lässt sich oft ein ganzes Universum erlauschen.
In einer Zeit, in der physisches Reisen immer schwieriger wird, sogar ökologisch verantwortungslos sein kann, ist es fantastisch, dass wir einfach unsere Ohren losschicken können. Gerade, weil vieles in der durchdigitalisierten Welt immer ähnlicher wird, wenn Algorithmen den persönlichen Geschmack ersetzen, gibt es abseits der Klicks und Likes versteckte Strömungen zu entdecken. Wohin diese Sie tragen werden, an welchen zufälligen oder gewollt angepeilten Küsten Sie landen, das bestimmen Sie selbst! Dieses Buch können Sie als chronologischen Kalender lesen, Sie können aber auch an jedem beliebigen Tag zusteigen und mit den Querverweisen jederzeit alternative Verbindungen „buchen“.
Zwischen diesen Buchdeckeln tönt also das Lob unserer Verschiedenheit. Denn wenn wir die Diversität verlieren, verlieren wir unsere Menschlichkeit, sagte die beninische Sängerin Angélique Kidjo kürzlich in einem Interview. Man darf nicht auf den oft gehörten Satz hereinfallen, Musik sei „eine universell verständliche Sprache“. Sie ist es meiner bescheidenen Meinung nach nicht, und es gehört ein bisschen Anstrengung dazu, sich in andere Tonsysteme und Klangsprachen einzufühlen. Ein gutes Training für Respekt vor dem Anderen, dem Fremden.
Etliche der vorgestellten Musikerinnen und Musiker durfte ich während der letzten 30 Jahre treffen – zu Hause bei mir in Freiburg, aber auch zwischen Accra und Montréal, Rio und Istanbul, Geilo und Girona. Aus einleuchtenden Gründen haben wir uns in jüngerer Zeit eher am Bildschirm verabredet. Aber ganz egal, ob im selben Raum oder über 10.000 Kilometer hinweg: Was diese Künstlerinnen und Künstler mir mit ihrer meist wunderbaren Offenheit erzählt haben, fließt belebend in meine kurzen Geschichten ein.
Noch immer bin ich weit entfernt davon, den Ozean an Klängen, über den ich hier schreibe, bis in seine Tiefen zu begreifen. Manchmal habe ich am Ufer nur den Zeh ins Wasser gehalten, an anderen Stellen durfte ich ein paar Schwimmzüge ins Weite wagen. Bei all dem bin ich immer noch ein Staunender. Staunen ist der erste Impuls zum Verstehen-Wollen. Und dieses Staunen möchte ich an Sie weitergeben – jeden Tag.
Stefan Franzen
Playlists
Wo immer möglich, wurde die im Text beschriebene Version eines Musikstücks ausgesucht, in Einzelfällen können diskographische Angaben differieren. Bei nicht vorhandenen Stücken empfiehlt sich ein Gegencheck bei verschiedenen Streamingdiensten oder ein Blick auf die Liste auf meinem Blog greenbeltofsound.de.
YouTube
Blog des Autors
Spotify
JANUAR
Glücksbringer von Gloria
1. Januar
Gloria Estefan, Kuba/USA (*1957)
„Abriendo Puertas“
(Abriendo Puertas, Sony 1995)
Ein Buch mit Musik aus aller Welt sollte man standesgemäß auf einem anderen Erdteil beginnen. Für den Neujahrstag setzen wir also Segel in die Karibik, wo während der Weihnachts- und Jahreswendzeit ganz andere Lieder angestimmt werden als in unseren Breiten.
Wenn Sie wie ich in den 1980ern pubertiert haben, dann wird Ihnen auf Schuldiscos auch „Doctor Beat“ und „Conga“ von der Miami Sound Machine ins Tanzbein gefahren sein. Diese Phase hatte die Kubanerin Gloria Estefan allerdings schon hinter sich gelassen, als sie begann, auf verschiedenen Soloalben ihre Wurzeln auszugraben. 1995 veröffentlichte sie Abriendo Puertas, und dafür schöpfte sie aus dem Reichtum karibischer und südamerikanischer Klänge, baute mit ihrem Team um Ehemann Emilio aber brandneue Stücke aus diesem Fundus. Mit ihm will sie auch die Einheit Lateinamerikas hörbar machen.
So treffen im Titelstück Stile aufeinander, die ansonsten nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben – aber die Synthese gelingt perfekt: Die wiegenden Akkordeonlinien stammen aus dem kolumbianischen Vallenato, einer Musikform, die in der Atlantikregion und im Tal von Valledupar beheimatet ist. Und dann mischt Señora Estefan den Vallenato mit typischen Salsa- und Mambo-Farben: mit kehligen Antwortchören und einem knackigen Blechbläsersatz, der schließlich in einem atemberaubenden Trompetensolo gipfelt. Eine grandiose Art und Weise, das neue Jahr mit seinen Veränderungen hoffnungsfroh zu begrüßen.
Und jetzt, wo die Türen einmal so schwungvoll geöffnet sind: Herzlich willkommen im faszinierenden Reich der globalen Klänge!
Andalusische Friedenshymne
2. Januar
Enrique Morente, Spanien (1942–2010)
„Estrella“
(Despegando, CBS 1977)
1492: Kolumbus „entdeckt“ Amerika. In Europa allerdings beginnt das Jahr mit einem anderen bedeutenden Datum: Der letzte maurische Herrscher Boabdil übergibt am 2. Januar dem spanischen König Ferdinand V. die Schlüssel der Stadt Granada und der darüber gelegenen Festung Alhambra. Damit ist das Ende der arabischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel endgültig besiegelt.
Heute ist Granada vor allem für die Musik der Roma (3. September) bekannt, die in diesen Breiten Gitanos heißen. Bis spät ins vergangene Jahrhundert hinein wurden sie geächtet und sind auch heute oft noch marginalisiert. Ohne die Gitanos würde der Flamenco in der heutigen Form jedoch nicht existieren. Sein Zentrum in Granada ist der Sacromonte, ein Hügel hinter der Altstadt Albaicín, dort waren sie oft in Höhlen ansässig. Zwar existieren diese „Cuevas“ immer noch, sind aber meistens zu touristischen Flamenco-Restaurants umfunktioniert. Bis heute bringt der Sacromonte dennoch exzellente, weltweiten Ruhm erntende Flamenco-Musiker hervor. Und der Clan der Morentes ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch künstlerisch sehr produktiv.
Schlendert man durch Granada, stößt man irgendwann auf einen Charakterkopf, der in einer eindrucksvollen Wandmalerei verewigt ist: Patriarch Enrique Morente, (†2010), Erneuerer des Flamenco-Gesangs, des Cante Jondo: Als Erster setzte er Verse des Dichters Federico García Lorca (19. August) zu Musik, schrieb eine Flamenco-Messe mit gregorianischem Choral, ging Teamworks mit den bulgarischen Frauenstimmen (27. November) ein. Eines seiner fantastischsten Stücke ist für mich die 1977 entstandene glühende Friedenshymne „Estrella“.
Stern, nimm mich mit in eine Welt mit mehr Wahrheiten,
Wir werden die schwarzen Wolken aufbrechen
die uns täuschen und verfolgen,
wir werden eine neue Welt ohne Gewehre oder Gifte öffnen.
Tropischer Schlummertrunk
3. Januar
Marcos Valle, Brasilien (*1943)
„Dorme Profundo“
(O Compositor E O Cantor, Odeon 1965)
Dass Sie gleich am Anfang dieses Kalendariums wegdösen, liegt mir fern! Aber heute, am Internationalen Tag des Schlafes, kann ich nicht widerstehen, Ihnen mein allerliebstes Schlummerlied vorzustellen. Es kommt aus Brasilien, wo jetzt gerade Hochsommer ist, und in der schwül-tropischen Mittagshitze kann man schon mal einnicken. Dann aber zumindest musikalisch kultiviert.
Marcos Valle gilt als der ewige Sunnyboy der Bossa Nova, und dazu passt sein Welthit „Summer Samba“ („So Nice“) von 1966, der auch heute noch in Dutzenden von Coverversionen um den Globus reist. Valle ist ein Spätzünder: Als die Bossa, die uns im Verlauf des Jahres noch häufiger begegnen wird, schon wieder abebbt, startet der Multiinstrumentalist und passionierte Surfer richtig durch. Mit dem großen Easy-Listening-Meister Sergio Mendes tourt er durch die USA, lässt sich dort auch vorübergehend nieder. Doch die Furcht, für den Vietnamkrieg eingezogen zu werden, lässt ihn nach Brasilien zurückkehren.
In der Heimat veröffentlicht er das Erfolgsalbum Samba ’68 und schickt sich nicht nur an, in die Fußstapfen des Bossa-Erfinders Antônio Carlos Jobim (8. Dezember) zu treten: Immer wieder ein bisschen neu erfindet er sich in den Folgejahrzehnten, nimmt clever den Zeitgeist in seine Musik auf – bis hin zu kräftigen Hip-Hop- und Drum’n’Bass-Färbungen.
„Dorme Profundo“ („Schlaf tief“) erschien auf seinem zweiten Album und hat alles, was man sich von einem wirkungsvollen Wiegenlied erwartet: elegante Gitarrenakkorde, schmelzende Streicher, gestreicheltes Schlagzeug und eine schmeichelnde, beruhigende Stimme. Dass das Ganze dann nicht in Kitsch abrutscht, so was gelingt nur in Brasilien. (Psst, Geheimtipp: Die Version von Valles Kollegin und Landsfrau Márcia ist noch einlullender!)
Anwältin der Menschlichkeit
4. Januar
Awa Ly, Senegal (*1977)
„Close Your Eyes“
(Safe & Sound, Rising Bird Music 2020)
Mitten im schlimmen Corona-Sommer 2020: Eine Sängerin aus dem Senegal sitzt mit ihrem Gitarristen auf einer winzigen Bühne. Ihr Charisma leuchtet in dieser Duo-Performance so stark, dass der Mensagarten Freiburg zu Tränen gerührt ist – eine kleine Insel der Hoffnung im fast lahmgelegten Kulturleben. Mit Awa Ly, die heute Geburtstag feiert, möchte ich die Reihe mit schwarzafrikanischen Klangkünstlerinnen beginnen, die die Welt mit spannender und selbstbewusster Arbeit bereichern.
In Paris aufgewachsen, in Rom lebend, mit Dakar im ständigen Austausch: Die kosmopolitische Songwriterin nährt ihre Lieder aus diesem Dreieck. Vor ihrer Hinwendung zur Musik war sie in Italien auf der Leinwand zu sehen. Auf der Konzertbühne allerdings schauspielert sie gar nicht: Selten habe ich eine Musikerin erlebt, die so unerschrocken auftritt, aber sich gleichzeitig nicht scheut, ehrliche Verletzlichkeit zu zeigen. Die kommt besonders zum Ausdruck, wenn es um ihr Herzensanliegen, das Engagement für Geflüchtete geht. Awa Ly sieht sich als Anwältin der Menschlichkeit, die mit jedem Song kleine Fragen mit auf den Weg gibt, Fragen nach dem Platz des Einzelnen in seiner Umgebung, in der Natur, im Universum.
„Diese Innenschau fehlt heute oft“, sagt sie. Ein schönes Sinnbild dafür ist das Video zu ihrer Single „Close Your Eyes“. Lange Reihen von Menschen stehen da in einer Lagerhalle, starren auf ihre Smartphones, doch ihre Augen sind verbunden. „Das Smartphone ist nur ein Symbol für alle Bildschirme, Radios, Zeitungen, aus denen gefilterte Infos auf uns einströmen. Es ist wichtig, dass wir uns selbst befragen, wie viel davon uns guttut. Der feine Unterschied zwischen anschauen – und hinschauen.“ Ein großes Vorbild für Awa Ly ist die sudanesische Freiheitsaktivistin Alaa Salah, die durch flammende Reden die Bevölkerung wachrüttelte – und die sie im Clip zu „Close Your Eyes“ verkörpert.
Vogelkonzert aus Bamako
5. Januar
Rokia Traoré, Mali (*1974)
„Tuit Tuit“
(Beautiful Africa, Nonesuch 2013)
Um den Internationalen Tag des Vogels zu würdigen, kann man aus einer riesigen Palette von Songs auswählen. In jedem Land der Erde gibt es entsprechende musikalische Hommagen an die fliegenden Sänger. Gefiedert geht also die gestern eröffnete Serie mit selbstbewussten afrikanischen Frauen in Mali weiter, mit Rokia Traoré, die ein besonders schönes Vogellied eingespielt hat.
Traoré stammt aus dem Volk der Bambara, steht aber als in Belgien aufgewachsene Diplomatentochter zwischen den Welten. Aus dieser besonderen Biografie heraus kann sie ganz anders auf die Musik ihrer ersten Heimat Mali blicken. Ihre Arrangements waren anfangs ganz fein gesponnen und akustisch, mit der Spießlaute Ngoni, einem Vorläufer des Banjos (26. März), und Kalebassen-Perkussion. Nachdenkliche, philosophische Texte schrieb sie dazu. Auf einer anderen Platte tauchte unvermittelt das Kronos Quartet (15. November) auf, um die afrikanischen Klänge mit Streichern zu bereichern. Und dann – wie auf der Scheibe Beautiful Africa geschehen – schnallt sie sich plötzlich eine elektrische Gretsch-Gitarre um, mit der sie richtig rockige Töne anschlägt.
„Tuit Tuit“ kommt genau von dieser Platte und ist kein zart tirilierender Birdsong, sondern drückt spielerisch-rockig ihre Verbundenheit mit der Savannen-Natur aus. „In Bamako habe ich ein ganz kleines Haus mit einem großen Garten, ich fühle mich sehr wohl mit den Tieren, wenn sie frei sind“, erzählte sie mir. „Gegenüber Menschen offenbare ich nicht alle meine Gedanken, ich teile sie lieber mit dieser Welt der Natur und mit den Vögeln, die mich jeden Morgen um sechs wecken.“ Und welche Arten ahmt Madame Traoré hier nach? Ornithologen mit Spezialgebiet Westafrika vor …
Abschied mit Dudelsack
6. Januar
Alan Stivell, Bretagne (*1944)
„Kimiad“
(Chemins De Terre, Fontana 1973)
Ein Urgestein des Folk-Revivals – so muss man das heutige Geburtstagskind bezeichnen. Der Bretone Alan Stivell hat seit den 1960ern die keltische Musik bewahrt und zugleich revolutioniert. Er holte die seit Jahrhunderten vergessene Bardenharfe wieder aus der Mottenkiste, arrangierte alte bretonische Melodien und Tänze für eine ordentlich scheppernde Rockband. Stivell wurde dadurch zur Ikone des neu erwachten bretonischen Selbstbewusstseins, beschäftigte sich aber auch mit den keltischen „Bruderkulturen“, sang auf Walisisch, Irisch und Schottisch. Und er hatte schon immer einen globalen Horizont.
„Seit meiner Kindheit bin ich von der Idee beflügelt, dass es eines Tages zwischen den verschiedenen Völkern keine Grenzen mehr geben wird“, verriet er mir 1998. „Das drückt sich schon auf meinen frühen Alben aus, wo unvermittelt plötzlich eine indianische Flöte oder eine indische Tabla neben der Harfe auftauchen können. Trotzdem soll jedes Volk aber an seiner Autonomie festhalten, auch im musikalischen Sinne.“
In späteren Jahren legte er auch mal gern neblige Keyboard-Teppiche unter seine Musik, und das brachte ihm den Ruf eines Klang-Esoterikers ein. Nicht ganz fair, denn Stivell ist im Herzen immer ein „homme politique“ geblieben, der schon früh Ideen formulierte, die immer noch aktuell sind. In unserem Gespräch gab er sich sogar kämpferisch: „Es gilt, einem Le Pen, der sich einen Dreck um Eigenständigkeiten schert, zu zeigen, dass man einer indigenen Kultur verpflichtet sein kann. Ich glaube, dass ein gesunder Internationalismus nur in einem vereinten Europa erreicht werden kann.“ Das klingt auch heute noch brandaktuell.
Hier kommt ein früher Klassiker aus seinem Album Chemin De Terre: In „Kimiad“ singt das lyrische Ich zu Dudelsack-Begleitung vom Abschiedsschmerz, denn es muss seine geliebte Heimat, die Bretagne, verlassen.
Zuflucht in der Engelsstadt
7. Januar
Rhiannon Giddens, USA (*1977)
„Angel City“
(Tomorrow Is My Turn, Nonesuch 2015)
In diesem Buch wird es immer wieder um die Kraft des Songschreibens gehen, denn ein richtig guter Song ist für mich ein besonders schöner Aspekt der Musik der Welt.
Ein Song ist ein Stück ganz persönliches Leben, konzentriert auf zwei bis sechs Minuten. Ein Song kann deinen Tag retten oder dir das Herz brechen. Erinnert dich an höchstes Glück und tiefsten Schmerz, tränkt dich mit Erlebnissen, Gefühlen, Farben und sogar Gerüchen eines einzigartigen Moments. In einem großen Song kannst du eine Melodie finden, die dich so mitnimmt, dass sie dir in allen Gliedern reißt, sie kann offene Wunde sein oder auch ungeschminkte Seligkeit.
Eröffnen wir die Songwerkstatt zum Ausklang der Weihnachtszeit mit einem Lied über die „Engelsstadt“ von Rhiannon Giddens aus North Carolina. Zusammen mit ihrer Kollegin Leyla McCalla (22. Februar) ist die Sängerin und Banjospielerin eines der prominentesten Gesichter der neuen amerikanischen Folkbewegung. Als mixed race woman nimmt sie nie ein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, gegen die Ungerechtigkeiten anzusingen, die bis heute den African Americans widerfahren. Und sie reißt beherzt die Trennlinien zwischen Country, Folk, Blues und Soul nieder.
„Wenn du einen der Fäden der amerikanischen Musik rausnimmst, dann kollabiert sie. Das war der Gedanke hinter dem Album Tomorrow Is My Turn. Denn diese Songs kommen aus einer gemeinsamen Welt: Country-Leute wie Jimmy Rodgers haben den Blues gesungen, und Bluesmen haben Country gesungen. Kategorisierungen? Die haben doch nur die Plattenfirmen vorgenommen.“ Am Ende der Platte steht – als Dank an ihre Mitmusiker und an die guten Seelen in schwierigen Zeiten – die Eigenkomposition „Angel City“. Es ist mein Lieblingssong auf dem Album, weil er zeigt: Einige wenige Akkorde zu einer starken Melodie genügen, um drei Minuten für die Ewigkeit zu schaffen.
Wüstensöhne der Zukunft
8. Januar
Imarhan, Algerien
„Achinkad“
(Aboogi, City Slang 2022)
Um den 8. Januar herum startete im Norden von Mali, in der Oase Essakane nahe Timbuktu, seit 2001 das Festival Au Désert: Das musikalische Wüstenspektakel entzündete sich ursprünglich an der Idee der traditionellen Meetings der Tuareg, wurde aber bald global. Regelmäßig machten sich Rockbands aus Europa und den USA auf den Weg, um mit den Berber-Nomaden zu jammen und sich im Wüstenblues zu schulen. Denn in dieser machtvollen Musik, die dem US-Blues so ähnlich ist, fanden Altrocker wie Robert Plant von Led Zeppelin oder Chris Eckman von den Walkabouts viele Anknüpfungspunkte. Der Unruhen in Mali wegen wanderte das Festival ab 2013 ins Exil an verschiedene Orte – und konnte bis heute nicht nach Essakane zurückkehren.
Der Tuareg-Rock aber blüht weiter, und er hat sich stilistisch aufgefächert. Die spannendste Band der 2020er ist für mich Imarhan aus dem algerischen Karawanenstützpunkt Tamanrasset. Imarhan übersetzt sich mit „die, die mir etwas bedeuten“, und dabei geht es selbstverständlich um den Zusammenhalt der blauen Ritter der Wüste, der auch in ihrer jüngsten Geschichte wieder gefordert ist: In Tamanrasset leben viele Flüchtlinge des Volkes, die vor den jüngsten islamistischen Umtrieben in Mali geflohen sind. Sie, die seit Jahrzehnten um Eigenständigkeit und mehr Rechte kämpfen, zahlreiche verheerende Dürrejahre durchstehen mussten, sind Verlierer im aktuellen Sahara- Konflikt.
Imarhan arbeiten weniger mit der rockigen Wall of Sound, die viele ihrer Bruder-Bands pflegen. Ihnen kommt es mehr auf bedächtige Akustikgitarren-Riffs an, die sie zur klangvollen Poesie in ihrer Sprache Tamasheq setzen, sie wirken Tupfer von Flamenco und Country ein. Und bei ihren Bühnenauftritten tragen die sechs Musiker statt des traditionellen Tagelmust (einer Kombination aus Turban und Schleier) auch mal gern Jeans, T-Shirt und Baseballkappe.
Samba-Apokalypse
9. Januar
Mau Mau, Italien
„Adorè“
(Bàss Paradis, EMI 1994)
Bei besonders abenteuerlichen Mischungen von Musikstilen bin ich immer etwas vorsichtig. Ist das Ergebnis wirklich etwas Spannendes, Ansteckendes, etwas Eigenes oder Neues? Oder wird hier einfach ein künstlicher Eintopf zum Brodeln gebracht, der schnell als fauliges Potpourri erkaltet, wenn er eine Weile vor sich hin gärt? Bei der heutigen Band brodelt es auch nach fast 30 Jahren in meinen Ohren weiter, wenn ich ihr Meisterwerk Bàss Paradis auflege. Und dabei kommen sie aus einer Stadt, die man auf einer Liste der kulturellen Schmelztiegel der Welt jetzt nicht ganz so weit oben ansiedeln würde: aus Turin.
Bereits 1990 formierte sich dort Mau Mau um den Sänger und Gitarristen Luca Morino. In ihrem Sound finden sich nicht nur alle mediterranen Einflüsse von Andalusien bis zum Balkan, auch afrikanische Tupfer und lateinamerikanische Rhythmen kann man erlauschen. Und doch verbindet sich alles zu einem Klang, der ganz typisch für nur diese eine Band ist. Dazu singen die Norditaliener im sehr charakterstarken piemontesischen Dialekt. Mau Mau sind damit Pioniere der Mestizo-Welle, die mit Manu Chao erst ein paar Jahre später so richtig über den Globus rollen wird.
Als diese sagenhafte Scheibe 1994 erschien, hatte ich beim freien Radio Dreyeckland eine Weltmusiksendung, und diese Platte spielte ich in jenem Jahr in Endlos-Rotation. Besonders ein Stück hatte es mir damals angetan: das mächtig polternde „Adorè“, das daherkommt wie eine gewaltige Karnevalsparade im Samba-Rhythmus. Allerdings mischen sich auch ganz schön apokalyptische Bilder hinein und die Heiligen einer katholischen Feiertagsprozession. Ich finde, das alles passt doch optimal ins Januar-Niemandsland zwischen Weihnachtszeit und Fastnacht. Wildes Tanzvergnügen wünsche ich!
Anrufung des Pockengottes
10. Januar
Orchestre Poly-Rythmo De Cotonou, Benin
„Mi Ni Non Kpo“
(The Vodoun Effect, Analog Africa 2008)
Sind Sie bereit für einen ersten Ausflug in den afrikanischen Pop der goldenen Ära? In den späten 1960ern und die ganzen 1970er hindurch vibrierte fast ganz Schwarzafrika mit einer Tanzmusik, die in jedem Land eine andere Färbung hatte. Lokale Farben verschmolzen mit Funk und Soul, denn in der Ära von James Brown waren die im ghanaischen Accra genauso angesagt wie im angolanischen Luanda.
Seit der Jahrtausendwende sind Vinyl-Verrückte aus dem sogenannten „Westen“ in Hinterhöfen, Lagerhallen und bei Privatsammlern unterwegs, um die Schallplatten-Schätze aus jener Zeit zu heben, zu digitalisieren und neu zu veröffentlichen. Manche gehen dabei wie koloniale Raubritter zu Werke, andere sorgen dafür, dass die heute schon steinalten Musikerinnen und Musiker ihre Tantiemen bekommen. Und manchmal führt das sogar dazu, dass Pop-Giganten von damals jetzt wieder auf die Bühne gehen.
Das ist in den 2010ern der Fall gewesen beim legendären Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, einer Big Band, die von 1969 bis 1985 sage und schreibe 500 Aufnahmen gemacht hat. Ihre Spezialität: die Rhythmen, Melodien und Instrumente der Vodoun-Rituale – wie etwa die ein Meter fünfundsiebzig große Trommel Sato, Glocken und Hörner – mit modernem Gitarren- und Keyboard-Sound aufzupeppen.
Dass ich diese Musik am 10. Januar platziere, hat natürlich einen Grund: Heute feiert man in Benin den Tag des Vodoun. Bei uns wird Vodoun (oder auch Voodoo) oft mit aufgespießten Puppen und schwarzer Magie in Verbindung gebracht. Dabei ist diese Naturreligion ein komplexes Glaubenssystem, das den Menschen in erster Linie helfen soll – und nicht etwa schaden. In „Mi Ni Non Kpo“ hat das Orchestre einen Rhythmus namens Sakpata aufgegriffen. Er wird im Vodoun immer dann gespielt, wenn der Gott beschworen wird, der vor Pocken schützen soll. Das Gitarrenriff trifft meinen Gehörgang jedes Mal wie ein Blitzschlag!
Kosmopolitin aus Nuuk
11. Januar
Nive Nielsen, Grönland (*1979)
„Tulugaq“
(Feet First, Glitterhouse Records 2015)
„Schön kühl hier!“, ruft Nive Nielsen aus, als wir uns auf die Steinstufen in der Rudolstädter Heidecksburg setzen. Gerade hat sie mit ihrer Band The Deer Children unter der heißen Julisonne ein Konzert gespielt – nicht ihre Temperaturen. Nielsen stammt aus der grönländischen Hauptstadt Nuuk, und sie ist die Blaupause für die moderne Inuit-Frau des 21. Jahrhunderts: studiert, weitgereist, dreisprachig, Indiepop-Sängerin, Hollywood-Schauspielerin – und trotzdem den Wurzeln ihrer Kultur verbunden.
Ihre Musik ist geprägt von unbekümmerten Arrangements um ihre helle Stimme, E-Gitarren, Glockenspiel, Streichern, Trompeten, Kinderchören, singender Säge und lustigem Synthesizer. Immer wieder singt sie auch im westgrönländischen Idiom Kalaalisut, wie in „Tulugaq“: „Doch auf Kalaalisut zu dichten ist für mich schwieriger als auf Englisch, ich kenne die Sprache besser und überdenke meine Worte mehr. Das kommt immer dann an die Oberfläche, wenn ich mal länger zu Hause in Nuuk bin. Auf Reisen allerdings denke ich sogar auf Englisch.“
Was das Überleben der Inuit-Kultur betrifft, zeichnet sie ein ernüchterndes Bild. Der traditionelle Kehlkopfgesang Katajjaq wurde den Inuit bei der christlichen Missionierung durch Dänemark weggenommen, nur im Norden, in der Thule-Region, blieb der Trommeltanz erhalten. Seine Elemente kann man ansatzweise noch in der rhythmischen Vertracktheit des ansonsten fast kindlichen Pop von Nive Nielsen hören.
So naiv die Musik tönen mag, in ihren Texten erzählt Nielsen vom drohenden Uranabbau oder ihrer Sorge über den Klimawandel. Sie erinnert sich, dass in ihrer Kindheit die Leute nicht aus den Häusern kamen, weil der Schnee so hoch war. „Heute musst du dir noch die wenigen Stellen suchen, wo du überhaupt Ski fahren kannst. Jedes Jahr geht der Rückgang schneller.“ Sind Nielsens Songs Klänge eines untergehenden Volkes? Es liegt auch an uns, das zu verhindern.
Ein Kraftort und ein Panamahut
12. Januar
Lakou Mizik, Haiti
„Panama’m Tonbe“
(Wa Di Yo, Cumbancha 2014)
Am 12. Januar 2010 wird Haiti von einer furchtbaren Erdbebenkatastrophe heimgesucht. 300.000 Tote sind zu beklagen und eine völlig zerstörte Infrastruktur. Doch wie so oft kommen Überlebensimpulse aus der Musik. Die Geschichte der neun Musiker von Lakou Mizik liest sich wie ein Protokoll unbezähmbaren Lebenswillens, eine Anleitung zur Auferstehung.
Der Gitarrist Steeve Valcourt berät in der Hauptstadt Port-au-Prince mit dem Sänger Jonas Attis und dem amerikanischen Produzenten Zach Niles, wie die Musikkultur Haitis in diesem am Boden liegenden Land bewahrt werden könnte. Es schält sich die Idee heraus, eine haitianische Supergroup auf die Beine zu stellen. Dafür wählen sie die herausragendsten Musiker aus allen Bereichen aus: Sänger aus dem Gospel, Blechbläser aus dem Rara, der haitianischen Karnevalsmusik, Drummer aus dem Voodoo (der, siehe vorgestern, ursprünglich aus Benin stammt). Jede und jeder von ihnen hat eine bewegende bis erschütternde Geschichte über das Erdbeben zu erzählen.
Unter dem Motto „Wa Di Yo“, („Sag ihnen, wir sind noch hier!“) schaufeln die neun Musiker mit ihren optimistischen, ausgelassenen, berührenden und auch mal bissigen Songs Haiti buchstäblich aus den Trümmerhaufen. Die Gruppe wird zu einem Kraftort, einem „Lakou“, wie er im Voodoo heißt. Der Song „Panama’m Tonbe“ ist einer der leichtfüßigeren im Repertoire, und die Sängerin Nadine Remy geleitet in dieses bekannte Traditional Haitis: Es erzählt, wie 1896 dem haitianischen Präsidenten Florvil Hyppolite der Panamahut vom Kopf gesegelt sein soll, woraufhin er an einem Schlaganfall starb. Ein verlorener Hut gilt seitdem als Unglücksbringer, und im Text kehrt der Wunsch wieder, Haiti mit all seinen Problemen möge bewahrt bleiben vor Panamahüten, die sich selbständig machen!
Göttliches Brausen
13. Januar
Aretha Franklin, USA (1942–2018)
„Amazing Grace“
(Amazing Grace, Atlantic 1972)
Es ist ein schmuckloser Raum für einen Gottesdienst. Ursprünglich war die New Temple Missionary Baptist Church ja auch ein Kino. Sie liegt mitten in Watts, dem Problembezirk von Los Angeles schlechthin, wenige Jahre zuvor Zentrum verheerender Rassenunruhen. Doch als am Abend des 13. Januar 1972 eine Sängerin an den Altar tritt, ereignet sich an diesem unscheinbaren Ort Musikhistorie.
Die Sängerin heißt Aretha Franklin. In den letzten fünf Jahren hat sie sich bei Atlantic Records von einer erfolglosen Jazz- und Popsängerin zur weltweit gefeierten Queen of Soul gemausert. Sie ist jetzt die musikalische Ikone der Bürgerrechtsbewegung und der schwarzen Frauen. Doch ihr Leben war in diesen Jahren auch eine Achterbahnfahrt: Eine toxische Ehe, der Mord an ihrem Freund Martin Luther King, Alkoholprobleme und der nicht verarbeitete Missbrauch während der Kindheit lasten auf ihrer Seele. Sie spürt: Es ist der richtige Zeitpunkt, zu ihren Wurzeln im Gospel zurückzukehren.
„Wir geben hier kein Konzert, das ist ein Gottesdienst“, sagt Reverend James Cleveland zu den Anwesenden, unter die sich auch neugierig Mick Jagger und Charlie Watts von den Rolling Stones gemischt haben. Und was dann passiert, muss man als göttliches Brausen beschreiben: Der Southern California Choir und eine Soul-Band um den Schlagzeuger Bernard Purdie machen aus den Baptistenhymnen und stürmischen Erweckungsgesängen der Pfingstkirche einen revolutionär neuen Gospel, sogar weltliche Popsongs werden in der heiligen Sphäre neu geboren.
Arethas Stimme wird im Wechselspiel mit dem Chor von einem unbegreiflichen Feuer erfasst, sie erreicht Spitzentöne, die durch Mark und Bein gehen, gipfelnd im Titelsong der später erscheinenden Doppel-LP. Niemand, egal ob gläubig oder nicht, kann „Amazing Grace“ ohne seelische Erschütterung hören – für mich gehören diese Minuten zu den kostbarsten Aufnahmen dieses Planeten.
Eine Kerze auf der Avenue Bourghiba
14. Januar
Emel Mathlouthi, Tunesien (*1982)
„Kelmti Horra“
(Kelmti Horra, World Village 2012)
Eine junge Frau im leuchtend roten Mantel erhebt sich aus der riesigen Menschenmenge auf der Avenue Bourguiba von Tunis. Sie hält eine Kerze in der Hand und beginnt zu singen, erst noch zaghaft und vorsichtig, dann mit immer festerer Stimme:
Wir sind freie Menschen, die keine Angst haben, wir sind Geheimnisse, die niemals sterben,
und denen, die Widerstand leisten, leihen wir unsere Stimme,
in ihrem Chaos sind wir das Leuchtfeuer.
„In dem Moment hatte ich keine Ahnung, was passieren würde, ich war sehr ängstlich. Doch schließlich sang ich aus vollem Herzen, war glücklich darüber, dass mein Song ‚Kelmti Horra‘ den großen Tag erleben durfte“, erinnert sich Emel Mathlouthi. Sie ist die Stimme der Revolution, mit der das tunesische Volk am 14. Januar 2011 den Diktator Ben Ali zur Flucht zwingt und auch für andere Länder den Aufbruch zum „Arabischen Frühling“ gibt. Nach der Revolution veröffentlicht sie ihr Debüt: Viele der Stücke sind geprägt von elektronischer Kühle und Schwere, verwurzelt aber sind die Rhythmen in der tunesischen Tradition. Mathlouthis Stimme strahlt dabei eine große Verletzlichkeit aus. „Es sind Lieder, die meine Schmerzen, meinen Tränen in sich tragen“, sagt sie über ihr Werk.
Der spannende und spannungsreiche Spagat zwischen Elektronik und Empfindsamkeit ist Mathlouthis Werk in der Wahlheimat New York bis heute erhalten geblieben. „Ich will eine lebendige Zeugin bleiben für das, was in Tunesien vor sich geht. Und mit meiner Musik eine Brücke bauen zwischen der tunesischen Jugend und den anderen Völkern.“ Heute ist in Tunesien wie in vielen arabischen Ländern die Aussicht auf nachhaltige demokratische Veränderung verflogen, Korruption und Gewalt sind wieder am Ruder. Umso wehmütiger wirkt Mathlouthis Freiheitslied von 2011, das von einem Moment des Aufbruchs kündete.
Besuch beim Eismann
15. Januar
Terje Isungset, Norwegen (*1964)
„Mellom Fjell“
(Winter Songs, All Ice Music 2010)
Wer diesen Mann kennenlernen will, muss sich warm anziehen. Der Norweger Terje Isungset ist der „Ice Man“, und das im schönsten, klingenden Sinne. Schon immer hatte der Schlagzeuger eine Vorliebe für die Elemente, baute Instrumente aus Stein oder Holz, schuf damit seine eigene Volksmusik, die genauso archaisch wie experimentell klingt. Schließlich entdeckt er das Wasser, auf dem sich in gefrorener Form am besten musizieren lässt. Das ist kein Witz: Isungset modelliert anfangs Perkussionsinstrumente und Marimbaphone aus Eis, später dann sogar Eishörner, Eistrompeten. Auch vor Harfen und Fiedeln aus Eis scheuen er und sein Team nicht zurück.
Bestaunen und hören kann ich diese eisigen Artefakte beim Ice Music Festival in seinem Heimatort Geilo im südnorwegischen Hochland, auf halber Strecke zwischen Oslo und Bergen. Dort lädt
Isungset immer Mitte Januar, zum ersten Vollmond des Jahres, Gastmusiker aus dem skandinavischen und samischen Folk (6. Februar/18. März), Pop und Jazz in eine Freiluft-Eisarena ein. Bei klirrenden Minusgraden lausche ich mitten in der nordischen Sternenwinternacht einer Musik, die feingewoben und surreal wirkt. Genauso unwirklich klingt der Publikumsapplaus aus dicken Handschuhen: Er erinnert mich eher an Pferdegetrappel.
„Das Eis ist Herr über mich, nicht umgekehrt!“, sagt Isungset bedeutungsvoll in seinem Iglu neben der Bühne. „Ich versuche nur, die Seele des Eises hörbar zu machen, Stücke zu finden, die schöne Töne hervorbringen und ‚singen‘. Wie die Instrumente klingen, hängt von der Qualität des Eises ab; wenn es richtig kalt ist, produziert es den größten Klangreichtum: Die Bässe werden klarer und fülliger, die Höhen brillanter und knisternder.“ In „Mellom Fjell“ formen Iceofon, Glasharmonika und die Stimme von Lena Nymark ein kristallines Klanggebilde.
Cello-Flug zum Gewölbe
16. Januar
Matthieu Saglio, Frankreich/Spanien (*1977)
„L’Appel Du Muezzin“/„Les Cathédrales“
(El Camino De Los Vientos, ACT 2020)
Heute, am Tag der Weltreligionen, möchte ich Ihnen zeigen, wie sich religiöse Gräben zumindest durch ein Instrument überwinden lassen. Der Franzose Matthieu Saglio, seit vielen Jahren im spanischen Valencia ansässig, zaubert auf seinem Cello Grenzen zwischen Erdteilen und Glaubensrichtungen weg. Klassisch ausgebildet, aber global interessiert, hat er anfangs eine Fusion seines Instruments mit dem Flamenco erprobt. Danach wurde er in ganz Europa bekannt mit dem Trio NES, hier spielte er an der Seite der Algerierin Nesrine, ebenfalls Cellistin. Seine Qualitäten als Komponist sind regelmäßig in Soundtracks für Theater oder Fernsehen zu hören. Aber als Solist hat er mich am meisten überzeugt, als sein Album El Camino De Los Vientos erschien.
Diese Scheibe unternimmt eine anregende Reise durch mediterrane Gefilde und darüber hinaus, durch die Souks des Maghreb, durch Schwarzafrika und den lateinamerikanischen Tango. Über die Inspiration sagt Saglio: „Der Titel bezieht sich auf den Charakter der Winde, die ja stets wechseln, unvorhersehbar sind, man kann nicht vorhersagen, woher sie kommen, wohin sie gehen, so ist das auch mit dem Wind der Kreativität.“
Während auf den meisten Stücken Gäste im Zusammenspiel mit Saglio zu hören sind, umrahmt er die Reise mit zwei Solo-Einlagen, die himmelsgewandte Züge tragen. „Am Anfang ertönt der allmorgendliche Ruf des Muezzins, es ist der Start in den Tag, und der hat eine spirituelle Prägung. Auch wenn es ein fiktives, erfundenes Gebet ist, eine Melodie, die ich selbst ersonnen habe. Und am Ende steht ein Solostück namens ‚Les Cathédrales‘: Ich stelle mir dabei einen Cellisten vor, der ganz allein in einer Kathedrale sitzt, und der Klang seines Instruments fliegt hinauf zum Gewölbe.“ Ich empfehle, beide Stücke nacheinander zu hören.
Von Vivaldi in den Dschungel
17. Januar
Witch’n’Monk (UK/Kolumbien)
„Outchant“
(Witch’n’Monk, Tzadik 2020)
Es ist der 17. Januar 2023: Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Freiburg sitzen auf der Bühne des Jazzhauses – seltsam genug – und spielen Antonio Vivaldis „Winter“. Sie interpretieren ihn allerdings in der Neufassung des deutschen Komponisten Max Richter, der das Stück in eine sphärische Minimal-Music-Richtung gestupst hat. Organisiert hat diesen Ausbruch des Orchesters aus den heiligen Theaterhallen hinein in die Club-Atmosphäre der neue Generalmusikdirektor André de Ridder. Er ist der Meinung: „Kategorien in der Musik sind richtig, aber man sollte sie als gleichwertig betrachten.“ De Ridder ist ein engagierter Vermittler zwischen Klassik, World, Jazz und Pop, wie es sie im etablierten Musikbetrieb leider immer noch zu wenig gibt. Ich habe ihn in Toronto entdeckt, als er eine Uraufführung mit dem Kronos Quartet leitete. Dass er jetzt in Freiburg wirkt: ein Glücksfall.
Nach dem Vivaldi-Vorspiel klettern zwei verrückte Musiker auf die Bühne. Sie: eine Sopranistin mit exaltierter, durchgedrehter Stimme, die zudem einen Zwitter aus E-Gitarre und Bass umhängen hat. Als Künstlerin nennt sie sich Heidi Heidelberg. Er, Mauricio Velasierra, hantiert mit den traditionellen Andenflöten Quena und Mohzeños, die er durch Effektgeräte schickt und die auch mal wie alte Dampfloks röcheln. Zusammen firmieren sie unter dem Namen Witch’n’Monk.
Ihre Version von Richard Wagners „Feuerzauber“ trabt macht- und geheimnisvoll wie durch einen dunklen Urwald, und Franz Schuberts „Gretchen am Spinnrade“ schmettert Heidelberg mit dem Gestus einer Rocklady. Das Stück „Outchant“ haben sie eigens für diesen Abend so arrangiert, dass sich ein Streichquintett, Posaune und Oboe vom Orchester dazugesellen können. Die Textur ist verblüffend, der Dialog gelingt. An diesen Abend denke ich gern zurück: Viel mehr solcher Abenteuerspielplätze zwischen Klassik und experimentellem Pop müsste es geben.
Ironie in der unterirdischen Stadt
18. Januar
Kate & Anna McGarrigle, Kanada (1946–2010/*1944)
„Complainte Pour Sainte Cathérine“
(Kate & Anna McGarrigle, Warner 1975)
Dieses Schwesternpaar hat die Musik der kanadischen Provinz Québec in den internationalen Popzirkus getragen. Ihre Songs reichen von tränenreichen Balladen bis zu gewitzten Einflüssen aus der Folkmusik der Acadiens, der französischsprachigen Bewohner. Und die sind ganz stark zu hören in dieser genauso verrückten wie rätselhaften „Klage der heiligen Katharina“. Worum geht’s?
Bei „Sainte Cathérine“ denken die Einheimischen von Montréal in allererster Linie nicht an die Heilige, sondern an die berühmte Einkaufsstraße in Downtown. Und die gibt es sozusagen zweimal, nämlich über und unter der Erde: Wegen der starken Temperaturschwankungen zwischen minus und plus 40 Grad haben die Planer im Zentrum eine unterirdische Stadt angelegt. Und genau dort sucht das lyrische Ich Schutz und trägt mit leicht ironischem Ton seine Ansichten zu Politik und Gesellschaft vor. Dazu wird auch noch das spießige Leben der Québecois ganz schön auf die Schippe genommen: Samstags geht man brav zum Eishockey, und sonntags wird der Hund spazieren geführt.
Und die Musik? Ein folkiger Rundgesang mit Akkordeon, Fiddle und Harmonika. Und natürlich dieser immer wiederkehrende jaulende Quintsprung, der schon sehr klagend klingt, aber auf eine satirische Art und Weise. An der provençalischen Form der Complainte hat sich Komponist Philippe Tatartcheff vielleicht auch ein wenig orientiert, als er den Text schrieb: Wie bei den Troubadouren gliedert er seine Verse in Couplet und Refrain. Die McGarrigles haben hier eine wahre Starbesetzung der Rockgeschichte gewonnen: Tony Levin am Bass, Steve Gadd an den Drums, David Spinoza an der Gitarre.
Kate McGarrigle ist heute im Jahre 2010 verstorben, das Erbe der Schwestern haben schon lange ihre Kinder Rufus und Martha Wainwright angetreten. Bei beiden hört man stark das Timbre der Mutter durch – machen Sie mal den Vergleichstest!
Brasil-Legende im Breisgau
19. Januar
Ralf Schmid, Deutschland (*1969)/Ivan Lins, Brasilien (*1945)
„Todo Mundo“
(Cornucopia, Moosicus 2012)
Manche Menschen meiner Heimatstadt Freiburg werden flapsig als „Breisgau-Brasilianer“ bezeichnet. Dazu zählen die Fußballer des SC, wenn sie sich mal wieder auf Spitzenplätze in der Bundesliga hochzaubern – oder auch so mancher Musiker, der sich an brasilianischen Rhythmen versucht.
Gern gelten lasse ich das Prädikat für Ralf Schmid. Denn der an der Musikhochschule dozierende Komponist, Arrangeur und Pianist hat sich feinnervig in Bossa-Nova- und Samba-Welten eingefühlt. „Ich mag es nicht, wenn Europäer brasilianischer sein wollen als die Brasilianer selbst. Deshalb habe ich es zunächst vermieden, solche Musik zu machen“, sagte er mir. „Aber der Background war sehr stark, denn mein Vater spielte immer brasilianische Musik, und so wurde das auch ein Teil von mir.“ Schmid hat die Klangwelt etlicher Brasil-Stars aus seinem Hörwinkel heraus bereichert. Zu ihnen zählt die Sängerin Paula Morelenbaum (8. Dezember) oder eine Legende der Música Popular Brasileira, Ivan Lins. Auch er ist wie Schmid ein Multitalent: Komponist, Arrangeur, Pianist und Sänger.
Am 19. Januar 2011 klingelt mein Telefon. Ob ich für ein Interview in die Freiburger Innenstadt kommen wolle, fragt Ralf Schmid, denn dort sitze in einer Hotellobby besagter Ivan Lins. Der Weltstar im beschaulichen Städtle? Tatsächlich, bestens gelaunt treffe ich ihn an – und ich bin völlig perplex ob seiner tiefen Sprechstimme, wo er doch beim Singen in ein abenteuerliches Falsett klettert. Lins und Schmid berichten mir, dass sie mit der SWR Big Band gerade ein Projekt aufgleisen, für das Lins einen ganzen Turm unveröffentlichter Songs mitgebracht hat. Cornucopia, das „Füllhorn“, entsteht daraus: raffinierte Bläserarrangements, garniert mit einem südafrikanischen Chor und dem deutschen Hip-Hop-Jazzer Joo Kraus an der Trompete. „Dass ich für Ivan arrangiert habe, das ist, als ob ein Traum in Erfüllung gegangen wäre“, gab Ralf Schmid damals zu.
Fernöstlicher Erlebnispark
20. Januar
Mitsune, Japan/Australien/Deutschland/Griechenland
„Hazama“
(Hazama, Eigenverlag)
Immer um diese Zeit herum im Januar wird die seit 1861 etablierte deutsch-japanische Freundschaft gefeiert. Sie geht auf Handelsbeziehungen im preußischen Reich zurück. Heute aber schauen wir uns die kulturellen Brückenschläge zwischen den beiden Staaten an, die es zum Glück auch gibt. Etwa in Gestalt der Band Mitsune aus Berlin.
Musik aus Japan hat es irgendwie nie so richtig in die Global-Pop-Szene geschafft. Umso erfreulicher, dass dieses Quintett fernöstliche Traditionen mit einer völlig unerwarteten zeitgenössischen Perspektive kombiniert. Ihre Herkunft ist multinational: Japan, Australien, Griechenland, Deutschland. Im Fokus steht die dreisaitige, mit Schlangen-, Katzen- oder Hundehaut bespannte Shamisen, eine Kastenspießlaute, die eine Weiterentwicklung der chinesischen Sanxian ist. Vor mehr als 400 Jahren kam sie nach Japan. Historisch war die Shamisen vor allem in verschiedenen Formen des Erzähl- und Puppentheaters gefragt, und sie gilt auch als das Instrument der Geishas.
Aus diesem Kontext herausgelöst wird es von Shomi Kawaguchi, Tina Kopp und Youka Snell, den drei Damen, die den Kern von Mitsune bilden: Geradezu muskelbepackt, zeitweise ein wenig „punkig“ sind die Arrangements, in denen die kernigen Zupf-Riffs vorwärtstreiben. Darüber legen die drei einen kraftgeladenen, augenzwinkernden, mit süßlichen Harmonien spielenden Chor. Unterstützt werden die Frauen von einer kleinen Rhythmusgruppe an Bass und Schlagzeug, und die kann sich auch mal zum geräuschhaften, perkussiven „Erlebnispark“ auswachsen. Mal groovt es richtig, mal wird martialisch galoppiert, zart wird es beim berühmten Kirschblütenlied „Sakura“. Gelegentlich treten Gastmusiker an Cello, Flöte, dem arabischen Hackbrett Qanun oder Bassgitarre hinzu. Und plötzlich tut sich die japanische Laute mit einem Banjo zur Country-Musik zusammen – oder tanzt gar einen Tango.
Die Sonne im Kopf
21. Januar
Lô Borges, Brasilien (1945–1982)
„O Trem Azul“
(Meus Momentos, EMI 1994)
Auch wenn das Land nur noch ein winziges Eisenbahnnetz hat, unter den vielen Eisenbahnliedern der Welt gehören die aus Brasilien zu meinen liebsten. Zum Beispiel dieses großartige: „O Trem Azul“, der blaue Zug, er stammt aus der Feder der beiden Songwriter Lô Borges und Ronaldo Bastos (heute geboren!), beide Mitbegründer der „Clube da Esquina“-Bewegung. Diese Bewegung aus der Stadt Belo Horizonte im Bundesstaat Minas Gerais (26. Oktober) verband bildgewaltige, teils psychedelische Poesie mit einem verschachtelten Rock-Sound à la Genesis. Aus dieser Kombi ergibt sich eine sehr lyrische, irgendwie fast sakrale Stimmung, typisch für die Musik des Bundesstaates Minas Gerais.
Ob Borges einen bestimmten blauen Zug gemeint hat? Tatsächlich gibt es einen „Trem Azul“ in Brasilien, er fährt im Staat Rio de Janeiro und verkehrt zwischen den Orten Miguel Pereira und Conrado. Ungünstig aber, dass die Strecke erst 1986 eröffnet wurde, sie konnte den Song also nicht inspiriert haben. Denn der „Trem Azul“ erschien im Original im Jahr 1972 und wurde in der Folge von vielen weiteren Künstlern der brasilianischen Popszene (der Música Popular Brasileira oder kurz: MPB) aufgegriffen.
„Du nimmst den blauen Zug, die Sonne im Kopf, die Sonne nimmt den blauen Zug, dich im Kopf“ – vielleicht spielten bei der Dichtung ein paar gute Gräser eine inspirierende Rolle. Also rätseln Sie lieber nicht zu lange, was das heißen soll, sondern genießen Sie diese Songperle aus einer vergangenen Ära Brasiliens – am besten in zwei Versionen: In der des Urhebers Lô Borges und in der von Elis Regina, die am 16. Oktober noch intensiver vorbeischaut.
Der Garten und der Gospel
22. Januar
Lizz Wright, USA (*1980)
„I Remember, I Believe“
(Fellowship, Verve 2010)
Für sie harre ich sogar ein paar Stunden im strömenden Regen aus. Als Lizz Wright 2012 beim Stimmen-Festival Lörrach auftritt, sitze ich mit meiner Familie unter einem Himmel, der drei Stunden lang alle Schleusentore weit geöffnet hat. Sie blickt von der Bühne auf ein Meer von Regenponchos und lächelt: „You look so beautiful.“ Am Ende haben wir alle Schwimmhäute zwischen den Fingern. Doch dieser Abend, an dem sie uns über die dicken Regenwogen hinwegträgt, ist das wert.
Lizz Wright, Tochter einer Organistin und eines Pfingstkirchenpastors aus Georgia, ist das, was man down to earth, geerdet, nennen könnte: „Ich komme aus einer Familie von sehr talentierten Gärtnern, in der Zeit der Sklaverei waren meine Vorfahren Landpächter“, erzählte sie mir 2011. „Sie haben alle im Umkreis ernährt, egal, was gerade los war in der Welt. Denn sie hatten dieses Wissen über die Ordnung in der Natur.“
Der Garten und die Kochkunst sind für Lizz Wright „eine heilende und kreative Sprache“. Das lässt sich besonders auf ihrem Album Fellowship herauslauschen, man schmeckt förmlich den Mutterboden ihrer musikalischen Wurzeln. Da ist viel Gospel dabei, den sie mit Band und Kammerchor interpretiert und mit einer innigen Glut. Die Linie zwischen sakral und weltlich wird öfters auch mal mutig überschritten, auch in der Musik von Jimi Hendrix und Eric Clapton findet Wright „Heiliges“.
Denn Dogmen sind ihre Sache nicht: „Richtig verstandene Religion und wahrer Glaube führen nicht zu Versteckspielen und Ignoranz, wie das bisher oft der Fall war. Sie führen zu Neugier auf den anderen, zu Mut und Mitgefühl.“ In diesem Sinne ist unser Geburtstagskind Lizz Wright eine Sängerin, die 60 Jahre nach dem Civil Rights Movement im versöhnenden Geiste weiterwirkt, die Vergangenheit aber nie vergisst. Etwa in „I Remember, I Believe“, einem berührenden Gospelsong aus ihrer eigenen Feder.
Von der Transkei in die Welt
23. Januar
Simphiwe Dana, Republik Südafrika (*1980)
„Ndiredi“
(Zandisile, Skip 2006)
An einem Abend im November 2006 ist die Zeitenwende in der südafrikanischen Musik zum Greifen nah. Als Vorprogramm für Miriam Makeba (1. Februar) ist sie bei der Basler AVO Session gebucht, aber sie stiehlt der „Mama Africa“ glatt die Show: Das Auditorium hält den Atem an, als Simphiwe Dana (sprich: sim’pieweh), heute im Jahr 1980 geborene Pfarrerstochter aus Johannesburg, die Bühne mit anmutigem Stolz und charmantem Charisma ausfüllt. Und mit einer Stimme wie ein heranrollender Soul-Hurricane.
Aufgewachsen ist sie als armes Mädchen in einem Dorf der Transkei ohne Strom und fließendes Wasser. Sie erinnert sich an wilde Tiere und schwarze Magie. Die Musik der weiten Welt kennt sie noch nicht, nur die Zeremonien der Dorfbevölkerung und den Gospel der lokalen Kirche. Aus ihm bezieht sie ihr Erbe, dann aber auch Inspirationen aus Soul und dem Jive, einer Jazz-Variante Südafrikas. Ab und an stiehlt sich ein nervöser House-Beat hinein, auch die Folklore des Xhosa-Volks schwebt durch die Harmonien.
„Ich will weg von der Schublade ‚Südafrika‘“, bekennt Dana. „Meine Musik umspannt den ganzen Kontinent. Noch mehr: Ich möchte schwarze Kultur von überall auf der Welt präsentieren, aus Afrika und der Diaspora.“ Ihre Stimme ist dafür ein grandioses Werkzeug: Sie beginnt meist bedächtig, mit tiefem Timbre, lässt Raum für beschwörende Hintergrundchöre. Und dann schwingt sie sich umso wirkungsvoller mit schmerzlicher Inbrunst zu einer Vokal-Explosion auf.
Die Liedkunst von Simphiwe Dana hat oft eine politische Dimension, spricht von der Gewalt der Schwarzen untereinander, vom Verrat des ANC an seinem Volk. „Im Moment gibt es keine Partei, die uns zur Freiheit führen kann. Wir müssen alle zusammenstehen und diese Partei gründen. We are the people“, sagte sie mir 2010 in trotzigem Optimismus. Das noch immer so verletzliche Südafrika wurde selten so selbstbewusst eingefangen wie bei ihr.
Etwas verstimmtes Zauberer-Treffen
24. Januar
DaWangGang, VR China
„Four Ways“
(Huang Qiang Zou Ban – Wild Tune Stray Rhythm, JARO 2013)
Heute ist – nach unserem Kalender – einer der frühestmöglichen Termine für das chinesische Neujahrsfest. Obwohl China mit Riesenschritten die ökonomische Weltherrschaft übernimmt, kennen die meisten von uns chinesische Popmusik nur aus der Kitsch-Beschallung in Schnellimbissen. Die hat wenig zu tun mit der kreativen Szene im Reich der Mitte. Nicht erst in den letzten Jahren hat sich eine Sparte von Underground-artiger Musik herausgebildet, die die Traditionen in ungewöhnliches Licht setzen.
Song Yuzhe stammt aus dem Nordosten Chinas und war zunächst in der Pekinger Punkrock-Szene aktiv. Es schlossen sich Wanderjahre durch Tibet an, er ließ sich von Nomaden in ihre Musik einweisen, stellte ein improvisierendes Musikerkollektiv auf die Beine, musizierte mit Mitgliedern der Pekingoper. Mit einem derart reichen Erfahrungsschatz ausgestattet gründete er 2009 DaWangGang, ein freies Kollektiv mit Künstlern aus Peking, der Inneren Mongolei und einer indisch-französischen Sängerin namens Rani. Seine sperrigen und gleichzeitig ungeheuer spannenden Songs grenzen manchmal fast an ein Hörspiel. Wir haben es hier mit Vertretern aus der mutigen Generation von Folk-Avantgardisten zu tun, die den kulturellen Beschränkungen Chinas kleine Eskapaden abtrotzt.
Song Yuzhe und Band fassen ihre Klangtableaus unter dem Titel „Huang Quiang Zou Ban“ zusammen. Frei übersetzt bedeutet das „etwas verstimmte Musik“ – ein aus der Pekingoper entlehnter Begriff. Ein einziges Album haben DaWangGang bislang erst herausgebracht, aber das hat es in sich: Da werden wir beispielweise in „Four Ways“ Zeuge einer Begegnung von zwei Zauberern, mit beschwörender Baritonstimme, Obertongesang, wehmütigen Spießfiedeln und Schamanentrommel.
OK, sollten Sie es trotzdem lieber ein bisschen traditioneller haben wollen, blättern Sie gern einen Monat vor: Am 21. Februar ist der spätestmögliche Termin für das chinesische Neujahr.
Der leuchtende Soul von Edinburgh
25. Januar
Blue Rose Code, Schottland
„Over The Fields“
(The Water Of Leith, Navigator Records, 2017)
Heute begehen Schotten in aller Welt den Robert Burns Day. Sie ehren damit ihren größten Poeten (1759–1796), der mit einer unermesslichen Zahl an Gedichten und Volksliedern den Kanon schottischer Lyrik begründet hat. Man isst beim Burns Supper das berühmte – und bei Nicht-Schotten äußerst umstrittene – Haggis, frittierte Schafsinnereien. Und man trägt natürlich Burns-Verse vor, wirft in einem streng ritualisierten Ablauf neckische Trinksprüche in die Runde. Burns hat zu seiner Zeit Tonschöpfer wie Beethoven und Schumann begeistert, und bis heute lassen sich Musiker aus der Folkszene, aber auch darüber hinaus vom kultisch verehrten Nationaldichter inspirieren.
Ich habe mir die Frage gestellt, wie Robert Burns schreiben würde, wenn er noch unter uns weilte. Gibt es einen Musiker, der in ähnlicher Weise tiefempfundene Verse fürs 21. Jahrhundert dichtet? Melodien, in denen sich Landschaft und Innenleben spiegeln, aber von einer zeitgenössischen Warte aus? Ziemlich rasch war für mich klar: Ein solcher Burns der Moderne könnte Ross Wilson aus Edinburgh sein, der unter dem Pseudonym Blue Rose Code wirkt.
Wilson und seine Band fangen feine seismische Regungen zwischen Volkslied, akustischer Popballade und Jazz in einem seelenvollen Ton auf, in ihrem Gepäck sind Fiddle und Dudelsack, aber auch Blechbläser und Bebop. Das ist in Schottland ziemlich einzigartig. Dazu kommt eine Stimme, die nackt und verletzlich ist. Wilson hat auch nie einen Hehl um seine Erkrankung gemacht: Sehr offen geht er damit um, dass er unter Depressionen leidet.
In der fließenden Ballade „Over The Fields“ ehrt Ross Wilson den 2017 verstorbenen Kollegen John Wetton (Wetton war mal Leadsänger der Bombast-Rocker Asia), mit einem mild leuchtenden Arrangement aus Streichern, Akkordeon und Pedal Steel-Gitarre. Das kann man ganz ergriffen auf sich wirken lassen. Auch ohne Schafsinnereien im Bauch.
Graphic-Novel-Heldin
26. Januar
Sahra Halgan, Somaliland (*1972)
„Hiddo“
(Waa Dardaaran, Buda Musique 1991)
Es gibt Länder, die gibt es gar nicht. Somaliland ist so eines: Ein einziger Staat, Taiwan, hat es bislang offiziell anerkannt. Wie kommt das?
Somaliland war britisches Protektorat, vereinigte sich 1960 aber mit der englischen Ex-Kolonie Somalia. Neun Jahre später kam es in Somalia zum Putsch, eine sozialistische Diktatur wurde errichtet, 1977 griff man Äthiopien an, um die dortigen Minderheiten zu „befreien“. Der Vorstoß endete in einer Niederlage. Nun kam es in verschiedenen Landesteilen Somalias zum Aufbegehren gegen die Militärführung. In der aufständischen Region Somaliland eskalierte die Situation ab 1988 mit Bombardierungen der Guerillas. Am heutigen 26. Januar im Jahre 1991 brach nach dem Sturz des Diktators Barre das Staatsgefüge zusammen. Somaliland proklamierte seine Unabhängigkeit, begann einen friedlichen Wiederaufbau.
Dass man unter solchen politischen Umständen Musik machen kann, scheint unvorstellbar. Die Löwennatur Sahra Halgan ist das lebende Gegenbeispiel. Sie fing als Teenagerin an zu singen, obwohl das für Frauen als verpönt galt. 1988 wurde sie mit sechzehn Jahren als Krankenschwester an die Front abkommandiert. Nach dem Ende der Gewalt im Norden ging Halgan ins Exil nach Lyon. Sie schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch und konnte nach einiger Zeit als Musikerin Fuß fassen. 2015 kehrte sie nach einer gewissen politischen Stabilisierung nach Somaliland zurück und gründete ein Kulturzentrum in ihrer Heimatstadt. Ihre erschütternde Geschichte hat sie in Zusammenarbeit mit zwei Zeichnern als Graphic Novel veröffentlicht.
Unermüdlich setzt sich Sahra Halgan mit ihren Auftritten international für ein großes Ziel ein: Ihre Heimat Somaliland soll endlich anerkannt werden. Ihr Gesang, der unter den Spielarten in der ostafrikanischen Popmusik durch eine besonders charakterstarke Art des Vibratos herausragt, ist ein fantastisches Transportmittel dafür.
Musik am dunkelsten Ort
27. Januar
Esther Bejarano, Deutschland (1924–2021)
„Shtil, di Nakht is oysgesthernt“
(Lider fars Leben – Lieder für das Leben, Moriba 1995)
Am heutigen Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz können wir uns ins Gedächtnis rufen, was für eine Bedeutung die Musik an einem der dunkelsten Orte der Menschheitsgeschichte hatte. In Auschwitz-Birkenau gab es ein Mädchenorchester, geleitet wurde es von Alma Rosé, der Nichte Gustav Mahlers (18. Mai). Zwei der Orchestermitglieder waren die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch und die Akkordeonistin Esther Bejarano.
Man kann nicht einmal ansatzweise erfassen, was diese jungen Frauen Tag für Tag durchmachten. Wie spielt oder dirigiert man, wenn der Horizont die Gaskammer ist? Wenn das Publikum aus den eigenen Mördern besteht? Oder aus den Mitgefangenen, bei deren Hinrichtung man musizieren muss? Man spielt gegen den Tod an, man spielt ums Überleben, fürs Überleben. Es ist ein Wunder, dass die Laienmusikerinnen am Abgrund der Hölle die Kraft hatten, große klassische Werke von Puccini, Verdi oder Dvořák zu erarbeiten.
Alma Rosé hat Auschwitz-Birkenau nicht überlebt, sie fiel mutmaßlich einer Vergiftung zum Opfer. Anita Lasker-Wallfisch und Esther Bejarano überlebten, beide machten und machen (Lasker-Wallfisch lebt bei Druckschluss noch, Bejarano starb 2021 mit 96 Jahren) die Aufklärung der kommenden Generationen zu ihrer Aufgabe. Esther Bejarano hat über Gedenkveranstaltungen und Schulbesuche hinaus auch die Musik dafür zu Hilfe genommen. In ihren letzten Lebensjahren wurde sie mit der Microphone Mafia noch zur mutigen Rapperin, davor sang sie mit ihrer Tochter Edna Widerstandslieder.
Aus diesem Repertoire stammt auch „Shtil, die Nakht is oysgesthernt“, ein Text, der vom Kampf der jüdischen Partisanen in Litauen erzählt und den Hirsch Glik auf die Melodie eines russischen Volksliedes dichtete. Bejarano blieb bis zu ihrem Tod ungebrochen kämpferisch. Ihre Maxime: „Ich singe so lange, bis es keine Nazis mehr gibt!“ Sie hätte immer noch viel zu tun.
Metaphernreiche Zugfahrt
28. Januar
Dina El Wedidi, Ägypten (*1987)
„Alive“
(Slumber, Kirkelig Kulturverksted 2018)
Der 28. Januar ging als „Tag des Zorns“ in die ägyptische Revolution von 2011 ein. Junge Aktivisten belagerten den Tahrir-Platz in Kairo, um den Sturz des Autokraten Hosni Mubarak herbeizuführen. Wie wir heute feststellen müssen, ist nicht nur in Ägypten von den Errungenschaften des „Arabischen Frühlings“ wenig übrig geblieben. Immerhin: Etliche junge Musikerinnen und Musiker, die auf den Bühnen der Aufständischen sangen, haben nach der Revolution eine internationale Karriere gestartet – in ihrer Heimat dagegen kämpfen sie erneut gegen Zensur an.
„Lasst uns träumen“ hieß der Hit der Jugend, der damals auf dem Tahrir erklang, und mit am Mikrofon stand die Sängerin Dina El Wedidi. Sie ist ein leuchtendes Beispiel für die weibliche Seite des kulturellen Aufbruchs in den arabischen Ländern. El Wedidi hat traditionelle Stile Ägyptens zu einer neuen Folkmusik gebündelt, und sie kombiniert elektronische Popmusik und arabische Musikvokabeln. Das spiegelt sich auf ihrem Album Slumber aufregend wider.
Die 30-minütige Suite hat El Wedidi ausschließlich aus Geräuschen von ägyptischen Zügen und Bahnhöfen gebaut. „Ich war neugierig auf das Thema Sounddesign. Für mich war die Frage: Wie kann ich den Zug zu einem Instrument formen, wie die Melodien, Harmonien und Rhythmen finden?“ Sie sammelte Rattern, Tuten und Quietschen zwischen Kairo und Alexandria, im Schlafwagenzug nach Luxor, im Bummelzug nach Assuan.
Aus der Geräuschkollektion wuchs eine fantastische, techno-artige Eisenbahnsymphonie. Die auch eine Reflektion über die Spannungen ist, die frau in einem autoritären, instabilen Staat tagtäglich aushalten muss. Ihre Texte übers Gefangensein, über die Hassliebe zur Heimat, aber auch über Migräneattacken spiegeln das in Metaphern wider. „Ägypten ist ein großartiger Ort, um Ideen zu empfangen“, resümiert Dina El Wedidi. „Doch um durchzuatmen, muss ich von Zeit zu Zeit außer Landes gehen.“
Aus Iberiens Kühlschrank
29. Januar
Berrogüetto, Galicien
„Permafrost“
(10.0, Berrogüetto Musica 2006)
Minusgrade, hoher Schnee, dicke Eiszapfen, aufgesprungene Lippen, blaue Zehen: Ende Januar herrschte noch in meiner Kindheit manchmal Schockstarre in der Natur. Als Winterfan leide ich seelisch unter dem Fehlen der Kontemplation fördernden Kälte. Und daher serviere ich heute ein eisiges Instrumental. Es stammt aus der Nordwestecke Spaniens, die Gegend, die sicher zu den kältesten der iberischen Halbinsel zählt. Eine Region, die ähnlich wie eine andere Nordwestecke Europas, die Bretagne, das keltische Erbe hochhält.
Die Band Berrogüetto hat mich für die Musik Galiciens erstmals in den späten 1990ern begeistert. Ich kannte diese Klanglandschaften schon aus Irland, Schottland und der Bretagne, doch hier sind ins Keltentum einige andere Facetten eingewoben: der ganz besondere Dudelsack, die Gaita, die sich kräftiger anhört als die irischen Uilleann Pipes (16. Dezember), nicht ganz so keck wie die Northumbrian Pipes (2. Oktober), weniger kieksend als der bretonische Binioù Kozh und ganz und gar nicht militärisch wie die schottischen Highland Bagpipes. Dazu gibt es die markanten Gesänge der Frauen, die sich mit der eckigen Rahmentrommel Adufe begleiten. Die wird während des Spiels auch mal effektvoll in die Höhe geworfen.
Galiciens Folkmusiker von heute sind Meisterinnen und Meister darin, traditionelle Melodien neu und ganz dicht orchestral zu adaptieren. Berrogüettos „Permafrost“, eine Schöpfung des Gaita-Spielers Anxo Pinto, schleicht sich erst mit einer schönen, melancholischen Winternostalgie-Melodie an und baut dann eine immer massivere Klangwand auf. Das Stück lässt einen bibbernd an die Vergnügungen des Winters zurückdenken, aber gleichzeitig kann man die Tanzbeine auch nicht stillhalten. Und das garantiert, dass es einem dann auch schnell wieder warm wird.
Ein Manifest im Palletten-Dress
30. Januar
Gaye Su Akyol, Türkei (*1985)
„İstikrarlı Hayal Hakikattir“
(İstikrarlı Hayal Hakikattir, Glitterbeat 2018)
Es dürfte immer weniger Künstlerinnen und Künstler geben, die den Mut haben, sich unverblümt zu den politischen Zuständen in der Türkei zu äußern. Und während ich diese Zeilen schreibe, ist klar, dass es in den nächsten Jahren noch schwerer wird: Eine Mehrheit des türkischen Volkes hat sich vor kurzem seinen eigenen Diktator wieder neu gewählt. Viel Arbeit für Gaye Su Akyol also, die in der Istanbuler Popszene ein Enfant Terrible ist: Zwischen Feminismus, Hippie-Kultur und glamouröser Rock-Attitüde hat sie sich unerschrocken eine Nische geschaffen.
Als Begleittext zu ihrer CD İstikrarlı Hayal Hakikattir





























