
One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet (Epische Romantasy von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau) E-Book
Jennifer Benkau
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: One True Queen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Lang lebe die Königin? Mailins Schicksal ist besiegelt: Sie wurde zur Königin von Lyaskye gekrönt und damit ist ihr Leben verwirkt, sollte sie je wieder einen Fuß in ihr Königreich setzen. Allerdings ist genau das Mailins Ziel. Denn wie soll sie in ihr altes Leben zurückkehren, wenn ihr Herz bei Liam geblieben ist? Mailin muss zu ihm, koste es, was es wolle. Doch um nach Lyaskye zurückzukehren, braucht sie ausgerechnet Nathaniel, den Königskrieger und Weltenspringer, dem sie das Herz aus der Brust gerissen hat … Band 2 der High-Romantasy-Reihe von Jennifer Benkau. Herzzerreißend. Episch. Atemberaubend. Jennifer Benkaus Romantasy-Reihen "One True Queen", "Das Reich der Schatten" und "The Lost Crown" spielen in derselben Fantasy-Welt, können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Sie sind in dieser Reihenfolge erschienen: One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet New-Adult-Romance von Jennifer Benkau: A Reason To Stay (Liverpool-Reihe 1) A Reason To Hope (Liverpool-Reihe 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2020
Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
© 2020 Ravensburger Verlag GmbH
Copyright 2020 © Jennifer Benkau
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Lektorat: Gudrun Likar
Umschlaggestaltung und Vorsatzkarte: Carolin Liepins, München
Verwendetes Bildmaterial von © Andrekart Photography, © iiiphevgeniy, © Romola Tavani, © ollen, © Azamat Fisun, © Chinawooth Sakaew, © Aleshyn_Andrei, alle von Shutterstock
Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-47984-9
www.ravensburger.de
Nur dieses eine Leben. Was bedeutet schon ein einziges?
KAPITEL1
Es sind zu viele.
Sie sind überall, ihre Gesichter hinter Masken verborgen, ihre Herzen entschlossen und ihre Schwerter schnell und tödlich. Mein eigenes zittert in meinen Händen und jeder Hieb, den ich pariere, jagt mir einen sengenden Schmerz durch den Arm, die Schulter und den Oberkörper bis tief in meinen Kopf. Ich werde langsamer.
Kalte, nasse Wände um mich herum. Blut in den Pflasterfugen am Boden. Jeder Stein ist voll Gewissheit, dass es kein Herauskommen gibt. Kein Ausweg. Nicht für mich. Die Wände kommen näher.
Gesichtslos dringen meine Gegner auf mich ein, jeder sieht aus wie der andere. Königskrieger. Sie haben zu schnell erkannt, dass ich keiner von ihnen bin. Längst schlage ich blindlings um mich – vergessen sind die einstudierten Techniken. Panik hat die Kontrolle an sich gerissen. Ich höre mein eigenes Keuchen, meinen Herzschlag und wie das Blut in meinen Adern rauscht. Das Blut, das aus meinen Wunden strömt und meine Kleider tränkt. Es ist zu viel, um noch zu hoffen.
Alle Wunder sind verbraucht. Wünsche an die Sterne weit fort. Verdient habe ich mir keinen davon.
Alles klingt wie von weit her. Schreie wie unter Wasser.
Ich bin es, der unter Wasser gedrückt wird. Eine brutale Hand in meinem Haar und Blut im Mund.
Mit aller Kraft stoße ich die Luft aus, sauge neue in meine Lungen. Da ist kein Wasser. Die Angst schmeckt wie die Lyria.
Weiteratmen! Weiter. Atmen.
Etwas erwischt mich am Oberarm, der Gegner vor mir hebt seine Waffe. Blocke ich diesen Schlag nicht ab, spaltet er mir den Schädel.
Eine Hand packt mich von hinten, greift nach meinem rechten Arm. Mein Körper reagiert losgelöst von meinem Verstand. Ich beobachte mich selbst dabei, das Schwert in die Linke zu nehmen und schützend über meinen Kopf zu heben. Gleichzeitig stößt mein rechter Ellbogen zu und trifft gegen etwas, das zurückweicht. Ich kann den Schwerthieb von vorn zur Seite lenken. Hastig werfe ich mich herum, um den Gegner hinter mir …
KAPITEL2
»Mailin!«
Lucinda starrt mich an. Blut tropft aus ihrer Nase auf die hellen Dielen.
Das Schwert fällt mir aus der Hand. Ein Shinai aus Bambus – kein Bastardschwert wie gerade noch. Natürlich nicht. Ich bin im Dōjō, nicht im Palast. Warum blutet Lucinda? Was zum Teufel ist passiert? Habe ich … sie verletzt?
Ich blicke in erschrockene Gesichter. Selbst bei denen, die ihren Gesichtsschutz noch tragen, erkenne ich das Entsetzen, es strahlt durch ihre Masken wie Licht durch dünnen Stoff. Und alle richten dieses Licht auf mich.
»Ich … habe ich …? Oh Gott, es tut mir leid.« Was ist in mich gefahren?
Lucinda hebt ihre Hand, als ich mich abwenden und davonstürmen will. Niemand außer ihr hätte mich zurückhalten können. Aber sie ist meine Trainerin und es wäre eine weit größere Respektlosigkeit, ihre Anweisung zu missachten, als ihr die Nase einzuschlagen. Mit dem Handrücken wischt sie sich das Blut weg, aber es kommt sofort neues. Eine ältere Frau reicht ihr ein Handtuch, Lucinda bedankt sich und tupft sich das Gesicht ab.
Ich kann nicht fassen, was gerade passiert ist.
»Es tut mir leid«, flüstere ich. Die anderen beginnen zu murmeln. Ich bin dankbar über das Rauschen in meinen Ohren, weil ich dadurch nicht hören kann, was sie sagen.
Wie soll ich es erklären? Eben noch trainierten wir Angriffs- und Paradetechniken. Und plötzlich war ich nicht mehr hier. Ich war in Lyaskye.
Und ich war nicht einmal mehr ich selbst.
»Alles in Ordnung«, sagt Lucinda. Sie meint die anderen damit, nicht mich. »So was kann passieren. Machen wir für heute Schluss, geht euch umziehen.« Ihre Stimme klingt hohl, weil ihre Nase anschwillt und ich weiß, dass es keine Worte gibt, um mich zu entschuldigen. Sie hat recht, es kann passieren, dass man beim Kendō versehentlich einen Schlag abbekommt. Aber das war etwas anderes. Ich habe die Kontrolle verloren. Und so etwas darf nie, nie, niemals passieren, wenn man auf einem Stand ist wie ich und ein Schwert in den Händen hält.
Lucinda wirft mir einen vielsagenden Blick zu, wendet sich ab und ich folge ihr aus dem Dōjō über den Flur und bis in den kleinen Pausenraum für die Mitarbeiter, der sich gegenüber dem Büro befindet. Am Fenster, das einen Spaltbreit offen steht, bimmelt ein Windspiel leise vor sich hin.
»Setz dich«, weist sie mich an und verschwindet im Nebenraum, wo ich ein Bad vermute. Mit einem frischen angefeuchteten Handtuch kommt sie zurück und setzt sich zu mir auf das Sofa.
»Tut mir wirklich leid«, wiederhole ich, weil mir beim besten Willen nichts anderes einfällt. »Ich wollte das nicht.«
»Meine Nase hat schon Schlimmeres ausgehalten. Schau mal, es blutet nicht mehr.« Sie hebt das Handtuch kurz an und lächelt beruhigend. Es blutet sehr wohl noch. »Sag mir lieber, was passiert ist.«
Ich will sie nicht verärgern, indem ich sie anschweige, aber was soll ich antworten? Dass ich einen Albtraum hatte, wie so oft in letzter Zeit? Dummerweise bin ich dabei wach. Aber bisher waren es nur Fragmente, die sich wie kurze Flashbacks zwischen die Realität schieben. Diesmal war ich nicht mehr ich selbst, die Realität war zu einer anderen geworden. Es wird schlimmer. Deutlich schlimmer.
»Ich werde nicht mehr kommen«, sage ich. »Ich bin momentan nicht in der Lage, mich zu kontrollieren.«
Lucinda lässt das Handtuch sinken und die Augenbrauen in die Höhe wandern, als hätte ich einen schlechten Witz gemacht. »Du fühlst dich außer Kontrolle? Ausgerechnet du?«
Statt einer Antwort grinse ich nur bitter. Habe ich ihr womöglich so fest vor den Kopf geschlagen, dass sie es wieder vergessen hat?
»Du bist nicht aggressiv, Mailin. Glaub mir, ich kenne den Unterschied. Du hattest Angst. Das war eine Panikattacke, oder?«
Mein Schlucken verrät zumindest einen Teil der Wahrheit. Panikattacke trifft es schon ganz gut. Es war eine Erinnerung. Nur keine von meinen eigenen. Keine von denen, die ich haben dürfte.
»Mailin.« Lucinda legt mir die Hand aufs Knie. »Was du im letzten halben Jahr durchgemacht hast, würde jeden bis auf den Grund aufwühlen. So etwas steckt man nicht einfach weg, indem man stur so tut, als wäre nichts geschehen.«
Ich schüttle wortlos den Kopf.
»Hey, ich muss jetzt drei Tage mit einer Knolle im Gesicht herumlaufen. Die Kollegen werden mich auslachen. Ich sage es dir ungern, aber: Du schuldest mir eine Erklärung.«
Still betrachte ich das Windspiel am Fenster. Sie hat recht. Leider habe ich keine Erklärung. Ich kann ihr kaum von meiner womöglich bloß eingebildeten Verbindung zu jemandem erzählen, der in dieser Realität nicht existiert.
»Du hast dich verändert.« Ohne meine Trainerin anzusehen, bemerke ich, dass sie ernst geworden ist. »Hat es mit deinem Verschwinden damals zu tun? Ist da irgendetwas passiert?«
Sie fragt das nicht zum ersten Mal. Als Nathaniel und ich gemeinsam nach Lyaskye verschwanden – wir hatten behauptet, in London gewesen zu sein –, kursierten jede Menge Gerüchte und selbst Lucinda, die wenig auf Gossip und Gerede gibt, blieb davon nicht unbeeindruckt. Dass Nathaniel danach nie wieder ins Dōjō gekommen ist und wir uns seitdem weitestgehend aus dem Weg gehen, befeuerte ihre Vermutungen, dass zwischen uns etwas vorgefallen sein muss.
»Ich habe mich verliebt«, sage ich, denn soweit hat sie natürlich recht: Ich schulde ihr die Wahrheit.
»In Nathaniel.« Lucinda lehnt sich zurück und zieht die nackten Füße auf die Couch.
»Nein. In jemand anderen.«
Sie rutscht näher zu mir und legt ihren Arm um meine Schultern. »In wen?« In ihrer Frage klingt so viel mehr mit. Wer war es – was hat er getan – was ist mit euch geschehen?
»Er heißt Liam.« Noch immer jagt dieser Name eine Druckwelle durch meinen Körper, unter der ich mich am liebsten auf dem Boden zusammenrollen möchte, so weh tut das Vermissen. Doch wie nach jeder Explosion folgt auch diesem Schmerz ein Moment der Taubheit, dumpf und stumm, in dem ich mir ein Lächeln abringen kann.
»Magst du etwas über ihn erzählen?«, fragt Lucinda neugierig und meine Hoffnung, wenigstens ein bisschen mit ihr über ihn reden zu können, löst sich auf wie ein Traum im Moment des Erwachens. Sie wird mein Problem nicht verstehen, sie wird nur, ohne es zu wollen, in der Wunde bohren. »Oder hast du ein Foto?«
»Nein. Und auch sonst nichts. Wir können nicht zusammen sein, er lebt unendlich weit weg.«
»Skypen? Ihr telefoniert doch wenigstens, oder?«
Ich schüttle den Kopf. »Es geht nicht.«
Lucinda hält inne, obwohl das »Aber« schon sichtbar auf ihren Lippen liegt. Endlich scheint sie zu begreifen, dass ich größere Probleme habe als eine Fernbeziehung. »Er fühlt nicht, was du fühlst?«, fragt sie vorsichtig.
»Ach, ich habe ihm die Nase gebrochen und seitdem hasst er mich«, scherze ich lahm, aber wir grinsen beide nur bemüht. »Doch. Leider liebt er mich auch. Das hat er. Aber das Ganze ist über ein halbes Jahr her, womöglich hat er mich inzwischen vergessen.« Vermutlich wäre das das Beste für Liam und weniger als das wünsche ich mir nicht für ihn. Er soll glücklich sein, nicht einsam. Doch meine Intuition, mein Band zu ihm und die Verbindung zu Lyaskye, die ich bei jedem Atemzug fein prickelnd an der Stirn spüre – da, wo die Tiara Stellaris meine Haut berührte und Lyaskyes Magie in mich drang –, flüstern mir zu, dass er mich selbst dann nicht vergessen könnte, wenn er es wollte. Ich habe es verhindert und uns beide zu einem Leben in Sehnsucht verdammt. Und das Schlimmste daran ist: Ich genieße es. Ganz tief unter all der Sehnsucht, dem Vermissen und dem Schmerz ist diese Gewissheit, dass Liam und ich – was immer auch geschehen wird – zusammen sein werden, in diesem Leben oder im nächsten.
»Mailin?« Lucinda sieht mich besorgt an und ich bemerke, dass ich ins Leere starre.
»Entschuldige«, sage ich schnell. »All das ist überhaupt keine Erklärung.«
»Es ist ja auch nichts Schlimmes passiert«, versucht Lucinda mich zu beschwichtigen, doch sie verteidigt bloß die Mailin aus Irland. Das unsichere Mädchen, das ich war, bevor ich nach Lyaskye kam, wo ich zu etwas anderem wurde. Nun bin ich ein weit größeres Risiko, als sie je verstehen wird.
Ich stehe vom Sofa auf, und auch wenn meine Bewegungen sicher nicht darauf schließen lassen, fühle ich mich schwerfällig und müde. »Es war Glück, dass niemand außer dir verletzt wurde. Ich hatte mich nicht unter Kontrolle und kann nicht versprechen, dass es nicht wieder vorkommt.« Es wird wieder vorkommen. Es wird schlimmer. »Es ist besser, wenn ich eine Weile nicht mehr trainiere. Bevor ich …« Noch jemanden umbringe, ergänze ich in Gedanken, was ich nicht aussprechen kann.
Damals konnte ich es nicht. Ich habe Cassian entkommen lassen, weil ich diese eine Grenze nicht zu überschreiten bereit war. Ich konnte keinen Menschen töten, nicht mal den schlechtesten unter allen. Diese Unfähigkeit bereue ich seitdem jeden Tag, wenn Lyaskye mich zärtlich umgarnt und zu sich zu locken versucht.
Wenn ich ihrem Ruf nur folgen könnte! Ein zweites Mal würde ich Cassian nicht davonkommen lassen.
Lucinda versucht nicht, mich umzustimmen. Sie muss ahnen, dass ich recht habe, womöglich spürt sie langsam, dass ich mich auf eine Art verändert habe, die nicht zu erklären ist. Nicht in dieser Welt; nicht Jenseits der Zeit.
Lyaskye hat mich in etwas anderes verwandelt, ich kann es nicht länger verstecken. Ich bin zu einer Kämpferin geworden. Zu einer Lügnerin. Und trotz meiner Flucht nicht zuletzt irgendwie … zu einer Königin.
KAPITEL3
»Mailin. Hi.«
In Nathaniels Stimme klingt etwas Schweres mit, eine Art verkniffenes Seufzen, das sich hinter meinem Namen versteckt.
Zugegeben, es waren nie meine stolzesten Momente, in denen ich ihn angerufen habe, aber muss er mich so unbarmherzig daran erinnern? »Du klingst begeistert, von mir zu hören.«
»Ich frage mich, wo ich dich heute abholen soll. Und warum. Hast du wieder gekifft?«
»Ich habe nicht gekifft. Noch nie!« Es waren harmlose kleine Kuchen, extra schokoladige »Brownies with benefits«. Ravi und seine Schwester haben sie mir zum Achtzehnten gebacken. Ravi hat mich vorgewarnt, aber woher hätte ich wissen sollen, dass zwei kleine Stücke schon zu viel sind?
»Hast du wieder Probleme mit der Gravitation?«, fragt Nathaniel spöttisch.
»Es war die Erdkrümmung!« Sie hatte sich zu stark angefühlt, so als würde ich jeden Moment stürzen, einen Purzelbaum machen und von der Erde kullern. Für mich war es viel weniger witzig als für ihn.
»Und du hast die Kontinentalverschiebung gespürt, ich erinnere mich besser, als mir lieb ist.«
»Das war an einem anderen Tag und hatte mit Gin Tonic zu tun.«
»Ich habe deine Haare gehalten, als du überm Klo hingst, ich weiß exakt, womit es zu tun hatte.«
»Und ich werde dir auf ewig dankbar sein, auch ohne dass du ständig darauf herumreitest.«
Die Versuche, meine Sehnsucht und die Träume mit allem zu betäuben, was die Volljährigkeit erlaubt, habe ich schnell aufgegeben. Es hat ohnehin nichts geholfen, es ist meist nur schlimmer geworden. Aber tatsächlich habe ich mich nach diesen verzweifelten Peinlichkeiten kaum noch bei Nathaniel gemeldet. Vermutlich denkt er, ich wäre inzwischen im Drogensumpf versunken.
»Was gibt es diesmal?«, fragt er mich skeptisch und ich klemme mir das Smartphone zwischen Ohr und Schulter, während ich die Kinderzeichnungen auf meinem Schreibtisch vor mir zu einem flachen Stapel zusammenlege. »Du klingst überraschend wenig verzweifelt. So kenne ich dich gar nicht mehr.«
Ich darf ihm den Zynismus nicht übel nehmen und tue es trotzdem. Selten geht es einem von uns beiden besser, nachdem wir uns gesehen oder telefoniert haben. Unsere Erinnerungen schweißen uns zusammen. Nur mit ihm kann ich über meine Schwester sprechen, denn niemand sonst kannte sie so, wie sie wirklich war. Für alle anderen war sie seit Jahren nichts als ein Körper, der versorgt werden musste. Nathaniel und ich sind die Einzigen, die wissen, wie gern sie ritt, wie sehr sie das Theater und ihren riesigen Wintergarten voller Vögel genoss und wie hingebungsvoll sie ihr Königreich liebte. Mit ihm kann ich über Lyaskye sprechen, auch wenn ich ihm bis heute nicht alles gesagt habe. Bis heute weiß er nicht, dass sie nach wie vor in meinem Kopf ist mit all ihrer wunderschönen, entsetzlichen Macht. Doch ich habe die Befürchtung, dass es erst dann wirklich wahr wird, wenn ich es jemandem erzähle, darum schweige ich.
Und dann ist da noch Liam. Das Bedürfnis, über ihn zu reden, scheint mir manchmal das Herz in Stücke zu reißen, doch sobald ich seinen Namen ausspreche, verschließt sich Nathaniels Blick und wird steinern. Mit jeder Parkuhr hätte ich ein besseres Gespräch führen können, denn die würde wenigstens reagieren, sobald neues Geld eingeworfen werden muss.
»Ich habe etwas gefunden. Hör mir erst zu!«, sage ich und füge, bevor er genervt aufstöhnen kann, rasch hinzu: »Nein, hör mir nicht zu, das würde nichts bringen. Ich muss es dir zeigen. Kannst du herkommen?«
Ich höre, wie er die Luft ausstößt.
»Vielleicht am Wochenende?« Seit ein paar Monaten ist er wieder am Trinity College in Dublin. Es hat mich nur einen Moment lang irritiert zu hören, dass er vor ein paar Jahren ein Pharmaziestudium begonnen und es nach unserer Rückkehr wieder aufgenommen hat. Auf den ersten Blick passt Pharmazie nicht im Geringsten zu dem General und Krieger, den ich in Lyaskye kennengelernt habe. Auf den zweiten erkenne ich jedoch den Grund: Nathaniel studiert vermutlich, was er in seiner Heimat nicht lernen kann und was dort gebraucht wird. Er ist und bleibt ein Stratege. Und er glaubt ebenso sehr an eine Rückkehr wie ich.
Nun wirkt er allerdings genervt, was daran liegen könnte, dass meine bisherigen Fährten bloß Zeit und Energie gekostet haben, bevor sie uns ins Leere führten.
»Darf ich dich an die CD erinnern, Mailin?«
»Natürlich darfst du das«, erwidere ich zuckersüß. »Aber wenn du es tust, bist du halt ein Arsch.«
Die Geschichte muss er mir ständig aufs Brot schmieren. Kurz nach unserer Rückkehr habe ich die Sachen durchsucht, die mein Vater auf dem Speicher in Kisten zurückgelassen hat. Als ich dabei auf das Metallica-Album stieß, auf dem »Nothing Else Matters« drauf ist, dachte ich, endlich etwas gefunden zu haben. Denn diesen Song hat Liam in Lyaskye auf der Gitarre gespielt. Nun gut, es war nicht exakt dieselbe Melodie, aber viel zu nah dran, um es als zufällige Ähnlichkeit abzutun. Dass mein Vater diesen Song auf CD besaß, musste doch etwas zu bedeuten haben? Ich erinnere mich, dass er dieses Lied geliebt hat, als ich ein kleines Mädchen war – warum hat er die CD dann nicht mitgenommen, als er uns verlassen hat? Womöglich, weil er an einen Ort gegangen ist, wo er keine CDs abspielen kann?
Nathaniel hielt meine Theorie, mein Vater könnte wie er ein Weltenspringer sein, für absurd. Er wurde nicht müde, mich immer wieder daran zu erinnern, dass jeder Mensch im Alter meiner Eltern diese CD im Schrank stehen hat.
Ich war maßlos enttäuscht. Meine Idee schien mir so folgerichtig. Sie erklärte alles! Nicht zuletzt, warum mein Vater vor zwölf Jahren auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist und sich nie wieder gemeldet hat. Nathaniel meinte allerdings, ich würde mich in eine Fantasie hineinsteigern, weil ich nicht damit umgehen kann, so viele wichtige Menschen verloren zu haben. Wir stritten uns fürchterlich und reduzierten unseren Kontakt danach auf ein Minimum.
»Was hast du diesmal?«, fragt er mich nun misstrauisch. »Ich sehe es mir an, wenn es nicht wieder alter Kram von deinem Vater ist.«
»Sagen wir so: Es lag bei seinen Sachen.«
Nathaniel seufzt. »Mailin.«
»Aber es gehört mir, nicht ihm. Komm es dir ansehen!«
Er zögert einen Moment, doch dann sagt er: »In Ordnung. Ich wollte ohnehin noch mal nach Killarney kommen.« In der Pause, die darauf folgt, spüre ich, dass nun etwas Bedeutsames kommt. »Ich gehe bald nach New York. Die Trinity und die Columbia bieten einen Doppelabschluss, ich wäre ein Idiot, würde ich das nicht wahrnehmen.«
»Großartig«, sage ich, vermutlich hört er, wie trocken mein Mund ist. New York.
Er wird also auch gehen. Und ich kann nicht mal wütend sein, von allen verlassen zu werden, denn ich selbst möchte am liebsten die Welt verlassen, weil ich nun in eine andere gehöre.
Nathaniel will am Samstag kommen und ich schaffe es nur deshalb, die zwei Tage auf ihn zu warten, weil ich unter der Woche nicht selbst nach Dublin fahren kann. Wenn ich allein fahren dürfte, würde ich sofort lossausen. Aber mit meinem Job neben der Schule – Regale auffüllen bei Tesco – kann ich mir nur eine Fahrstunde in der Woche leisten und vermutlich wird Mums alter Ford durchgerostet sein, bis ich endlich den Führerschein habe. Normalerweise würde ich Ravi fragen, aber der musste ja sofort nach der bestandenen Fahrprüfung in eine Radarkontrolle rasen und fährt nun wieder Rad.
Die Tage ziehen sich endlos und immer wieder ertappe ich mich dabei, die Bilder aus der Mappe zu ziehen und auf versteckte Hinweise zu untersuchen. Ich werde immer aufgekratzter, sodass Mum mich mit einer Mischung aus Neugierde und Sorge mustert und wissen möchte, ob ich auf ein Date hinfiebere. Überbordende Erleichterung zeichnet sich auf ihrem Gesicht ab: Ich verhalte mich nach all der langen Zeit endlich wieder wie jedes achtzehnjährige Mädchen. Man könnte mich beinah für normal halten.
Ich muss den Gedanken verdrängen, dass alles, was mich heiter und hibbelig macht, damit zu tun hat, einen Weg nach Lyaskye zu finden. Weg von Mum. Und dann wird mir wieder bewusst, dass ich allem Sehnen standhalten muss, auch wenn mir bewusst ist, welchen Preis mich das auf Dauer kosten wird.
Mum hat alles verloren – alles außer mir. Ihre Eltern sind früh gestorben, mein Dad hat sie verlassen und Vicky … am Ende auch. Wie kann ich nur daran denken, sie allein zu lassen? Ich reibe mir über die Stirn, kratze über die Haut, wo ich die Tiara Stellaris immerzu spüre, bis das kühle Prickeln für einen Moment verschwindet.
Es wird zurückkommen.
KAPITEL4
»Und?« Ich hebe eine Augenbraue. »Was siehst du?«
Nathaniel schaut von der Kinderzeichnung auf, die ich ihm in die Hand gedrückt habe, kaum dass er mein Zimmer betreten hat. Mum ist bei einer Freundin, ansonsten hätte er sich kaum hergewagt. Seit wir gemeinsam verschwunden waren, macht sie ihn für alles Unheil der Welt verantwortlich.
»Ein depressives Osterei?«
Ich reiße ihm das Bild aus der Hand. »Willst du mich verarschen? Das ist eindeutig ein Cercerys! Es ist nicht ganz rund, sondern oval, okay. Aber wie alt mag ich gewesen sein, als ich das gemalt habe? Drei oder vier? Warum hätte ich ein dunkelblaues Osterei mit hellblauen Sternen malen sollen, die eine Art W formen – zufällig das Sternbild der Kassiopeia?«
»Ja, warum? Kannst du dich nicht erinnern?«
Ich schnaube. »Hätte die Erzieherin meinen Namen nicht draufgeschrieben, wüsste ich nicht mal, dass es von mir ist. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, was du mit vier gemalt hast?« Ich lasse ihm keine Zeit, mir zu antworten. »Vergiss es. Vermutlich hast du mit vier wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben, wenn dich etwas beschäftigt hat. Aber mich hat das da beschäftigt.« Ich wedle mit der Zeichnung. »Was bedeutet, dass ich es schon mal irgendwo gesehen haben muss.«
Nathaniel lässt sich auf mein Bett sinken und stützt die Ellbogen auf die Oberschenkel. Mein Bild überzeugt ihn nicht, aber er hat auch noch nicht alles gesehen.
Ich reiche ihm das Blatt zurück. »Falte es an den geknickten Stellen nach innen.«
Er tut, was ich sage, und legt die äußeren beiden Viertel des Blattes nach vorn. Und obwohl er seine Miene im Griff hat und nichts seine Bestürzung verrät, spüre ich sie wie eine Schockwelle von ihm abströmen.
Das mehr oder weniger runde blaue Gebilde im Inneren könnte Zufall sein. Doch der gelbe Kreis außen, in dessen Mitte eine Art Rune prangt – ein H mit zwei Querstrichen statt einem –, lässt keinen Zweifel offen.
»Was das Zeichnen betrifft, war ich offenbar schon immer talentfrei. Aber ich habe unverkennbar ein Cercerys mit einem Clansymbol darauf gebastelt.«
»Es sieht wirklich danach aus.« Es wundert mich beinah, dass er nicht versucht, mir wieder andere Erklärungen aufzutischen. »Hast du mal bei deiner Mutter nachgehakt? Vielleicht weiß sie doch mehr, als sie sagt.«
Ich seufze. »Das wäre zu schön. Aber sie weiß wirklich nichts. Sie hat mir allerdings eine Adresse in Dublin genannt. Die letzte, unter der mein Vater gemeldet war.«
»Sieh mal an. Und ich dachte, es gäbe keine.«
»Dachte ich auch, aber ich habe keine Ruhe gegeben.« Nervös gehe ich im Raum auf und ab. Mum hat mich unter Tränen gebeten, nicht nach ihm zu suchen, weil er mich doch wieder verletzen wird. Es hat wehgetan, sie so zu sehen. Und doch habe ich darauf bestanden und ihr angedroht, allein zu suchen, wenn sie mir nicht hilft. »Es gibt keinen Telefonanschluss mehr und meine Mutter meint, die Post wäre schon vor Jahren zurückgekommen. Er wird also mit Sicherheit nicht mehr dort wohnen. Aber vielleicht wissen die Nachbarn, wo er hingezogen ist. Womöglich hat er etwas zurückgelassen.«
»Womöglich.« Das angedeutete Lächeln auf seinem schönen Gesicht ist traurig. Er greift nach meiner Hand, als ich an ihm vorbeitigere, und hält mich sanft fest. »Womöglich jagst du etwas hinterher, das nicht existiert. Nicht in dieser Welt. Nehmen wir mal an, dein Vater wäre ein Weltenspringer …«
»Dann hältst du es für möglich?«
Er mustert erst die Zeichnung und dann mich intensiv. »Schon«, sagt er dann und mein Herz klopft heftiger. »Ich habe mich immer gefragt, wie du dich bei unserem ersten Sprung von mir losreißen konntest. Vielleicht war es …«
»… weil ich auch … Clanerbe in mir trage?«
Nathaniel hebt die Schultern. »Aber selbst wenn, überleg mal. Dein Vater ist seit Jahren spurlos verschwunden. Falls er ein Weltenspringer ist – und Mailin, ich meine dieses sehr, sehr unwahrscheinliche ›falls‹ –, dann ist er nicht mehr hier.«
Ich verstehe. Wenn er nach Lyaskye gegangen ist, dann muss er sein Cercerys zwangsweise mitgenommen haben. Und damit auch jede Chance, ihm zu folgen.
Nathaniel streicht mit dem Daumen über meinen Handrücken und erst diese kleine Geste erinnert mich daran, dass er mich immer noch festhält. »Mailin, ich weiß, dass ich das schon oft gesagt habe, aber …«
»Oft genug!« Ich will mich losreißen, aber seine eben noch weiche Berührung wird plötzlich fest. »Ich habe es doch versucht, oder nicht? Seit Monaten reiße ich mich zusammen, quetsche mich in dieses Leben hier wie in eine viel zu enge Jeans, die mir ins Fleisch schneidet, Bauchschmerzen bereitet und mich kaum atmen lässt. Ich habe versucht zu akzeptieren, dass ich nicht zurückkann, habe mir wochenlang eingeredet, ich müsse nur dran glauben, dass ich auch hier leben kann. Aber es geht einfach nicht!« Noch einmal zerre ich an meiner Hand und diesmal lässt Nathaniel mich los. »Ich kann so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich spüre, wie dieses Schauspiel mich immer schwächer und müder macht. Ich werde daran zugrunde gehen. Und ja, mir ist klar, dass ich selbst schuld bin, aber das ändert nichts.«
Nathaniel schüttelt den Kopf. »Ich glaube immer noch nicht, dass du wirklich einen Zauber gewirkt hast. Du glaubst es bloß, daher spürst du die Wirkung.«
Ich presse kurz die Lippen zusammen. Dass er diese Art von Magie nicht verstehen kann, heißt nicht, dass sie nicht da ist. Ob es nun an einem gewirkten Bann liegt oder an etwas anderem: Zwischen Liam und mir besteht eine Verbindung. »Ich träume Dinge, die er erlebt hat«, sage ich. »Ich träume Liams Albträume.«
Er hält meinem Blick stand. »Das kannst du nicht wissen.«
»Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was ich kann oder nicht!«
»Ich glaube dir, dass du von ihm träumst. Wie könntest du nicht von ihm träumen? Du liebst ihn.« Klingt da eine Spur Bitterkeit in seiner Stimme mit? Immer noch? »Du sehnst dich nach ihm. Diese Träume sind Inszenierungen deines Unterbewusstseins.«
»Natürlich. Ich sehne mich ganz fürchterlich danach, durch Liams Augen zu sehen, während er den absoluten Horror durchleben muss.« Und wieder jagt mir, als ich seinen Namen ausspreche, dieser heftige Schmerz durch den Körper und gleich danach das Gefühl, gar nichts mehr zu spüren.
»Du hast Angst um ihn«, sagt Nathaniel sanft. »Aber was immer auch passiert, Mailin: Sullivan kann auf sich aufpassen. Ohne dich vermutlich besser als mit dir.«
Da mag er sogar recht haben. Liam hatte sich allein für mich in die Hand seiner schlimmsten Feinde begeben, mit nichts anderem bewaffnet als mit Mut und Hoffnung. Doch ich habe das Gefühl – nein, die sichere Gewissheit –, dass ihm beides entgleiten wird, wenn ich nicht zurückgehe.
»Diese Träume könnte er dir eingebrockt haben«, sagt Nathaniel schließlich ausdruckslos. »Die Traumwebermagie ist … eigen. Und sehr mächtig.« Er klingt, als hätte er seine eigenen Erfahrungen damit gemacht.
»Weißt du, was ich zu meiner Mutter gesagt habe, als es um die Adresse meines Vaters ging?«, frage ich leise. »Ich sagte: ›Ich schaffe es mit deiner Hilfe oder ohne.‹ Und das gilt auch für dich. Ich muss es versuchen, ich kann nicht anders. Liam ist nur wegen mir in dieser Lage.«
Er erhebt sich, die Bewegung wirkt seiner muskulösen, schlanken Gestalt zum Trotz schwerfällig. »Dann wäre alles umsonst gewesen. Sullivans Opfer ebenso wie meines. Wir hätten dich umsonst gerettet.«
Unvermittelt braut sich eine gewaltige Wut in mir zusammen. Die feine Linie auf meiner Stirn brennt eisig kalt. »Es ging dabei aber nie um mich«, presse ich hervor.
Er legt mir die Hände auf die Oberarme, eine sanfte Berührung, von der ich gut genug weiß, wie fest sie werden kann, sodass ich stillhalte, obwohl ich nicht von ihm festgehalten werden will.
»Mir schon.«
»Und doch wirst du mir helfen, oder?«
»Ich will das nicht.«
Was nicht direkt ein Widerspruch ist. »Du willst doch auch nach Hause!« Denn genau das ist Lyaskye, was auch immer uns dort erwartet. Unser Zuhause. Seines war es schon immer. Und vielleicht auch meines.
»Was ich will«, sagt er leise, »spielt keine Rolle.«
Es tut mir leid, diese Karte zu spielen, aber er lässt mir keine Wahl. »Es spielt aber eine Rolle, was ich will, General Bagehot. Denn meine Schwester ist tot. Ich bin deine Königin.«
KAPITEL5
In den letzten Tagen hat es unentwegt geregnet, sodass das Wasser zentimeterhoch auf den Straßen steht und Nathaniel nur langsam durch das wie versunken daliegende Killarney fahren kann. Nun allerdings verziehen sich die Wolken und ein klar gewaschener blauer Winterhimmel spannt sich über die Stadt. Das Kirchturmdach schimmert kupfern im Licht der Mittagssonne und wir sehen beide zu lange hin; wissend, was der jeweils andere denkt. Vicky liegt hinter dieser Kirche auf dem Friedhof begraben. Nathaniel war bei der Beerdigung, still und unauffällig hielt er sich im Hintergrund, um meine Mutter nicht aufzuregen.
»Kommst du klar?«, fragt er mich, als wir durch den Schatten fahren, den der Kirchturm quer über die Straße wirft.
Ich spare mir ein »Natürlich« oder »Es geht schon«. Wir haben uns mehr als genug für ein ganzes Leben angelogen. »Es sind die kleinen Dinge, die so fürchterlich wehtun«, sage ich, den Blick nach draußen gerichtet, wo alles irgendwie verweint aussieht. »Mein Geburtstag war in Ordnung, Weihnachten auch. Silvester war sogar recht schön. Ich konnte mich darauf vorbereiten, ohne Vicky zu sein. Auf die Kleinigkeiten kann man sich nicht vorbereiten. Ein Geruch, der vorbeifliegt, mich an sie erinnert und wieder verschwindet. Eine Erinnerung, die mich glücklich macht – und dann bricht wieder die Realität über mich herein und zerstört alles. Oder ein Lied, das ich höre und bei dem in mir sofort der Wunsch aufkommt, es ihr vorzuspielen. Bis mir dann einen Sekundenbruchteil später einfällt, dass sie nicht mehr da ist. Man weiß nie, wann wieder so ein Moment kommt, nur, dass sie ständig kommen. Es ist, als würde man sich an Papier schneiden. Man rechnet nicht damit und nur deshalb tut es so weh.«
Der Motor brummt, trotzdem höre ich Nathaniel tiefer atmen. »Es tut mir unglaublich leid, dass wir sie nicht retten konnten.«
»Ich weiß. Hast du dich je gefragt, warum wir es nicht geschafft haben?«
Sein Blick bleibt auf der Straße, aber sein Fokus richtet sich dennoch spürbar stärker auf mich. »Was meinst du damit?«
»Wir dachten, wir wären zu spät gewesen, um Vicky zu retten. Aber was, wenn Zeit keinen Unterschied macht?«
»Sag, worauf du hinauswillst.« Ich bin mir sicher, dass er das längst begriffen hat. Aber es beunruhigt ihn. Vermutlich hofft er, mich falsch zu verstehen. Er sieht mich jetzt an, behält die Fernstraße vor uns nur aus dem Augenwinkel im Blick.
»Ich spüre Lyaskye noch immer in mir, Nathaniel. Sie ist ein Teil von mir und ich merke, dass sie etwas mit mir macht.« Ich sehe es in den Augen anderer Menschen. Ihr Blick bleibt stets einen Moment zu lange auf mir haften. Ihre Pupillen weiten sich. Oft öffnen sie leicht den Mund. Ich weiß, was sie in mir sehen: Genau das, was ich damals an Vicky wahrgenommen habe. Ihr Strahlen. Das Strahlen, an dem sie letzten Endes verglüht ist.
Ich halte Nathaniels Blick. »Was lässt uns so fest glauben, dass ich den Teil von Lyaskye, der Vicky umgebracht hat, nicht mitgenommen habe?«
Er sieht nach vorn auf die Straße und zieht die Zähne über die Unterlippe. Eine ratlose Geste, ein bisschen Ehrlichkeit. Wir müssen uns nichts mehr vormachen, schon eine ganze Weile nicht mehr. »Hoffnung«, flüstert er. »Ich hatte gedacht, sie wäre etwas wert, diese Hoffnung.«
Ohne darüber nachzudenken, greife ich nach seiner Hand, die am Lenkrad liegt, verschränke meine Finger mit seinen. »Das ist sie. Und wir werden sie brauchen. Aber Hoffnung allein reicht nicht, fürchte ich.«
Ich hatte ihm meinen Verdacht gar nicht verraten wollen, um ihn nicht unter Druck zu setzen. Aber meine anderen beiden Gründe, nach Lyaskye zurückzukehren, kann er nicht nachvollziehen. Meine Liebe zu Liam bedeutet ihm weniger als nichts. Er hasst Liam, jetzt, da er ihm nach unserer Flucht und Liams Opfern widerwillig Respekt zollen muss, vielleicht noch mehr als zuvor. Und die Sehnsucht nach Lyaskye mag er ebenso empfinden wie ich – größer ist jedoch sein Wille, stärker als diese Sehnsucht zu sein.
Meinem dritten Grund hat Nathaniel nichts entgegenzusetzen. Es mag fraglich sein, ob wir mein Leben in Lyaskye retten können. Viel wahrscheinlicher werde ich beim Versuch draufgehen. Aber hier, Jenseits der Zeit, können wir überhaupt nichts tun, außer abzuwarten, wie ich in Lyaskyes Strahlen blasser und durchscheinender werde und mich irgendwann auflöse, genau wie Vicky.
Ich merke zu spät, dass meine Hand die seine immer noch hält. Er sieht aufmerksam auf die Straße und ist doch mit seinen Gedanken allein bei mir. Es ist nicht fair, die Distanz zwischen uns zu verringern. Er hält sie so hartnäckig, weil ihm Nähe wehtut.
Manchmal erwische ich mich dabei, wie mir der Hauch eines Wunsches sanft durch die Gedanken bläst: der Wunsch, Liam vergessen zu können oder ihn nie getroffen zu haben. Dann wäre alles so einfach. Ich würde mich sofort in Nathaniel verlieben, daran bestünde nicht der geringste Zweifel. Er ist ehrlich, treu und mutig, und sein Wort hat Bestand, selbst wenn die Welt in Trümmern liegt. Ich würde ihn aus tiefster Seele lieben, denn man kann kaum anders, als ihn zu lieben. Es sei denn, das Herz quillt bereits über von Gefühlen für einen anderen, egal wie weit er fort ist, egal wie unerreichbar. Vielleicht ist mein Herz ja in Wahrheit nicht mehr bei mir, sondern genauso fern, wie Liam es ist?
Das Navi führt uns nach einer zweistündigen Fahrt in einen Vorort am nordwestlichen Rand von Dublin. Langsam fahren wir zwischen braven Mehrfamilienhäusern hindurch, die sich nur in der Farbe ihrer Haustüren voneinander unterscheiden. Auf einer matschigen Wiese kicken sich Jugendliche einen Ball zu und eine Katze kreuzt die Straße so gemächlich, dass Nathaniel bremsen muss. Mir kommt der entsetzliche Gedanke, dass mein Vater in einem dieser Häuser lebt. Was, wenn seine neue Frau die Tür öffnet und Kinder neugierig an ihr vorbeischmulen? Seine Kinder … Was, wenn sein ganzes Geheimnis darin besteht, uns gegen eine neue Familie ersetzt zu haben?
Die ganze Fahrt über hat mich das lange Sitzen nicht gestört, aber nun rutsche ich unbehaglich im Sitz hin und her. Der Wagen beginnt zu rumpeln, weil der Asphalt holprig wird, als wir ein Stück durch den Wald fahren. Schließlich tauchen wieder Häuser auf. Alte Häuser. Hier ist keine Tür mehr bunt gestrichen und die Gehwege verschwinden unter Unkraut. Wir fahren weiter, bis das Navi verkündet, dass wir unser Ziel erreicht haben. Ich muss schlucken, denn hier, wo das Ende der geteerten Straße in einen Feldweg ausläuft, der aus den Abdrücken breiter Traktorreifen zu bestehen scheint, steht nur ein einziges Haus. Die Fenster sind mit Brettern zugenagelt und die Haustür hängt schief in den Angeln. Im Dach fehlen Schindeln, die zerbrochen und mit Moos bewachsen neben dem Gemäuer liegen. Das Haus meines Vaters steht leer. Und zwar seit Jahren.
»Was hast du erwartet?« Die Enttäuschung in Nathaniels Stimme verrät ihn. Er hatte ebenso wie ich die Hoffnung, hier etwas zu finden. Im Gegensatz zu ihm bin ich nicht bereit, sie so schnell aufzugeben. Ich atme kurz durch und steige aus dem Wagen. Hier am Rande der Stadt ist es milder als bei uns an der Westküste, zumindest solange die Ostwinde ruhen. Etwas Eigenartiges liegt in der Luft, ich spüre es vom Haus ausströmen wie einen Geruch, der längst hätte verfliegen müssen. Unbehagen steigt in mir hoch und löst in mir den Drang aus, ins Auto zu steigen und zurück nach Hause zu fahren. Stattdessen gehe ich dem Gefühl entgegen. Direkt auf das Haus zu und damit auf den Ort, der mich deutlich von sich wegtreibt.
Jemand hat die Türen verrammelt, damit niemand eindringt. Oder … damit nichts hinausgelangt.
»Hallo?« Eine krächzende Frauenstimme lässt mich herumfahren. Auf der anderen Straßenseite steht tief über ihren Stock gebückt eine kleine alte Frau mit grauem Haar neben einem Weidenkorb. Wo kommt sie so plötzlich her? Kurz blicke ich zu Nathaniel, der noch am Auto wartet und die Frau offenbar ebenfalls nicht hat kommen sehen. Er schlägt die Tür zu und geht ihr ein paar Schritte entgegen.
»Kann man euch helfen?«, fragt die Alte. Was sie wirklich wissen will, schwingt in ihren Worten unverkennbar mit: Wer seid ihr und was wollt ihr hier?
»Das kann gut sein.« Nathaniel lächelt, was ihn in den Augen vieler nur geringfügig harmloser erscheinen lässt. Um ihn unter »seriös« abzuspeichern, ist er für die meisten eindeutig zu schwarz.
Auch die Frau verzieht ihr runzliges Gesicht skeptisch. »Wir kaufen hier nix. Wir haben alles, wir wollen nix. Und wir geben auch nix, damit ihr’s gleich wisst.«
»Wohnen Sie in der Nähe?«, fragt Nathaniel.
Missmutig weist sie hinter sich, wo ich nichts anderes als wuchernde Hecken erkenne, hinter denen vom Winter kahl gefressene Bäume aufragen wie Knochenhände, die sich in den Himmel strecken. Meine Vorstellung präsentiert mir das Bild eines Hexenhäuschens hinter einem Labyrinth aus Dornen.
Ich trete neben Nathaniel. »Wir sind auf der Suche nach einem Mann, der hier gelebt hat.«
»Da wohnt lang keiner mehr«, erwidert die Frau.
»Es könnte eine Weile her sein.« Verdammt, warum habe ich kein Foto von meinem Vater mitgenommen?
»Der alte Walsh«, knurrt sie zu meiner Überraschung und prompt schlägt mein Herz schneller. »Der war der Letzte, der hier gelebt hat. Der alte Walsh und seine Whiskeyflaschen.«
»Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen?«, fragt Nathaniel.
Die Frau stößt einen grüblerischen kleinen Laut aus, dann hellt sich ihre Miene auf. »Na, als sie ihn rausgetragen haben, als er es endlich geschafft hat, sich totzusaufen.«
So viele Jahre habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Lange Zeit habe ich mir eingeredet, er wäre mir egal. Genauso egal, wie ich ihm offenbar bin. Doch zu hören, dass er tot sein soll, zieht mir fast den Boden unter den Füßen weg. »Wann?«
»Pff«, macht die Alte, als wolle sie ausspucken. »Zwanzig Jahre ist das her, wenn nicht länger. Zweiundzwanzig?«
Vor Erleichterung wird mir schwummrig. Ich greife nach Nathaniels Schulter und er legt mir den Arm um die Hüfte. Sie redet nicht von meinem Vater. Sie meint meinen Großvater. Dad hat den Kontakt vor langer Zeit eingestellt, gleich nach dem Tod seiner Mutter, die – wie er mir erzählt hat – allein dafür gesorgt hatte, dass er zu einem fühlenden Wesen herangewachsen ist. Damals hatte ich das nicht verstanden und meinen Fragen war er immer ausgewichen.
»Und später war niemand hier?«, hakt Nathaniel nach. »Das Haus sieht verlassen aus, aber nicht so verfallen, als hätte hier seit über zwanzig Jahren niemand mehr etwas daran gemacht.«
»Der alte Mister Walsh«, sage ich, »hatte doch einen Sohn. Erinnern Sie sich an den?«
»Den kleinen Lausbub, ja sicher. Wir nannten ihn Mackie, mein Mann – Gott hab ihn selig – und ich.«
»Macaire«, flüstere ich. Mein Vater heißt Macaire.
Die Alte brummelt mit in sich gekehrtem Blick, offenbar tief in ihren Erinnerungen versunken. »Richtig. Verließ sein Elternhaus früh, weil er die Welt sehen wollte.«
Mein Blick trifft den von Nathaniel. Vielleicht nicht nur diese Welt …
Schließlich zuckt die Frau mit den Schultern. »Den hab ich viele Jahre nicht mehr gesehen. Was wollt ihr von dem?«
»Wir müssen ihm etwas Wichtiges sagen«, beginnt Nathaniel unverbindlich, während mir herausplatzt: »Er ist mein Vater. Ich heiße Mailin Walsh.«
Einmal mehr kneift sie die Augen zusammen und mustert mich, nickt wortlos, als würde sie mein Bild mit dem des Kindes in ihrer Erinnerung vergleichen und die Ähnlichkeiten erkennen. Sie lächelt bekümmert. »Dann ist er also wirklich so ein Mann geworden, der sich ständig aus dem Staub macht. Ich habe das immer geahnt. Tut mir wirklich leid, Mädchen. Aber hier ist er nicht.«
»Wir werden uns trotzdem kurz umsehen«, sagt Nathaniel. »Möglicherweise hat er etwas hinterlassen.«
»Oh nein, nein.« Mit einem Mal scheint die Frau um mehrere Zentimeter zu wachsen. »Da geht ihr nicht rein! Niemand tut das. Das Haus wurde verbarrikadiert.«
»Wir würden nur ganz kurz …«, versuche ich es, aber sie unterbricht mich, indem sie mir einen knorrigen Finger unter die Nase hält, als wolle sie damit meinen Mund schließen.
»Das verstehst du nicht, Kleines. Ihr jungen Dinger glaubt, ihr wüsstet alles. Aber nichts wisst ihr, gar nichts. In dem Haus dort, da wohnt der Grogoch!«
Ich verkneife mir mit Mühe ein Augenrollen. Eine Elfengläubige, natürlich. Seit ich Dinge erlebt habe, die andere für bloße Fantasie halten, glaube ich an viel mehr, als ich mir je zu träumen gewagt hätte. Aber für jeden angeblichen Beweis von Elfen, Kobolden und Geistern habe ich bisher noch eine sehr weltliche Erklärung finden können.
»Der Grogoch wird uns nichts tun«, sagt Nathaniel mit rührender Ernsthaftigkeit, um die alte Frau nicht zu beleidigen. »Und wir ihm erst recht nicht.«
Doch mir ist klar, dass jede Diskussion Zeitverschwendung sein wird. Der Korb zu den Füßen der Frau ergibt jetzt Sinn: Sie bringt dem scheußlichsten aller irischen Kobolde Essen, damit er nicht zu ihrem Haus hinüberkommt und sich dort holt, was er haben will. Vermutlich ist der Glaube einer alten Nachbarin der einzige Grund, warum das Haus noch nicht abgerissen und das Grundstück neu bebaut wurde. Die Alte wird eher die Garda rufen und uns Hausfriedensbruch vorwerfen, bevor sie zulässt, dass wir das Wesen aufscheuchen und es sich nachher in ihrem Keller einen Unterschlupf sucht.
»Haben Sie vielen Dank für Ihre Auskunft.« Am Arm ziehe ich Nathaniel mit mir zum Auto.
»Viel Glück bei der Suche nach deinem Vater, Mädchen!«, ruft sie mir nach.
»Dein Ernst?«, fragt Nathaniel, während wir einsteigen. »Wir kuschen vor einer Sagengestalt? Die Frau füttert da nichts weiter als Ratten, das ist dir doch klar, oder?«
»Wir fahren trotzdem«, erwidere ich und schnalle mich an. »Und wenn es dunkel ist und alte Damen schlafen, kommen wir zurück.«
KAPITEL6
Bei Dunkelheit fällt die Vorstellung, dass sich Feen und Geister in dem alten Haus verstecken, sehr leicht.
Wir haben den Wagen in einiger Entfernung geparkt und bewegen uns fast lautlos. Sicher liegt die alte Frau nicht auf der Lauer, um uns dabei zu erwischen, wie wir ihren Grogoch ärgern, aber wir wollen trotzdem nicht ertappt werden. Da der Mond von Wolken verdeckt wird, erkennen wir ihren Korb am Fuß der drei Eingangsstufen erst, als wir beinah darüberstolpern. Nathaniel lässt seinen Handybildschirm kurz aufleuchten. Der Korb ist vollkommen leer.
»Sehr fleißige Ratten.« Und wieder spüre ich dieses Unbehagen, das aus dem Haus zu strömen scheint und mich warnt: Verschwinde!
Es verrät mir, dass wir hier richtig sind.
Nathaniel prüft die Bretter, mit denen die Tür vernagelt ist. »Das lässt sich aufstemmen. Aber die Alte könnte es hören und ich habe keine Lust, mich mit der Garda anzulegen.«
Ich kichere verhalten. Er war General der Königskrieger und Minister über Frieden und Krieg, bevor er mit mir geflohen ist – und fürchtet sich vor der Vorstadtpolizei?
Aber auch ich möchte kein Aufsehen erregen und so bedeute ich ihm, mir zu folgen, und wir umrunden das Haus. Und bingo: An der Rückseite findet sich im Schein meines Displays eine einfache Holztür, die im oberen Bereich ebenfalls verrammelt ist. Doch ein genauerer Blick zeigt mir, dass die Tür dahinter nach innen aufgeht. Sie ist nicht verschlossen.
Gänsehaut kriecht mir über die Arme. Hier ist jemand.
Es ist dunkel im Inneren des Hauses, sodass ich auf meinem Handy herumwische, um die Taschenlampe einzuschalten. Ein pilziger Geruch von morschem Holz liegt in der Luft und irgendwo dahinter etwas, das an nasses Fell erinnert. Wir stehen in einer halb ausgeräumten Wohnküche. Helle Schatten an den schmutzigen Wänden zeugen von fortgebrachten Schränken, doch der altmodische Gasherd und die Spüle sind noch da und von einer dicken Schicht Staub bedeckt. Ein einziger Stuhl steht noch an den Holztisch gerückt. Und dieser Tisch – mir stockt der Atem – ist verkratzt und glanzlos, aber sauber gewischt.
»Hallo?«, flüstere ich. Keine Antwort.
Nathaniel ist bereits am Durchgang zum nächsten Raum. Ein Vorhang verdeckt mir die Sicht, Nathaniel streift ihn mit der Hand und Staubflocken sowie ein toter Falter schneien zu Boden. Er deutet auf etwas, das ich erst erkenne, als auch ich durch den Türrahmen trete: In der Ecke des alten Wohnzimmers, neben einem mit kalter Asche gefüllten Kamin, bilden Teppiche, Polster sowie eine löchrige Matratze ein Lager auf dem Boden. Mein Blick fällt auf eine Thermoskanne und eine leere Tasse. Ich gehe hin, hebe die Kanne auf und drehe den Deckel. Noch bevor ich ihn vollends abgeschraubt habe, steigen Wärme und der Duft von Schwarztee daraus empor.
»Du hattest recht«, sagt Nathaniel. »Hier lebt jemand. Die alte Frau weiß das, vermutlich kümmert sie sich um die Person.«
Beim Gedanken, dass jemand in diesem verfallenen Haus wohnt, zieht sich mir der Magen zusammen. »Warum hat sie das nicht gesagt?«
»Vielleicht weil …« Nathaniel hält im Satz inne, als in der oberen Etage etwas knarzt. Er hält auf die Treppe zu und ich folge ihm nach oben, sorgsam darauf bedacht, nicht auf eine morsche Stufe zu treten. Meine Gedanken wirbeln durcheinander und sind zugleich ganz klar, viel klarer, als mir lieb ist. Das traurige Lächeln der alten Nachbarin ergibt plötzlich einen Sinn: Der Mensch, der hier vor sich hin vegetiert, kann nur mein Vater sein.
»Es war ein Bettler«, murmle ich, halb zu Nathaniel, halb zu mir selbst.
»Sieht so aus, ja.«
»Nein, ich meine nicht den Menschen, der sich hier versteckt. Oder vielleicht doch? Ich rede von dem Mann, der Liam beigebracht hat, ›Nothing Else Matters‹ auf der Gitarre zu spielen. Einen Song von Metallica. In Lyaskye. Liams Mutter beschrieb ihn mir als Obdachlosen, der kaum ein Wort sprechen konnte. Seltsamer Zufall, oder?«
Am oberen Ende der Treppe bleibt Nathaniel stehen und dreht sich zu mir um. Von meiner Handytaschenlampe beleuchtet, wirkt er in der Dunkelheit fast wieder wie der Krieger, als den ich ihn kennengelernt habe. »Du glaubst …?«
»Du selbst hast mir davon erzählt.« Ich sollte leiser sprechen, aber in mir herrscht ein Aufruhr, so laut, dass ich mein eigenes Wort kaum verstehe, geschweige denn meinen Gedanken folgen kann, bevor ich sie ausgesprochen habe. »Du hast mir erzählt, man könne an Lyaskyes Grenzen zerrissen werden und in beiden Welten nur zur Hälfte weiterexistieren.« Was, wenn meinem Vater genau das geschehen ist?
»Dann solltest du vorsichtig sein«, sagt Nathaniel, aber ich bin bereits an ihm vorbeigestiefelt, schnurstracks zur ersten Tür, die aus der oberen Angel bricht und mir fast entgegenkippt, als ich sie aufreiße. Nathaniel stützt sie rasch mit der Hand ab und stößt ein leises Grollen aus. »Vorsicht, sagte ich.«
Der Raum ist leer, sieht man einmal von Staubbergen und einer mumifizierten Maus in der Zimmerecke ab. Auch im nächsten Raum ist nichts. Ich erwarte ein ähnliches Bild, als wir die letzte Tür öffnen. Doch was ich wirklich sehe, lässt mich erschaudern. Ein Schlafzimmer. Der Lichtkegel meines Handys schält ein großes Bett aus dem Dunkel. Flecken prangen auf dem gräulichen Laken, die Decken sind zu einer Art Nest geformt.
Nathaniel wirkt nervös, selbst durch seinen Winterparka erkenne ich, dass er die Muskeln anspannt. In seinem Blick liegt eine Befürchtung verborgen. Er schiebt mich halb hinter sich, beugt sich herab und schaut unter das Bett. Plötzlich springt auf der anderen Seite des Möbelstücks etwas hervor. Ich erschrecke, beruhige mich im gleichen Moment selbst, denn wir wussten doch, dass sich hier jemand versteckt. Der Obdachlose. Der Mann, nach dem wir suchen. Vielleicht mein …
Das pure Entsetzen lässt mich aufschreien, als das, was durch den Raum auf uns zuhuscht, im Schein meiner Lampe sichtbar wird. Das ist kein Mann. Kein Mensch.
Das Wesen ist kleiner, dürrer und entweder von Fell bedeckt oder nackt, doch wenn es Haut ist, so ist sie dunkel wie verkohlt. Nathaniel springt auf es zu, versperrt mir kurz die Sicht. Ein Fauchen erklingt und schon ist das Wesen zur Tür hinaus. Schritte, als klapperten blanke Knochen über die Dielen, poltern durch den Flur, verklingen plötzlich und setzten sich dann über uns fort.
»Es ist auf den Dachboden getürmt«, murmelt Nathaniel.
Mir rast das Herz. Ich habe vieles gesehen. Aber so etwas? »Fuck, was war das?«
»Werden wir gleich sehen.«
Und dann folgt er dem Wesen durch den Korridor bis zu der Öffnung über seinem Kopf. Früher mögen hier Luke und Leiter gewesen sein, nun ist da nichts als ein schwarzes Loch in der Decke. Ich möchte ihn wegziehen, sehe fast vor mir, wie die knochigen Hände nach ihm greifen und ihn mit einem Ruck nach oben reißen. Stattdessen beobachte ich mit leerem Kopf, wie er die Arme ausstreckt, um mit den Fingern am Rand der Öffnung Halt zu finden.
Er hat recht, rede ich mir ein. Es ist vor uns geflohen. Es hat mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Und wir müssen wissen, was es ist. Mit einem irischen Grogoch hat es in jedem Fall nichts zu tun.
Mit Leichtigkeit zieht Nathaniel sich hoch, sein Oberkörper verschwindet im Dunkeln und kurz darauf auch seine Beine. Mir entkommt ein winziger hoher Laut bei dem Gedanken, dass er nun fort ist und alles still bleibt, obwohl ich nach ihm rufe. Doch dann kommt zumindest seine Stimme aus der Schwärze. »Reich mir mal das Handy, ich brauche Licht.«
»Zieh mich hoch«, erwidere ich und halte ihm die Hand hin.
»Ich schaue erst mal, wo das Viech hin ist.«
»Zieh mich hoch«, wiederhole ich ungeduldig und wundere mich selbst, wie herrisch ich klingen kann. Er schnaubt, packt meine Hand und zerrt mich mit einem solch unbeherrschten Ruck nach oben, dass ich kurz befürchte, mein Arm könne auskugeln. Ich will ihn anfahren, was das soll, da gleitet das Licht meines Telefons, das ich in der anderen Hand halte, über den Speicher und ich vergesse, was ich sagen wollte, vergesse den Schmerz in der Schulter. »Was zur Hölle ist denn das?«
Schmuck glitzert vor uns auf Decken und Teppichen ausgebreitet auf dem Speicherboden. Ringe, Halsketten, Armreife und vor allem Amulette in allen Formen und Größen. Ich mache vorsichtig ein paar Schritte, um auf nichts draufzutreten. Sogar eine Krone liegt dort, eine Silberkrone, angelaufen, sodass sie fast schwarz wirkt und die eingearbeiteten Edelsteine hell herausstechen. Perlen schimmern, Diamanten funkeln. Zwischen kostbarem, alten Geschirr mit vergoldetem Dekor liegen Münzen verstreut. Es sieht aus, als läge ein Scherbenmeer aus Gold und Kostbarkeiten zu meinen Füßen.
»Was immer es ist, es mag Schmuck.« Nathaniels Stimme klingt belegt und genauso fühlen sich seine Worte an: Als läge etwas darüber, das weggewischt werden muss, damit man erkennt, was die wahre Bedeutung dieser seltsamen Sammlung ist.
Ganz langsam taste ich mich vorwärts, einer schmalen Spur folgend, die in den hinteren Bereich des Speichers führt, wo Schränke und Regale eine fast lückenlose raumtrennende Wand bilden. »Es sucht etwas«, korrigiere ich leise. »Das alles, was hier auf dem Boden liegt, ist bedeutungslos. Es will eigentlich etwas anderes.« Meine Stirn kribbelt, während ich hin und her leuchte. Denn auch ich suche etwas. Und ich habe das sichere Gefühl, diesem Etwas nahe zu sein. Es vielleicht sogar hier zu finden.
»Mailin!«
Ich höre Nathaniels Warnruf und fast im gleichen Augenblick werde ich hart herumgerissen und stolpere über Schmuck und Porzellan, das klirrend über den Boden rutscht. Das Wesen erkenne ich erst, als es an uns vorbeigeschossen ist, tief gebückt, doch mit abgespreizten Armen, als hätte es Schwingen, die es nur ausbreiten müsste, um davonzufliegen. Meine rechte Körperhälfte zieht und brennt plötzlich. Das Smartphone fällt mir aus der Hand und wirft seinen Lichtstrahl in die Spinnweben unter dem Dach. Ich taste über meine Schulter und den Oberarm. Es hat mir die Jacke zerfetzt und zwischen dem aufklaffenden Stoff spüre ich Feuchtigkeit. Blut. Meine Hand gleitet höher. Dort, wo meine Schulter in den Hals übergeht, hat nur der Kragen meine Haut geschützt. Meine Finger werden nass, als sie die Wunde ertasten. Es dauert ein wenig und dann setzt der Schmerz ein. Ich winde mich, greife nach Nathaniels Arm, um mich an ihm festzuhalten, aber wo er eben noch stand, ist nun bloß Leere.
»Fuck«, hauche ich. Mir schwindelt. In einigen Metern Entfernung poltert und kracht es. »Pass auf!«, will ich rufen, aber meine Stimme ist klein und leise, als hätte das Wesen mir sämtliche Kraft aus dem Körper gesogen. »Pass auf, es hat Krallen. Oder ein Messer.« Oder … Ich weiß es nicht.
Erneutes Poltern, ein unwirkliches Zischen, gefolgt von einem heiseren Röcheln. Nathaniel gibt keinen Laut von sich. Ich starre in die Richtung, aus der die Geräusche kommen, taste gleichzeitig nach dem Smartphone, aber meine Hand ist kalt und schwer und meine Finger prickeln, als wären sie eingeschlafen. Das Wesen krächzt auf wie ein Rabe, etwas schabt hastig über Holz und endlich höre ich auch einen menschlichen Laut. Nathaniels Grollen klingt genervt, aber nicht, als sei er ernsthaft in Gefahr. Endlich habe ich das Handy, umklammere es mit meinen steifen Fingern und leuchte ins Dunkle. Nathaniel hat das Wesen an beiden Handgelenken gepackt und drückt es nun mit vor dem dürren Hals gekreuzten Armen gegen die Wand, sodass er ihm mit seinen eigenen Knochen die Kehle zudrücken könnte, sollte es weiter Ärger machen.
»Alles in Ordnung?« Er klingt, als meine er das Wesen, das er nicht aus den Augen lässt.
»Ich denke schon.« Mit weichen Knien trete ich näher, ziehe den Kragen der Jacke etwas höher, sodass ihm nicht sofort auffällt, dass das Ding mich verletzt hat. Es sieht furchterregend aus. Trockene dunkelgraue Haut bedeckt Knochen und sehnige Muskeln. Ein paar lange, helle Haare wachsen auf seinem Kopf und es trägt ein uraltes Hemd, grau und fleckig geworden. Seine Augen aber sind erschreckend menschlich. Als sei es irgendwann mal ein Mensch gewesen und dann zu dieser Kreatur vertrocknet. Mir wird übel bei der Vorstellung, es könnte das sein, was von meinem Vater übrig geblieben ist. Ich trete noch näher, leuchte dem Wesen über den dürren Körper. Nein, es ist viel zu klein und zudem scheint es … weiblich zu sein.
Erst als die Kreatur die Lippen zu einem Grinsen verzieht, wird mir bewusst, dass ich ihm direkt ins Antlitz schaue. Schnell wende ich den Blick ab. Wer weiß, was es zu tun vermag. Ich will gerade Nathaniel fragen, ob er eine Vorstellung hat, um was es sich überhaupt handelt, da beginnt es leise zu lachen.
»Eine Königin.« Es streut die Worte in abgehackten Silben in sein Gelächter. »Eine Königin der Nacht kommt mich holen.«
Ich zucke zusammen und selbst Nathaniel kann ein Schaudern nicht unterdrücken.
»Ja«, sage ich, weil sich das Schweigen hilflos anfühlt. »Du hast recht. Eine Königin.« Meine Schläfen kribbeln von der Macht und dem Zauber der Tiara Stellaris.
»Du bist von Sternen gekrönt«, flüstert das Wesen und meine Welt wankt.
Nathaniel knurrt es an, es solle den Mund halten, aber es spricht ungerührt weiter, selbst als er es schüttelt. »Du bist von Sternen gekrönt von Lyaskye und dem Morgen.«
»Wir hatten also recht«, ist alles, was mir als Antwort einfällt. »Du kommst aus Lyaskye.«
Der Laut, mit dem es reagiert, könnte ein Lachen sein oder ein Weinen und plötzlich habe ich Mitleid mit der Kreatur. Egal, was sie ist, sie ist vollkommen allein in einer Welt, die der ihren so schrecklich fern ist. Sie kann nicht nach Hause.
»Lass sie los.«
Nathaniel dreht mir wortlos das Gesicht zu.
»Lass sie los!«, wiederhole ich.
»Sie?« Er schnaubt, aber er tut, was ich sage, wenn auch misstrauisch und jederzeit bereit, wieder zuzufassen.
Die Kreatur reibt mit ihren Klauen über ihre Schultern und schnüffelt an ihren Krallen. Meine Wunden brennen. Vielleicht hatte sie nur Angst. Oder sollte ich Angst haben?
»Wie kommst du hierher?«, frage ich.
Wieder dieser Laut, der ans Herz geht. Herablassung oder Erstaunen, Spott oder Leid. Ich kann es nicht sagen, es ist alles und nichts. »Ich sollte befreit werden. Aber der Held«, sie kichert, »war ein Versager.«
»Du bist gesprungen, nicht wahr?« Nathaniels Stimme klingt, als wäre das ein Verbrechen. »Bist du ein Weltenspringer?«
»Ich diene keinem Clan.«
»Dann hat jemand versucht, dich mitzunehmen«, vermute ich.
Das Wesen nickt. »Ja. Und es bitter bereut.«
Die nächste Frage wiegt so schwer, dass sie kaum aus meinem Mund herauswill. »Wer?«
Darauf faucht es mich an, ich weiche erschrocken zurück und Nathaniel packt es an der Kehle und knallt es gegen die Wand. Es schlägt mit den Klauen nach seinem Oberkörper, erwischt ihn einmal, zweimal, gibt dann aber röchelnd auf, da er ihm ungerührt die Luft abdrückt.
»Bist du in Ordnung?«, hauche ich. Kaum vorstellbar, dass es ihn nicht ernsthaft verletzt hat, aber er nickt bloß.
»Wer?«, wiederholt er meine Frage mit Nachdruck.
Das Wesen klingt, als presse es seine Worte zwischen Metall und Steinen hervor. »Mein Diener. Ein Versager.«
»Ist er hier?«, frage ich. »Lebt er mit dir in diesem Haus?«
»Seine nutzlosen Überreste«, stößt das Wesen verächtlich in meine Richtung aus.
»Und dieser Diener ist ein Weltenspringer.«
»Nicht mehr.«
Mein Blick schweift über die Schätze, die die Kreatur auf dem Speicher hortet. »Er besaß ein Cercerys. Und nun gehört es dir.«
»Plunder. Es nützt nichts mehr.«
Nein, denke ich. Es nützt dir nichts. Weil du kein Weltenspringer bist.
»Gib es uns.« Der Hauch eines Lächelns liegt in Nathaniels Augenwinkel versteckt. Ich erkenne Hoffnung, wenn ich welche sehe. Bei ihm besser als bei jedem anderen.
Das Wesen kichert, als wäre diese Forderung aussichtslos. »Aus welchem Grund sollte ich euch helfen? Ihr helft mir auch nicht.«
»Das könnten wir aber«, flüstere ich, vielleicht zu leise, als dass es mich verstehen kann, aber zumindest hört es auf zu kichern und legt den Kopf schief. »Oder willst du hierbleiben? Hier, inmitten deines … Plunders?«
»Mag sein«, erwidert es.
Nathaniel drückt fester zu, ich lege ihm eine Hand auf den Arm, bis er seinen Griff lockert.
Das Wesen ignoriert ihn vollkommen. Es hat nur Augen für mich und ich bin nicht sicher, ob sein Interesse meinem Angebot gilt oder meinen Knochen, die es womöglich abnagen will.
»Ich würde dir schaden, Majesty«, schnarrt es, als hätte es meinen Gedanken gelauscht.
»Was soll das heißen?«
»Du willst mich nicht in deinem Reich. Wäre ich dort, so würdest du mich jagen.«
»Du vergisst, dass ich ebenfalls nicht dort bin.«
Es lacht höhnisch. »Ist das nicht Beweis genug, dass du mir nicht helfen kannst? Hättest du einen Weltenspringer, Majesty, so wärst du nicht hier. Es sei denn …« Erkenntnis lässt seinen Blick lodern. Erkenntnis oder Wahn. »Ein Springer ohne Magie?« Jetzt erst betrachtet es Nathaniel näher. Aus seiner Mimik wird nicht klar, ob es die richtigen Schlüsse zieht. Doch seine Vermutung ist richtig. Nathaniel ist dieser Springer ohne Magie. Um sie zu wirken und uns nach Lyaskye zu bringen, braucht er entweder Lyaskyes Nachthimmel und die Kassiopeia, das Sternbild seines Clans, oder das Cercerys, in dem die Saphire der Kassiopeia die Sterne nachbilden.
»Du hast ein Cercerys«, sage ich leise. »So ist es doch, nicht wahr?«
»Ich habe keinen Grund, es dir zu geben.«
»Ist mein Angebot, dich nach Hause zu bringen, denn nicht Grund genug?«
Es ist so still, dass ich die Kreatur mühsam atmen höre. »Majesty«, sagt sie schließlich fast weich, »du wirst mich niemals heimbringen. Ich bin deine größte Bedrohung. Dein Tod, Majesty.«
Zahlreiche Gedanken gehen mir durch den Kopf. Wenn mein Verdacht richtig ist, dann hat mein Vater versucht, das Wesen aus Lyaskye zu entfernen. Der Sprung hat ihn zerstört – wie er vielleicht auch das Wesen zerstört hat. Womöglich gab es einen Grund, diese Kreatur aus Lyaskye fortzubringen; einen Grund, der so wichtig war, dass mein Vater dafür alles riskiert hat, sogar sein Leben.
»Was bist du?«, fragt Nathaniel, dessen Gesicht mit jedem Wort des Wesens härter geworden ist.
»Wer bist du?«, korrigiere ich.
Erneut kichert es. »Nichts mehr, Majesty. Nur ein Überrest. So nutzlos wie dein Clanmann ohne Magie.«
Bevor Nathaniel es für diese Worte strafen kann, verstärke ich den Griff um seinen Arm. »Lass sie los«, sage ich noch einmal.
Die Kreatur reibt sich mit ihren Klauen die Kehle. »Ich bin deine Feindin, Majesty.«
Ich überwinde meine Furcht und trete einen Schritt näher, so nah, dass ich den staubigen Geruch wahrnehme. Das Wesen riecht nicht wie ein Fleischfresser und auch nicht so vermodert, wie man anhand seines Aussehens denken könnte. Es riecht wie halb vergessene Erinnerungen; wie die Seiten uralter Bücher. »Ich wähle meine Feinde selbst.«


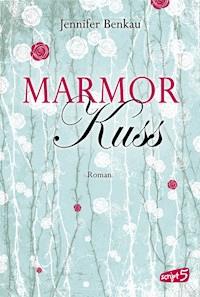















![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)









