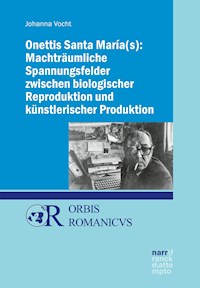
Onettis Santa María(s): Machträumliche Spannungsfelder zwischen biologischer Reproduktion und künstlerischer Produktion E-Book
Johanna Vocht
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Orbis Romanicus
- Sprache: Deutsch
Juan Carlos Onetti (1909-1994), eine der prägendsten Autorenfiguren der lateinamerikanischen Moderne, schuf über einen Zeitraum von 60 Jahren ein selbstbezügliches literarisches Gesamtwerk, das fast gänzlich in der fiktiven Stadt Santa María verortet ist. Im Prozess der literarischen Stadtgründung, deren Verfall und Neugründung, entsteht ein machträumliches Spannungsfeld zwischen biologischer Reproduktion und künstlerischer Produktion. Onettis Erzählkosmos ist von einer patriarchalen Ordnung strukturiert. Die hegemoniale Männlichkeit, die diese Ordnung stützt, definiert sich über künstlerische Schöpfungspotenz und die Unterordnung der Frau. Die Publikation zeichnet die verschiedenen Strategien nach, durch die sich Frauenfiguren in Onettis Texten dieser Unterordnung erwehren und zeigt damit, dass das patriarchale System in eine sanmarianische Dystopie der kurzen Leben mündet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johanna Vocht
Onettis Santa María(s): Machträumliche Spannungsfelder zwischen biologischer Reproduktion und künstlerischer Produktion
Umschlagabbildung: Juan Carlos Onetti, © Suhrkamp Verlag
Die vorliegende Arbeit wurde im Jahr 2020 vom Fachbereich 05 – Sprache, Literatur, Kultur der Justus-Liebig-Universität Gießen als Dissertation angenommen und erfolgreich verteidigt.
DOI: 10.24053/9783823394259
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ISSN: 2365-3094
ISBN 978-3-8233-8425-0 (Print)
ISBN 978-3-8233-0251-3 (ePub)
Inhalt
1Einleitung: Zum Verhältnis von Raum, Macht und Gender in Onettis Santa María
In the year of '39 came a ship in from the blue
the volunteers came home that day
and they bring good news of a world so newly born
though their hearts so heavily weigh
for the earth is old and grey, little darlin' we'll away
but my love this cannot be
for so many years have gone though I'm older but a year
your mother's eyes from your eyes cry to me1
Brian May (1975)
1909 in Montevideo geboren, lebte, arbeitete und publizierte Juan Carlos Onetti bis zu seiner Exilierung 1975 wechselweise in Montevideo und Buenos Aires. Die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens verbrachte er in Madrid. Dort verfasste er den Großteil seines Spätwerks, erhielt 1980 den Premio Cervantes und starb 1994.2 Lange Zeit war Onetti kaum über Uruguay und den La-Plata-Raum hinaus bekannt. Allein ein eingeschworener Kreis junger Schriftsteller*innen und Intellektueller aus dem Umfeld der linksliberalen Wochenzeitschrift Marcha (deren Redaktion Onetti von 1939 bis 1941 angehörte), die auch als „generación crítica“ oder „generación del 45“ in die Literaturgeschichtsschreibung eingingen, pflegte bereits zu Beginn der 1940er Jahre einen regelrechten Kult um den späteren Cervantes-Preisträger.3 Onetti verfasste und veröffentlichte zwischen 1933 und 1993 14 Romane, zahlreiche Kurzgeschichten sowie journalistische Beiträge.
Als Schlüsselwerk gilt bis heute der 1950 erschienene Roman La vida breve. Anhand der Genese einer fiktiven Kleinstadt namens Santa María exemplifiziert Onetti in diesem Roman die Mechanismen der Autofiktionserzeugung. Sein literarisches Schaffen lässt sich damit grob in zwei Perioden unterteilen: eine ‚präsanmarianische‘ und eine ‚sanmarianische‘, d.h. in Texte vor der Erfindung Santa Marías und in solche, die ebendarin verortet sind.4 So konstatiert Roberto Ferro, dass mit Beginn der „Saga de Santa María“5 Onettis Erzählen in zunehmendem Maße selbstbezüglich werde:
Hasta la aparición de La vida breve, la narrativa de Onetti remite a una constelación de escrituras que cita y reescribe, entre las que se inscriben de modo paradigmático, aunque no excluyente, las de Céline, Faulkner, Arlt, Joyce y la novela de aventuras: ese gesto se registra como un movimiento de apertura. A partir de La vida breve, la instancia citacional se hace endógena, las repeticiones autorreferenciales comienzan a constituirse en uno de los rasgos distintivos de su escritura, que exhibe la marca de un porvenir inscripto en la repetición.6
Ferro zeichnet damit die Veränderung des Gesamtwerks von einem stark intertextuell zu einem stark intratextuell geprägten Erzählwerk nach.7 Das heißt, die narrativen Referenzen beschreiben eine räumliche Bewegung: von einem ‚textlichen Außen‘ in den frühen Werken zu einem ‚textlichen Innen‘ in den sanmarianischen Erzählungen. Einzelne, überwiegend männliche Figuren sind sich ihres Fiktionalitätscharakters bewusst und reflektieren diesen auch aktiv.8 Ein poetologischer Effekt dieser starken Autoreferentialität besteht darin, dass die einzelnen Texte zum Teil erst innerhalb des Gesamtkontextes verständlich werden. Ferro plädiert in seiner Studie daher auch für eine Lesart, die Onettis literarisches Gesamtwerk als „único texto“9 fasst. Die vorliegende Arbeit folgt diesem Vorschlag, indem sie das ausgewählte Korpus als Teil des Gesamtwerks liest und immer wieder dazu in Beziehung setzt.
Das zu untersuchende Textkorpus umfasst die Romane La vida breve (1950), Juntacadáveres (1964), La muerte y la niña (1973) und Dejemos hablar al viento (1979) sowie die Kurzgeschichte „La novia robada“ (1968). Allen genannten Texten ist gemein, dass sie sich in zahlreichen Anspielungen auf La vida breve (1950) als ‚Gründungstext‘ beziehen und überwiegend in dem darin erdachten Santa María verortet sind. Entscheidungsleitend bei der Auswahl der einzelnen Romane sowie der Kurzgeschichte waren die unterschiedlichen Darstellungen von künstlerischer Produktion und biologischer Reproduktion respektive deren Negationen. Diese wiederum stehen, so die Grundannahme der vorliegenden Arbeit, stets in komplexen reziproken Abhängigkeitsverhältnissen zu den Parametern Raum, Macht und Gender, welche in diesem Rahmen analysiert werden sollen.
Die Hypothese basiert auf folgenden Vorüberlegungen: Mit Santa María wählt Onetti einen in Lateinamerika weit verbreiteten Städtenamen, der sich, wie Jorge Edwards exemplarisch für die bisherige Onetti-Forschung formuliert, auf eine fiktive, prototypische lateinamerikanische Provinzstadt bezieht:10
Es una ciudad provinciana, un espacio cerrado, ocupado por unos cuantos personajes novelescos, y es, en seguida, un mundo novelesco que se encuentra en las cercanías de lugares tan reales como Buenos Aires y Montevideo. […] Es la metáfora de cualquier ciudad de América del Sur, con su carácter provinciano, con su cercanía de algún puerto, con sus barrios de inmigrantes.11
Während die Forschung sich bis dato also vor allem auf Santa María als Teil einer bekannten lateinamerikanischen Geographie bezogen hat, soll in vorliegender Arbeit noch ein weiterer terminologischer Aspekt für die Analyse fruchtbar gemacht werden: So rekurriert der Name Santa María in der christlichen Tradition auf die heilige Maria, die Muttergottes, die Gebärerin des christlichen Heilands; evoziert wird damit werkübergreifend die Figur der Mutter als traditionelles Symbol des Lebens, der Geburt und der Schöpfung. Allerdings spielen auf diegetischer Ebene Mutterfiguren nur eine sehr marginale Rolle. In weiterem starkem Kontrast zu dem christlichen Marienmythos steht, dass Fortpflanzung und Elternschaft in Onettis Texten entweder offen problematisiert oder von den Figuren verweigert werden und damit als grundsätzlich dysfunktional und/oder konfliktbehaftet markiert sind. In Onettis Texten wird, so eine weitere Lektürebeobachtung, (biologische) Reproduktion vielmehr durch kinderlose Frauenfiguren, die gleichzeitig mit Attributionen von Mütterlichkeit versehen werden, repräsentiert. Jegliche Art der Genealogie auf diegetischer Ebene erscheint damit unmöglich. Über all dem ‚schwebt‘ eine männliche Schöpferfigur, deren Erzählpotenz sich auf unterschiedliche männliche Erzählinstanzen aufteilt.
Unter diesen Prämissen wird Santa María über seine Funktion als literarischer Handlungsort oder topographischer Referenzrahmen hinaus auch als metafiktionales Produkt respektive Kunstwerk und metonymisch als grundlegendes Prinzip des stark vom Marienmythos geprägten Phänomen des Marianismo lesbar. In der vorliegenden Arbeit soll es folglich nicht nur um das eine, singuläre Santa María in Onettis Gesamtwerk gehen, sondern um eine Vielzahl von Santa Marías und innerhalb dieser um die genderbezogene Darstellung machträumlicher Spannungsfelder zwischen biologischer Reproduktion und künstlerischer Produktion.
Nach den inhaltlichen Vorüberlegungen sollen nun kurz diejenigen Raumtheorien skizziert werden, die zu oben genannter Beobachtungen geführt und diese Arbeit geprägt haben. Grundlegend war zunächst die Orientierung an Henri Lefebvres Theorie des sozialen Raums, wonach Raum nicht nur als Produkt, sondern gleichzeitig auch als Produzent sozialer Ordnungen zu verstehen ist.12 In den Worten von Wolfgang Hallet und Birgit Neumann heißt das: „Als Signatur sozialer und symbolischer Praktiken ist Raum kulturell produziert und kulturell produktiv: Der Raum selbst spiegelt demzufolge bestehende Machtverhältnisse wider und verfestigt diese.”13 Raum, und insbesondere der Raum in der Literatur, fungiert in dieser Lesart als „kultureller Bedeutungsträger“, der, so Hallet/Neumann weiter, „[k]ulturell vorherrschende Normen, Wertehierarchien, kursierende Kollektivvorstellungen von Zentralität und Marginalität, von Eigenem und Fremdem“14 konkret veranschaulicht. Diese kulturellen Wertehierarchien und -vorstellungen stehen sich mitunter widersprüchlich gegenüber und bilden dadurch Machtverhältnisse, kulturelle Konflikte oder Formen von Diskriminierung ab. Dementsprechend argumentieren Hallet/Neumann:
Da in materiellen Räumen heterogene, sogar widersprüchliche Symbolisierungen zusammenlaufen können, ist ihnen stets eine (inter-)kulturelle Vielschichtigkeit eingeschrieben, die dazu geeignet ist, die vermeintliche Homogenität und Hierarchisierung kultureller Ordnungen in Frage zu stellen.15
Die zitierte Betonung der Machtverhältnisse als Effekte räumlicher Praktiken rekurriert wiederum auf Michel Foucaults relationales Macht- und Raumverständnis. Allerdings fehlt in Foucaults Ausführungen zu raumabhängigen Machtrelationen ein expliziter Geschlechterbezug, sprich: Foucault verwendete in seinen Analysen das generische Maskulinum. Erst eine feministische Rezeption zeigte die gendersensible Anschlussfähigkeit seiner Texte auf und ebnete damit den theoretischen Weg für eine genderkritische Perspektive. Diese wiederum korrespondiert mit einem Postulat der feministischen Humangeographie, welches die Konstruktion von Raum als unbedingt genderabhängig beschreibt.16 Mit ihrem programmatischen Ansatz „geography matters to gender“17 prägte Doreen Massey, eine der wichtigsten Vertreterinnen der feministischen Humangeographie, die wissenschaftliche Erforschung von Raum-, Macht- und Genderrelationen. Mit implizitem Rückgriff auf Lefebvre schreibt sie:
The only point I want to make is that space and place, spaces and places, and our senses of them (and such related things as our degrees of mobility) are gendered through and through. Moreover they are gendered in a myriad different ways, which vary between cultures and over time. And this gendering of space and place both reflects and has effects back on the ways in which gender is constructed and understood in the societies in which we live.18
Massey betont damit die Notwendigkeit, nicht nur Klassenzugehörigkeit, sondern auch das soziale Geschlecht (gender) als feste Analysegrößen in der Humangeographie zu etablieren. Sie verweist auf die Interdependenzen zwischen der sozialen Konstruktion von Geschlecht und unserer alltäglichen Raumwahrnehmung und -gestaltung. Wie sehr die deiktische Funktion von Sprache genderspezifische räumliche Grenzen zu ziehen respektive zu reproduzieren vermag, und inwieweit Machtverhältnisse durch Sprechverbote in bestimmten räumlichen Kontexten geprägt werden, erläutert die britische Mediävistin Mary Beard in Women and Power (2017). Beide genannten feministischen Ansätze sind dem Prinzip der Intersektionalität verhaftet, das wiederum einer herrschafts- und machtkritischen Perspektive Rechnung trägt: Es wird nicht mehr von singulärer (und damit ausschließlicher) Weiblichkeit respektive Männlichkeit ausgegangen, sondern die Pluralität unterschiedlicher struktureller und gesellschaftlicher Abhängigkeiten und Diskriminierungserfahrungen abgebildet, in die jede Person eingebunden ist bzw. die eine Person in einem bestimmten kulturellen oder politischen Kontext erfährt.19 Diesem intersektionalen Ansatz fühlt sich auch die vorliegende Arbeit verpflichtet.
Dementsprechend lässt sich also konkretisieren: Raum ist in vorliegender Untersuchung als sozial geformtes, kulturell veränderliches Konstrukt zu verstehen, das Machtbeziehungen sowohl abbildet als auch hervorbringt. Die einzelnen Akteur*innen bzw. Figuren werden dabei nicht androzentrisch, d.h. ‚automatisch‘ als männlich verstanden, sondern in Abhängigkeit von ihrem sozialen Geschlecht untersucht. Das in dieser Arbeit angewandte Geschlechter-Verständnis orientiert sich wiederum an R.W. Connells theoretischem Zugang auf dem Gebiet der Men’s Studies.20 In Abgrenzung zu einem überwiegend diskursiv-semiotisch verstandenen Gender-Begriff, wie ihn insbesondere Judith Butler prägte, spricht Connell einerseits von der sozialen Gemachtheit von Geschlecht, betont jedoch gleichzeitig auch die Bedeutung körperreflexiver Praktiken für dessen Darstellung:21
Through body-reflexive practices, bodies are addressed by social process and drawn into history, without ceasing to be bodies. They do not turn into symbols, signs or positions in discourse. Their materiality (including material capacities to engender, to give birth, to give milk, to menstruate, to open, to penetrate, to ejaculate) is not erased, it continues to matter. The social process of gender includes childbirth and child care, youth and aging, the pleasures of sport and sex, labour, injury, death from AIDS.22
Unter körperreflexive Praxen fasst Connell dezidiert auch reproduktive Fähigkeiten und Vorgänge. Sie spricht von der „reproductive arena“23 als sozialem Ordnungsprinzip. Nach Connell strukturiere der Reproduktionsbereich, einschließlich körperreflexiver Praktiken wie sexueller Erregung oder Zeugung sowie der Organisation von Fürsorge-Aufgaben maßgeblich die Geschlechterverhältnisse und konstituiere damit auch die spezifischen Machtrelationen zwischen Männern und Frauen.24
Für die vorliegende Arbeit lässt sich aus diesen schlaglichtartig skizzierten Vorüberlegungen eine Reihe von Forschungsfragen formulieren:
Wie wirken die geschlechtsspezifischen, reproduktiven (Un-)Fähigkeiten der Figuren auf die gesellschaftliche und räumliche Ordnung Santa Marías und
in welcher Weise prägt der Raum selbst das Feld der Reproduktion und
damit die Darstellung genderabhängiger Machtverhältnisse?
In welchem geschlechterspezifischen Verhältnis stehen biologische Reproduktion und künstlerische Produktion und
inwieweit spiegelt sich dieses Spannungsfeld in den dargestellten Männlichkeiten respektive Weiblichkeiten wider?
Wie verhält sich der durch den Namen Santa María evozierte Marienmythos in Bezug auf die dargestellten Geschlechterverhältnisse innerhalb des männlich dominierten Onetti’schen Erzählkosmos und
welche biopolitischen Diskurse lassen sich daraus für die analysierten Werke ableiten?
Diese Forschungsfragen implizieren, wie bereits im Titel der Arbeit anklingt, dass innerhalb des Onettti’schen Gesamtwerks und insbesondere innerhalb der ausgewählten Texte, eine konfliktive Beziehung zwischen Reproduktion und Produktion vorherrscht und dass dieses Spannungsverhältnis in genderspezifische, machträumliche Parameter eingebunden ist. Mit dieser Arbeitshypothese begegnet die vorliegende Untersuchung einem im Folgenden noch näher auszuführenden Forschungsdesiderat, insofern der Analysefokus auf den schöpferischen, hervorbringenden Fähigkeiten der Frauenfiguren liegt und diese unter machträumlichen Implikationen und als selbstbestimmte Handlungen zu männlicher Schöpfungspotenz in Beziehung gesetzt werden.
Die Forschungsarbeiten, die sich bislang unter dezidiert genderspezifischen Fragestellungen mit Onettis Texten auseinandergesetzt haben, reproduzieren einen heteronormativen Machtdiskurs, der Männern Handlungsmacht zugesteht und Frauen als Katalysatoren dieser Handlungen begreift. So beschreibt etwa Elena M. Martínez den narrativen ‚Wert‘ der Frau hauptsächlich über deren Nutzen für die männlichen Figuren, sei es „en términos de la producción narrativa [o de] la gratificación sexual“25. Die vorliegende Arbeit weist, wie bereits die oben formulierten Forschungsfragen verdeutlichen, weit über diesen Forschungsdiskurs hinaus, indem sie die Frauenfiguren in ein Machtverhältnis zu den Männerfiguren setzt und damit das bisherige Subjekt (männlich)-Objekt (weiblich)-Schema aufbricht.26 Diese explizit feministische Lektüre will sich damit auch als Gegengewicht zu einem Forschungsdiskurs verstanden wissen, dessen Interesse überproportional auf die Analyse der männlichen Figuren gerichtet ist und Frauenfiguren allein in Bezug auf ihre Objekthaftigkeit, in eindimensionaler Abhängigkeit zu den dargestellten Männerfiguren liest. So geht die vorliegende Untersuchung zwar auch davon aus, dass Onettis Erzählwelt klar androzentrisch markiert und patriarchal strukturiert ist, verweigert sich jedoch der im Forschungsdiskurs bislang daraus abgeleiteten Schlussfolgerung, dass weibliche Figuren per se einen passiven und alle männlichen Figuren einen aktiven Part besetzen. Die vorliegende Arbeit basiert vielmehr auf einem pluralistischen Patriarchatsbegriff, d.h. sie geht von einer grundsätzlichen Pluralität unterschiedlich organisierter patriarchaler Systeme aus, deren terminologisch verbindendes Merkmal auf der Tatsache beruht, dass die Systeme von Männern dominiert werden und Frauen darin eine untergeordnete Position zugewiesen ist. Patriarchal ist an dieser Stelle deskriptiv, als Ausdruck feministischer Systemkritik zu verstehen. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich ein pluralistischer Patriarchatsbegriff von der Denkschule des radikalen Feminismus distanziert, nach der ‚Männer‘ ‚Frauen‘ unterdrücken und nicht ein kulturell etabliertes System Machtasymmetrien und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern reproduziert.
In dieser Arbeit soll somit herausgearbeitet werden, dass Frauen in Onettis Texten, trotz systematischer männlicher Dominanz innerhalb des Diskursraums Santa María, im Bereich der Sexualität und Reproduktion Strategien der Verweigerung und Selbstermächtigung aufweisen, welche die in den ausgewählten Texten dargestellten patriarchalen Logiken aktiv zu unterlaufen vermögen.
1.1Aufbau der Forschungsarbeit
Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut:27 Das nachfolgende Unterkapitel (1.2.) gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Onetti und verortet sein Werk im literaturhistorischen Kontext. Aufgezeigt werden mögliche Anknüpfungspunkte und nötige Abgrenzungen der vorliegenden Arbeit von bisherigen Forschungsarbeiten, auf die auch im Laufe der Untersuchungen immer wieder verwiesen wird.
Kapitel 2 stellt den theoretischen Zugriff dieser Arbeit vor, der bereits teilweise angerissen wurde und der für die anschließende Textanalyse in den Kapiteln 3–5 grundlegend sein wird. So erläutert Kapitel 2.1 zunächst die geschlechterabhängigen, machträumlichen Implikationen von Sprache nach Mary Beard. In Kapitel 2.2 folgen Michel Foucaults Überlegungen zu Raum (insbesondere sein Heterotopie-Begriff) und Macht, außerdem sein theoretischer Zugang zu den Begriffen Diskurs, Biomacht respektive Biopolitik und Gouvernementalität. Kapitel 2.3 schlägt durch die Darstellung eines feministischen Anschlusses an Foucault die Brücke zu R.W. Connells gendertheoretischem Konzept der hegemonialen Männlichkeit. Letzteres wird in Kapitel 2.4 ausgeführt. Eine kulturräumliche Spezifizierung der hegemonialen Männlichkeit, sprich der Versuch, eine spezifisch lateinamerikanische hegemoniale Männlichkeit zu definieren, erfolgt in Kapitel 2.5. Mit Blick auf den Namen Santa María als Referenz auf den christlichen Marienmythos, wird dessen Niederschlag im Männlichkeitskonzept des Machismo sowie in dem komplementären Weiblichkeitskonzept des Marianismo beleuchtet und in den Analysekapiteln 4 und 5 mit der Darstellung spezifischer Männlichkeiten respektive Weiblichkeiten innerhalb des ausgewählten Textkorpus abgeglichen.
Im Zentrum des dritten Kapitels steht das Textkorpus dieser Arbeit und insbesondere das Stadtbild Santa Marías. Da sich Onettis Erzählungen, so eine Grundannahme der vorliegenden Untersuchung, weniger über ihre Handlung als über ihre diskursive Ausgestaltung konstituieren, erscheint eine Inhaltsangabe, die allein die (mitunter fragmentierte) Handlung der einzelnen Texte wiedergibt, nur bedingt aufschlussreich. Die einzelnen Texte sollen daher über Santa María in ihrer Funktion als narratives Verbindungselement vorgestellt werden. Das schließt bereits eine Analyse spezifischer gesellschaftlicher Konfliktfelder und Machtdiskurse mit ein. Das Kapitel zeichnet nach, wie diese innerhalb des Gesamtwerks verortet werden und sich in dessen Verlauf auch verändern. Die ausführliche Untersuchung der diskursiven Ausgestaltung Santa Marías ist bereits als Hinführung auf die Analysen spezifischer Männlichkeiten und Weiblichkeiten in den Kapiteln 4 und 5 zu verstehen. Nachgezeichnet wird darin die poetologische Funktion Santa Marías zwischen selbstreferentiellem Imaginationsraum und christlich-männlich hegemonialem Diskursraum. Neben der Analyse der diskursiven Ausgestaltung Santa Marías nach Andreas Mahler ist hier Foucaults Diskursbegriff untersuchungsleitend.
Während Kapitel 3 also Santa María als veränderlichen kulturellen Bedeutungsträger betrachtet, untersucht Kapitel 4 mithilfe von Connells Theorie der hegemonialen Männlichkeit die Struktur und Wirkweise der patriarchalen Ordnung in Santa María. Es wird analysiert, wie sich Androzentrismus und Phallogozentrismus in Onettis Erzählwerk sowohl über die Ebene des Diskurses als auch über die der Diegese generieren und gegenseitig verstärken. Das Unterkapitel 4.1 analysiert die poetologischen Mechanismen, die der Autofiktionserzeugung in La vida breve (1950) als Ausgangspunkt zugrunde liegen, und geht insbesondere auf die künstlerische Produktivität der metafiktionalen Erzählerfiguren ein. Um die außergewöhnliche Komplexität und werkimmanente Verknüpfung der Erzählerfiguren offenzulegen und deren Geschlechterspezifik herauszuarbeiten, werden in Kapitel 4.2 anhand der Erzählanalyse nach Gérard Genette die unterschiedlichen Erzählhaltungen innerhalb des Analysekorpus aufgeführt.28 Spezifische Männlichkeiten bei Onetti bilden den Untersuchungsgegenstand von Kapitel 4.3. Entscheidend dabei ist die Unterscheidung der beiden Fiktionsebenen, d.h. in Abstimmung mit dem Forschungsdiskurs zu Männlichkeiten in Lateinamerika, und insbesondere in der La-Plata-Region, wird untersucht, wie sich eine ‚präsanmarianische‘ hegemoniale Männlichkeit (Ursprungsfiktion) zu einer sanmarianischen hegemonialen Männlichkeit (Metafiktion) verhält.
Unter der Prämisse, dass Frauen innerhalb der patriarchalen Ordnung Santa Marías räumlichen Disziplinierungsmaßnahmen sowie verschiedenen Mechanismen gesellschaftlicher Ausgrenzung ausgesetzt sind, analysiert Kapitel 5 weibliche Formen von Widerständigkeit und Selbstermächtigung und rückt dabei das Feld der Reproduktion als Aushandlungsort genderspezifischer Raum-Machtrelationen in den Fokus. Kapitel 5.1 behandelt den Frauenkörper als Kapital weiblicher Macht und Selbstbestimmung innerhalb einer männlichen Ökonomie des Begehrens. Kapitel 5.2 fokussiert auf Strategien weiblicher Widerständigkeit im privaten Raum des Hauses, der mit Foucault als Abweichungsheterotopie innerhalb des männlich dominierten öffentlichen Raumes gefasst wird. Weibliche Sprachmacht und die Artikulation der eigenen Bedürfnisse im Verhältnis zu räumlichen Parametern stehen in Kapitel 5.3 im Zentrum der Untersuchung.
Kapitel 6 resümiert die Forschungsergebnisse dieser Arbeit unter biopolitischen Fragestellungen und reflektiert dabei das Spannungsfeld zwischen metapoetischer und christlicher Ordnung. Die patriarchale Ordnung Santa Marías sowie die Widerständigkeit der Figuren werden in Bezug zu einem spezifisch lateinamerikanischen Geschlechterverhältnis gesetzt.
Mit der methodologischen Verknüpfung von Raum-, Macht- und Gendertheorien in Bezug auf „Onettis Santa Marías“ begegnet diese Arbeit also nicht nur einem grundlegenden Forschungsdesiderat, das die Untersuchung aktiver weiblicher Handlungsmuster innerhalb eines männlich dominierten Diskursraums betrifft, sondern folgt auch einer, den Onetti’schen Texten eigenen narrativen Logik, die nicht auf eine stringente Handlungsabfolge und entsprechende handlungsauslösende Figuren hin ausgerichtet ist, sondern Santa María als kulturellen Bedeutungsträger und damit Kristallisationspunkt ideologischer, (bio-)politischer oder ethischer (die Reihung ließe sich fortführen) Diskurse in den Fokus rückt.
1.2Forschungsstand und literaturhistorische Einordnung
„El imposible Onetti“29 – so betitelt Jorge Edwards einen Zeitungsartikel über Onetti und spielt damit auf die paradoxe Position an, die Onettis Werk innerhalb der Literaturgeschichte einnimmt: So ist einerseits sein Einfluss auf den modernen lateinamerikanischen Roman kaum zu überschätzen, wie zahlreiche Kritiker*innenstimmen belegen, und andererseits ist sein Werk bis heute keinem großen Publikum bekannt. Onetti gilt damit als klassischer writers‘ writer, über den Edwards weiter schreibt:
Desde la perspectiva de hoy, Onetti, el imposible, el hirsuto, es una de las encarnaciones válidas de la literatura entre nosotros, en nuestra región y nuestro tiempo. Es muy difícil estar con él, pero estar contra él es imposible, por más que les pese a los representantes del mercado librero. Onetti nos lleva a terrenos sucios, moralmente contaminados, inquietantes, pero imposibles de eludir.30
Die Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten zu Onettis enigmatischem Werk ist trotz (oder gerade wegen?) seiner Außenseiterposition in Bezug auf den literarischen Mainstream mittlerweile beträchtlich. Dieses Kapitel konzentriert sich daher ausschließlich auf Forschungsarbeiten, die Onettis Werk unter Aspekten von Metafiktionalität, Räumlichkeit, Macht oder Gender analysieren sowie in einen kulturtheoretischen oder politischen Kontext stellen.
Zwei aktuelle Beiträge, die eine gesellschaftskritische Interpretation anklingen lassen, stammen von Victor A. Ferretti und Kurt Hahn. Beide thematisieren aus einer medientheoretischen Perspektive heraus Problemfelder menschlichen Miteinanders, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt haben und damit auch eine spezifische Universalität und Zeitlosigkeit der Onetti‘schen Texte belegen: Ferretti untersucht xenophobe Dynamiken und ihre gesellschaftliche Wirkmächtigkeit in der Kurzgeschichte „Historia del caballero de la rosa y de la virgen encinta que vino de Lilliput“ (1956) und Hahn arbeitet anhand der Kurzgeschichte „Matías el telegrafista“ (1970) die Unmöglichkeit zwischenmenschlicher Kommunikation im Spannungsfeld moderner Kommunikationsmedien heraus.31
Dezidiert politische Lektüren der Onetti’schen Texte liegen bis dato nur in zwei allegorischen Deutungen der Romane El astillero (1961) und Juntacadáveres (1964) vor. Einerseits im Aufsatz des chilenischen Autors Carlos Franz und andererseits im Beitrag der argentinischen Autorin Cristina Peri Rossi. Gemäß der allegorischen Lesart (bezogen auf Juntacadáveres und El astillero) von Franz wissen die Bewohner Lateinamerikas um die Aussichtslosigkeit jeglicher Unternehmung. Fortschritt ist nur um den Preis der Selbstausbeutung zu haben und Korruption dessen essentieller Bestandteil.
En la Santa María de Onetti progresar es prostituirse. […] la ‚invasión’ de la modernidad nos trae progreso, pero a la vez corrompe nuestras costumbres ancestrales, la tecnología extranjera cancela nuestros usos, el capital nos compra, la globalidad pincha nuestra burbuja.32
Franz liest den Einzug der Moderne und den damit einhergehenden Fortschritt in den Onetti’schen Erzählungen als Überfall (invasión) und Bruch mit der eigenen Tradition, europäische Technologien als Eingriff in altbekannte Abläufe und den Einzug des Kapitalismus als Grund für Korruption. Kurzum, er diagnostiziert den Onetti’schen Figuren eine ausgeprägte Angst gegenüber ‚dem Fremden‘, Fortschritt und Neuerung. Diese Angst versieht Fortschrittlichkeit mit negativen Vorzeichen: progresar es prostituirse. So wie die marode Werft und ihre drei verbliebenen Mitarbeiter Larsen, Gálvez und Kunz in einem Kreislauf aus Korruption und Verfall gefangen sind, so entkommt, laut Franz, auch Lateinamerika diesem Zustand nicht. Die Angst vor dem Neuen, dem Fremden und Anderen, d.h. die Angst vor der Moderne, lähmt demnach die Bewohner*innen Santa Marías respektive Lateinamerikas. Selbsttäuschung wird damit zur allgegenwärtigen Überlebensstrategie.33
Während Franz seine allegorische Lesart auf Lateinamerika als gemeinsamen Kulturraum richtet, liest Peri Rossi El astillero (1961) als politische Allegorie auf Uruguay. Die ruinöse fiktive Werft arbeitet sie in ihrem Aufsatz als Bild der nationalen Dekadenz Uruguays heraus:
[…] es una soberbia alegoría del proceso de decadencia de Uruguay, previsto, con notable lucidez por el escritor cuando recién se iniciaba. […] Ese astillero onettiano donde nada funciona, donde todo es símbolo, y las palabras son eufemismos, ese astillero que entre residuos, polvos y ventanas sin vidrios vive de su antiguo esplendor era la imagen más patética y simbólica de la realidad uruguaya.34
Peri Rossi betrachtet El astillero (1961) als Werk literarischer Weitsichtigkeit bezüglich eines in den 1970er Jahren einsetzenden Niedergangs Uruguays, welcher seinen politischen Höhepunkt im Staatsstreich von 1973 fand. Die Funktionslosigkeit und marode Architektur der beschriebenen Werft werden dabei zum Bild für einen handlungsunfähigen Staatsapparat und ein Land in der Dekadenz. Der alte Glanz der Werft (respektive Uruguays) ist unter Staub und Euphemismen verborgen und verkommt zum reinen Symbol vergangener Blüte.
Verweise auf ein grundsätzliches politisches Rezeptionspotential oder Anspielungen auf zeitgenössische politische Ereignisse und Diskurse finden sich bei Ricardo Piglia und Sonia Mattalia. Piglia deutet die hermeneutische Offenheit in Onettis Texten insofern politisch, als er sie als moralisch ambivalent liest. In dieser fiktionalen Uneindeutigkeit erkennt Piglia, dass die Welt nicht in moralische Dichotomien aufzuteilen ist oder klare Lösungen bereithält, sondern sich über eine ihr inhärente Ambivalenz oder vielmehr ‚Unabgeschlossenheit‘ konstituiert – und eben darüber ihre Brüche und Reibungspunkte artikuliert, wie sich ergänzen ließe:
Porque él hace algo que es un gesto que yo lo vivo [sic] como políticamente muy decisivo, y es que Onetti no cierra la conclusión nunca. Es un lugar muy importante del análisis de las formas sociales e ideológicas. El final es el que decide del sentido. Y los de él son siempre indecisos. […] Entonces esas son las operaciones donde la literatura interviene en la política. Experiencias construidas en el laboratorio de la cultura para hacer ver que las cosas no son tan sencillas ni tan claras.35
Demnach vermag Literatur und insbesondere Onettis Erzählwerk mit den Mitteln poetologischer Darstellung politische und ideologische Entstehungsprozesse und auch deren Konfliktpotentiale offenzulegen, indem sie sich eben einer eindeutigen moralischen Haltung enthält. Mattalia hingegen vertritt die These, dass sich innerhalb des Onetti’schen Gesamtwerks eine Entwicklung herauslesen lässt: So schreibt sie dem im spanischen Exil verfassten Spätwerk und insbesondere Cuando ya no importe (1993) eine zunehmende weltpolitische Referenzierbarkeit zu:
También, y esto es novedoso en la narrativa del autor, algunos fragmentos hacen referencias directas a hechos históricos en el Cono Sur, como los golpes militares en Uruguay y Argentina en la década del 70, la presencia de la CIA, historias breves de exiliados, la guerra de las Malvinas, entre otras, que señalan la necesidad ética de Onetti de denunciar directamente, desde el exilio, la violencia de los regímenes militares.36
Wie das obige Zitat zeigt, interpretiert Mattalia vereinzelte direkte und indirekte Anspielungen auf zeitgenössische politische Diskurse als Kritik des Exilautors Onetti an politischen Umbrüchen in seiner Heimat. Vom Großteil der Forschung wird Onetti jedoch nach wie vor als ‚unpolitischer‘ Autor wahrgenommen.37 Dass sich diese Lesart bis auf wenige Ausnahmen so hartnäckig im Forschungsdiskurs hält, ist, so darf vermutet werden, auch zu großen Teilen auf eine missverständliche und vor allem den frühen Forschungsdiskurs dominierende, aus aktueller Forschungsperspektive methodisch unsaubere biographistische Gleichsetzung von realem Autor und fiktiven Figuren zurückzuführen.38
Die Forschungsarbeiten, die sich mit Macht- und Genderfragen innerhalb des Onetti’schen Gesamtwerks auseinandersetzen, argumentierten bislang überwiegend mit einer asymmetrischen Machtverteilung zwischen Männern und Frauen, welche zu Ungunsten der Frauen ausfiel. Demnach gelten Männer als aktiv an der Handlung beteiligte Subjekte, Frauen als passive, indirekt handlungsauslösende Objekte.39 Josefina Ludmer, Judy Maloof, Elena M. Martínez oder Mark Millington verweisen darauf, dass die Aushandlung der konfliktiven Identitäten, die ein für die Onetti’sche Textwelt typisches, marginalisiertes und entfremdetes männliches Subjekt in Onettis Texten kennzeichnet, nicht ohne die katalytische Funktion einer weiblichen Figur gedacht werden könne. Männliche Subjektivierungsprozesse stünden damit immer in Beziehung zu einem weiblichen Komplementärobjekt. ‚Die Frau‘ wird in dieser Lesart einem bestimmten Typus zugeordnet und dadurch auch ihre Funktionalität für männliche Identitätsaushandlungen affirmiert.40 Im Folgenden soll dieses diskursbestimmende Postulat von aktiven Männlichkeiten und passiven Weiblichkeiten anhand einzelner Studien noch einmal detaillierter erläutert und vor allem in seiner Absolutheit in Frage gestellt werden.
Ludmers 1977 verfasste kritische Studie Onetti. Los procesos de construcción del relato ist eine der ersten Arbeiten, die auf die weiblichen Figuren in Onettis Erzählungen fokussiert, und gilt mittlerweile als Standardwerk der Onetti-Forschung. Ludmer arbeitet für diese Studie mit den drei Texten La vida breve (1950), Para una tumba sin nombre (1959) sowie „La novia robada“ (1968), als deren Nexus sie den weiblichen Körper setzt und damit auch als erste eine narrative Verbindung von weiblichem Körper und poetologischer Genese bei Onetti untersucht. Von der Psychoanalyse nach Jacques Lacan und der marxistischen Theorie beeinflusst, arbeitet Ludmer heraus, wie die narrative Ökonomie aller drei Texte an (Dys)funktionalitäten des weiblichen Körpers gebunden ist:
Las tres partes trazan una travesía por un cuerpo femenino, algo así como un horror del cuerpo femenino: la teta cortada y la Queca, la matriz de Rita con el chivo y la concha inútil de Moncha.41
In diesem Zitat verbindet Ludmer Frauenfiguren aus ihrem Untersuchungskorpus mit paradigmatischen, dysfunktionalen primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen: Gertrudis’ amputierte Brust mit Queca, Ritas Gebärmutter mit einem symbolischen Ziegenbock anstelle eines Fötus sowie Monchas ‚funktionslose‘ Vulva. Über ein enges semiotisches Zusammenspiel zwischen Textkörper und dysfunktionalem Frauenkörper leitet Ludmer in ihrer Studie eine Negation weiblicher Reproduktionsfähigkeit ab, welche sie wiederum einer männlichen Produktionspotenz gegenüberstellt. Anders ausgedrückt: In Ludmers Lesart wird weibliche biologische Reproduktionsimpotenz durch männliche künstlerische Produktionspotenz ersetzt: „[E]n Onetti escribir es gestar […].“42 Der Schaffensprozess verlagert sich demnach von einer biologischen auf eine künstlerische Ebene und damit von der Ebene der histoire auf die Ebene des discours. Weibliche Gebärfähigkeit wird durch männliche Imaginationsfähigkeit substituiert.
Während Ludmer eine Verschiebung der (Re)Produktionspotenz von der biologischen/weiblichen auf die künstlerische/männliche Ebene postuliert, liest Maloof mit explizitem Rückgriff auf Elisabeth Bronfens komparatistische Studie Nur über ihre Leiche (2004 [1993 engl.]), den weiblichen toten Körper als fiktionsgenerierend. Maloof rekurriert in ihrer Studie Over her dead body (1995) auf überwiegend stereotype Frauenfiguren. Bei Maloof haben diese die Funktion, den männlichen Protagonisten einen Ausweg aus ihren täglichen, frustrierenden sozialen Kämpfen zu weisen:
These idealized images of Woman (usually a very young woman, a madwoman, a prostitute, or a handicapped woman) help the narcissistic masculine character to escape from the drudgery and frustrations of his everyday life in a reified social environment.43
Frauenfiguren werden von Maloof demnach rein über ihre Funktion wahrgenommen, die den passiven, unterstützenden Gegenpart für den Narzissmus männlicher Figuren bilden. Erst durch deren Tod, sprich Over her dead body, erfüllt sich männliche künstlerische Produktion, wie Maloof exemplarisch an den Leichen Quecas (La vida breve, 1950) und Ritas (Para una tumba sin nombre, 1959) und der damit verbundenen männlichen Autorschaft Brausens und Díaz Greys ausführt. Die künstlerische Selbstverwirklichung männlicher Figuren basiert demnach auf der (textlichen) Liquidation einer Frauenfigur. Für La vida breve (1950) weist Maloof etwa nach, dass sich allein die Beschreibung der beiden Frauenleichen Queca und Elena Sala aus männlicher Perspektive derart gleichen, dass von einem Muster und einer Entindividualisierung der toten Frauen gesprochen werden kann.44 Seine poetologische Ausarbeitung findet dieses Schema schließlich in Para una tumba sin nombre (1959), insofern die männlichen Erzähler nicht einmal mehr der namentlichen Identität der Toten (sin nombre!) Bedeutung beimessen. Was zählt, ist allein das künstlerisch-diskursive Ergebnis, d.h. wie die Geschichte erzählt wurde.
Diese überwiegend männlich konnotierte künstlerische Schöpfungspotenz in Abhängigkeit zu einem passiven weiblichen Gegenpart beschreibt auch Millingtons Lesart: So konstatiert er in seinen Untersuchungen zunächst eine grundsätzliche Dominanz männlicher Vorstellungen, Perspektiven und Belange in Onettis Texten. Daraus leitet er die Position ‚der Frau‘ als das dem Männlichen gegenüber ‚Andere‘ und infolgedessen deren ausschließlich katalytische Funktion für die fiktiven Biographien der Männerfiguren ab:
Within this male discourse woman is different: she is positioned and given identity in relation to man […]; […] her gender is significant in that she is other […] it is not male, it is other.
[…] the female character is a function, a marker of the male situation.45
Durch die Positionierung ‚der Frau‘ in Abhängigkeit zu männlichen Figuren, wird sie auf die Rolle ‚der Anderen‘ beschränkt. Millington spielt damit implizit auch auf einen konsistenten Phallogozentrismus46 innerhalb der Onetti’schen Erzählungen an. Über eine Funktionalisierung als Marker für männliche Identitätsproblematiken weist die Rolle ‚der Frau‘ in seinen Ausführungen jedoch auch nicht hinaus. Aktive weibliche Handlung liest Millington in Onettis Texten nicht:
Women never initiate action in Onetti’s fiction with a view to changing their situations, but they frequently stimulate male characters to move, and it is that movement which creates the narrative dynamic of the fiction.47
Frauenfiguren fungieren in Onettis Texten demnach exklusiv als indirekt handlungsauslösende Momente, indem sie die männlichen Figuren dazu anregen, ihre Situation zu ändern, sprich: sich zu bewegen (movement)48. Frauen sind nach Millington die statischen, aber gleichwohl impulsgebenden Elemente der Erzählung, während Männer aktiv die Handlung gestalten.
Während Millington die männliche Dominanz innerhalb der dargestellten Räume bei Onetti zwar konstatiert, aber deren räumliche Parameter nicht weiter analysiert, stellt Martínez sie in den Fokus ihrer Untersuchung. In ihren Ausführungen arbeitet sie heraus, dass die Handlungsorte in Onettis Erzählwerk überwiegend männlich homosozial geprägt sind und diese omnipräsente Prägung wiederum bestimmte genderabhängige Machtverhältnisse prägt:
La narrativa de Juan Carlos Onetti, desde El pozo (1939) hasta Cuando ya no importe (1993), articula y reproduce un espacio homosocial por excelencia. Por homosocial se entiende aquí el lugar privilegiado en que los personajes masculinos como sujetos del discurso, llevan a cabo entre ellos transacciones de poder social, económico, y narrativo; mientras que los sujetos femeninos aparecen como objetos de cambio, intercambio o en palabras de Luce Irigaray, como ‚mercancía‘.49
Unter homosozialen Räumen versteht Martínez solche, die durch einen hegemonial männlichen Diskurs geprägt sind – sei es in sozialem, wirtschaftlichem oder narrativem Sinne. Frauen fungieren dabei als Tauschobjekte oder Waren. Homosoziale Räume reproduzieren, wie Martínez weiter ausführt, die Subjekt-Objekt-Relation zwischen Männern und Frauen. In ihnen dominieren Rivalitäten und Komplizenschaften zwischen Männern, Frauen dienen dagegen allein als Sache, über die gesprochen wird.50 Wie Millington arbeitet auch Martínez ‚die Frau‘ allein in ihrer Objekt-Funktion in Bezug auf die Aushandlung männlicher Selbstfindungsproblematiken heraus. Im Zentrum ihrer Analyse steht daher auch kaum die Frage nach heterosozialen Interaktionen, sondern vielmehr die nach homosozialen Beziehungen und insbesondere nach homoerotischer Anziehung zwischen Männern.
Für die vorliegende Arbeit ist dieser Aufsatz jedoch insofern von großem Interesse, als Martínez die männliche Dominanz durch das Konzept des homosozialen Raumes nicht nur diskursiv, sondern auch auf der Ebene der histoire, in physischen Räumen innerhalb der Erzählungen verortet. Sie zeigt auf, in welchem Umfang Frauen in Onettis Texten bereits dadurch, dass sich Handlung überwiegend in homosozial geprägten Settings (wie etwa Bar oder Nachtclub) vollzieht, aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. An Martínez anschließend, stellt sich für die Textanalyse in Kapitel 5 dieser Arbeit die Frage: Welche Räume bleiben den Frauen in Onettis Texten überhaupt, um aktiv zu handeln – zumal innerhalb eines Diskursraums, der durch den männlich-konstituierenden Blick der fiktiven Autorfigur Brausen erschaffen wurde und der kontinuierlich von männlichen Stimmen weitererzählt wird?51
Während Ludmer, Maloof, Martínez und Millington in ihren Untersuchungen die diskursive Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen betonen, dekonstruieren Christopher F. Laferl, Roberto Echavarren, Sonia Mattalia und Teresa Porzecanski diese männliche Suprematie in ihren genderkritischen und queeren Interpretationsansätzen. Echavarren nimmt in seinem Aufsatz „Andrógino Onetti“ (2007) die Unbestimmtheit und Brüchigkeit von Geschlechterkonstruktionen bei Onetti in den Blick.52 Laferl untersucht in seinem Beitrag „Männer interessieren sich für Männer” (2019) die Körperlichkeit und homoerotische Anziehungskraft dreier peripherer Männerfiguren, d.h. er betrachtet homosoziale Subjekt-Objekt-Abhängigkeiten: Erstens die zwischen dem jungen Protagonisten Bob und dem namenlosen männlichen Erzähler in der Kurzgeschichte „Bienvenido, Bob“ (1944), zweitens die zwischen dem schwerkranken ehemaligen Spitzensportler und dem Besitzer des Krämerladens in Los adioses (1954) und drittens die Abhängigkeit zwischen dem abgehalfterten Ringer Jacob van Oppen und seinem Manager Orsini in Jacob y el otro (1959). Laferl gelangt zu dem Schluss, dass Onetti in seinen Texten Konzepte hegemonialer Männlichkeit durch eine „Erosion von Männlichkeit“ dezentriert und damit patriarchale Strukturen dekonstruiert.53
Eine explizit feministische Perspektive nimmt Sonia Mattalia in ihrer Monographie Una ética de la angustia (2012) ein. Ihre Studie bildet damit für die vorliegende Arbeit einen wichtigen Anknüpfungspunkt in Bezug auf die Analyse weiblicher Handlungsmacht in Onettis Texten. Allerdings behandelt Mattalia drei Kurzgeschichten, die keine Verknüpfung zu Santa María aufweisen und wählt einen tiefenpsychologischen Interpretationsansatz: Ausgehend von der Freud‘schen Kernfrage „qué quiere la mujer“54, fokussiert sie weibliches Begehren und dessen explizite Artikulation durch aktive Frauenfiguren, wie etwa die namenlose Protagonistin der Kurzgeschichte „Un sueño realizado“ (1941), Gracia in „El infierno tan temido“ (1957) oder Kirsten in „Esbjerg en la costa“ (1946). In Mattalias tiefenpsychologischer Lesart ruft das artikulierte weibliche Begehren auf Seiten der männlichen Protagonisten Langman („Un sueño realizado“, 1941) und Risso („El infierno tan temido“, 1957) Unverständnis und Unsicherheit hervor. Während die besagten Protagonisten ohnmächtige Statisten bleiben, handeln die aktiven Frauenfiguren frei und selbstbestimmt. Die männlichen Figuren agieren in dieser Lesart passiv oder werden, wie Teresa Porzecanski auch mit Rückgriff auf Jean-Paul Sartre formuliert, zu einem „proyecto en construcción“55. Am Beispiel Baldis, des Protagonisten der gleichnamigen Kurzgeschichte „El posible Baldi“ (1936), arbeitet Porzecanski eine ‚tragische‘, da von unlösbarer Konfliktivität behaftete Männlichkeit in Onettis Texten heraus. Die größte Problematik der männlichen Identitätssuche liegt laut Porzecanski darin, dass ‚der Mann‘ vom Sartre‘schen Diktum, zur Freiheit und damit zur ständigen (Neu)erfindung seiner selbst verdammt zu sein, innerlich zerrissen wird und letztlich in einer unauflösbaren Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung verharrt. Porzecanski folgt in ihrer Untersuchung der essentialistischen Argumentationslinie der französischen Philosophin und Feministin Elisabeth Badinter. In ihrer Monographie Die Identität des Mannes (1997 [1992 franz.]) stellt Badinter Männlichkeit56 im 20. Jahrhundert als konfliktives und in letzter Konsequenz defizitäres Konstrukt dar. In Porzecanskis Lesart sind Baldis Identitätsentwürfe demnach grundsätzlich an die affektive Empathie ‚der Frau‘ gebunden.57
Die bislang umfassendste Werkstudie zu Onetti, La fundación imaginada (2011) stammt jedoch von Ferro, auf dessen Ansatz, Onettis gesamtes Erzählwerk als único texto zu lesen, bereits eingegangen wurde. Mit seiner strukturalistischen Interpretation im Anschluss an die Arbeiten von Ludmer (2009 [1977]), Millington (1985), und Martínez (1992) schreibt Ferro damit dezidiert gegen einen Forschungsdiskurs an, der das Düstere und Nihilistische in Onettis Werk als dessen entscheidende Merkmale herausstellte, es vorrangig existentialistisch las, und verwehrt sich damit auch gegen den oft gestellten Anspruch, einen stringenten, linearen Sinnzusammenhang zwischen Onettis Texten herzustellen.58 Stattdessen plädiert Ferro für eine offene, Fragmentarität und Brüche zulassende (wenn nicht gar kalkulierende) Lektüre:
Considero necesario, en este punto, hacer explícita una toma de distancia con cierta dirección de la crítica, bastante extendida y hasta institucionalizada, que lee la trama de las remisiones intertextuales como una garantía de la certeza de que la obra onettiana estaría construida bajo el signo del deterioro, que Onetti, con una tenacidad casi abusiva, reescribiría insistentemente la misma historia con algunas variaciones: fracaso, vidas desgraciadas, droga, prostitución, miseria moral.59
Ferro verwehrt sich in seiner Analyse gegen eine Lesart, die Onettis Texte als schematische Wiederholungen einer einzigen Geschichte begreift, die allein in der Fokussierung spezifischer Motive wie Scheitern, Drogen, Prostitution etc. variieren. Auf Ferros stattdessen vorgeschlagene Lesart, die Gesamtheit der Onetti’schen Romane und Kurzgeschichten als ein einziges, zusammenhängendes Textkonglomerat zu fassen, wurde bereits auf den ersten Seiten dieser Arbeit verwiesen. Dass an dieser Stelle noch einmal explizit Ferros ‚Ein-Text-Postulat‘ aufgerufen wird, soll die Relevanz dieser philologischen Perspektive für diese Arbeit, verbunden auch mit einer Abgrenzung zum bis dato dominierenden Forschungsdiskurs verdeutlichen. So wird Santa María erst durch Ferros Zugang als metafiktionale Raumfigur in Abhängigkeit zum rioplatensischen Metropolenbild präsanmarianischer Texte lesbar. Anders formuliert heißt das, Santa María wird im Text zuverlässig durch direkte Anspielungen auf Buenos Aires und Montevideo oder (im Laufe des Spätwerks indirekter werdende) Referentialisierung auf eine unbenannte Kapitale konstruiert. Bei der Untersuchung des Textraums Santa María ist es demnach hilfreich, sich auch mit der diskursiven Darstellung der Metropolen Buenos Aires und Montevideo in La vida breve (1950) vorgängigen Texten auseinanderzusetzen. Denn obschon sich das gewählte Textkorpus auf Santa María-Texte beschränkt, bleibt die lateinamerikanische Metropole (exemplarisch dargestellt an Montevideo und Buenos Aires) über weite Strecken ein wichtiger Referenzpunkt für die Konstruktion des imaginären Santa María. Sprich: Das Großstadtbild, das die frühen Texte Onettis vermitteln, ist für diese Arbeit insofern von entscheidender Bedeutung, als die Erfindung Santa Marías sowohl auf diskursiver als auch auf diegetischer Ebene auf den Großstadt-Darstellungen vorangegangener Erzählungen aufbaut.60 So wird in La vida breve (1950) selbst die großstädtische Unübersichtlichkeit und Anonymität und damit einhergehend das Gefühl der Entfremdung, unter dem der fiktive Autor Brausen leidet, und das ihn letzten Endes auch zur Erfindung eines metafiktiven Gegenortes inspiriert, nur marginal oder wie Millington konstatiert, vermittels narrativer Leerstellen dargestellt.61 Diskursiv handelt es sich um räumliche Spiegelungen, welche Santa María als idyllischen Gegenort zu Buenos Aires/Montevideo konstruieren, inhaltlich um die Abkehr des Protagonisten von den Zumutungen der Großstadt und einer damit verbunden Flucht in eine vermeintliche Kleinstadtidylle.
Die mimetisch-dystopische Metropolendarstellung in Onettis frühen Romanen und Kurzgeschichten wird in der Forschung oft mit dem Werk Roberto Arlts, dem Pionier des rioplatensischen Stadtromans, verglichen. Das ‚literarische Erbe‘, das Onetti von Arlt übernimmt, besteht demnach vornehmlich in der negativ konnotierten Darstellung der Großstadt als Ort der Feindseligkeit und Selbstentfremdung des modernen Individuums.62 In seiner Romantrilogie El juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929) und Los lanzallamas (1931) entwirft Arlt die Großstadt (Buenos Aires) als Strudel, wie Rosalba Campra mit Bezug auf ein eigentlich konträres Konstrukt feststellt. So bezog sich dieser Begriff ursprünglich auf den Urwald als die alles verschlingende, zivilisationsfreie Hölle in Eustachio Riveras gleichnamigem Roman La vorágine (1924). Den Gegensatz dazu bildete die zivilisierte Stadt. Nach Campra erhält bei Arlt jedoch genau die ehemals zivilisierte, beherrschbare Stadt die menschenvernichtenden Züge des unkontrollierbaren Urwalds:
La ciudad ya se ha transformado en una vorágine. Los críticos han insistido suficientemente en el papel de Roberto Arlt respecto a la creación de esta imagen de una Buenos Aires sombría. En El juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929), Los lanzallamas (1931), Arlt muestra cómo la ciudad forma, o más bien deforma a los personajes en su cuerpo y en su alma, obligándolos a actuar como seres despiadados y corruptos para poder sobrevivir. El espacio en que se mueven, coherentemente, es mezquino y oscuro: zaguanes, escaleras de caracol, sórdidas piezas amuebladas en las que estas criaturas resentidas rumian su venganza contra el mundo.63
Die Großstadt wird bei Arlt damit zum düsteren (mezquino y oscuro) Dschungel, der die Menschen zwar nicht mehr ‚verschlingt‘ (wie der Dschungel die Protagonisten Arturo und Alicia in La vorágine), jedoch in ihrem täglichen Überlebenskampf moralisch deformiert und korrumpiert (wie etwa Silvio Astier, den Protagonisten von El juguete rabioso (1926), der im Laufe seiner éducation sentimentale zum Verbrecher und Verräter an seinem Freund wird, wie Juan Villoro schreibt)64. Die Feindseligkeit der Großstadt geht dabei in den Körper der Figuren über und deformiert deren Psyche.65 Letzteres mündet in einen schmutzigen, trotzigen Überlebenskampf der einzelnen Individuen. Die entsprechende Kulisse dafür bilden dunkle Flure, Wendeltreppen oder schäbige Pensionszimmer.
In Recorridos urbanos (2009) gelangt Christina Komi zu einem ähnlichen Schluss. Sie vergleicht die medial vermittelte Repräsentation der Großstadt Buenos Aires in Arlts Los siete locos (1929) und Los lanzallamas (1931) mit der Onettis in El pozo (1939), Tierra de nadie (1941) sowie einigen frühen Kurzgeschichten. Das Bild der Stadt, das Komi in ihrer Monographie herausarbeitet, setzt sich daraus zusammen, was die Stadt einerseits an Bedeutungen generiert und wodurch sie andererseits selbst geprägt und verändert wird. Dabei bezieht sich Komi auf das Konzept der analogen Stadt des italienischen Architekten Aldo Rossi.66 Die Idee, die hinter Rossis Überlegungen stand, war, modernen Städtebau nicht nur an infrastrukturellen und ökonomischen Funktionen auszurichten, sondern kulturelle Analogien und Verweise zwischen Architektur und Stadt herauszuarbeiten, um dementsprechend zukunftsweisend zu bauen. Komi transferiert diese originär urbanistische Betrachtungsweise für ihre Studie in die Literaturwissenschaft:
La expresión señala el punto de encuentro entre los componentes materiales del espacio, la memoria y los elementos imaginativos que forjan, también a su manera, este espacio.67
El lenguaje de la ficción percibe, representa e inventa la ciudad y sus lenguajes.68
Sie beschreibt zunächst die Besonderheiten, die das Buenos Aires (bzw. die rioplatensische Großstadt) der Zwischenkriegsjahre von europäischen Metropolen wie Paris oder London unterscheiden. Da ist einerseits die immense Zahl an europäischen Migranten zu nennen, die Buenos Aires zu Beginn des 20. Jahrhunderts in zwei mehr oder weniger parallel existierende Gesellschaften (die Norm-Gesellschaft sowie die davon abgespaltene randständige Gesellschaft der Einwanderer) teilt und andererseits die relative historische Unbeschriebenheit der rioplatensischen Gesellschaft („un tipo de tabula rasa“69). Die industrialisierungsbedingte Verstädterung tut ihr übriges, um die rioplatensische Großstadt der Zwischenkriegsjahre zu dem zu machen, was Komi als reale Vorlage für deren literarischen Repräsentationen bei Arlt und Onetti beschreibt:
La Buenos Aires de los años veinte surge como una ciudad de cemento que crece y se extiende a un ritmo desenfrenado, amenazando no sólo las tradiciones locales sino, más profundamente, la integridad psicológica del individuo que transforma de repente en hombre de masas dentro de una ciudad masificada, en una fracción de la sociedad o en pieza de máquina.70
Der rapide Anstieg der urbanen Bevölkerung sowie die zunehmende Ökonomisierung und Prekarisierung des städtischen Lebens befeuern die Entfremdung des Individuums, wie Komi fortfährt. Das ungebremste physische Wachstum der Stadt bedroht laut Komi nicht nur die ursprünglichen Traditionen, sondern vor allem auch die menschliche Psyche. So leidet das moderne Individuum sowohl in den Texten Arlts als auch in denen Onettis unter gesellschaftlicher Randständigkeit und Vereinsamung. Weiter verhandelt wird der Gegensatz zwischen einem Leben in Gesellschaft (Stadt) und einem Leben in Gemeinschaft (Peripherie, Land). Traum, Exzess und Gewalt sind laut Komi Strategien der städtischen Individuen, um den alltäglichen Entbehrungen und Feindseligkeit der Großstadt zu entfliehen bzw. um sich ihnen entgegenzustellen:
Tanto en Arlt como en Onetti, la ciudad se vive como un mundo atroz, difícilmente tolerable y, a menudo, asociado a la marginación, deliberada o casual. La realidad de la megalópoli aplasta a los individuos y es urgente buscar alternativas. En este contexto, la fabulación, el fraude y el ensueño son mecanismos que introducen en lo real partes de mundos alternativos, con el objeto de restituir lo que falta.71
Während Arlts Protagonist*innen die Großstadt als hypertrophes Gebilde wahrnehmen und sich vornehmlich in (sinnlose) Gewalt gegen sich selbst und andere stürzen, erfahren die Protagonist*innen in El pozo (1939) und Tierra de nadie (1941) die Stadt als fragmentierte Wirklichkeit, der sie sich nicht entgegenstellen, sondern der sie versuchen zu entkommen: Onettis Protagonist*innen ziehen sich in die Privatheit schäbiger Pensionszimmer und Tagträume zurück. Ihre Beziehung zur feindseligen Außenwelt ist weniger durch subjektive Konfrontation (wie etwa Erdosains Selbstmord bei Arlt) als vielmehr durch Kommunikationslosigkeit und Anonymität (sprechend ist in diesem Kontext bereits der Romantitel Tierra de nadie) gekennzeichnet.72
Rocío Antúnez‘ Monographie Caprichos con ciudades (2014) untersucht, wie auch Komi, Texte Onettis vor 1950 (journalistische Arbeiten eingeschlossen) und klammert damit Santa María weitestgehend aus. Anders als Komi fokussiert Antúnez jedoch eine literaturhistorische und biographische Einordnung Onettis in die lateinamerikanische Großstadtliteratur (bezüglich Buenos Aires und Montevideo). Eine weitreichende Beobachtung bezieht sich dabei auf Buenos Aires als ‚Stadt ohne Gedächtnis‘73. Das dadurch fehlende Identifikationspotential (das jede Form von kollektiver Erinnerung eigentlich vermittelt) schlägt sich laut Antúnez auch auf Onettis Protagonisten in Tierra de nadie (1941) nieder und das städtebauliche Äquivalent dieser „ciudad de todos y de nadie“74 findet seine Entsprechung im Mikrokosmos des Hotel- oder Pensionszimmers. Die Dominanz dieser geschichtslosen, nomadischen Wohnform zieht sich leitmotivisch durch Onettis Gesamtwerk. Seine männlichen Protagonisten leben, um Antúnez‘ Überlegungen weiterzuführen, nicht nur in Buenos Aires und Montevideo, sondern auch in Santa María teilweise in Transiträumen, wie etwa Junta Larsen im Hotel Berna (El astillero, 1961).
Eine weitere Forschungsarbeit, deren Ergebnisse für die vorliegende Untersuchung fruchtbar gemacht werden können, ist Andrea Mahlendorffs komparatistisch angelegte Raumstudie Literarische Geographie Lateinamerikas (2000). Mahlendorffs Analysekorpus ist breiter angelegt als das in Komis oder Capras Arbeiten. In ihrer Lektüre rekurriert sie auf Untersuchungen von Fernando Aínsa sowie auf Héctor Alvarez Murenas Essay El pecado original de América (1954).75 Ziel ihrer Analyse ist das Herausarbeiten eines lateinamerikanischen Raumbewusstseins, d.h. die Repräsentation der Stadt bildet nur eine Form von Räumlichkeit ab, die Mahlendorff untersucht. Ihre Lektüre von Tierra de nadie (1941) und La vida breve (ergänzt durch einen Vergleich mit Julio Cortázars Rayuela, 1963) deckt damit auch ein Forschungsdesiderat ab, das die komparatistischen Großstadtstudien von Campra, Komi und Antúnez bezüglich Santa María offenlassen. So zeichnet Mahlendorff in ihrer Untersuchung eine poetologische Genese anhand räumlicher Parameter auf. Santa María beschreibt in dieser Lesart den „Übertritt vom geographischen in den imaginären Raum“76. Den Roman Tierra de nadie (1941) liest Mahlendorff als „Prolog auf den neun Jahre später erscheinenden Roman La vida breve“77. Ähnlich wie Komi sieht auch Mahlendorff die urbanen Individuen in Tierra de nadie (1941) von Vereinsamung, Anonymität und gesellschaftlicher Ohnmacht geprägt:
Aus den vereinsamten Individuen, die Onetti in den Blick nimmt, ergibt sich das bedrückende Bild der anonymen Massengesellschaft, in der es dem Einzelnen nicht gelingt, ein persönliches Profil zu entfalten. Die wesentlichen Kennzeichen dieser Gruppe von Personen, die Onetti in seinem Roman vorstellt, sind Einsamkeit und Gleichgültigkeit. Er entwirft in ihnen eine indifferente Generation, die sich ihrem Schicksal machtlos ausgeliefert sieht.78
Die Entfremdung des modernen Individuums, die Mahlendorff paradigmatisch mit einem Ausspruch Diego Aránzurus79, einem der Protagonisten des Romans Tierra de nadie (1941), belegt, verweist auf das gestörte Verhältnis des vereinsamten Großstädters zu seinen kulturellen Ursprüngen. Ungelöste Identitätskonflikte, die sich in einem Hin- und Hergeworfen-Sein „zwischen Metropole und gran aldea auf der Suche nach dem eigenen Profil“80 artikulieren, dominieren die bruchstückhaften Figuren-Dia- und Monologe, aus denen sich Tierra de nadie (1941) zusammensetzt. Laut Mahlendorff eint alle Figuren das Gefühl persönlicher Schuld und persönlichen Scheiterns. Eine alles umspannende Langeweile beherrsche die gesamte Romanhandlung. Die Stadt werde nicht nur als identitätslos, sondern auch als Gefängnis wahrgenommen, dem es zu entfliehen gelte. „Die Überforderung angesichts einer chaotischen Welt“, so resümiert Mahlendorff die Verfasstheit der Figuren, „macht den Menschen entscheidungs- und handlungsunfähig. Einzige Fluchtburg bleibt die Welt der Imagination.“81 In diesem Sinne deutet Mahlendorff Aránzuru als „Urform Brausens“ und damit als intertextuelle Verbindung zwischen Tierra de nadie (1941) und La vida breve (1950):82
–En fin … Me voy a dedicar a inventarte. ¿Me entendés? Imaginar quién sos. Pensá un poco. Todos estos días juntos, piel con piel. Pero cada uno está preso en sí mismo y … Todo el resto es ilusión. (TN221).
Das laut Mahlendorff zweite offensichtliche Bindeglied zwischen Tierra de nadie (1941) und La vida breve (1950) bildet der Fluss, denn während „el río sucio, quieto, endurecido“ (TN228) den Text Tierra de nadie (1941) beschließt, bildet der Fluss in La vida breve (1950) eine erste topographische Referenz für die Situierung Santa Marías.Das entsprechende Kapitel ist mit „Díaz Grey, la ciudad y el río“ (VB428) überschrieben.
Mahlendorffs Analyse von La vida breve (1950) konzentriert sich auf drei Raummodelle. Sie unterscheidet den „Raum des Alltäglichen“, den „Raum des Nebenan“ und den „Raum der Imagination“ voneinander.83 Der erste Raum verweist auf Juan María Brausens Wohnung in Buenos Aires, die er zusammen mit seiner Ehefrau Gertrudis bewohnt. Den zweiten Raum bildet demnach die symmetrisch gespiegelte Nachbarwohnung der Prostituierten Queca. Santa María, als der Raum der Imagination verstanden, konstituiert „die dritte räumliche Einheit, in der sich das Erzählen vollzieht. Im Vergleich zu den anderen beiden Räumen ist er nicht mehr in der konkreten Geographie Lateinamerikas verortet, sondern beschreibt sozusagen selbst einen Bereich imaginärer Geographie der Neuen Welt.“84 Mahlendorff liest Santa María zudem als „Ort der Erlösung“85, dessen geographischer Mittelpunkt in dem Reiterstandbild Díaz Greys zusammenläuft. Die Erlösung besteht vornehmlich darin, dass sie den Protagonisten Brausen von seiner aufreibenden Identitätsproblematik befreit. In Santa María kann er endlich sein, was er will. Identitäten werden nicht sozial oder gesellschaftlich festgeschrieben, sie sind wandelbar. Hier sieht Mahlendorff auch eine Verbindung zur Existenzphilosophie Martin Heideggers und Jean-Paul Sartres, die postuliert, es obliege jedem Menschen selbst, sich täglich neu zu erfinden:
Onettis Werk erscheint als eine literarische Illustration der Existenzphilosophie Heideggers und Sartres, die darin die absolute Freiheit des Menschen sahen, daß [sic] er nicht an eine vorherbestimmte Form des Daseins gebunden ist, sondern sein Leben auf eine Existenz hin entwirft.86
Diesen Grundgedanken existentialistischer Selbstverantwortlichkeit verknüpft Mahlendorff mit dem Begriff der Ambiguität sowie dem titelgebenden Leitmotiv des kurzen Lebens. Sie konstatiert, dass Brausens Rettung in der Möglichkeit bestehe, kraft der eigenen Imagination mehrere Identitäten, die wiederum an mehrere kurze Leben gebunden seien, für sich zu erschaffen. Jeder dieser Identitäten wird in Mahlendorffs Lesart ein eigener Raum zugeschrieben.
Diese Arbeit übernimmt die Begrifflichkeiten Mahlendorffs mit oben beschriebenen theoretischen Implikationen. Um die Provenienz der Termini kenntlich zu machen, werden sie in der Textanalyse kursiv verwendet.
2Grundlegende theoretische Implikationen zur Verknüpfung von Raum, Macht und Gender
You could see your own house
as a tiny fleck on an ever-widening landscape,
or as the center of it all from which
the circles expanded into the infinite unknown.
It is that question of feeling at the center
that gnaws at me now.
At the center of what?
WEAREHEREBECAUSEYOUWHERETHERE.87
Adrienne Rich (1984)
Ende der 1960er Jahre proklamierte Michel Foucault ein ‚Zeitalter des Raumes‘: „Wir leben im Zeitalter der Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, des Nahen und Fernen, des Nebeneinander und des Zerstreuten.“88 Und weiter: „Heute tritt die Lage an die Stelle der Ausdehnung, […]. Die Lage wird bestimmt durch Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Punkten oder Elementen […].“89
Analog dazu lässt sich auch Onettis Gesamtwerk, in der monographischen Lesart Ferros, als ein textliches ‚Neben- und Ineinander‘, als eine Ansammlung stark selbstbezüglicher Äußerungen, Motive, Semantiken etc. begreifen, die in eine spezifisch Onetti’sche Poetologie mündet. Weiter verstärkt wird diese räumlich ausgerichtete Ordnung durch die raumbasierten Figuren der Repetition, Metonymie, Fragmentierung oder Ellipse. Die fragmentierende Beschreibung wird in Onettis Texten vor allem an einer Deplatzierung von Objekten sichtbar. Durch grammatikalische Bedeutungsverschiebungen erscheinen Gefühle, Wahrnehmungen, Gesten oder Mimik im Wortsinne ‚wesentlich‘ und vom Körper abgekoppelt. Sie werden personifiziert und mit neuer Bedeutung aufgeladen: „[…] me voy levantando, estiro el dolor de las piernas.“ (JC384). Anstatt der Beine streckt die Person den Schmerz (in den Beinen) aus, d.h. Onetti verschiebt durch die Personifizierung des Schmerzes den Fokus vom Materiellen (Körper) auf die reine Wahrnehmung (Schmerz) und verstärkt diese dadurch. Schmerz (Empfindung) wird vom Körper separiert.90 Besonders häufig wird der Typus der fragmentierenden Beschreibung im Zusammenhang mit der Personifizierung von risa oder sonrisa angewendet: „La risa bailó un solo círculo sobre la mesa.“ (TN43) Das Lachen wird zu etwas Eigenständigem, in dieser Szene sogar zu einem Produzenten von szenischer (nicht wie zu vermuten, auditiv wahrnehmbarer) Kunst: Das Lachen tanzt. Bei der ersten Begegnung zwischen Junta Larsen und Angélica Inés in El astillero (1961) nimmt Larsen das Lachen der Frau als eine Art Korrespondenz zwischen ihr und dem Raum wahr: „[…][Angélica Inés] reía a sacudidas, con la cara asombrada y atenta, como eliminando la risa, como viéndola separarse de ella, brillante y blanca, excesiva; alejarse y morir en un segundo, derretida, sin manchas ni ecos, sobre el mostrador, sobre los hombros del dueño, entre las telarañas que unían las botellas en el estante.“ (AS159) Ähnlich einem kubistischen Gemälde dekonstruiert Onetti dabei die Mimik einer Figur und setzt sie in neuer Anordnung, mit neuem Fokus wieder ins Bild. Das Lachen wird in diesem Fall nicht nur auditiv und optisch (als Gesichtsbewegung) wahrgenommen, sondern personifiziert (alejarse y morir). Es scheint sich zu materialisieren (derretida) und vom Körper zu lösen (sobre el mostrador, sobre los hombros del dueño, entre las telarañas). Durch die Figur der Hypallage (brillante y blanca als Charakterisierungen, die eigentlich mit den Zähnen, die sich beim Lachen zeigen, jedoch nicht mit dem Lachen selbst assoziiert werden) findet eine zusätzliche grammatikalische Verschiebung statt: von den Zähnen (die jedoch nicht im Text genannt sind, sondern allein durch die Kombination der beiden Adjektive brillante y blanca evoziert werden) zum Lachen. Die Logik mimetischer chrono- oder topographischer Deskriptionen gerät hingegen in den Hintergrund bzw. ist dieser autopoetischen Ordnung unterworfen. Onettis Texte sind nicht über eine kartographisch nachvollziehbare Topographie oder eine urbane Genealogie strukturiert, sondern über die Beziehungen der Figuren untereinander und zudem in Wechselwirkung mit dem Raum. Entsprechend wird Raum in vorliegender Arbeit als Träger kultureller Einschreibungen, Differenzen, Machtrelationen, Hierarchisierungen etc. fassbar. Konzeptionell geht diese Raumbetrachtung auf eine Reihe einflussreicher deutscher Vordenker wie Walter Benjamin und Georg Simmel oder Friedrich Ratzel zurück.91 Doch erst auf ‚Umwegen‘ fand diese Perspektive wieder Eingang in die aktuelle, deutschsprachige Raumtheorie: So zeichnete sich, wie u.a. Doris Bachmann-Medick feststellt, die deutsche Geisteswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst durch eine skeptisch-zurückhaltende Haltung gegenüber Raumfragen aus, die vor allem auf der historischen Erfahrung der imperialistischen Raum-Politik der Nationalsozialisten beruhte. Erst ab den 1970er Jahren griffen postkoloniale und soziologische Ansätze internationaler Forscher wie Edward Soja, Edward Said, Gayatri Spivak oder Homi Bhabha die analytische Verknüpfung von Raum- und Machtfragen wieder auf und leiteten damit eine (Re)Politisierung von Raum ein.92 Diese fand durch die Rezeption von Soja et al. auch wieder Eingang in den deutschen Diskurs.
Entsprechend wissen wir im 21. Jahrhundert nicht nur um die geopolitische Bedeutung von Kriegen oder der Folgen des Klimawandels, sondern auch um die symbolische Situierung von Macht an bestimmten Orten, wie etwa Regierungsvierteln oder Finanz-, Wirtschafts- und Technologiezentren. Massey hebt zudem hervor, dass die Situierung von gesellschaftlicher, politischer oder ökonomischer Macht entscheidend von geschlechterspezifischen Prämissen abhängt und dadurch bis heute eine spezifische Machtverteilung zwischen Männern und Frauen manifestiert. Grundlegend dafür ist laut Massey eine bis in die Antike zurückreichende Aufteilung in öffentlichen und privaten Raum, der in der westlichen Tradition geschlechterspezifische Machtverteilungen eingeschrieben sind:
One of the most evident aspects of this joint control of spatiality and identity has been in the West related to the culturally specific distinction between public and private. The attempt to confine women to the domestic sphere was both a specifically spatial control and, through that, a social control on identity.93





























