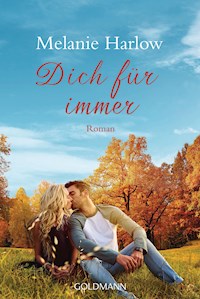Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cloverleigh-Farms-Romance-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er war immer mein Fels in der Brandung - doch jetzt schlagen die Welle über uns zusammen.
Als ich 16 war, rettete Noah McCormick mir das Leben. Seitdem ist er nicht nur mein bester Freund, sondern auch die einzige Person, der ich blind vertraue. Nie hätte ich gedacht, dass ich jemals mehr von ihm wollen würde - bis jetzt.
Es ist das erste Mal seit Jahren, dass wir uns wiedersehen, und definitiv das erste Mal, dass ich ihn überrasche, als er gerade aus der Dusche kommt. Mit einem Mal sind alle meine Vorsätze über Bord geworfen und wir können gar nicht mehr die Finger voneinander lassen. Die Grenzen sind klar gesetzt: Er will keine Beziehung, und ich reise in einer Woche wieder nach Hause - 700 Meilen weit entfernt.
Es ist eine lockere Affäre. Und mehr will ich auch gar nicht ... oder?
Eine prickelnde Friends-to-Lovers-Romance. Der dritte Band der Cloverleigh-Farms-Romance-Reihe von Melanie Harlow.
Stimmen unserer Leserinnen und Leser:
»Die Autorin nimmt uns mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle( und lässt uns lange um einen guten Ausgang bangen).« (1Leseratte aus Erfurt Amazon 16.05.2022)
»Wunderschöner Roman, der mich sehr berührt hat.« (yh110by Lesejury 22.05.2022)
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin:
Only Us – Unwiderstehlich
Only Us – Unvergesslich
Über dieses Buch
Noah McCormick und ich waren immer nur gute Freunde. Obwohl er schon mit 16 ziemlich süß war und mittlerweile ein unglaublich heißer Sheriff ist, war er immer nur mein großer Beschützer, dem ich blind vertrauen konnte. Das wollte ich nie aufs Spiel setzen.
Bis ich ins Bad geplatzt bin, als er gerade aus der Dusche kam – splitterfasernackt und einfach nur zum anbeten. In dem Moment wollte ich nichts weiter, als alle meine guten Vorsätze über Bord werfen.
Ich hätte wegschauen sollen, mich entschuldigen sollen. Oder zumindest hätte ich ihm ein Handtuch geben können. Aber ich konnte einfach nicht. Und nach all den Jahren, in denen wir nur befreundet waren, können wir auf einmal die Finger nicht mehr voneinander lassen.
Er hat klargemacht, dass er keine Beziehung will. Und das ist absolut in Ordnung für mich, denn in weniger als einer Woche reise ich wieder ab – zurück in mein richtiges Leben.
Es ist alles nur eine lockere Affäre. Und mehr will ich auch gar nicht ... oder?
Über die Autorin
Melanie Harlow bevorzugt ihre Martinis trocken, ihre Schuhe hoch und liebt abenteuerliche, romantische Geschichten mit allen schmutzigen kleinen Details. Ihre Bücher handeln von modernen Paaren, Menschen wie du und ich, die mit ganz alltäglichen Problemen kämpfen und oft Rückschläge hinnehmen müssen, bis sie letztendlich doch die wahre Liebe finden. Melanie lebt mit ihrem Mann, zwei Töchtern bei Detroit.
Melanie Harlow
Unerreichbar
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Melanie Harlow
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Insatiable«
Published by arrangement with Bookcase Literary Agency and Rebecca Friedman Literary Agency.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Maike Hallmann
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © Shift Drive/shutterstock; Mari Dein/shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0772-5
be-ebooks.de
lesejury.de
Für meine Familie
Kapitel 1
Noah
Sie hieß Dottie, war knapp über neunzig und bei uns auf der Polizeiwache als Stammgast bekannt.
Ich hielt am Freitagabend um kurz vor sieben vor ihrem Haus. Bisher war während meiner Schicht nicht viel los gewesen – größtenteils routinemäßige Verkehrskontrollen und einige Einsätze, aber keine Notfälle. Das war in einer Kleinstadt wie Hadley Harbor die Norm.
Auch Dottie war definitiv kein Notfall.
Diesmal hatte sie den Notruf gewählt, weil sie ganz sicher war, dass jemand nachmittags, als sie eingekauft hatte, in ihr Haus eingebrochen sei. Zwar hatte der Eindringling nichts gestohlen, aber die Möbel in ihrem Wohnzimmer neu arrangiert. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, das Blaulicht auf meinem Wagen einzuschalten.
»Ich bin gleich wieder da, Renzo.« Mein treuer belgischer Schäferhund blieb auf der Rückbank des Explorers – seine Mimik verriet mir, dass er darüber nicht glücklich war –, und ich stieg aus und ging zum Haus. Wie immer beobachtete Renzo mich wachsam durchs Autofenster, aber bei diesem Einsatz drohte keinerlei Gefahr.
Trotzdem war es gut zu wissen, dass er aufpasste, egal, was geschah.
Ich klopfte an die Haustür des ortstypischen, zweistöckigen Backsteinhauses, und keine zehn Sekunden später stand Dottie Jensen vor mir und strahlte mich so breit an, dass ich ihr komplettes Gebiss betrachten konnte. Sie hatte wahrscheinlich bereits aus dem Fenster gespäht. »Ah, hallo, Deputy McCormick. Ich hatte gehofft, dass Sie es sein würden.«
»Hallo, Mrs Jensen. Ich bin's.«
Sie schaute an mir vorbei zur Straße, wo mein Hundestaffel-Einsatzfahrzeug parkte. »Haben Sie Ihr Hündchen nicht mitgebracht?«
Jedes Mal dieselbe Frage. Ich atmete tief durch, um nicht die Geduld zu verlieren, und beantwortete sie. Wieder einmal. »Doch, er ist immer bei mir. Aber er ist im Auto.«
»Ist es im Wagen nicht zu warm für ihn?«
»Es ist ein kühler Abend, und das Einsatzfahrzeug ist klimatisiert.«
»Würde er nicht lieber mit hereinkommen?«
»Am besten komme ich erst mal rein und sehe mich um, und sobald Sie mir erzählt haben, was passiert ist, und ich alle Informationen beisammen habe, lasse ich ihn heraus, damit Sie ihn begrüßen können.«
»Das klingt wunderbar«, sagte sie eifrig. »Bitte, kommen Sie doch herein.«
»Danke.«
Sie zog die Tür weiter auf und machte mir Platz, damit ich in die Diele treten konnte. Das Haus war still und roch nach einer Mischung aus Möbelpolitur und dem, was immer sie sich zum Abendessen zubereitet hatte.
»Kann ich Ihnen etwas anbieten?«, fragte sie. »Ein Glas Limonade? Kekse? Oder möchten Sie etwas Richtiges essen? Ich habe heute Nachmittag beim Metzger wunderbare Schweinekoteletts gekauft und sie mir zum Abendessen gebraten. Mögen Sie Ihr Kotelett mit Apfelmus?«
»Nein, danke, Ma'am.« Obwohl der Hunger an mir nagte, musste ich mich an das übliche Prozedere halten. Die einsame alte Mrs Jensen würde mich stundenlang hier festhalten, wenn ich es zuließ. Sie tat mir leid – ihr Mann war nach über sechzig Jahren Ehe vor wenigen Monaten gestorben –, und ich schenkte ihr immer ein bisschen Zeit, wenn ich es einrichten konnte, aber mein Dienst endete in ungefähr zwanzig Minuten, und ich wollte rechtzeitig zu Hause sein, um mir das dritte Spiel der World Series anzusehen.
Aus dem Flur warf ich einen Blick in das Wohnzimmer rechts von mir, dann ins Esszimmer auf der linken Seite. Alle Räume sahen haargenau so aus wie bei meinem letzten Besuch. »Wenn ich es recht verstanden habe, glauben Sie, dass jemand eingebrochen ist?«
»Oh ja. Da bin ich mir ganz sicher.« Mrs Jensen rang mit knotigen Fingern die Hände und riss die Augen auf. Ihre Stirn lag in Falten.
»Können Sie mir erzählen, was passiert ist?«
Sie nickte und strahlte, als hätte ich sie gerade zur Königin von England gekrönt. »Ja. Es ist so, ich war zum Einkaufen in der Stadt – ich habe einen Braten geholt, weil mein Sohn George zu Besuch kommt, und Sue, seine Frau, hat nie gelernt, wie man einen Schmorbraten so zubereitet, wie ich es ihr gezeigt habe, aber Sue ist eben eine dieser Karrierefrauen, Sie wissen schon, und ich glaube nicht, dass es ihr sehr wichtig ist, was sie abends auf den Tisch stellt.« Sie senkte die Stimme und fuhr hinter vorgehaltener Hand verschwörerisch fort. »Sue ist auch keine großartige Hausfrau, um die Wahrheit zu sagen, aber wir können nicht viel tun hinsichtlich der Partner, die unsere Kinder sich aussuchen. Haben Sie Kinder, mein Lieber?«
»Nein, Ma'am.« Ich wappnete mich gegen die unausweichlichen Nachfragen.
»Warum denn nicht? Will Ihre Frau keine Kinder haben?«
»Ich habe auch keine Ehefrau, Mrs Jensen.« Was ich ihr schon mindestens fünfzig Mal erzählt hatte, und jedes Mal reagierte sie auf die gleiche Weise.
»Keine Ehefrau?« Sie prallte zurück. »Aber Sie müssen doch bereits an die dreißig sein, Deputy McCormick.«
»Dreiunddreißig, Ma'am.«
»Dreiunddreißig! Als Mr Jensen dreiunddreißig war, waren wir bereits zwölf Jahre verheiratet. Und hatten vier Kinder. Insgesamt hatten wir sechs, wissen Sie.«
»Ich weiß.« Ich dachte an das kalte Bier, das in meinem Kühlschrank wartete, und kämpfte gegen den Drang an, auf meine Armbanduhr zu schauen.
»Und wir waren siebenundsechzig Jahre lang verheiratet, bis er gestorben ist. Er ist im vergangenen Frühling gestorben. Am neunten April.«
Auch das wusste ich, denn danach hatten ihre Anrufe in der Dienststelle angefangen, wegen ihrer »Notfälle«.
Manchmal hörte sie Geräusche und dachte, es wäre jemand im Haus. Manchmal fehlte irgendein Gegenstand, der wieder auftauchte, sobald ein Beamter erschien und ihr bei der Suche half. Zweimal hatte sie behauptet, sie sei gestürzt und brauche Hilfe, um wieder aufzustehen, aber in beiden Fällen hatte sie sich von allein wieder aufgerappelt und die Tür geöffnet, als die Beamten klopften. Jedes Mal tat sie alles in ihrer Macht Stehende, um die Helfer so lange wie möglich in ihrem Haus festzuhalten, und meist bedeutete das, ihnen Essen anzubieten, ihnen ihre Lebensgeschichte zu erzählen, ihre Nase in die persönlichen Angelegenheiten der diensthabenden Beamten zu stecken und ungefragt Ratschläge zu erteilen.
Sie war eine über neunzigjährige Nervensäge, und ich hatte bereits eine Mutter, die mir wegen meines ewigen Junggesellentums die Hölle heiß machte – nicht zu knapp –, aber es machte mir nichts aus, herzukommen und nach dem Rechten zu schauen, selbst wenn es vor allem darum ging, ihre Einsamkeit ein wenig zu lindern. Es gehörte zum Job. Es war das, was auch mein Dad getan hätte, und er war der beliebteste Sheriff gewesen, den dieses County je gehabt hatte. Er hatte verstanden, dass noch mehr hinter dem »Dienen und Beschützen« steckte, das Teil unseres Berufseids war, als Verhaftungen vorzunehmen oder Verbrechen zu verhindern.
»Ja, Ma'am. Ich hatte das Glück, Mr Jensen mehrmals zu begegnen. Wir auf der Polizeiwache mochten ihn alle sehr.«
Sie lächelte glücklich. »Er war ein Schatz. Und so gut aussehend. Die Mädchen haben immer alle versucht, seine Blicke auf sich zu ziehen. Also ... gibt es denn niemanden, der Ihre Blicke auf sich zieht?«
»Im Moment nicht, Ma'am.«
»Aber wollen Sie denn keine Familie gründen?«
»Ich habe Familie. Ich glaube, Sie kennen meine Mom, Carol McCormick. Sie ist Krankenschwester in der Hausarztpraxis hier in Hadley Harbor.«
»Ach, natürlich.« Mrs Jensen nickte. »Carol ist einfach entzückend. Ich kannte auch Ihren Vater. Wir haben Sheriff McCormick sehr geliebt. Es hat Mr Jensen und mir sehr leid getan, als er gestorben ist.«
»Danke. Ich habe außerdem einen Zwillingsbruder, eine Schwester und einen Schwager sowie zwei Neffen und eine Nichte. Und Renzo. Jede Menge Familie ringsum.« Ich lächelte sie an und versuchte, die Angelegenheit zu beschleunigen. »Also, als Sie aus der Stadt nach Hause gekommen sind, stand Ihre Haustür da offen? Oder war sie nicht abgeschlossen?«
Sie sah kurz verwirrt aus. »Warum sollte ich die Tür nicht abgeschlossen haben?« Dann fiel es ihr wieder ein, und sie schnippte mit den Fingern. »Oh! Ach ja. Die Haustür war einen Spalt breit geöffnet, aber ich weiß, dass ich sie zugezogen und abgeschlossen habe, bevor ich gegangen bin. Ich bin ganz allein hier, und obwohl es eine kleine Stadt ist, kann man nie vorsichtig genug sein.«
Ich nickte. »Aber es war niemand im Haus, als Sie hineingegangen sind?«
»Nein, niemand. Der Schuft muss gegangen sein, nachdem er die Möbel umgestellt hatte.«
»Aber es fehlt nichts?«
»Soweit ich es erkennen kann, nicht«, sagte sie beinahe bedauernd und rang die Hände, während sie sich zu dem fraglichen Raum umschaute, als wäre sie irgendwie enttäuscht darüber, dass das Familiensilber nicht verschwunden war.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich trotzdem einmal umsehe?«
Sie schien glücklich über den Vorschlag zu sein und tätschelte meinen Arm. »Natürlich nicht. Gehen Sie nur hinein. Lassen Sie sich Zeit, so viel Sie brauchen. Und in der Zwischenzeit mache ich Ihnen einen schönen Imbiss fertig. Mr Jensen hat abends um diese Zeit immer einen kleinen Imbiss zu sich genommen.«
Statt ihr zu widersprechen, stimmte ich zu und ging ins Wohnzimmer, während sie sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung machte, in die Küche. Sie bewegte sich langsam, mit dem vorsichtigen Schlurfen einer kleinen alten Dame, aber sie summte eine Melodie vor sich hin, und ich wusste, dass ich ihr gegeben hatte, was sie brauchte – Zeit und Aufmerksamkeit.
Im Wohnzimmer gab es keine Anzeichen dafür, dass irgendwelche Möbel umgestellt worden waren. Aber für den Fall, dass mein Gedächtnis mich trog, hob ich ein Ende des Sofas hoch. Die tiefen Abdrücke, die die Sofafüße im Teppich hinterlassen hatten, verrieten mir, dass es schon seit einer ganzen Weile dort stand. Wahrscheinlich seit 1951, dem Jahr, in dem die frisch vermählten Jensens hier eingezogen waren, wie sie mir schon mehrmals erzählt hatte.
Es war ein hübsches Haus in einer ruhigen Straße in einer friedlichen Stadt, die perfekte Umgebung, um eine Familie großzuziehen. Ich betrachtete die gerahmten Fotos, die dicht an dicht auf dem Kaminsims standen, in den Bücherregalen und auf Beistelltischen. Ein zimmergroßer Schrein, dem Leben einer Familie gewidmet, das sich fast über ein Jahrhundert erstreckte. Ein schwarz-weißes Hochzeitsfoto aus den 1920ern. Ein weiteres aus den Fünfzigern. Babys bei Taufen. Familienfotos, die fünf Generationen an Feiertagen, Hochzeiten, Geburtstagen und Jubiläen aus früheren Jahren zeigten. Kinder, Enkelkinder und Urenkel.
Ich dachte an das Haus meiner Mutter, das ebenfalls voller Familienfotos war. Doch zu ihrem ewigen Kummer gab es da nur zwei Hochzeitsfotos – ihr eigenes und das meiner Schwester Nina. Sie hatte immerhin drei Enkelkinder, und ein weiteres war unterwegs, dank meiner Schwester Nina und meinem besten Freund Chris, die gleich nach unserer ersten Dienstzeit bei der Armee geheiratet hatten. Ungeachtet der Tatsache, dass wir uns beide für vier weitere Jahre verpflichtet und jeder noch zwei Kampfeinsätze absolviert hatten, war es ihm gelungen, sie während dieser Zeit zweimal zu schwängern, und dann noch zweimal, seit wir wieder zu Hause waren.
Ich dachte nicht gern über die Logistik dahinter nach, aber ich fand es wunderbar, ihren Kindern ein Onkel zu sein – dem achtjährigen Harrison, der sechsjährigen Violet und dem vierzehn Monate alten Ethan. Jeden Moment konnte das vierte Kind kommen, und meine Mutter lag mir ständig in den Ohren, dass ich langsam aufholen müsse, als wären wir Teilnehmer bei einer Art Fortpflanzungswettbewerb.
Sie hielt sich sogar einen Bereich auf ihrem Kaminsims frei und behauptete, sie warte darauf, dass ich heiratete und Kinder bekäme, damit sie dort etwas aufstellen könne. Wenn ich bei ihr zu Besuch war, fand sie immer einen Moment Zeit, um auf das leere Stück Kaminsims zu starren und sehnsüchtig zu seufzen oder es mit einem Tuch abzustauben. Letztes Jahr zu Weihnachten hatte ich ihr ein gerahmtes Foto von Renzo und mir geschenkt und ihr gesagt, dass es besser nicht werden würde. Sie hatte missbilligend geschnaubt, das Foto aber fortan stolz zur Schau gestellt. Sie liebte diesen Hund fast so sehr wie ich.
»Huhu, Deputy McCormick, Ihr Imbiss ist fertig!«, rief Mrs Jensen.
Ich seufzte, ging durchs Esszimmer zurück und dann in die Küche. Mrs Jensen hatte einen Teller mit einem Sandwich auf den Tisch gestellt, außerdem Kartoffelchips und eine Scheibe eingelegte Gurke. Neben dem Teller stand ein Glas Milch, und sie hatte den Stuhl für mich herausgezogen.
»Es ist ein Sandwich mit gegrilltem Speck, Salat und Tomate auf getoastetem Brot, genau wie Mr Jensen es immer mochte.« Sie lachte und schüttelte den Kopf. »Gott behüte, wenn ich mal vergessen habe, das Brot zu toasten!«
»Vielen Dank, Ma'am, aber ich kann wirklich nicht bleiben. Meine Schicht ist gleich zu Ende, und ich muss zurück aufs Revier und noch Papierkram erledigen, bevor ich mit Renzo für heute Feierabend mache.« Und Sie stehlen mir meine Baseball-Zeit, Lady.
»Oh.« Sie sah geknickt aus. »Können Sie zurückkommen, wenn Sie fertig sind?«
Lächelnd schüttelte ich den Kopf. »Das ist leider nicht möglich.«
»Nun, wie wäre es dann, wenn ich ihnen das hier einpacke? Es hat ja keinen Sinn, es umkommen zu lassen, nicht wahr?«
Ich dachte einen Moment lang nach. »Nein, sicher nicht.«
»Wunderbar.« Das Lächeln kehrte auf ihr Gesicht zurück. »Lassen Sie mich das kurz für Sie in einen Beutel packen, dann können Sie sich auf den Weg machen.«
»Danke. Ich habe mich im Wohnzimmer umgesehen, aber mir ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Sollte sich herausstellen, dass doch irgendetwas fehlt, geben Sie uns einfach Bescheid.«
»Oh, das werde ich tun«, versicherte sie mir und holte eine braune Papiertüte aus einer Schublade. »Ich rufe immer den Sheriff an, wenn ich einen Notfall habe.«
Und auch, wenn Sie keinen haben, dachte ich bei mir. Aber ich brachte es nicht über mich, deswegen ärgerlich zu sein. Ich kannte das Gefühl, jemanden zu vermissen. Manchmal setzte es einem sehr zu.
Einige Minuten später hatte ich die Provianttüte in der Hand, und die alte Dame folgte mir auf dem Gartenweg zu meinem Wagen. Durchs Fenster sah ich Renzo erwartungsvoll mit dem Schwanz wedeln. Ich öffnete die Tür, und er sprang aufgeregt und glücklich ins Gras. Er trug ein Halsband mit der Aufschrift »Hundestaffel«, komplett mit einem Sheriff-Abzeichen.
»Sitz«, befahl ich ihm, und er gehorchte. »Braver Junge.«
»Darf ich ihn streicheln?«, fragte Mrs Jensen.
»Natürlich.«
Sie tätschelte ihm ein paarmal den Kopf. »Wie alt ist er noch mal?«
»Er ist fünf.«
»Ach du meine Güte, so ein großer Hund! Und er ist erst fünf Jahre alt. Er wiegt bestimmt hundert Pfund!«
»Er wiegt etwa achtzig Pfund, was durchschnittlich ist.«
»Er scheint sehr lieb zu sein.«
»Er kann lieb sein.« In der dienstfreien Zeit war Renzo ein übermütiges Energiebündel und wollte immer nur spielen, aber bei der Arbeit war er eine hervorragend trainierte, knallharte Maschine – schnell, wendig, aggressiv, brutal, wenn nötig, und mir gegenüber unglaublich loyal. Manchmal hatte ich das Gefühl, als hätte auch ich zwei Seiten in mir, daher passten wir gut zusammen. Er war seit drei Jahren bei mir.
»Darf er einen kleinen Snack haben?«, fragte Mrs Jensen hoffnungsvoll. »Ich habe keine Hundeleckerlis, aber vielleicht einen Keks? Weil er so brav gewartet hat?«
Ich schüttelte den Kopf. »Danke, aber Diensthunde sollten nicht mit Essen belohnt werden.«
»Warum denn nicht?«
»Nun, bei unseren Durchsuchungen treffen wir häufig auf Nahrungsmittel und wollen nicht, dass er sich davon ablenken lässt, weil er fressen will, statt seine Aufgabe zu erfüllen.«
»Ah, ich verstehe.« Sie seufzte sehnsüchtig. »Dann sage ich jetzt mal gute Nacht, Deputy McCormick. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.«
»Gute Nacht, Mrs Jensen. Und danke für das Sandwich.« Ich hielt die Tüte hoch, und Renzo sprang wieder in den Wagen.
»Gern geschehen. Ich habe Ihnen auch ein kleines Leckerli eingepackt, mein Lieber. Es ist nicht selbst gemacht, aber meine kleinen Enkelkinder liebten die immer. Und obwohl die Enkel inzwischen größtenteils erwachsen sind und nicht mehr so oft zu Besuch kommen, kann ich irgendwie nicht aufhören, sie zu kaufen. Albern, nicht wahr?«
»Nein, das verstehe ich.« Schließlich redete ich bei Ballspielen auch immer noch mit meinem Dad, als säße der ein paar Schritte weiter im Fernsehsessel, statt auf dem katholischen Friedhof um die Ecke begraben zu sein.
»Sie sind ein Schatz.« Sie lächelte, als hätte sie plötzlich eine Eingebung. »Wissen Sie was? Ich habe eine Enkelin, die fast in Ihrem Alter ist, und ich glaube, Sie würden perfekt zueinander passen. Wie wäre es, wenn ich ...«
»Auf Wiedersehen, Mrs Jensen.« Ich schnitt ihr das Wort ab, ging um den Explorer herum und ließ mich auf den Fahrersitz sinken. Auf keinen Fall wollte ich mich in die Fänge einer weiteren Möchtegernkupplerin dieser Stadt begeben. Es schien, als wäre jeder im Umkreis von fünfzig Meilen überzeugt, »das perfekte Mädchen« für mich zu kennen, mit dem ich »sesshaft« werden konnte. Ganz gleich, wie oft ich betonte, dass ich nicht auf der Suche sei, ich schien damit nie durchzudringen.
Bist du nicht einsam?, fragte man mich.
Ganz und gar nicht, antwortete ich stets, und das war überwiegend die Wahrheit. Es gab Zeiten, in denen ich weibliche Gesellschaft vermisste – ein mitfühlendes Lächeln am Ende eines harten Tages. Einen weichen, sexy Körper in der Nacht, jemanden, dem ich Lust bereiten und mit dem ich herumtollen konnte. Aber meine letzte Trennung hatte mir die Freude an Beziehungen endgültig ausgetrieben, und die wenigen Dates mit »perfekten« Frauen hatten mir danach nur gezeigt, wie gut manche Menschen verbergen konnten, dass sie in Wirklichkeit vollkommen durchgeknallt waren. Mein Sexleben war ein wenig traurig, aber niemand sagte je: Hey, Noah, ich kenne da eine völlig normale Frau mit einem bombastischen Lächeln und einem fantastischen Körper, die für eine Nacht auf der Durchreise in der Stadt ist. Darf sie rüberkommen und dir einen blasen?
Bis so etwas geschah, würde ich hier und da mit einer Dürreperiode zurechtkommen müssen.
Ich trug auf meinem Laptop ein paar Notizen über den Besuch bei Mrs Jensen ein, dann fuhr ich los. Auf dem Weg zum Revier klaubte ich das Sandwich aus der Tüte und biss hinein. Ich hatte seit einer Ewigkeit kein BLT-Sandwich mehr gegessen, und tatsächlich schmeckte es verdammt gut.
»Sie ist gar nicht so übel, nicht wahr?«, fragte ich Renzo. »Etwas neben der Spur vielleicht, aber ich schätze, das hat sie sich verdient.«
Als ich auf dem Parkplatz hinter der Polizeiwache einbog, hatte ich das Sandwich, die Chips und die saure Gurke aufgegessen. Ich erinnerte mich, dass sie ein kleines Leckerli erwähnt hatte, und stöberte mit der freien Hand in der Tüte herum.
Als ich ein Twinkie herauszog, musste ich lachen.
Es erinnerte mich an jemanden.
Kapitel 2
Meg
Seit ich denken konnte, bewältigte ich extremen Stress damit, Twinkies zu essen.
Wirklich idiotisch viele Twinkies.
Das war total kindisch und wahnsinnig ungesund – meine Arterien waren wahrscheinlich längst unwiderruflich verstopft von dem ganzen köstlichen goldenen Biskuitteig und der süßen, schaumigen Cremefüllung, aber ich kam nicht dagegen an – Twinkies hatten einfach etwas so Tröstliches an sich.
Doch nicht einmal meine Lieblingskuchen hätten geholfen, als ich an einem Freitagabend nach Hause kam und meinen Freund, mit dem ich seit drei Jahren zusammen war, beim Packen antraf.
»Was soll das heißen, du gehst?« Ich starrte Brooks ungläubig an und beobachtete von der Schlafzimmertür aus, wie er systematisch sauber gefaltete, blütenweiße Unterhemden in seinem Koffer stapelte.
»Ich habe den Job bei dieser Kanzlei in Manhattan angenommen. Mein Zug geht heute Abend.«
»Heute Abend!« Ich trat in den Raum, und mein Magen rutschte mir in die Kniekehlen. »Du ziehst heute Abend nach Manhattan?«
»Ja«, bestätigte er ruhig.
»Aber ... aber was ist mit uns?«
»Ich bitte dich, Meg. Du weißt, dass es kein uns mehr gibt.« Seine Stimme war vollkommen sachlich.
Normalerweise wusste ich seine unerschütterliche Haltung zu schätzen – sie lieferte ein gutes, ruhiges Yin zu meinem impulsiveren Yang –, aber ich kam nicht umhin, mich von dieser Wendung der Ereignisse ein bisschen überrumpelt zu fühlen. Außerdem ärgerte ich mich ein klein wenig darüber, dass er überhaupt kein Gefühl zeigte. Drei Jahre waren eine lange Zeit, auch wenn das letzte Jahr nicht sehr gut gewesen war. »Können wir darüber reden?«
»Wir haben darüber geredet, Meg.« Neben die Unterhemden packte er nun ein Häufchen marineblaue und grüne Boxershorts – in der ganzen Zeit, die wir zusammen gewesen waren, hatte ich Brooks nie in Unterwäsche einer anderen Farbe gesehen. »Wir haben während der Feiertage darüber geredet, wir haben im Sommer darüber geredet, und wir haben letzten Monat darüber geredet, bevor ich mein Vorstellungsgespräch in New York hatte.«
»Ich weiß, aber ... ich habe wohl nicht gedacht, dass es wirklich passiert.« Panik wallte von meinem Magen in die Brust hoch. Wenn Brooks wirklich fortging, wäre dies meine dritte gescheiterte Beziehung in Folge. Das war nicht nur Pech. Das war ein Muster. Eine Reihe. Vielleicht sogar ein Fluch.
Brooks blieb auf halbem Weg zwischen Kleiderschrank und Bett stehen, einen Kleiderbeutel in Händen, und sah mich an, einen ernsten Ausdruck auf seinem attraktiven Gesicht. »Es war deine Entscheidung, nicht daran zu glauben, dass es wirklich passiert. Ich habe es dir aber gesagt.«
Ich kaute an meinem Daumennagel, denn ich wusste, dass er recht hatte.
»Wir haben einander seit Wochen kaum gesehen.« Er legte den Kleidersack aufs Bett und ging zurück zum Schrank.
»Nun ...« Ich suchte verzweifelt nach einer Verteidigungsstrategie. »Du bist eine Nachteule, und ich bin Frühaufsteherin. Ich gehe ins Bett, bevor du nach Hause kommst, und ich bin morgens immer vor dir auf und aus dem Haus. Es ist schwierig.«
»Das ist alles wahr.« Er kam mit einem Arm voller Hemden an identischen hölzernen Kleiderbügeln zum Bett zurück. »Aber so sollte eine Beziehung nicht sein.«
»Außerdem hatten wir beide auf der Arbeit wirklich wahnsinnig viel zu tun.« Brooks und ich waren Anwälte. Allerdings arbeitete er für das Justizministerium – zumindest nach meinen letzten Informationen –, und ich praktizierte nicht mehr als Anwältin, sondern war Wahlkampfstrategin. Unsere Jobs waren anspruchsvoll und wichtig. Es gab spätabendliche Meetings und frühmorgendliche Videokonferenzen, knappe Deadlines, und es stand immer viel auf dem Spiel. »Es ist schwierig geworden, uns nahe zu sein.«
»Es ist mehr als das.« Brooks schob die Hemden in den Beutel. »Zwischen uns passiert nichts mehr, Meg. Wir haben seit Monaten nicht mehr miteinander geschlafen.«
»Das stimmt nicht ganz. Wir haben es einmal nachts versucht, aber du bist eingeschlafen. Das war nicht meine Schuld.« Obwohl es sich irgendwie so angefühlt hatte, als wäre es meine Schuld gewesen – Brooks hatte sich Mühe gegeben, war der Situation aber nicht, ähm, gewachsen gewesen. Insgeheim war ich irgendwie erleichtert gewesen, aber ein anderer Teil von mir hatte sich gefragt, warum ich ihn nicht mehr erregte.
»Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich stelle nur die Tatsachen fest«, sagte er. Brooks stellte immer nur die Tatsachen fest. »Und sei ehrlich. Hast du es vermisst?«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Sex mit Brooks hatte ich nicht vermisst, und ihm war es wahrscheinlich genauso gegangen. Im Bett waren die Dinge brav geworden. Langweilig. Vorhersehbar.
Eine Zeit lang hatte ich mir eingeredet, ich müsse mich nur mehr anstrengen – mir ein paar Dessous kaufen, ihm Schweinereien zuflüstern, ihm einen Blowjob anbieten ... aber dann hatte ich doch nichts dafür getan, es zwischen uns prickelnder zu machen. »Vielleicht könnten wir uns mehr Mühe geben«, schlug ich wenig leidenschaftlich vor.
»Nein, Meg. Es sollte nicht nötig sein, dass wir uns solche Mühe geben. Wir verdienen beide eine Beziehung, die sich nicht wie ein weiterer Job anfühlt.«
Ich starrte auf seine Schuhe, teure lederne Oxfords in Braun mit Vorderkappen. Sie waren blitzblank poliert und passten ausgezeichnet zu seinem dunkelblauen Anzug. Mein Blick wanderte an den Hosen seines maßgeschneiderten Anzugs hinauf zu seinem gestärkten weißen Hemd und der straff gebundenen gestreiften Krawatte. Um sechs Uhr abends war er immer noch einigermaßen glatt rasiert, und sein dunkelblondes Haar sah frisch geschnitten aus – er hatte alle drei Wochen einen festen Termin beim Friseur. Er war groß, muskulös und gut aussehend – wie aus einer Zeitschriftenreklame für einen Herrenduft.
Aber als ich ihn jetzt ansah, verspürte ich keinerlei physische Anziehung, keine aufsteigende Hitze, kein Verlangen, ihm diesen teuren Anzug vom Leib zu reißen und mich auf ihn zu stürzen. Und er, das war klar, verspürte ebenso wenig den Drang, sich auf mich zu stürzen.
»Ich werde bis zum Ende des Jahres weiter die Hälfte der Miete bezahlen«, teilte er mir mit. »Das gibt dir Zeit zu entscheiden, ob du den Mietvertrag ganz übernehmen, in eine kleinere Wohnung umziehen oder dir eine Mitbewohnerin suchen willst.«
Als die Realität zu mir durchdrang, dass ich wieder einmal verlassen wurde, ließ ich mich aufs Bett fallen. »Oh Gott.«
Brooks hörte endlich auf zu packen und setzte sich neben mich. »Ich tue das nicht, um dich zu verletzen.«
Ich holte tief Luft, stieß den Atem wieder aus und versuchte, meine komplizierten Gefühle zu analysieren. »Ich bin nicht direkt verletzt ... Ich bin – ich weiß nicht, was ich bin. Enttäuscht. Beschämt, wütend. Und vielleicht doch ein klein wenig verletzt. Wolltest du einfach fortgehen, ohne Auf Wiedersehen zu sagen?«
Er zuckte die Achseln. »Du kennst mich. Ich wollte keine Szene. Ich habe angenommen, dass du wie gewöhnlich Überstunden machst und dass ich hier fertig wäre, bevor du nach Hause kommst. Ich hatte vor, dir eine E-Mail zu schicken.«
»Eine E-Mail!« Ich starrte ich an. »Um eine dreijährige Beziehung zu beenden?«
»Oder dich anzurufen«, fügte er schnell hinzu. »Ich hatte mich noch nicht ganz entschieden. Aber sei fair, Meg – unsere Beziehung war schon vor langer Zeit zu Ende. Wir waren nur beide zu halsstarrig – oder zu beschäftigt –, um uns mit einer Trennung herumzuschlagen.«
Ich schloss die Augen und kämpfte mit den Tränen.
»Die letzten paar Monate haben mir das nur immer klarer gemacht«, fuhr er fort. »Wir haben einander nicht genug geliebt, um darum zu kämpfen.«
Tief im Herzen wusste ich, dass er recht hatte, aber obwohl er wir gesagt hatte, hörte ich: Ich habe dich nicht genug geliebt, um darum zu kämpfen.
Vielleicht war es unfair, ihm derart die Worte im Mund herumzudrehen, aber ich konnte nicht anders. Vor allem, da alle meine Beziehungen auf diese Weise zu enden schienen – sie erloschen einfach. Kein echtes Drama. Keine riesige Szene. Kein Streit.
»Wie kommt es, dass ich so schlecht darin bin?«, hörte ich mich fragen.
»Schlecht worin?«
»Beziehungen. Ich meine, ich bin schon dreiunddreißig. Warum kriege ich es nicht hin?«
»Willst du die Wahrheit hören?«
»Ich weiß es nicht. Will ich?«
»Es liegt daran, dass du deine Beziehungen nie zur Priorität machst. Du machst nicht einmal dich selbst zur Priorität. Im Zentrum deines Lebens steht immer dein Job. Und ich sage das nicht, um dich anzugreifen – ich benenne einfach die Fakten.«
Ich würde den Brooks nicht vermissen, der einfach die Fakten benannte.
Nicht dass er falschlag. Ich war schon immer ein Workaholic gewesen. Eine Perfektionistin. Schon in der Schule hatte ich immer auch sämtliche Zusatzaufgaben erledigt. Freiwillig die Gruppenprojekte geleitet. In der Schullektüre weitergelesen als gefordert. Ich war lange aufgeblieben und hatte mich davon überzeugt, dass meine Hausaufgaben absolut korrekt waren, und war geradezu besessen von meiner Handschrift gewesen. Es fühlte sich einfach gut an. Die Lehrer hatten mich gelobt. Meine Eltern hatten mit meinen Zensuren und meiner Leistungsbereitschaft geprahlt. Ich hatte Preise und Stipendien und Aufsatzwettbewerbe gewonnen.
Hart arbeiten und Erfolg haben war das, was ich am besten konnte – und hatte mir diese Tatsache nicht genau das verschafft, was ich jetzt hatte? Einen Juraabschluss? Einen tollen Job? Einen guten Ruf in einem hart umkämpften Berufsfeld?
Natürlich war es so, und ich war stolz auf alles, was ich erreicht hatte.
Aber ich begriff langsam, dass es einen Preis hatte.
Als Brooks gegangen war, zog ich mich um – Jogginghose statt Arbeitskostüm, Kuschelsocken statt Komfortpumps –, band mir das Haar zu einem wirren Knoten und ging schnurstracks in die Speisekammer, wo ich einen Notfallvorrat an Alkohol und Twinkies aufbewahrte. Dann mixte ich mir eine Margarita, ließ mich im Wohnzimmer auf den Boden plumpsen und machte mich daran, eine blödsinnige Menge an Zucker, Salz, Fett und Alkohol zu konsumieren, während ich mir unzählige Folgen von Law & Order ansah und versuchte, nicht über den traurigen Zustand meines Privatlebens nachzudenken.
Doch zwei Drinks und vier Twinkies später fand ich, ich bräuchte vielleicht eine Intervention.
Ich brauchte dringend jemanden, der mir sagte, dass ich nicht traurig und allein enden würde, umgeben von leeren Twinkie-Einwickelpapieren. Also schnappte ich mir mein Handy, um meine Schwester April anzurufen. Ich hatte vier Schwestern, aber April war die, der ich in unserer Kindheit und Jugend am nächsten gestanden hatte. Meine Schwester Chloe war mir tatsächlich im Alter näher (nur vierzehn Monate jünger als ich), aber sie war als Kind ziemlich schwierig gewesen. So hatte ich mich eher an April gehalten, die auch nur zwei Jahre älter war als ich und schon immer eine eher sorgende Rolle innegehabt hatte.
Und jetzt, da Frannie – mit ihren siebenundzwanzig Jahren das Nesthäkchen der Familie – kurz vor ihrer Hochzeit stand und Chloe sich unlängst verlobt hatte, blieben April und ich als die beiden letzten ledigen Sawyer-Schwestern übrig. (Sylvia, die Älteste von uns, hatte direkt nach dem College geheiratet.)
Wir hatten bisher nicht viel darüber gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, dass April vielleicht die Einzige war, die mich jetzt verstehen würde. Zumindest würde sie mir helfen, meine eigenen Gefühle zu verstehen – anderenfalls drohte die Gefahr, dass ich eine potenziell tödliche Menge der goldenen Biskuitkuchen mit der luftigen, süßen Cremefüllung zu mir nehmen würde.
Als April nicht ans Telefon ging, schickte ich meinem Freund Noah eine Textnachricht. Er war Deputy des Sheriffs in meiner Heimatstadt und einer meiner engsten Freunde aus der Highschool. Wir hatten zuletzt vor ein paar Monaten miteinander gesprochen, und gesehen hatte ich ihn tatsächlich seit Jahren nicht mehr, aber so war das mit uns. Wir hörten lange Zeit nichts voneinander, aber sobald einer von uns sich die Mühe machte, nach dem Telefon zu greifen oder in ein Flugzeug zu steigen, war es immer so, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen.
Außerdem hatte er mir einmal das Leben gerettet. Seitdem fand ich, dass er irgendwie für mich verantwortlich war.
Ich: Hey.
Noah: Hey. Ich habe gerade an dich gedacht.
Ich: Hast du je auf einen Notruf reagiert, bei dem es um Tod durch Twinkies ging?
Noah: Nicht direkt.
Ich: Gut.
Noah: Hast du einen Notfall, bei dem du Hilfe brauchst, Sawyer?
Ich: Noch nicht.
Noah: Okay. Wenn doch, empfehle ich den Notruf und nicht mein Handy. Ich bin mindestens siebenhundert Meilen entfernt. Und obwohl Tod durch Twinkies wahrscheinlich eine langsame Art zu sterben ist, wäre ich vielleicht nicht rechtzeitig da.
Ich: Würdest du es wenigstens versuchen?
Noah: Für dich immer.
Darüber musste ich grinsen. Noah schrieb weiter:
Noah: Vielleicht solltest du aber die Finger von den Twinkies lassen.
Ich: VERDAMMT, ICH HAB'S VERSUCHT.
Noah: Kannst du dir nicht eine andere schlechte Angewohnheit zulegen?
Ich: Welche denn zum Beispiel?
Noah: Keine Ahnung. Eine, mit der es schneller ginge. Wie wäre es mit Klippenspringen?
Ich: Nie und nimmer.
Noah: Mit Streichhölzern spielen?
Ich: Kein Interesse.
Noah: Schwert schlucken?
Ich: Träum weiter.
Noah: Hahaha. Ich habe nicht von meinem Schwert gesprochen. Obwohl es einigen Schaden anrichten könnte, möchte ich dir versichern.
Ich: Du bist ein Ferkel. Ich weiß nicht, warum ich dir überhaupt geschrieben habe. UND TSCHÜSS – ENDGÜLTIG.
Noah: Das war's? Ich werde nie wieder von dir hören?
Ich: Würde dir das überhaupt etwas ausmachen?
Es war eine kindische Reaktion, aber ich spürte heute Abend aus keiner Richtung irgendwelche Liebe. Ich wollte hören, dass ich jemandem wichtig war.
Noah: Sei nicht blöd, Sawyer. Du weißt, dass es mir etwas ausmachen würde.
Sofort fühlte ich mich besser. Und ein wenig albern.
Ich: Entschuldige. Ich hatte einen echt miesen Tag.
Einen Moment später summte mein Handy. Noah McCormick ruft an. »Hallo?«
»Hey.«
»Bist du bei der Arbeit?« Ich stellte ihn mir in seiner Uniform vor, wie er in seinem schwarz-weißen Explorer saß. Kurzes, dunkles Haar. Sanfte, braune Augen mit dichten Wimpern. Gepflegte Bartstoppeln auf einem kräftigen Kinn. Und starke Arme. Seine Arme hatten mir immer gut gefallen.
»Ich bin jetzt zu Hause«, sagte er. »Also, was hast du denn?«
»Erhöhtes Cholesterin hab ich. Und zu hohen Blutdruck. Und wahrscheinlich nur noch wenig Zeit auf Erden.«
Sein Lachen war tief und volltönend. »Was ist los?«
Ich beäugte einen fünften goldenen Kuchensnack. »Frustfressen mit Twinkies. Aber ich habe auch Margaritas«, füge ich hinzu, um erwachsener zu klingen.
»Twinkies und Tequila. Stilvoll.«
Ich nahm einen großen Schluck und stellte das Glas wieder ab. »Ich tue, was ich kann.«
»Also, was ist passiert?«
»Ich habe bei einer weiteren Beziehung versagt.«
»Mit deinem Freund? Wie war noch mal sein Name, River?«
»Brooks.« Ich nahm noch einen Schluck. »Aber er ist jetzt nicht mehr mein Freund. Er hat mich verlassen.«
»Ach ja? Wann?«
»Heute Abend. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, hat er gerade seine Sachen gepackt.« Bei der Erinnerung daran streckte ich die Hand nach dem fünften Twinkie aus und biss hinein.
»Ach. Einfach so ohne Vorwarnung?«
»Nicht wirklich. Zwischen uns lief es nicht gerade großartig.« Ich kaute und schluckte. »Aber es ist so beschämend. Ich werde immer wieder sitzen gelassen. Was stimmt nicht mit mir, Noah?«
»An dir gibt es nichts auszusetzen, abgesehen von der Tatsache, dass ich deinetwegen den Anfang des Spiels verpasse.«
»Vielleicht ist es das. Ich bin egoistisch.«
Er seufzte. »Sawyer, du hast auf dem College jeden Sommer Häuser für Habitat for Humanity gebaut. Du bist nicht egoistisch.«
Ich warf den Rest des nicht verzehrten Twinkies beiseite, sprang auf und begann vor dem Sofa auf und ab zu tigern. »Bin ich zu wählerisch?«
»Du solltest wählerisch sein. Es gibt eine Menge Arschlöcher da draußen.«
»Vielleicht bin ich schrecklich im Bett.«
»Irgendwie bezweifle ich das.«
»Aber du weißt es nicht sicher!«
»Das ist wahr«, lachte er, »also solltest du vielleicht nach Hause kommen und mir erlauben, mal eine Probefahrt mit dir zu machen. Deine Lenkeigenschaften und dein Fahrverhalten begutachten.«
Das entlockte mir ein Grinsen. »Sehr witzig.«
All seinen schmutzigen Scherzen zum Trotz hatte Noah noch nie irgendetwas bei mir versucht. Früher hatte ich mich gefragt, warum nicht, aber schließlich war ich zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach nicht sein Typ war. Er stand auf heiße Blondinen mit mindestens einem C-Körbchen. Damals war ich brünett gewesen, und meine Körbchengröße entsprach meiner Mathezensur. Ein glattes A. (Obwohl ich inzwischen immerhin ein B-plus-Körbchen hatte, möglicherweise sogar ein C-minus.)
Einmal, als ich noch an der Uni war und er mich in D.C. besuchte, hatte ich allerdings kurz gedacht, er wäre drauf und dran, mich zu küssen. Er war damals Soldat und stand kurz vor seinem zweiten Kampfeinsatz, deshalb hatte sich unser Abschied irgendwie aufgeladen angefühlt. Aber der Moment hatte nur einen Sekundenbruchteil gedauert, und anschließend war ich mir sicher gewesen, es mir nur eingebildet zu haben.
»Hör zu, Sawyer. Vergiss diesen Burschen. Er ist ein Blödmann.«
»Woher weißt du das? Du hast ihn nie kennengelernt.«
»Ich brauche ihn nicht kennenzulernen. Er hatte die Chance, mit dir zusammen zu sein, und hat es vermasselt. Scheiß auf ihn. Er ist ein Blödmann.«
»Danke.« Es ging mir schon ein bisschen besser, auch wenn es nicht der Wahrheit entsprach, was Noah gesagt hatte.
»Gern geschehen. Darf ich mir jetzt das Spiel ansehen?«
»Gleich.« Ich warf mich aufs Sofa und starrte an die Decke. »Glaubst du, ich bin dazu verdammt, allein zu sein, weil ich meine Arbeit immer über meine Beziehungen stelle?«
»Keine Ahnung. Vielleicht.«
Ich runzelte die Stirn. »Das ist nicht die richtige Antwort.«
»Was ist denn die richtige Antwort?«
»Die richtige Antwort ist: ›Wenn du die große Liebe deines Lebens findest, wirst du ihr oberste Priorität einräumen wollen. Du wirst darüber gar nicht nachdenken müssen. Du tust es einfach – instinktiv.‹«
»Na bitte.«
»Aber was ist, wenn das nie passiert, Noah? Was, wenn der Bursche nie auftaucht? Oder«, fuhr ich fort und wurde von Sekunde zu Sekunde panischer, »oder wenn er zwar auftaucht, ich aber zu beschäftigt oder zu abgelenkt bin, um ihn zu bemerken? Was, wenn ich gerade ... auf mein verdammtes Handy starre, wenn er vorbeigeht?«
Er atmete tief aus. »Ich denke, wenn du wirklich glaubst, dass es eine große Liebe in deinem Leben gibt, dann wird dein Bauch dir sagen, dass du aufschauen sollst.«
Ich schloss die Augen. »Glaubst du das wirklich?«
Er zögerte. »Zumindest teilweise. Ich glaube daran, dass du deinem Bauchgefühl trauen solltest.«
»Aber nicht an die eine große Liebe im Leben?«
»Das ist ein Märchen, Sawyer. Aber wenn es dich glücklich macht, daran zu glauben, dann nur zu.«
Ich seufzte. Das war tatsächlich ein guter Punkt. Machte es mich glücklich, an die Art Liebe zu glauben, die einen traf wie der Blitz, die man nur einmal im Leben fand und die aus dem Nichts kam und einen umhaute? Oder war das nur eine Ausrede? Vielleicht hatte ich erwartet, dass Amor die ganze Arbeit tat, obwohl Liebe in Wirklichkeit viel mehr Anstrengung meinerseits erforderte. Mehr Dessous und Blowjobs.
Ich hatte keine Ahnung.
»Bist du noch da?«, fragte Noah.
»Ja.« Ich richtete mich auf und schwang die Füße auf den Boden. »Hey, vergiss nicht, dass ich zu Frannies Hochzeit nächste Woche nach Hause komme. Lass uns mal abhängen und ein Bier zusammen trinken.«
»Ich bin dabei. Und für ein Bier bin ich immer zu haben.«
»Wie wäre es mit Donnerstag?«
»Gut. Tatsächlich habe ich Donnerstag frei.«
»Okay, ich rufe dich an, wenn ich da bin. Und danke, dass du mir heute Abend zugehört hast. Tut mir leid, dass ich das Gespräch irgendwie monopolisiert habe.«
»Ich kenne dich schon lange, Sawyer. Ich bin daran gewöhnt.«
Ich grinste und wurde mir bewusst, wie sehr ich ihn vermisste. »Arschloch. Viel Spaß bei deinem Spiel. Wir sehen uns nächste Woche.«
»Klingt verlockend. Gute Heimreise.«
Wir beendeten den Anruf, und ich legte mein Telefon beiseite und dachte daran, wie witzig es war, dass ich den Norden von Michigan immer noch als Zuhause betrachtete, obwohl ich seit fünfzehn Jahren nicht mehr dort lebte. Ich sah es im Geiste vor mir – Cloverleigh Farms, wo ich aufgewachsen war; die nahe gelegene Kleinstadt Hadley Harbor, in der Noah lebte; die Leelenau-Halbinsel – der kleine Finger Michigans – mit ihren wunderschönen Stränden, dem dunkelblauen Wasser und lieblichen, sanften Hügeln, die mit Wein- und Obstgärten und Wäldern bedeckt waren. Es war eine sehr idyllische Gegend, um dort aufzuwachsen, und doch hatte ich darauf gebrannt, sie zu verlassen, in die Welt hinauszugehen, wo wichtige Dinge geschahen. Ich konnte mich nicht einmal erinnern, wann ich das letzte Mal länger als einen Tag zu Weihnachten oder Ostern dort gewesen war. Vielleicht zur Beerdigung von Noahs Dad? Das war vor drei Jahren gewesen. Schuldgefühle schnürten mir die Kehle zusammen.
Die Arbeit würde immer da sein, aber niemand lebte ewig.
Plötzlich bekam ich furchtbares Heimweh und vermisste alle, die ich lieb hatte. Laut meinem Flugticket würde ich D.C. am Donnerstagmorgen verlassen und am Sonntag zurückkehren, dem Tag nach der Hochzeit. Aber jetzt wollte ich länger als drei Tage dort sein.
Würde es meinen Chef verärgern, wenn ich eine ganze Woche Urlaub nahm? Würde ich wichtige Meetings verpassen und die Chance, an tiefgreifenden Entscheidungen beteiligt zu sein? Uns stand ein Wahljahr bevor, und ...
Plötzlich hörte ich Brooks' Stimme in meinem Kopf: Es liegt daran, dass du deine Beziehungen nie zur Priorität machst. Du machst nicht einmal dich selbst zur Priorität. Im Zentrum steht immer dein Job.
Er hatte recht. Aber ich konnte etwas daran ändern.
Was mich selbst betraf, war eine kleine Auszeit vielleicht genau das, was ich brauchte. Eine Chance, der Hektik der politischen Welt zu entfliehen und mich mal zu entspannen. Aufzuhören, immer alles erledigen zu wollen, und einfach Spaß zu haben. Die Welt würde schon nicht implodieren, nur weil ich Urlaub machte.
Ich sprang vom Sofa auf, holte den Laptop aus meiner Umhängetasche und schrieb meinem Chef eine E-Mail, dass ich länger als ursprünglich geplant abwesend sein würde, wenn nötig aber aus der Ferne weiterarbeiten könne. Und ich buchte meinen Flug auf den nächsten Morgen um. Ich musste der Fluggesellschaft dafür eine ordentliche Gebühr bezahlen, aber das kümmerte mich nicht.
Glücklich mit meiner Entscheidung ging ich ins Schlafzimmer, um zu packen.
Kapitel 3
Noah
Ich sah mir den Rest des Spiels an, abgelenkt von Gedanken an Meg Sawyer. (Es war nicht wirklich meine Schuld. Die Schläge waren beschissen und die Würfe noch schlimmer. Und Renzo hätte verdammt noch mal besser fangen können.)
Außerdem hatte Meg mich schon immer abgelenkt.
Obwohl wir nicht auf dieselbe Schule gegangen waren – sie hatte staatliche Schulen besucht, während meine Eltern auf katholische bestanden hatten –, hatte ich gewusst, wer sie war. Hier kannte so ziemlich jeder jeden. Aber wir waren uns erst an dem Tag nähergekommen, als ich sie am öffentlichen Strand aus der Bucht gezogen hatte, kaum bei Bewusstsein und weiß wie ein Laken, ihr Körper erschreckend schlaff in meinen Armen, als ich sie auf den Sand gelegt hatte.
Ich schaltete den Fernseher aus, ging ein letztes Mal mit Renzo in den Garten und schaute zu den Sternen auf, während ich mich an die Panik erinnerte, die ich an jenem Tag empfunden hatte.
Ich war sechzehn gewesen, gerade alt genug, um Rettungsschwimmer zu werden, aber ich hatte sie genau beobachtet, als sie versuchte, zum Boot eines Freundes zu schwimmen, das vor der Küste vor Anker lag. Die Strömung war an dem Tag recht stark gewesen, und sie hatte keine Schwimmweste getragen.
Ich hatte instinktiv Bescheid gewusst, als sie anfing, Probleme zu bekommen – meine Brust hatte sich zugeschnürt, mein Adrenalinpegel war in die Höhe geschossen –, und war von meinem Stuhl gesprungen und losgerannt.
Bis zum heutigen Tag krampfte sich mir der Magen zusammen, wenn ich daran dachte, was hätte passieren können, wenn ich sie nicht im Auge behalten hätte. Nun gut, die Gründe, weshalb ich beobachtet hatte, wie sie ins Wasser ging, hatten vielleicht etwas mit dem winzigen blauen Bikini zu tun gehabt, den sie trug, aber ich glaubte auch an Bauchgefühle, und meins war an dem Tag stark gewesen.
Als klar gewesen war, dass es ihr gut ging und sie aufstehen konnte, hatte sie die Arme um mich geschlungen und geschluchzt. An dem Punkt hatte ich nur gehofft, dass ihre nackte, sandverklebte Haut auf meiner mir keinen Ständer bescherte. Ich hatte ihre Umarmung nicht erwidert, aber das kümmerte sie nicht. Dieses Mädchen hatte sich geschlagene fünf Minuten an mich geklammert wie Efeu an Ziegelsteine und sich die Augen ausgeweint.
Von dem Moment an hatte ich das Gefühl gehabt, sie beschützen zu müssen. Mir gefiel das Gefühl, das ich empfand, wenn ich daran dachte, sie gerettet zu haben. Ich würde es sogar als Wendepunkt in meinem Leben bezeichnen – danach hatte ich gewusst, was ich werden wollte. Außerdem war mein Dad Polizist gewesen und mein Idol. Daher war es für niemanden eine Überraschung gewesen, als ich direkt nach der Highschool zur Armee ging und später selbst Polizist wurde.
»Komm, Junge. Lass uns reingehen.« Ich ließ Renzo wieder ins Haus und sagte ihm mehrmals gute Nacht, bis er mir endlich glaubte, dass für heute Abend mit dem Spielen Schluss war, und sich auf seinem Bett in einem der beiden Schlafzimmer im Erdgeschoss zusammenrollte. Mein Haus war nicht groß, aber Renzo und mir bot es jede Menge Platz. Unten befanden sich zwei kleine Schlafzimmer, ein Bad, Küche und Wohnzimmer. Oben waren mein Schlafzimmer und ein zweites Bad.
Zehn Minuten später lag ich in meinem Bett, das groß genug für zwei war, in dem ich aber seit ein paar Jahren allein schlief.
Sie ging mir nicht aus dem Kopf.
Ich hatte sie eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber sie schien sich nie sehr zu verändern. Langes, braunes Haar, in das sich im Sommer goldene Strähnchen mischten. Graublaue Augen, die je nach Licht die Farbe änderten. Sie war schlank und sportlich und hatte lange, muskulöse Beine.
Ich konnte kaum glauben, dass ein weiterer Idiot aus D.C. ihr den Laufpass gegeben hatte – was zum Teufel stimmte nicht mit diesen Typen? Wenigstens hatte ich sie ein bisschen zum Lachen bringen können.
Wenn ich ihr Lachen hörte, musste ich immer an die frühen Tage unserer Freundschaft zurückdenken.
Wir hatten damals immer bei mir oder bei ihr zu Hause ferngesehen (sie liebte True-Crime-Serien und Polizeisendungen, auf die ich in dem Alter auch irgendwie gestanden hatte), oder wir riefen einander spätnachts an und redeten stundenlang. Es war verrückt, denn ich war bei anderen Mädchen immer verlegen und wortkarg gewesen, aber die Gespräche mit Meg waren mir leichtgefallen – häufig sogar leichter als Unterhaltungen mit meinen männlichen Freunden. Ich wusste genau, wie ich sie aufziehen konnte, und sie brachte mich mühelos zum Lachen. Ich hatte mit Meg sogar über Mädchen reden können, und sie hörte zu und gab mir Ratschläge. Danach hörte ich ihr zu, wie sie sich über all die dummen, unreifen Jungs in ihrer Schule beklagte, die sich nur für Mädchen interessierten, die sie ranließen.
Natürlich interessierte ich mich ebenfalls für Mädchen, die mich ranließen, aber das sagte ich ihr nicht, denn sie sollte nicht denken, dass sie so etwas tun musste, um von einem Mann beachtet zu werden. Denn Meg war nicht nur wunderschön, sie war auch unglaublich gut in allem, was sie tat. Überfliegerin mit Bestnoten. Schülerratsvorsitzende. Mitglied in der Schulmannschaft. Klar, sie war angespannt und ein Strebertyp, aber sie hatte von allen Menschen, die ich kannte, das größte Herz. Sie meldete sich immer freiwillig für alle möglichen Aufgaben und setzte sich für eine gute Sache nach der anderen ein. Und das war nicht nur Show – es war ihr wirklich wichtig.
Sie war damals zu mir nach Hause gekommen und hatte sich zu meinem Bruder Asher gesetzt, der eine Zerebralparese und dadurch auch Sinnesbehinderungen hatte, und mit ihm geredet, als wäre er einfach einer ihrer Freunde.
Das mag sich nicht nach einer großen Sache anhören, aber für Asher – und für mich – war es etwas Gewaltiges. Mein Bruder war ein kluges, witziges, tapferes und interessantes Kind gewesen, aber es hatte nur selten jemanden gegeben, der über seine Behinderung hinausschaute, um diese Qualitäten zu entdecken. Und ich verstand, warum das so war.
Seine Sprache war für jeden außerhalb der Familie fast unverständlich. Er war auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen, und er machte eine Menge unwillkürlicher Bewegungen. Manchmal sabberte er. Gelegentlich hatte er Krämpfe. Dazu kamen seine Überempfindlichkeit gegen Licht, Geräusche und Berührung, außerdem seine Unfähigkeit, sich verständlich zu machen; und Kinder sind misstrauisch. Er war oft frustriert und ängstlich, was zu Verhaltensproblemen führte wie Wutanfällen oder extremer Zurückgezogenheit. Unnötig zu sagen, dass es ihm schwerfiel, in seiner eigenen Schule Freunde zu finden, und dass er oft schikaniert und missverstanden wurde. Die Leute nannten ihn dumm, was ihn wahnsinnig machte – er war ganz und gar nicht dumm. Er war sogar sehr klug. Er konnte nur nicht so kommunizieren, wie die Kids in der Schule es erwarteten. Und all diese blöden Intelligenztests sind für Kinder gemacht, die genau das können.
Für mich war es eine Selbstverständlichkeit gewesen, ihn zu beschützen.
Wenn Kinder Asher auslachten – und sie waren brutal gewesen –, brannte bei mir eine Sicherung durch. Es hatte unzählige Raufereien auf dem Spielplatz gegeben, in den Fluren, auf der Straße. Die Grundschulrektorin hatte die Telefonnummer meiner Eltern wahrscheinlich als Kurzwahlnummer gespeichert, so oft war ich zu ihr hinuntergeschickt worden. (Sie und ich haben seither oft über meine Karriere bei der Polizei gelacht.) Aber ich wollte nur, dass er wie alle anderen behandelt wurde.
Zu sehen, wie er zu Hause mit Meg interagierte, sie zum Lachen brachte, ihr eins seiner Projekte am Computer zeigte, über eine Fernsehsendung sprach, die ihm gefiel (er teilte ihr Interesse an True-Crime), hatte sich für mich also unvorstellbar schön angefühlt.
Sie war viel zu gut für irgendein Arschloch, das ihr nur an die Wäsche wollte, und das schloss mich ein. Nicht dass ich je auf diese Weise an sie gedacht hätte.
Nicht oft.