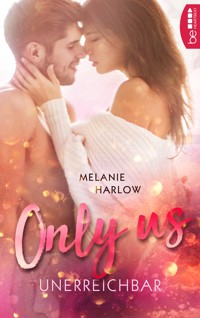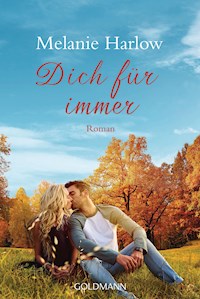Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cloverleigh-Farms-Romance-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ich bin Single-Dad dreier Töchter und CFO von Cloverleigh Farms. Ich habe keine Zeit, mich zu verlieben. Stattdessen muss ich ein Hotel managen, die roten Socken aus der weißen Wäsche fischen und das Bett beziehen, ohne wie ein Seemann zu fluchen.
Zugegeben, Frannie Sawyer ist atemberaubend. Aber auch die Tochter meines Bosses. Und die Teilzeit-Nanny meiner Kinder. Was wohl heißt: Hände weg! Die Fantasien, die ich von ihr habe, sind schlimm genug. Wie wäre es erst, wenn ich sie auch noch küssen würde? Und wenn es nicht nur bei einem Kuss bliebe?
Als Marine sollte ich die Willensstärke haben, die Hände von ihr zu lassen. Doch das tue ich nicht. Und jetzt muss ich mich entscheiden: zwischen dem Leben, das ich will, und dem, das sie verdient. Auch wenn das bedeutet, sie zu verlieren.
Stimmen unserer Leserinnen und Leser:
»Heiß, herzzerreißend - hatte ich 'heiß' gesagt? Mit dem perfekten Maß an Verbotenem.« (Ilsa Madden-Mills, Wall Street Journal-Bestsellerautorin)
»Unwiderstehlich. Hat alles, was ich in einer Liebesgeschichte suche: Ein atemberaubender Held, genug knisternde Hitze, um eine Sauna anzutreiben, und genau das richtige Maß an Humor, um den Herzschmerz auszugleichen.« (Helena Hunting, New York Times-Bestsellerautorin)
»Herz, Hitze und Humor - dieses Buch, so wie auch ihre anderen, ist absolut unwiderstehlich.« (Laurelin Paige, New York Times-Bestsellerautorin)
»Eine hitzige Liebesgeschichte, voller Leidenschaft, Verlangen und der ganz großen Liebe!« (bluetenzeilen Lesejury 16.12.2021)
»Diese Liebesgeschichte ist süß, verboten, sexy und einfach nur zum Dahinträumen.« (skjoon Lesejury 05.12.2021)
»Großartiger Schreibstil.« (labelloprincess Lesejury 06.11.2021)
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Impressum
Über die Autorin
Melanie Harlow bevorzugt ihre Martinis trocken, ihre Schuhe hoch und liebt abenteuerliche, romantische Geschichten mit allen schmutzigen kleinen Details. Ihre Bücher handeln von modernen Paaren, Menschen wie du und ich, die mit ganz alltäglichen Problemen kämpfen und oft Rückschläge hinnehmen müssen, bis sie letztendlich doch die wahre Liebe finden. Melanie lebt mit ihrem Mann, zwei Töchtern bei Detroit.
Melanie Harlow
Unwiderstehlich
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
Für meine Töchter und meinen Dad, auch wenn keiner von ihnen meine Erlaubnis hat, dieses Buch jemals zu lesen.
Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen – sondern das, was man bereit ist zu geben – nämlich alles.
Katharine Hepburn
Kapitel 1
Mack
Nur einen einzigen Morgen. Mehr wollte ich nicht.
Einen einzigen Morgen für mich.
Ausschlafen. Nackt schlafen. Bei geschlossener Schlafzimmertür schlafen.
Und wach werden, wenn mir danach zumute war. Aufwachen, nichts hören. Und tun, wozu auch immer ich am Morgen Lust hatte – Joggen gehen oder mir einen runterholen oder verdammt noch mal einfach weiterschlafen.
»Daddy! Steh auf!«
Heute war nicht dieser Morgen.
Stöhnend wälzte ich mich auf den Bauch und zog mir das Kissen über den Kopf. »Daddy ist nicht da«, sagte ich mit vom Kissen gedämpfter Stimme.
Ich hörte Gekicher, dann spürte ich, wie sich die Matratze bewegte, als eine meiner drei Töchter auf mein Bett sprang. Vielleicht waren es auch mehrere. Tatsächlich war es ziemlich erstaunlich, dass nicht schon längst eine von ihnen hier war. Nachdem ihre Mutter gegangen war, hatte ich mein Bett monatelang nicht für mich allein gehabt. Manchmal schlief die elfjährige Millie wegen Bauchschmerzen bei mir. Oder die achtjährige Felicity wegen Albträumen. Häufig war es auch die vier Jahre alte Winifred, die sich vor dem Ungeheuer unter ihrem Bett zu mir flüchtete.
Und manchmal auch alle drei zusammen.
Eine von ihnen sprang auf meinen Rücken, als sei ich ein Pony, und zerrte an meinem T-Shirt. »Wir haben Hunger.« Das klang nach Felicity.
»Schon wieder? Ich habe euch doch gerade erst was zu essen gemacht.«
»Es ist Morgen. Wir haben seit gestern Abend nichts zu essen bekommen.«
»Es kann unmöglich schon Morgen sein. Es ist noch dunkel.«
»Das liegt an dem Kissen über deinem Kopf.« Sie kicherte. »Außerdem hast du geschnarcht.«
»Kann Millie euch nicht einfach Müsli machen?«
»Wir wollen kein Müsli. Wir wollen Pfannkuchen.«
Ich seufzte. »Kann sie keine Pfannkuchen machen?«
»Sie weiß nicht, wie der Herd funktioniert. Wir brauchen einen Erwachsenen.«
Einen Erwachsenen. Ich war der einzige Erwachsene im Haus. Wie zum Teufel war es so weit gekommen? »Woher weißt du, dass ich erwachsen bin?«
Noch mehr Gekicher. »Weil du groß bist und Riesenfüße hast. Und Barthaare. Und du heißt Daddy.«
»Ich habe dir doch schon gesagt, Daddy ist nicht da.«
»Und wer bist dann du?«
Ich drehte mich um und warf sie auf den Rücken. »Das Kitzelmonster!«
Sie kreischte und zappelte, während ich sie gnadenlos durchkitzelte, woraufhin Winifred ins Zimmer gerannt kam und aufs Bett sprang. »Ich auch!«
Winnie gehörte zu den wenigen Kindern, die tatsächlich gern gekitzelt wurden, oder zumindest mochte sie die körperliche Zuwendung. Eilig rückte sie dicht an Felicity heran und präsentierte mir ihr Bäuchlein wie ein Hund, der gestreichelt werden will.
Kurz kitzelte ich sie beide, dann hockte ich mich hin und kratzte mich am Kopf. »Ihr habt ja immer noch eure Schlafanzüge an. Ist heute etwa Samstag?«
»Ja«, bestätigte Felicity.
»Gut.«
»Deine Haare sehen komisch aus«, eröffnete sie mir.
»Deine auch«, entgegnete ich. Vor Kurzem hatte sie sich einen »Schnitt« verpasst und sich das Haar vorn zu einem Pony wie dem von Mavis aus Hotel Transsylvanien abgesäbelt. Eine Zeit lang hatte sie sogar darauf bestanden, dass alle sie Mavis nannten. Die Therapeutin der Mädchen hatte mir versichert, das sei kein Grund zur Sorge und bedeute lediglich, dass sie sich mit der Figur der Mavis identifiziere, die ebenfalls ohne Mutter bei ihrem Vater lebte.
»Sind Sie sich auch wirklich sicher, dass es nicht bedeutet, dass sie ein Vampir ist?«, hatte ich gefragt. Felicity hatte zwar noch niemanden gebissen, aber sie war dazu übergegangen, bevorzugt Schwarz zu tragen, und hatte mich gefragt, ob ich ihr ein sargförmiges Bett bauen könne. So viel zum Thema Albträume.
Aber die Therapeutin hatte nur gelächelt. »Ganz sicher.«
Millie erschien im Nachthemd an meiner Schlafzimmertür. »Dad, ich brauche für den Ballettunterricht heute ein schwarzes Trikot, aber ich finde kein sauberes.«
»Verdammt. Hast du überall nachgesehen?«
»Ja. In meiner Schublade und in meinem Wäschekorb. Und das macht einen Vierteldollar für die Schimpfwortkasse.«
Ich verzog das Gesicht. Diese verfluchte Schimpfwortkasse würde mich noch in den Ruin treiben. »Hast du auch in den Trockner geschaut?«
»Jepp. Da ist auch keins.«
»Himmel, Arsch und Zwirn.«
»Das macht fünfzig Cent«, sagte Felicity.
Ich pikste sie in die Seite. »Wenigstens lernst du dank meiner Flüche besser rechnen. Millie, hast du in der Waschmaschine nachgesehen? Ich weiß, dass ich gestern eine Ladung dunkle Wäsche reingeworfen habe.« Was bedeutete, dass ich gestern Abend wahrscheinlich vergessen hatte, die Sachen in den Trockner zu tun, und sie heute noch mal waschen musste.
»Nein, in der Waschmaschine habe ich nicht nachgeschaut.«
»Um wie viel Uhr hast du noch mal Ballettunterricht?«
Millie verdrehte die Augen, eine pubertäre Attitüde, die ich langsam etwas leid wurde. »Zur selben Zeit wie immer. Um zehn.«
»Richtig.« Ich schaute auf die Digitaluhr auf meinem Nachttisch. Es war halb acht. »Okay, bis dahin habe ich ein Trikot für dich.«
»Und ich brauche auch noch etwas für den Kuchenbasar heute Nachmittag«, fügte sie hinzu.
»Was für ein Kuchenbasar?«
Ein weiteres Augenverdrehen, begleitet von einem Aufstampfen mit dem Fuß. »Daddy! Mit dem Kuchenstand wollen wir Geld sammeln, für die Reise in der achten Klasse nach Washington, D.C.! Das habe ich dir schon ungefähr hundertmal erzählt.«
Ich sprang aus dem Bett und zog meine Flanellschlafanzughose hoch. »Achte Klasse! Scheiße, Millie, du bist erst in der Sechsten. Diese Reise ist erst in zwei Jahren – kein Wunder, dass ich das unter ›Kann man getrost vergessen‹ abgespeichert habe.« Ich nahm ein US-Marine-Corps-Sweatshirt aus meiner Kommode und zog es über mein T-Shirt.
Dies trug mir einen tiefen Seufzer ein. »Das macht einen Dollar für die Kasse, Dad.«
»Nein, tut es nicht! Ich war erst bei fünfzig Cent.«
»Das S-Wort kostet einen ganzen Dollar, Daddy«, erinnerte Felicity mich.
»Oh, stimmt.« Ich hielt inne. »Weißt du was? Das ist es mir wert.«
»Also, was bringe ich für den Kuchenbasar mit?«, wollte Millie wissen.
»Keine Ahnung. Wir überlegen uns was.« Irgendwann zwischen Wäschewaschen, dein Haar in einen Dutt fummeln, Essen machen, das eure Zähne nicht verfaulen lässt oder eure Gehirnzellen abtötet, dich rechtzeitig zum Ballett bringen, bei der Arbeit vorbeischauen, Geld in die Schimpfwortkasse werfen, dem Wocheneinkauf, jeder von euch genug Zeit und Aufmerksamkeit schenken, dass ihr euch geborgen und geliebt fühlt, und – ich ging zum Fenster und sah hinaus – den heute Nacht gefallenen Schnee wegschippen.
Herrgott, es war erst Anfang Februar – heute war Murmeltiertag. Und es war bewölkt, was bedeutete, dass (zumindest der Legende zufolge) ein früher Frühling ins Haus stand. Aber im Moment fühlte es sich an, als würde der Frühling nie hier ankommen. Die Winter im nördlichen Michigan waren lang und kalt, mit durchgehend grauem Himmel und knietiefem Schnee, aber dieses Jahr kam es mir besonders schlimm vor. Lag es daran, dass dies mein erster Winter als alleinerziehender Vater war?
Gemeinsam marschierten wir von meinem Schlafzimmer im ersten Stock nach unten in die Küche, wo ich mir Kaffee aufsetzte, für Felicity und Winifred Pfannkuchen aus dem Tiefkühlschrank holte und Millie ein Rührei machte. Sie saßen nebeneinander an der Frühstückstheke, die die Küche vom Esszimmer trennte. Früher war zwischen den beiden Räumen eine Wand gewesen, aber mein Freund Ryan Woods, der vorige Bewohner dieses Hauses, hatte die Küche umgebaut und sie moderner und offener gestaltet. Tatsächlich aßen wir fast nie am Esszimmertisch. Den benutzte ich überwiegend, um Wäsche zu falten.
»Die schmecken nach Eisfach«, sagte Felicity, betrachtete ihren Pfannkuchen und verzog das Gesicht. »Haben wir keine Muffins von Mrs Gardner mehr?«
»Die haben wir aufgegessen«, informierte ich sie, während ich Orangensaft in drei Gläser goss. Mrs Gardner war unsere vierundneunzigjährige Nachbarin, eine Witwe, die für uns alle zu einer Art Ersatzgroßmutter geworden war, seit wir letzten Sommer in dieses Haus gezogen waren. Sie backte für ihr Leben gern und brachte uns häufig ihre köstlichen Muffins oder Kekse, die nie lange überlebten. Als Gegenleistung erledigte ich bei gutem Wetter die Gartenarbeit für sie und räumte im Winter in ihrer Einfahrt und auf dem Weg vor ihrem Haus den Schnee. Die Mädchen jäteten Unkraut in ihren Beeten, brachten ihr die Post ins Haus und malten ihr Bilder, die sie stolz an ihren Kühlschrank hängte.
»Wollt ihr eine Banane oder einen Apfel?«, fragte ich die Mädchen. Zumindest das Obst war frisch.
»Banane«, kam es von den beiden jüngeren.
»Apfel«, sagte Millie.
»Will irgendjemand Speck?«
Alle drei nickten begeistert. Bei Speck waren wir ausnahmsweise alle einer Meinung.
Ich nippte an meinem Kaffee und warf ein paar Speckstreifen in die Pfanne, dann lief ich in den Keller, um die Ladung dunkle Wäsche noch einmal zu waschen, die ich am Abend zuvor vergessen hatte. Da ich nun schon einmal hier unten war, holte ich eine Fuhre weiße Wäsche aus dem Trockner und legte sie in einen Korb, wobei ich bemerkte, dass alles einen eindeutig rosafarbenen Ton angenommen hatte. Im selben Moment entdeckte ich auch schon Winifreds rote Socke im Korb, mitten zwischen weißen Socken und weißer Unterwäsche.
Na toll. Genau das, was ich brauchte – rosa Socken.
Leise fluchend – wenigstens hörte mich diesmal niemand – ließ ich den Korb stehen und ging zurück in die Küche, wo ich die brutzelnden Speckstreifen wendete, noch mehr Kaffee in mich hineinkippte und zusah, wie sich Winifred Ahornsirup über den Mund schmierte. »Das ist Lippenstift«, verkündete sie stolz.
»Du schmierst ihn dir gerade in die Haare«, bemerkte Millie und rückte mit ihrem Barhocker von Winnie ab.
Eine Gabel landete laut klirrend auf dem Boden. Zwei Minuten später stieß jemand mit dem Ellbogen ein Glas um, und Saft rann über die Thekenkante an der Vorderseite eines Schranks herunter. Nachdem das wieder sauber gewischt war (und ich der Schimpfwortkasse weitere fünfzig Cent schuldete), überwachte ich gerade Felicity dabei, wie sie an unserer kleinen Kücheninsel ihre Banane in Scheiben schnitt, als die Küche sich mit Rauch füllte. Ich drehte das Gas unter dem Speck aus, nahm die Pfanne vom Kochfeld und öffnete das Fenster.
»Bäh, angebrannt«, sagte Millie.
Ich schloss die Augen und holte Luft.
»Ist schon gut, Daddy«, warf Felicity ein. »Ich mag schwarzen Speck.«
Winifred hustete, und ich öffnete ein Auge und sah sie an. »Du erstickst doch nicht, oder?«
Sie schüttelte den Kopf und griff nach ihrem Saft.
»Gut. Ersticken ist nicht erlaubt.« Ich schob die zu ausgiebig gebratenen Speckstreifen auf ein paar Küchentücher. »Dann essen wir unseren Speck heute Morgen wohl extrakross, Mädels. Tut mir leid.«
»Oh, Daddy, ich hab ganz vergessen, es dir zu erzählen. Millie hat meine Brille kaputt gemacht«, verkündete Felicity, die inzwischen mit ihrer klein geschnittenen Banane wieder auf ihrem Platz an der Theke saß.
»Hab ich gar nicht!«
»Hast du doch. Du hast dich draufgesetzt.«
Millie sah sie finster an. »Vielleicht hättest du sie nicht auf der Couch liegen lassen sollen.«
»Vielleicht solltest du schauen, wo du dich mit deinem dicken Hintern hinsetzt.«
»Ich habe keinen dicken Hintern! Daddy, Felicity hat gesagt, mein Hintern ist dick!«
»Niemand in diesem Haus hat einen dicken Hintern«, sagte ich und stellte den extrakrossen Speck vor sie hin. »Jetzt esst euer Frühstück. Felicity, ich sehe mir deine Brille gleich mal an.«
Es gelang mir, alle dazu zu bringen, etwas zu essen, Felicitys Brille zu reparieren, die Küche sauber zu machen, ein wenig Wäsche zusammenzulegen, mich anzuziehen, meine und Mrs Gardners Einfahrt freizuschaufeln und meinen SUV rechtzeitig in Gang zu bringen, damit ich Millie zum Ballett fahren konnte – mit Müh und Not.
»Okay, los geht's«, rief ich von der Haustür aus.
»Aber mein Haar ist nicht frisiert«, protestierte Millie, die gerade in ihrem schwarzen Trikot und ihrer rosa Strumpfhose die Treppe herunterkam. Ihr blondes Haar war tatsächlich immer noch ein einziges Durcheinander.
»Und Winnie ist noch nicht angezogen«, vermeldete Felicity von der Couch im Wohnzimmer, wo sie auf ihrem iPad spielte.
Ich sah zu Winifred, die in ihrem Hufflepuff-Schlafanzug auf dem Boden lag und sich einen Zeichentrickfilm ansah. »Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Winnie, zieh deine Stiefel und deinen Mantel über deinen Schlafanzug. Felicity, mach dich fertig und sorg dafür, dass ihr eure Mützen und Handschuhe dabeihabt. Es ist eiskalt draußen.« Dann sah ich Millie an. »Geh und hol die Sachen für den Dutt. Ich verteile hier sonst überall Schnee, und ich hab keine Lust, das ganze Mistzeug extra wieder auszuziehen.«
Felicity zeigte mit dem Finger auf mich und rutschte von der Couch. »Das macht noch mal fünfzig Cent, Daddy.«
»Mist ist kein Schimpfwort«, wandte ich ein.
»Darf ich es in der Schule sagen?«
»Nein.«
»Dann ist es ein Schimpfwort.«
Ich seufzte tief. Gleich darauf kam Millie mit einer Bürste, einem Haargummi und einem Kästchen Haarnadeln die Treppe herunter. Fünf Minuten später war es mir gelungen, ihr dickes, honigblondes Haar zu einer Frisur zu bändigen, die einem Ballerina-Dutt ähnelte. Stirnrunzelnd betrachtete ich das Ergebnis. »Nicht mein bestes Werk heute, Mills. Das muss ich leider zugeben.«
»Mein Dutt ist immer der schlechteste von allen, Daddy. Die anderen Mädchen lachen schon darüber.«
Ein schweres Gewicht legte sich auf meine Brust. »Das tut mir leid. Ich gebe mir wirklich Mühe.«
»Wir sind fertig«, sagte Felicity. »Aber meine Stiefel sind so eng, dass ich kaum hineinkomme. Und Winnie kann nur einen Handschuh finden.«
Ich schloss für einen Moment die Augen und holte tief Luft. »Wir werden dir diese Woche neue Stiefel besorgen, und in dem Kasten da sind eine Million Handschuhe. Hol bitte einen davon.«
»Dann passt er aber nicht zu dem anderen.«
»Das ist egal. Beeil dich, deine Schwester kommt sonst zu spät.«
»Ich komme doch sowieso jede Woche zu spät«, murrte Millie und warf sich ihre Tasche über die Schulter. Als sie sich an mir vorbei durch die Tür zwängte, hielt ich sie am Ellbogen fest.
»Hey. Tut mir leid. Ich werde mich von jetzt an mehr anstrengen, dich pünktlich hinzubringen, okay?«
Sie nickte. »Okay.«
Ich ließ sie los, scheuchte Felicity in ihren zu kleinen Stiefeln zur Tür hinaus und zog Winnie einen x-beliebigen Fäustling über die Hand, bevor ich sie hochhob, nach draußen trat und die Tür hinter uns zuzog.
Ich hatte in den vergangenen neun Monaten wesentlich katastrophalere Vormittage erlebt, aber es hatte auch schon erfolgreichere gegeben – wenn auch nicht viele. Ich gab wirklich mein Bestes, aber verdammt noch mal, Millie hatte einen besseren Dutt verdient, Felicity verdiente passende Stiefel und Winifred einen Dad, der daran dachte, sie anzuziehen und ihr den Sirup aus dem Haar zu waschen, bevor er mit ihr das Haus verließ.
Und sie alle verdienten eine Mutter, die nicht einfach abhaute – sie hatte ihre Töchter in den vergangenen neun Monaten nur zweimal gesehen.
Was mich betraf, wäre ich mit einem Morgen nur für mich zufrieden gewesen. Einem einzigen Morgen, an dem ich nicht die Verantwortung für alle schultern musste, an dem ich mich wie ein Mann fühlte und nicht nur wie Daddy. Einem Morgen, an dem ich fluchen konnte, ohne Geld in ein Glas werfen zu müssen. Einfach um mich daran zu erinnern, dass es ein Leben jenseits von schmutziger Wäsche, Mittagessen und kleinen Mädchen gab. War es verwerflich, das zu wollen?
Wahrscheinlich.
Aber trotzdem.
Ein einziger Morgen. Das war alles, was ich mir wünschte.
Kapitel 2
Frannie
Unter dem Schuh der Braut klebte Toilettenpapier.
Ich stand an der Rezeption des Cloverleigh Farms Inn, das das Hochzeitspaar für das ganze Wochenende gebucht hatte, und sah sie aus dem WC in der Lobby kommen. Sie schleifte sechs oder sieben peinliche weiße Vierecke mit. Rasch trat ich hinter dem Tresen hervor und ging auf sie zu, bevor sie im Restaurant des Landhotels verschwinden konnte, in dem gerade die Hochzeitsfeier stattfand.
»Verzeihung, Mrs Radley?«
Die Braut, eine schlanke Frau in den Vierzigern mit kastanienbraunem Haar, drehte sich zu mir um und lächelte angesichts der Verwendung ihres neuen Familiennamens. »Das bin dann wohl ich, nicht wahr? Es wird noch eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe.«
Ich erwiderte ihr Lächeln. »Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass Sie Toilettenpapier unterm Schuh hängen haben.«
Sie schaute auf ihre Füße, die unter dem knielangen Saum des elfenbeinfarbenen Schrägschnittkleides deutlich zu sehen waren. »Ach herrje. Vielen Dank – das wäre peinlich geworden.«
»Keine Ursache.«
Als sie sich nach dem Papier bückte, riss einer der Satin-Spaghettiträger ihres Kleides. Sie schnappte nach Luft, zog ihn hoch und hielt ihn fest. »Oh mein Gott, was für ein Schlamassel«, flüsterte sie. »Und gleich ist unser erster Tanz dran. Hilfe!«
»Keine Sorge«, beruhigte ich sie und nahm sie am Arm. »Kommen Sie mit. Das kriegen wir schon wieder hin.«
Ich stieß die Tür hinter der Rezeption auf und führte sie in den Flur mit den Büros der Verwaltung. Zuerst versuchte ich es bei meiner Mutter, aber die Tür war abgeschlossen. Als Nächstes ging ich zum Büro meiner Schwester April – sie war die Eventplanerin des Hotels und immer für Notfälle gewappnet. Gerade beaufsichtigte sie im Restaurant das Anrichten des Desserts, aber ihre Bürotür war nicht abgeschlossen.
Eine kurze Durchsuchung von Aprils Schreibtisch förderte allerdings nichts zutage, womit ich ein Kleid hätte flicken können, nicht mal eine Sicherheitsnadel. »Verflixt«, sagte ich und schaute zur unruhigen Braut hinüber. »Sie haben nicht zufällig Nadel und Faden in Ihrer Handtasche, oder?«
Mrs Radley schüttelte mit schuldbewusster Miene den Kopf. »Nein. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.«
Ich schob Aprils oberste Schreibtischschublade wieder zu. »Okay, eine Idee hab ich noch, wo ich suchen kann, und wenn da nichts ist, laufe ich hoch in meine Wohnung und hole eine Sicherheitsnadel.«
»Oh, Sie wohnen hier?«
»Ja«, bestätigte ich und zog Aprils Bürotür zu. »Ich bin Frannie Sawyer. Meiner Familie gehört das Cloverleigh Farms Inn.«
»Ach du meine Güte, natürlich«, sagte sie und folgte mir den Flur entlang. »James, mein Mann, spielt mit Ihrem Vater Golf. Und ich habe gestern Ihre Mutter kennengelernt. So wunderbare Menschen. Sie sind fünf Mädchen, nicht wahr? Welche davon sind Sie?«
»Ich bin die Jüngste. Okay. Probieren wir es hier mal.« Ich öffnete die letzte Tür auf der linken Seite und schaltete das Licht ein.
Als ich Macks Büro betrat, konnte ich ein leichtes Flattern in meinem Bauch nicht unterdrücken. Es roch nach ihm – eine maskuline Mischung aus Holz, Leder und Kohle. Es war vielleicht merkwürdig, aber ich hatte den Geruch von Eisenwarenläden immer geliebt, und genauso roch Macks Büro für mich. Wahrscheinlich lag es an meinen schönen Erinnerungen daran, wie ich als Kind mit meinem Dad in die Eisenwarenhandlung gegangen war und er mir anschließend immer ein Eis gekauft hatte.
Vielleicht war der Grund aber auch, dass Mack verdammt heiß war und ich ständig von ihm fantasierte. Schon möglich.
»Gehört das Büro Ihrem Dad?«, fragte Mrs Radley und schaute sich um, während ich zum Schreibtisch ging.
»Nein, das ist das Büro von Mack, unserem Finanzchef. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er Nähzeug hat. Ich habe ihm aus Spaß welches zu Weihnachten geschenkt, denn ich musste ihm letztes Jahr zweimal einen Hemdknopf annähen, der ihm bei der Arbeit abgerissen war.«
Mit leichten Gewissensbissen, weil ich in seiner Abwesenheit in seinem Schreibtisch herumwühlte, zog ich die oberste Schublade auf: Bleistifte, Kulis, ein gelber Textmarker, eine herausgerissene Seite aus einem Disney-Ausmalbuch, wahrscheinlich von einer seiner Töchter, Post-it-Zettel, Pfefferminzbonbons, seine Visitenkarten vom Cloverleigh Farms Inn. Für einen Moment abgelenkt, nahm ich eine der Karten in die Hand.
Declan MacAllister, Finanzvorstand und Geschäftsführer.
Ich vergaß immer, dass er eigentlich Declan hieß, da alle ihn Mack nannten, aber der Name gefiel mir. Manchmal flüsterte ich ihn sogar nachts in mein Kissen.
»Sind das seine Töchter?« Sie zeigte auf ein Foto auf dem Schreibtisch. Hinter mir auf dem Regal standen weitere Bilder von den Mädchen. Er war so ein aufopferungsvoller Dad. Ich wusste das aus erster Hand, weil ich, seit seine Frau ihn letztes Jahr verlassen hatte – sie musste verrückt sein –, Teilzeit-Kindermädchen bei der Familie war. Die Mädchen waren wirklich entzückend, klug und lieb.
Und Mack war einfach ... alles.
»Ja«, bestätigte ich. »Sind sie nicht süß? Ah!« Ganz hinten in der Schublade fand ich das kleine Nähset, das ich ihm geschenkt hatte. Triumphierend hielt ich es in die Höhe und musste daran denken, wie er gelacht und sich mit einer Umarmung, von der ich mich immer noch nicht erholt hatte, bei mir bedankt hatte. Seine Brust war so fest.
Mrs Radley sah mich erleichtert an. »Gott sei Dank.«
Ich schnappte mir Macks Schere und trat hinter sie. »Okay, ich denke, ich schaffe das, ohne dass Sie das Kleid ausziehen müssen, aber versuchen Sie, sich möglichst wenig zu bewegen. Ich will Sie nicht stechen. Weißes oder gelbes Garn? Tut mir leid, Elfenbein ist in dem Set nicht dabei.«
»Weiß.« Sie stand ganz still, während ich den Faden einfädelte. »Ist er das?« Sie deutete auf ein gerahmtes Foto von Mack und seinen Töchtern, das ich beim Mitarbeiter-Picknick im letzten Juni aufgenommen hatte. Winifred saß auf seinen Schultern, und die beiden anderen hingen an seinen kräftigen Oberarmen. Alle vier lachten in die Kamera. Ich erinnerte mich daran, wie dankbar Mack an dem Tag gewesen war, weil ich Basteln und Spiele für die Kinder organisiert und ihnen die ganzen guten Verstecke gezeigt hatte. Ich hatte ihnen erlaubt, barfuß im Bach zu waten, und sie in die Ställe mitgenommen, damit sie die Tiere streicheln konnten. Er hatte gesagt, er habe sie seit Monaten nicht mehr so glücklich gesehen, mir einen Arm um die Schultern gelegt und mich an sich gedrückt. (In meinen Fantasien entwickelte sich das rasch weiter, aber in Wirklichkeit hatte ich es bei einem »Gern geschehen« belassen.)
»Ja, genau«, sagte ich, während ich vorsichtig den Träger ihres Kleides wieder festnähte. »Das ist er.«
»Sehr attraktiv.«
»Ja.« Mein Herz schlug ein wenig schneller.
Sie lachte leise. »Das war ein sehr nachdrückliches Ja. Sind Sie beide ein Paar?«
Nur in meinen Träumen. Ich räusperte mich. »Nein.«
»Ist er verheiratet? Ich sehe keine Frau auf den Fotos.«
»Er war es. Jetzt ist er geschieden und alleinerziehender Dad.«
»Sind Sie verheiratet?«, fragte die Braut weiter.
Ich lachte. »Nein.«
»Freund?«
Ich schüttelte den Kopf.
Sie deutete auf das Foto von Mack und seinen Töchtern. »Ich wette, dieser Mann könnte irgendwann mal einen freien Samstagabend gebrauchen. Sie sollten ihn fragen, ob er mit Ihnen ausgeht.«
»Es ist wahrscheinlicher, dass er mich an einem Samstagabend als Babysitter engagiert«, antwortete ich trocken und machte einen Knoten in das Fadenende.
»Sind Sie denn so viel jünger als er?«
»Zehn Jahre. Ich bin siebenundzwanzig, und er ist siebenunddreißig.«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das ist doch gar nichts. James ist zwölf Jahre älter als ich. Das Alter ist nur eine Zahl.«
Vielleicht, aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass Mack ein Kind vor sich sah, wenn er mich anschaute. Kein einziges Mal in den fünf Jahren, seit er hier arbeitete, hatte er mich auf irgendeine Weise erkennen lassen, dass es anders sein könnte, ungeachtet der Tatsache, dass ich kaum atmen konnte, wenn wir uns im selben Raum aufhielten.
Es war eine hoffnungslose Schwärmerei, und das war mir vollkommen klar.
Ich schnitt den Faden ab und überzeugte mich davon, dass von meinem Werk nichts zu sehen war. »Da wir gerade vom Bräutigam sprechen – wir sollten besser zusehen, dass Sie zum ersten Tanz zurück im Saal sind.«
»Sie haben recht. Ich habe nicht vor, ihn vom Haken zu lassen. Ihm graut vor dem Tanz.« Sie lachte und drehte sich zu mir um. »Wie sehe ich aus?«
»Wunderschön. Sie strahlen richtig.«
»Kein Lippenstift auf den Zähnen? Kein Weinfleck auf meinem Kleid?« Sie schaute auf ihre Schuhe. »Kein Toilettenpapier?«
Lachend schüttelte ich den Kopf. »So können Sie gehen.«
»Vielen, vielen Dank, Frannie.« Sie umarmte mich kurz. »Sie sind ein Schatz.«
»Gern geschehen. Geben Sie mir eine Sekunde, um die Sachen hier wegzuräumen, dann bringe ich Sie zurück.«
»Ich finde den Weg, keine Sorge.« Sie ging zur Tür. »Und ich sollte mich lieber beeilen – die Macarons auf dem Tisch mit den Desserts sahen köstlich aus. Nicht, dass sie alle weg sind, wenn ich dort ankomme.«
»Oh, die habe ich gemacht. Ich kann Ihnen jederzeit noch ein paar bringen, falls keine mehr da sein sollten.«
Mit offenem Mund drehte sie sich zu mir um. »Die haben Sie gemacht? Die sind wunderschön! Und absolut köstlich! Ich habe eins probiert, als wir das erste Mal hier waren – kein Scherz, das war einer der Gründe, warum ich unsere Hochzeit hier feiern wollte.«
Ich lächelte und wurde rot. »Das freut mich sehr.«
»Sie sind wirklich talentiert. Sind Sie Konditorin? Was um alles in der Welt machen Sie an der Rezeption?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin keine Konditorin. Aber ich habe von einem Konditor, der hier vor Jahren gearbeitet hat, einiges gelernt – Jean-Gaspard. Er war so freundlich, meine ständige Anwesenheit in der Küche und meine endlosen Fragen zu ertragen, und ich habe mir alles gemerkt, was er gesagt hat.«
Sie lachte. »Nun, es hat sich ausgezahlt. Bekommt man Ihre Sachen auch im Laden?«
»Nein. Nur hier.«
»Sie sollten sich damit unbedingt selbstständig machen!«
»Vielleicht mach ich das irgendwann«, sagte ich und schob die Nadel zurück in das Nähset.
»Worauf warten Sie?«, rief sie und warf die Hände in die Luft.
»Ich weiß es nicht. Darauf, dass der Blitz einschlägt?« Ich lachte verlegen. In Wahrheit hatte ich mir das schon tausendmal ausgemalt – nur ein ganz kleiner Laden, gesäumt von ein paar Glasvitrinen voller wunderschöner, bunter Macarons. Aber konnte ich mit so etwas Erfolg haben? Was, wenn es zu speziell war und die Touristen hier einfach nur Karamellbonbons und Eiscreme wollten? Was, wenn ich scheiterte und haufenweise Geld verlor? Ich hatte keinerlei Erfahrung oder Know-how, wenn es ums Geschäftliche ging – ich war nur ein Mädchen, das gern buk.
»Hören Sie, ich habe im Moment keine Visitenkarte bei mir, aber wenn ich aus Hawaii zurückkomme, schicke ich Ihnen eine. Ich bin im Bereich Gewerbeimmobilien tätig, und manchmal investiere ich auch in lokale Projekte – insbesondere in solche von Unternehmerinnen. Wenn Sie jemals ausführlicher darüber reden wollen, lassen Sie es mich wissen. Dann könnte ich mich auch dafür erkenntlich zeigen, dass Sie mich auf meiner Hochzeit vor einer unendlichen Blamage gerettet haben.«
»Okay«, sagte ich, obwohl mir das nicht allzu realistisch erschien. »Vielen Dank.«
Sie grinste mich ein letztes Mal an, dann verschwand sie im Flur und ließ mich allein in Macks Büro zurück.
Ich packte das Nähset zusammen und legte es wieder neben seine Schere in die Schublade. Ich wusste, dass ich eigentlich zur Rezeption zurückgehen sollte, aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, mir einen Moment Zeit zu nehmen und mich auf seinen Stuhl zu setzen. Also ließ ich mich auf das abgenutzte Leder sinken, legte die Arme auf die Armlehnen, schloss die Augen und atmete tief ein.
Genau hier befindet sich jeden Tag sein Hintern. Es ist, als würde mein Po seinen berühren.
»Frannie? Was machst du da?«
Ich riss die Augen auf und sah zur Tür, wo meine Schwester Chloe stand und mich anstarrte.
Ich sprang auf. »Gar nichts«, sagte ich schnell und kam hinter dem Schreibtisch hervor. »Ich habe nur nach etwas gesucht.«
»In Macks Büro?«
»Ja.« Ich schaltete das Licht aus, schob mich an ihr vorbei in den Flur und schloss die Tür hinter uns. »Der Braut war ein Träger an ihrem Kleid abgerissen, und wir brauchten Macks Nähzeug aus seinem Schreibtisch. Ich habe es in Ordnung gebracht.«
»Ja, ich habe sie gerade vorbeilaufen sehen.« Chloe schaute über ihre Schulter. »Sag mal, hast du Dad gesehen? Ist er heute Abend hier?«
»Vorhin war er da. Ist er nicht im Restaurant?« Ich ging bereits Richtung Rezeption.
»Nein. Vielleicht ist er schon zu Bett gegangen. Er ist in letzter Zeit immer so müde. Ich mache mir Sorgen um ihn.«
»Ich mir auch«, gab ich zu, öffnete die Tür am Ende des Flurs und ließ Chloe vorgehen. »Er sollte mal einen Gang runterschalten.«
»Finde ich auch. Ich wünschte, er würde mir erlauben ...« Sie seufzte. »Aber das wird er niemals tun.«
»Was soll er dir erlauben?«
»Vergiss es. Gar nichts. Ich geh dann mal.«
»Okay. Nacht.« Ich sah zu, wie sie durch die Eingangstür verschwand, und kämpfte mit der Enttäuschung darüber, dass sie sich mir nicht anvertraut hatte. Aber das war nichts Neues – obwohl Chloe nur fünf Jahre älter war als ich, hatten wir kein besonders enges Verhältnis.
Das lag zum Teil vielleicht an all der Aufmerksamkeit, die ich als Kind wegen meines Herzproblems bekommen hatte. Sie war das Nesthäkchen gewesen, bis ich aufgetaucht war und jede Menge Zuwendung beansprucht hatte. Noch vor meinem zehnten Lebensjahr hatte ich insgesamt drei Operationen am offenen Herzen gebraucht. Vielleicht hatte man ihr einfach nicht genug Beachtung geschenkt.
Doch vielleicht lag es auch am Altersunterschied. Sie war immer gerade aus den Dingen herausgewachsen, wenn sie für mich wichtig wurden – Barbiepuppen, Freundschaftsbänder, Boybands. Unsere Interessen schienen sich nie zu überschneiden, und sie verschwand aufs College, bevor ich in die Highschool kam.
Ich wünschte mir oft, zwischen mir und Chloe wäre es anders – zwischen all meinen Geschwistern und mir, um genau zu sein. Die Sawyer-Schwestern nannten uns die Leute.
Da war Sylvia, die Älteste, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem großen, wunderschönen Haus in der Nähe von Santa Barbara lebte. Ich hatte sie nie dort besucht, aber Sylvia postete immer jede Menge Fotos auf ihren Social-Media-Accounts, mit Hashtags wie #gesegnet und #meinleben und #dankbar. Alle meine Schwestern waren hübsch, aber ich hatte schon immer gefunden, dass Sylvia die Schillerndste von uns war. Ihr Mann Brett, ein Investmentbanker, war attraktiv und erfolgreich, sie hatten entzückende, kluge Kinder, und ihr Leben schien einfach perfekt. Deshalb kam es mir auch etwas seltsam vor, dass Sylvia auf keinem der Fotos, auf denen sie zu sehen war, lächelte.
April war fünfunddreißig und besaß eine Eigentumswohnung im Zentrum von Traverse City, nicht allzu weit entfernt vom Cloverleigh. Sie war nach dem College nach New York gegangen und hatte dort sieben Jahre lang gearbeitet. Danach war sie nach Hause gekommen, hatte sich als Eventplanerin betätigt und Cloverleigh Farms im Alleingang zu der Location für Luxushochzeiten in ländlicher Umgebung gemacht. Ihr Blick fürs Gestalterische und ihre Fähigkeit, Trends vorherzusehen und sich entsprechend anzupassen, waren unglaublich. Sie war Romantikerin wie ich, und Hochzeiten waren für sie das Größte, daher fand ich es irgendwie merkwürdig, dass sie nicht verheiratet war. Aber immer, wenn unsere Mutter versuchte, auf den Busch zu klopfen, zuckte April nur die Achseln und sagte, sie sei eben dem Richtigen noch nicht begegnet.
Meg, unsere mittlere Schwester, war dreiunddreißig und lebte in Washington, D.C. Sie war schon immer sehr leidenschaftlich gewesen und hatte ihre Ansichten immer vehement vertreten: vom Einsatz gegen Tierquälerei über Frauenrechte bis hin zum Kampf gegen Armut. Nach ihrem Jurastudium hatte sie einen Job bei der Amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU angenommen, arbeitete jetzt aber für einen US-Senator. Sie hatte so viel zu tun, dass sie nur selten mal nach Hause kam. Ich nahm an, dass sie immer noch mit ihrem Freund zusammenwohnte, irgendeinem hochrangigen Regierungsangestellten, aber ganz sicher war ich nicht.
Chloe, die ebenfalls in Traverse City lebte, kümmerte sich um das gesamte Marketing und die PR für das Cloverleigh und half bei den Weinproben. Sie war ehrgeizig, klug und kreativ, hatte ständig neue Ideen, und überhaupt riss sie sich den Arsch auf. Ich hatte den Eindruck, meine Mom und mein Dad bemerkten gar nicht, was sie täglich alles leistete. Manchmal fragte ich mich, ob es daran lag, dass Chloe als Jugendliche so schwierig gewesen war – trotzig, halsstarrig, eine uneinsichtige Regelbrecherin, die es liebte, ihre Grenzen auszutesten, und manchmal vergaß, nachzudenken, bevor sie sprach. Das totale Gegenteil von mir. Selbst als Erwachsene geriet sie häufig mit unseren Eltern aneinander und schien nie klein beizugeben. Ich wünschte mir oft, ich wäre ein bisschen mehr wie sie.
Ich wünschte mir oft, ich wäre ein bisschen mehr wie irgendeine von ihnen. Sylvia beneidete ich um ihre glückliche Ehe und ihre Familie, April um ihr Selbstbewusstsein und ihre kreative Ader, Meg um ihre feurige Leidenschaft und Chloe darum, dass sie so unbeirrt ihre Meinung vertrat ... sie wirkten alle so furchtlos auf mich. Manchmal fühlte ich mich nur dem Namen nach wie eine Sawyer-Schwester. Schließlich war ich die Einzige, die nicht mal fürs College das Nest verlassen hatte.
Es lag nicht daran, dass ich nicht auch gern auf ein weiter entferntes College gegangen wäre, genau wie meine Schwestern. Vielmehr hatten meine Eltern, insbesondere meine Mutter, mich darin bestärkt, Kurse vor Ort zu besuchen, damit ich weiter zu Hause wohnen konnte. »So bist du in der Nähe von Ärzten, die du kennst«, hatte sie zu mir gesagt. »Und dann fühlst du dich auch wohler und bist weniger gestresst. Ich weiß, du glaubst, du würdest zurechtkommen, aber wozu ein unnötiges Risiko eingehen?«
Wie oft hatte ich diese Frage in meinem Leben schon gehört – tausend Mal? Eine Million Mal? Meine Mutter stellte sie mir immer, wenn ich etwas tat, womit sie sich unwohl fühlte. Und ich hätte ihr alle möglichen Antworten geben können.
Weil ich erwachsen bin und meine eigenen Entscheidungen treffen will? Weil ich es satthabe, behandelt zu werden, als sei ich aus Porzellan? Weil ich nicht am Ende dastehen will mit null begangenen Fehlern und tausend Dingen, die ich bereue?
Aber nichts davon hatte ich je ausgesprochen.
Natürlich wusste ich, dass meine Eltern mich nur so behüteten, weil sie mich liebten, und ich hatte wirklich keinen Grund, mich zu beschweren. Ich liebte die Farm und das Hotel und die nahe gelegene Kleinstadt Hadley Harbor – ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ich hatte meine eigene Wohnung, in die ich mich zurückziehen konnte, und es fehlte mir an nichts. Mein Job an der Rezeption war nicht anstrengend, meine Arbeitszeiten ließen genügend Raum fürs Backen, und es gefiel mir, neue Menschen kennenzulernen, die Gäste zu begrüßen und ihnen alles zu zeigen, was wir zu bieten hatten. Ich kannte dieses Haus wie meine Westentasche.
Natürlich wäre es schön gewesen, ein paar mehr Freunde in meinem Alter zu haben, aber wir lebten in einer ländlichen Umgebung, in der es für junge Leute vor allem im Winter nicht besonders viele Angebote gab. Und weil ich wegen der ganzen Operationen und Krankenhausaufenthalte – von den Ängsten meiner Eltern, dass ich mich mit irgendwas anstecken könnte, ganz zu schweigen – ohnehin so viel Unterricht versäumte, hatte meine Mutter nach der zweiten Klasse beschlossen, mich zu Hause zu unterrichten, sodass ich auch keine besten Freundinnen von früher hatte, die ich anrufen konnte.
Aber immerhin hatte ich meine Eltern und meine Schwestern und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeitete. In der Sommersaison, wenn unser kleines Hotel und die Stadt vor Touristen nur so wimmelten, hatte ich auch schon Affären gehabt und war definitiv nicht das unschuldige Lämmchen, für das meine Eltern mich hielten. Ja, manchmal fühlte ich mich etwas einsam, aber das war wahrscheinlich ein geringer Preis für ein so angenehmes Leben.
Trotzdem.
Ich schob eine Hand in die Tasche meiner schwarzen Arbeitshose und holte die Visitenkarte hervor, die ich zuvor dort hineingeschoben hatte.
Declan MacAllister.
Es wäre schön gewesen, jemanden zu haben, mit dem ich dieses Leben teilen konnte.
Kapitel 3
Mack
Mein Wecker ging wie gewöhnlich um Viertel nach sechs, und ich sprang unter die Dusche. Um halb sieben war ich für die Arbeit angezogen und auf dem Weg nach oben, um die Mädchen zu wecken.
Ich hatte eine Weile gebraucht, aber mittlerweile bekam ich die morgendliche Routine an Schultagen tipptopp hin, und der heutige Tag lief mit geradezu militärischer Präzision ab.
Millie und Felicity duschten abends und legten sich vor dem Zubettgehen ihre Sachen heraus, sodass ich lediglich schauen musste, ob sie wirklich wach waren, bevor ich Winifred weckte. Sie brauchte manchmal länger, um richtig zu sich zu kommen, deshalb half ich ihr immer dabei, aus ihrem Schlafanzug heraus- und in ihre Schulsachen hineinzuschlüpfen. Wie ihre Schwestern legte sie sich ihre Kleidung am Abend vorher zurecht, sodass es für gewöhnlich ziemlich schnell ging, vor allem seit sie aufgehört hatte, wieder ins Bett zu machen.
Um Viertel vor sieben war ich unten, stellte das Frühstück auf den Tisch und schüttete Kaffee in mich hinein. Um sieben aßen die Mädchen, während ich ihnen einen Imbiss und Wasserflaschen einpackte und die Rinde von belegten Broten abschnitt, einmal Erdnussbutter und Marmelade auf Vollkorn, einmal Mandelmus und Honig auf glutenfreiem Weißbrot. (Warum Millie immer noch darauf bestand, glutenfrei zu essen, kapierte ich nicht – das war ein Spleen ihrer Mutter gewesen. Half es ihr, sich ihrer Mom irgendwie näher zu fühlen?) Winnie würde nach der Vorschule zu Hause mit dem Babysitter essen.
Um Viertel nach sieben standen Rucksäcke und Stiefel in Reih und Glied an der Tür, und die Kinder putzten sich oben die Zähne. Um halb acht warteten wir dick eingemummelt an der Bushaltestelle. Um zwanzig vor acht hatte ich allen einen Abschiedskuss gegeben, ihnen versichert, dass ich sie liebte, und ihnen einen schönen Tag gewünscht. Der Ausdruck auf Millies Gesicht verriet mir, dass sie sich Zuneigungsbekundungen in der Öffentlichkeit nicht mehr viel länger gefallen lassen würde, aber ich hatte vor, sie so lange damit zu quälen wie möglich. Sie hatten keine Mutter und keine Großeltern in der Nähe (meine alten Herrschaften hatten sich vor Jahren nach Arizona zurückgezogen, und Carlas Eltern lebten in Georgia), und meine Schwester Jodie wohnte mit ihrer Familie zwei Stunden entfernt in Petoskey. Daher fiel mir die Aufgabe zu, dafür zu sorgen, dass diese Mädchen wussten, wie sehr sie geliebt wurden, und auch wenn ich fast alles verpfuschte, was ein alleinerziehender Vater überhaupt verpfuschen konnte: In diesem Punkt würde ich nicht versagen. Schließlich konnten sie nichts dafür, dass ihre Mutter und ich nicht miteinander ausgekommen waren.
Um acht befand ich mich auf dem Weg ins Cloverleigh und war verdammt zufrieden mit mir. Heute Morgen hatte niemand geweint, gestritten oder seinen Saft verschüttet. Niemand hatte mich in letzter Minute an eine nicht unterschriebene Erlaubnis erinnert oder an Geld, das ich zu überweisen vergessen hatte, oder mich gebeten, auf eine Exkursion mitzukommen, die ich nicht begleiten wollte, und ich war mir zu neunundneunzig Prozent sicher, dass sich alle die Zähne geputzt hatten. Ich war noch nicht dazu gekommen, Felicity neue Stiefel zu kaufen, aber immerhin hatte ich Winifreds verschwundenen Fäustling gefunden.
»Was bin ich doch für ein toller Kerl«, sagte ich zu mir selbst und nippte an einem Thermobecher mit einem Foto von einem Petoskey-Stein, auf dem die Aufschrift DAD, YOU ROCK prangte. Ein Weihnachtsgeschenk von Felicity.
Ich nahm noch einen Schluck aus dem Becher und erinnerte mich an meine Überraschung, als jedes der Mädchen mir ein perfekt eingewickeltes Präsent in mir unbekanntem Geschenkpapier überreicht hatte. Waren sie ohne mich losgezogen und hatten Geschenke gekauft?
Später hatte Felicity ausgeplaudert, dass Frannie Sawyer ihnen an einem der Babysitter-Nachmittage bei uns geholfen hatte, im Internet ein paar kleine Geschenke für mich auszusuchen. Sie hatte sie an ihre Adresse liefern lassen und sie dann mitgebracht, damit sie eingepackt und unter den Baum gelegt werden konnten. So war Frannie: immer bereit, für andere einzuspringen, und das stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Letzten Sommer, als Carla uns verließ, hatte sie angeboten, ihre Stunden im Hotel zu reduzieren, um mir mit den Kindern zu helfen. Ich wäre vor Dankbarkeit beinahe auf die Knie gefallen. Sie war ein Gottesgeschenk.
Zu Weihnachten hatte ich die Kinder beauftragt, eine Schachtel Pralinen für Frannie auszusuchen, die sie ihr bei der großen Weihnachtsfeier für die Belegschaft überreicht hatten. An dem Abend hatte sie mir auch das kleine Nähset gegeben, und ich hatte ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich die Karte zu der Schokolade nicht mit unterschrieben hatte.
An diesem Abend hatte sie noch hübscher ausgesehen als gewöhnlich, und so gut gerochen. Ich erinnerte mich daran, wie ich sie (zweifellos nach ein paar Gläsern Bier) impulsiv umarmt und darüber nachgedacht hatte, wie lange ich meine Arme nicht mehr um eine Frau gelegt oder eine Frau so eng an mich gedrückt hatte, dass ich den Duft ihres Halses wahrnehmen konnte. Ich hatte keine weiblichen Freunde außerhalb der Arbeit, und mit Sicherheit hatte ich keine Dates. Frannie so nah zu sein war ein Schock für meine Sinne gewesen, und ich hatte sie schnell wieder losgelassen, bevor mein Körper meine Gedanken verraten konnte, die in etwa lauteten: Hey, ich weiß, du bist die Tochter vom Chef und die Babysitterin (außerdem sind meine Kinder ganz in der Nähe), aber du riechst toll, und du siehst perfekt aus in dem Kleid, und ich bin wiiiiirklich lange nicht mehr flachgelegt worden, also, was hältst du davon, wenn wir uns zum Vögeln in mein Büro schleichen? Ich verspreche auch, dass es schnell geht, wahrscheinlich beschämend schnell, und es wird auch überhaupt nicht peinlich werden, wenn wir uns dann am Montag bei der Arbeit wiedersehen. Vielen Dank.
Später an diesem Abend hatte sie die Idee gehabt, mit den Kindern eine Fahrt im altmodischen Pferdeschlitten des Cloverleigh zu unternehmen. Es war ein aufgearbeiteter Portland-Schlitten mit einer roten, samtbezogenen Sitzbank, auf der wir fünf uns zusammengequetscht hatten, dicke Wolldecken über dem Schoß. Irgendwie war sie neben mir gelandet und wurde fest gegen mich gedrückt, und der Duft ihres Parfums und die Tatsache, dass ihr Bein direkt an meinem lag, hatten mir eingeheizt, obwohl unsere Nasen, Finger und Zehen ganz taub wurden vor Kälte.
Noch lange nachdem ich die Kinder nach Hause gebracht und ihnen gute Nacht gesagt hatte, hatte ich in meinem Bett gelegen und an Frannie gedacht. Ich konnte immer noch hören, wie sie mit den Mädchen lachte, sah ihre rosigen Wangen vor mir und die Schneeflocken, die auf ihrem langen gewellten Haar lagen. Ich hatte mir gewünscht, sie immer noch an meiner Seite zu haben. Wie lange war es her, dass ich mit einer warmen, weichen, sexy Frau im Dunkeln rumgemacht hatte?
Bevor ich etwas dagegen hatte tun können, war ich bereits fiebrig dabei gewesen, mir bei der Vorstellung, wie sie nackt unter mir lag, einen runterzuholen. Ihr Atem auf meinen Lippen. Ihre graugrünen Augen, die sich langsam schlossen. Ihre Hände, die sich ins Laken krallten. Ihr Stöhnen in meinem Ohr. Ich hatte mich deswegen so schuldig gefühlt, dass ich ihr bei unserer nächsten Begegnung kaum in die Augen hatte sehen können.
Was mich natürlich nicht daran hinderte, es immer wieder zu tun. Tatsächlich war sie irgendwie zu meiner Lieblingsfantasie geworden. Ich schüttelte den Kopf und trank den letzten Schluck aus meinem Becher. Was für ein armseliges Klischee: Der geschiedene Dad, der scharf auf den Babysitter war. Als würde ein Mädchen wie sie etwas mit einem Mann wie mir zu tun haben wollen – einem Kerl mit drei Kindern und einer verbitterten Ex-Frau.
Aber heute Morgen ging es mir gut.
Ich bog in die Einfahrt des Cloverleigh, stellte den Wagen auf dem mir zugewiesenen Parkplatz ab und betrat durch den Vordereingang das Hotel. Auf dem Weg in mein Büro kam ich an Frannie vorbei, die an der Rezeption saß.
Vielleicht hatte ich diesen Weg genau deshalb genommen. Es gab eine Hintertür, durch die man schneller zu den Verwaltungsbüros kam, aber Frannies Lächeln vermochte einen schlechten Morgen in einen guten und einen guten in einen großartigen zu verwandeln.
Genau so ein Lächeln schenkte sie mir nun, es ließ ihr ganzes Gesicht aufleuchten. Sie hatte mit einer Strähne ihres sandfarbenen Haares herumgespielt, aber als sie mich sah, ließ sie die Hände sinken. »Morgen, Mack.«
»Morgen, Frannie. Wie war dein Wochenende?«
»Ziemlich gut. Wir hatten eine Hochzeitsfeier.«
Ich blieb stehen, die Hand schon auf der Tür zum Flur. »Oh, stimmt. Wie ist es gelaufen?«
»Gut.« Sie nickte enthusiastisch. »Nur dass der Braut ein Träger ihres Kleids gerissen ist und ich das kleine Nähset benutzen musste, das ich dir geschenkt habe, um den Schaden zu beheben.« Mit einem Mal wirkte sie nervös. »Ich hoffe, das war in Ordnung.«
Ich lächelte beruhigend. »Kein Problem. Du kannst das Nähzeug jederzeit benutzen.«
»Danke.«
»Einen schönen Tag noch.« Ich drückte die Tür auf und verschwand gerade im Flur, als in meiner Tasche das Handy vibrierte.
»Hallo?«
»Hallo, Mack, hier ist Mrs Ingersoll.«
Miriam Ingersoll, eine verwitwete Freundin meiner Mutter, war mein zweiter Babysitter. Von Montag bis Mittwoch holte sie Winifred um halb zwölf von der Vorschule ab, erwartete die beiden älteren bei uns zu Hause, wenn sie von der Bushaltestelle kamen, und passte auf alle drei auf, bis ich zwischen fünf und sechs nach Hause kam. Donnerstags und freitags war das Frannies Job.
»Hi, Mrs Ingersoll. Alles in Ordnung?«, fragte ich.
»Ich fürchte, nein. Ich bin heute Morgen auf dem vereisten Gehweg gestürzt und habe mir ein Bein gebrochen.«
»Oh nein.« Ich fühlte mich wie ein Arschloch, weil ich sofort darüber nachdachte, was das für die Kinder und für mich bedeutete. Dann erinnerte ich mich an meine Manieren. »Geht es Ihnen gut?«
»Nicht so besonders. Ich bin jetzt im Krankenhaus, meine Tochter ist bei mir. Ich muss vielleicht operiert werden.«
Ich schloss die Augen und legte meine Umhängetasche mit meinem Laptop darin auf meinen Schreibtisch. »Tut mir leid, das zu hören.«
»Mir tut es leid, Mack. Was ist mit den Kindern?«
»Machen Sie sich um die drei keine Sorgen. Ich finde schon eine Lösung.«
»Sind Sie sicher? Ich könnte meine Tochter schicken, damit sie Winifred abholt. Sie ist gerade hier bei mir.«
In grimmiger Entschlossenheit presste ich die Lippen zusammen. »Nein, ist schon in Ordnung. Sie müssen sich jetzt darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Bitten Sie Ihre Tochter, mich anzurufen, damit ich weiß, wie es Ihnen geht, okay?«
»Okay. Sagen Sie bitte auch den Kindern, dass es mir leidtut.«
»Kein Problem. Werden Sie bald wieder gesund.« Wir verabschiedeten uns, und ich ließ mich in meinen Stuhl sinken. »Scheiße.«
»Alles in Ordnung?«
Ich sah auf und entdeckte Henry DeSantis, den Winzer des Cloverleigh, der in der Tür zu meinem Büro stand. »Ja. Nein.« Ich legte das Handy beiseite und fuhr mir mit einer Hand übers Gesicht. »Mein Babysitter hat sich das Bein gebrochen und kann nicht Auto fahren. Ich muss mir überlegen, was ich heute Nachmittag mit meinen Kindern mache.«
»Tut mir leid. Das ist ja echt Mist.«
»Ich werde schon eine Lösung finden. Was gibt es?«
»Ich wollte einige Zahlen mit Ihnen besprechen, bevor wir uns wegen der Reparatur der Abfüllanlage oder der Anschaffung einer neuen mit Sawyer zusammensetzen.«
Ich runzelte die Stirn. Manchmal schien die Beförderung zum Finanzchef mehr Ärger mit sich zu bringen, als sie wert war. Aber ich konnte die Gehaltserhöhung gebrauchen, und ich schätzte die Herausforderung. Außerdem war es gut, mein betriebswirtschaftliches Studium tatsächlich mal zu nutzen. »Oh, richtig. Wann fängt die Besprechung an?«
»Um zehn.« Er hielt inne. »Soll ich einen neuen Termin ausmachen?«
»Nein, ich muss nur noch ...«
»Morgen, Henry! Hey, Mack.« Chloe Sawyer schlüpfte an DeSantis vorbei und schob sich in mein Büro. »Hast du eine Sekunde?«
»Tatsächlich muss ich ...«
»Ich wollte mit dir über die Idee mit der Destillerie sprechen, die ich letzte Woche schon mal erwähnt habe. Ich versuche schon die ganze Zeit, meinen Dad dazu zu bringen, mit mir darüber zu reden, aber ich schwöre bei Gott, dass er mir aus dem Weg geht.«
»Ja, so was tun wir Väter, wenn wir wissen, dass unsere Töchter uns um Dinge bitten wollen, die wir uns nicht leisten können.« Ich griff nach meinem Becher und stellte fest, dass er leer war. »Ich brauche mehr Kaffee. Vorzugsweise mit etwas Whiskey darin.«
Chloe lachte. »Wenn wir eine Destillerie vor Ort hätten, könnte ich dir welchen besorgen. Hast du heute irgendwie einen schlechten Tag?«
»Schon, ja. Mein Babysitter ist ausgefallen, und ich muss Ersatz finden, bevor Winifred um halb zwölf aus der Vorschule kommt.«
»Lass Frannie sie doch abholen.«
»Frannie arbeitet heute. Ich will ihr das nicht zumuten.«
Chloe verdrehte die Augen. »Sie sitzt an der Rezeption. An einem Montagmorgen. Im Februar. Es ist nicht so, als hätte sie viel zu tun. Ich bin mir sicher, dass Mom für sie einspringen kann.«
»Ich komme dann später wieder, Mack«, sagte DeSantis, während er sich rückwärts aus meinem Büro schob. »Wenn Sie Zeit haben, wunderbar. Wenn nicht, auch nicht schlimm.«
Ich warf ihm einen dankbaren Blick zu. DeSantis war ein feiner Kerl. »Ich werde mir die Zeit nehmen. Geben Sie mir dreißig Minuten, um ein paar Telefonanrufe zu tätigen und die Kinder unterzubringen.«