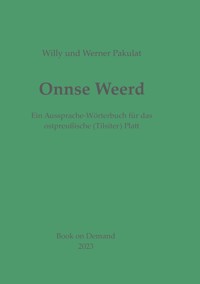
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aussprache-Wörterbuch zum ostpreußischen (Tilsiter) Platt
von Willy und Werner Pakulat
Das E-Book Onnse Weerd wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Ostpreußen, Plattdeutsch, Tilsit, Aussprache, Wörterbuch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Herausgebers
VORWORT
VORBEMERKUNG
SCHREIBWEISE UND AUSSPRACHE
KONSONANTEN
Kapitel A
Kapitel B
Kapitel C
Kapitel D
Kapitel E
Kapitel F
Kapitel G
Kapitel H
Kapitel I
Kapitel J
Kapitel K
Kapitel L
Kapitel M
Kapitel N
Kapitel O
Kapitel P
Kapitel Q
Kapitel R
Kapitel S
Kapitel Sch
Kapitel S
Kapitel T
Kapitel U
Kapitel V
Kapitel W
Kapitel Z
Vorwort des Herausgebers
Dieses Buch ist nach einem maschinenschriftlichen Manuskript mit vielen handschriftlichen Korrekturen und Zusätzen entstanden. Von den beiden Autoren habe ich nur Werner Pakulat kennengelernt, Willy war da bereits verstorben. Werner erzählte mir die Geschichte dieses Buchprojektes: Sein Bruder Willy hat über mehrere Jahre daran gearbeitet und schließlich auch der Ostpreußischen Landsmannschaft zum Druck angeboten. Man hatte kein Interesse.
Werner hat das Manuskript in seiner Handschrift bearbeitet und über Jahre aufbewahrt. Wir haben viel darüber gesprochen in seiner Wohnung in Greifswald mit seiner Frau Lore, auch über Tilsit, denn wir waren ja beide Tilsiter. Pakulats hatten draußen in der Stolbecker Straße gewohnt, meine Familie in der Bahnhofstraße gegenüber von der Artillerie-Kaserne. Werner war etliche Jahre älter als ich und konnte sich gut an Tilsit erinnern, so daß ich viele neue Eindrücke erhielt. Und er sprach auch sein Hochdeutsch mit so einem herrlichen ostpreußischen Akzent, daß ich ihm gerne zuhörte.
Als er schon sehr krank war, ließ er seine Frau eine Aktentasche holen, in der er das Wörterbuchmanuskript seines Bruders aufbewahrte. Er öffnete die Aktentasche, die einen dicken Ordner enthielt: „Hier, mach damit, was du willst. Die Aktentasche dazu kannst auch behalten.“ So gelangte ich in den Besitz des Manuskripts, und als ich es mir zuhause genauer ansah, zweifelte ich daran, daraus ein Buch machen zu können.
Dann starb Werner.
Und da versprach ich Willy und Werner Pakulat, auf jeden Fall „Onnse Weerd“ zu einem Buch zu machen.
Die braune Lederaktentasche mit dem dicken Ordner wurde über zwei Umzüge gerettet, und jetzt, wo ich im Seniorenwohnheim über eine Menge Zeit verfüge, habe ich das Manuskript in eine druckfähige Form gebracht.
Natürlich bleiben meine Zweifel, daß es noch Interessenten für ein solches Wörterbuch geben wird. Schon Willy Pakulat hatte in seinem Vorwort davon gesprochen. Schiedko jedno!
Die ursprünglichen Amerikaner (fälschlich „Indianer“ genannt) versuchen seit Jahrzehnten, ihre fast vergessenen Sprachen wiederzubeleben, weil diese wesentlich zur Identität ihrer jeweiligen Völker gehören. Ich habe Zweifel, daß das gelingen kann, so viele Sprachen sind mit ihren Völkern schon untergegangen, kaum erinnert man sich noch an ihre Namen. Auch die Ostpreußen und ihr Dialekt werden wohl dieses Schicksal erleiden.
Als meine Familie 1945 in einem mecklenburgischen Dorf angesiedelt wurde, war das Ostpreußische noch in der Sprache meiner Mutter (meinen Vater gab es nicht mehr) noch sehr lebendig. Bis heute klingen ihre ostpreußischen Wörter noch in mir. Ihr Gnosen, Dämlack, Patscheimer, die Füße heiß bähnen, Paslack, gnatzich, begnupst, Spickfuß, ich war wohl eingedruselt, Flinsen natürlich, Bommbomms, ein Butsch und viele andere Ausdrücke waren alltäglich, obwohl wir uns alle Mühe gaben, hochdeutsch zu sprechen. Wir wollten ja nicht durch unsere Sprache als Andere auffallen. Das ging so weit, daß meine kleine Schwester das Wort „Gäger“ erfand, weil sie gemerkt hatte, daß die Wörter Jeschirr, järne, jeholt usw. ostpreußische Ausdrücke waren, bei denen man das j durch g ersetzen mußte.
Ich liebe dem ostpreußischen Dativ („Es wird gebeten, dem Seehund nicht zu zergen.“ Siegfried Lenz) und die mindestens doppelte Verneinung und das schöne „nuscht“ (Drut wart keiner nich schlau. Rein gar nuscht.) Und die schönen Verkleinerungsformen (Du-chen, Mann-chen, Topp-ke, Hund-ke). Und „Das darf ich nich leiden!“ (im „Hauptmann von Köpenick“)
Heute ist Sonntag, der 12. November 2023.
VORWORT
„Trautsterche, Duche, wo bist du? Putthännke, Putthoanke, komm min Schoapke to mi! Schusche Patrusche, schloap, schloap!“
Diese bekannten Worte unserer Agnes Miegel aus „Mutter Ostpreußen“ hören wir manchmal bei festlichen Anlässen. Dabei kommt es aber oft vor, daß die herzerfrischende heimatliche Wärme dieser Dichtung verlorengeht, weil die mundartlichen Ausdrücke nicht richtig ausgesprochen werden. Ähnliches erleben wir mit anderen Vorträgen in ostpreußischem Dialekt.
Die älteren Ostpreußen, die den Klang unserer Heimat noch im Ohr haben, geht damit die ganze innige Vertrautheit verloren.
Ganz arg aber kann es werden, wenn sich jemand mit dem ostpreußischen Platt abmüht. Vielfach ist es dann so, als würde ein bekanntes heimatliches Lied nach einer uns ganz fremden Weise vorgetragen.
Diesen meist jüngeren Vortragenden muß trotzdem Dank und Anerkennung gezollt werden, daß sie sich überhaupt mit unserer plattdeutschen Mundart befassen. Sie nehmen diese Mühe ja nicht nur auf sich, um anderen Landsleuten eine Freude zu machen. Sie selbst erleben dabei, wenn auch noch nicht so recht bewußt, ein Stückchen Ostpreußen. Ihnen vor allem soll deshalb dieses Buch eine Hilfe sein, soll ihnen die plattdeutsche Ausdrucksweise leichter verständlich machen. Darum wurde versucht, die Wörter unserer ostpreußischen Landschaft allgemeinverständlich aufzuschreiben und die Aussprache möglichst einfach darzustellen.
Aber auch denen, die mit ihrer heimatlichen Ausdrucksweise in der Fremde alleingeblieben sind, die vielleicht schon vieles vergessen haben, ihnen kann diese Wortsammlung eine liebe Erinnerung sein. Sie werden mit Freuden feststellen, wie ungeheuer reichhaltig und differenziert der Wortschatz in unserem Plattdeutsch ist,
Nun wird man fragen, wozu sich die ganze Mühe machen. Die Alten, denen das Platt noch was zu sagen hätte, werden bald nicht mehr sein. Die Jungen aber habe sich längst an ihre neue Umgangssprache gewöhnt. Sicher ist das so. Aber gerade weil das so ist, müßten wir mit allen Kräften zu verhindern suchen, daß das Ureigenste unserer ostpreußischen Heimat, die von der Landschaft mitgeprägte gemeinsame Muttersprache, mit den Alten ausstirbt.
Wir können uns hier ein Beispiel an den vielen einheimischen Mundartvereinigungen nehmen. In den Jahren der Nachkriegsereignisse, die uns alle durcheinanderwirbelten, haben diese sich fester zusammengeschlossen, weil sie mit Recht befürchteten, daß ihre mundartlichen Spracheigenarten durch die Hinzugekommenen ihre Urtümlichkeit verlieren. In jeder örtlichen Tageszeitung kann man mundartliche Beiträge der jeweiligen Landschaft finden, und es ist erstaunlich, wieviel Interesse dafür vorhanden ist.
Um wieviel wichtiger müßte es für uns sein, die wir in alle Gegenden Deutschlands verschlagen wurden und nur relativ kleine Gemeinschaften bilden können, daß wir unser ostpreu-ßisches Platt pflegen und vor dem Vergessenwerden bewahren.
Zwar scheint es so, als haben wir Ostpreußen uns schon zu Hause mit dem Platt nicht so recht befreunden können. Besonders in den Städten galt es teilweise als unfein, plattdeutsch zu sprechen. Selbst jetzt bekam ich oft von Landsleuten, die ich befragte, die verschämt entrüstete Antwort: „Bei uns zu Hause wurde nicht Platt gesprochen!“
Dabei können wir Ostpreußen doch stolz auf unser Plattdeutsch sein. Nur wir können diese Mundart sprechen, die in ihrer besonderen Eigenart die Sprachen der deutschen Landschaften wesentlich bereichert.
Viel Liebes und Interessantes unserer Heimat haben wir erst in der Fremde kennen- und liebengelernt. Vielleicht entdecken wir die Schönheit unseres ostpreußischen Platt, wenn wir öfter mit gleichgesinnten Landsleuten schmunzelnd unsere wohl manchmal derben, aber doch so warm und von Herzen kommenden plattdeutschen Wörter sprechen.
VORBEMERKUNG zur Nutzung des Wörterbuchs nach den Aufzeichnungen der Autoren.
Dies ist vor allem ein Wörterbuch zur Aussprache der plattdeutschen Wörter und erst in zweiter Linie zu ihrer Bedeutung. Weggelassen wurden alle Wörter, die im Plattdeutschen genau wie im Hochdeutschen gesprochen werden:
Kind, Hund, Mond.
Das Wörterbuch besteht aus zwei Teilen:
1. Hochdeutsch (alphabetisch) – Plattdeutsch
2. Plattdeutsch (alphabetisch) – Hochdeutsch
Bei den Substantiven wird neben dem Stichwort im Singular auch die Pluralform angegeben, getrennt durch ein Komma. Weitere Möglichkeiten des Plurals durch Anhängen von s, sch sind gebräuchlich. Bei zahlreichen Substantiven sind diese alternativen Formen angegeben, getrennt durch den Schrägstrich für „oder“:
Hus, Hieser/Hiesersch
Schlorr, Schlorre/Schlorres
Ein Semikolon bedeutet überall eine stärkere Abgrenzung, eine neue Bedeutung:
Messer – Mäter, Mätersch; Knief; Poggerötzer
Nase – Näs, Näse; Tuntel; Schniefketuntel; Zingke
Die Adjektive sind mit den besonderen Steigerungsformen im Plattdeutschen enthalten:
grot, jrätter, jrättste
leef, leewer, leefste
Bei den Verben sind die vom Hochdeutschen stark abweichenden konjugierten Formen angegeben. Ein Beispiel für alle Konjugationsformen des Verbs goahne (gehen):
Präsens
Präteritum
Perfekt
(ich) öck
goah
jing
bönn jegange
(du) du
jeihst
jingst
böst jegange
(er, sie, es) he/se/et
jeiht
jing
öss jegange
(wir) wie
goahne
jinge
sönd jegange
(ihr) ju
goahne
jinge
sönd jegange
(sie) se
goahne
jinge
sönd jegange
In der Regel sind die folgenden Formen angeführt:
Infinitiv, 1. Pers. Sing. im Präsens, 2. Pers. Sing. im Präsens,
1. Pers. Plur. im Präteritum, Partizip Perfekt:
trauen – true, tru, trust, trude, jetrud [= trauen, ich traue, du traust, wir trauten, getraut]
wachen – woake, woak, woakst, woakde, jewoakt („Du kannst ruhig schloape, du mottst nur woak sömd!“)
Der bestimmte Artikel ist im ostpreußischen Platt für die männlichen und weiblichen Substantive: dä.
Für die sächlichen lautet er: dat.
dä Mann, dä Frau, dat Kind
Der unbestimmte Artikel lautet:
een Mann, eene Frau, een Kind
Um die Bedeutung der Wörter im ostpreußischen Platt verständlicher zu machen, wurden als Beispiel oft Sprichwörter, Sinnsprüche oder Redensarten im Anschluß an das Wort oder die Wortgruppe in kursiver Schrift gesetzt.
womöglich – womäjlich; amänd („Amänd hätt he doch rächt!“)
torfstechen – torrfstäke („Du kannst torrfstäke möttem Läpelstähl!“ ≈ Du kannst nichts!)
Ein Punkt unter einem Vokal bei einigen mehrsilbigen Wörtern kennzeichnet die Betonung dieser Silbe im Wort. Bei den meisten Wörtern ist die Silbenbetonung jedoch wie bei den hochdeutschen Entsprechungen.
ạfklabạstere, ạndeeje, Bommbọmm, Rụscheldupps
Der Schrägstrich / bedeutet wie allgemein akzeptiert „oder“, das Semikolon ; trennt stärker als das Komma, häufig Wörter unterschiedlicher Bedeutung,
der Pfeil → steht für „siehe (auch)“.
Die Unterstreichung bei s und sch bedeutet, daß der betreffende
Laut stimmhaft zu sprechen ist.
Blume – Bloom, Bloome/Bloomes; Bloomke, Bloomkes
möglich – meejlich/mäjlich
schließlich – amänd; tolätzt → endlich
Preeslok, Dirrschus
SCHREIBWEISE UND AUSSPRACHE
Für die Schreibweise des ostpreußischen Platt gibt es keine verbindlichen Regeln, man findet also bei den verschiedenen Autoren, die das Platt verwenden, durchaus auch unterschiedliche Schreibweisen. Und da es ein einheitliches ostpreußisches Platt nie gegeben hat, sondern mehrere regionale Varianten (z.B. Ermland, Masuren, Memelland, Kurische Nehrung), sind viele Unterschiede auch dadurch zu erklären. Die Autoren dieses Wörterbuches sind Tilsiter, ihr Platt ist also das des litauisch beeinflußten Memel-landes.
Hier kam es in der Hauptsache darauf an, die plattdeutschen Wörter so zu schreiben, daß deren einigermaßen richtige Aussprache auch ohne besondere Lautzeichen nur von der Schreibweise abgelesen werden kann.
Daraus ergeben sich folgende Regeln für ihre Schreibweise und Aussprache.
VOKALE
A) Immer breit und betont
1. Vor einem Konsonanten:
Äwer, Oler, utlatsche
2. a wird vom Ostpreußen immer breit und gedehnt als Kehllaut gesprochen, auch wenn zwei Konsonanten folgen:
afdampfe, blare, Dammelskopp
3. Dieser für das Ostpreußische Platt charakteristische Doppellaut klingt zwischen halboffenem o und a und wird immer breit und gedehnt artikuliert. Bei einigen Sprechern ist der Laut auch ein halboffenes, langen o, IPA: [ɔ:], mit nachklingendem a, wie in
goahne, oale, Goarde
4. Dehnung: e nach i und alle verdoppelten Vokale, wie in bliewe, rietz, plaastere, Plääster, Krooch, tuusche, dreech, Kreemels
Bei Wörtern, die wie im Hochdeutschen geschrieben werden müßten, sind die Vokale verdoppelt, die sich in der Aussprache von den hochdeutschen Wörtern unterscheiden:
Woort, Koorn, schääme, Tääter
Das Dehnungs-h wird der leichteren Lesbarkeit wegen beibehalten: Stohl, Koh, Meehre
B) Immer kurz und unbetont (wie im Hochdeutschen)
1. vor zwei Konsonanten:
önne, omm, örre, Tuttschke
2. vor ch, ck, ng, ngk, nd, sch, ss, tz:
Köch, jlick, Jung, Schlungk, Hundke, Fösch, plustere, Prötz
KONSONANTEN
1. ss, sch
Sollen diese Zischlaute stimmhaft gesprochen werden, wie es im Plattdeutschen vielfach vorkommt, so wird das durch eine Unterstreichung bezeichnet:
Duss el (Anders als im Hochdeutschen wird ss stimmhaft gesprochen.);
Grasch el (sch wird hier stimmhaft gesprochen, wie j im französischen journal).
Flins, Schmisser, utjefosselt, fisslich, rụschele, schusche, Schutte, Sching,
2. –che, -ke
Diese Endsilben stehen für das in Ostpreußen so beleibte Verkleinern der Begriffe. Um das Stammwort deutlich werden zu lassen, ist die Nachsilbe in manchen Fällen mit einem Bindestrich angeschlossen:
Kind-che, Brot-che, Du-che, Mann-che
Bei -ke wird das k als Gaumenlaut wie bei „ick“ gebildet:
Dach-ke, Du-ke, Brot-ke
3. g als j gesprochen ist ein weiteres Merkmal des ostpreußischen Platt; in diesen Fällen wird das Wort immer mit j geschrieben:
jebruke, jenäse, jewasse, jestorwe, jliede, jierich, Jefliejel, Jepäck, Jeschörr
4. Um manche Wörter richtig zu artikulieren, ist vor das k noch ein g gesetzt:
mangk, beschrängke, jejungkt, Jedrängk, Gangk
5. kw statt qw
Da die Schreibweise nach Möglichkeit der Aussprache angepaßt wurde, mußte bei den Wörtern mit qu konsequenterweise das kw angewendet werden:
Kwoal, Kwäljeist, kwär, kwatsche, kwoake
Zusammengesetzte Wörter
Bei manchen zusammengesetzten Wörtern kann aus der plattdeutschen Schreibweise der Sinn nicht sogleich erkannt werden. In solchen Fällen sind die beiden Bestandteile hinter dem Wort in Klammern die zusammengesetzten Wörter durch einen Bindestrich auseinandergezogen bzw. durch einen etwas größeren Abstand kenntlich gemacht:
Heijaust (Heej-aust) - Heuernte
Scholteknis (Schol-teknis) - Schulzeugnis
Huckke - Hocke
A
Aal ‒ Oal, Oale/Oals
aalen ‒ oahle. (He oahlt sick in dä Sonn.)
Aas – Oas, Oaser. (Ju Oaßer! Du Oaßknoake!- Schimpfwörter)
aasen – oase (vergeuden). Oas nichso romm mit dä Zocker.
ab – af. af un to; afnähme; afwasche.
abändern – afändere.
Abbau – Afbu, Afbute. He woahnt oppen Afbu.
abbitten – afbödde.
abblasen – afbloase.
abblitzen – afblötze. He öss doamött afjeblötzt.
abdampfen – afdamfe. Du sullst afdamfe! (verschwinden)
abdrücken – afdröcke.
Abend – Oawend, Oawende.
aber – obber, owwer. (Mit Betonung der zweiten Silbe bedeutet es eine besondere Bekräftigung. Öss dat uck woahr? – Ow’wer!)
abends – oawends.
Aberglaube – Oawerglowe. He öss oawerglowsch.
Abfahrt – Affoahrt, Affoarte.
Abfall – Affall, Affäll; Schramull, Schuchmull
Abfalleimer – Affallämmer, Patschämmer (für Flüssigkeiten)
abfärben – affarwe.
abflauen – afflue. Dä Wind flut af.
Abfuhr – Affohr.
abfüttern – affuttere.
Abgabe – Afgoaw, Afgoawe.
abgebrannt – afjebrännt. Öck sie ganz afjebrännt. (Ich habe kein Geld mehr,)
abgedroschen – afjedrosche
abgegolten – afjegolle, afjejöllt
abgegrast – afjegroast
abgegriffen – afjejräpe
abgemacht – afjemoakt (Man ist sich einig.) (Auch für Speisen:) Dä Sopp öss nich afjemoakt. (Kein Fett drin, schlecht gewürzt) Nich jesollte, nich jeschmollte. Es fehlen die nötigen Afmoaksel.
abgemessen ‒ afjemäte
abgeplattet – afjeplat
abgerissen – afjeräte (auch für „abgetragen“). He hätt dem Antoch schon afjeräte. Auch: afjekoddert.
abgetragen → abgerissen.
abgesagt – afjesächt
abgeschieden – afjescheede
abgesehen – afjeseehne
abgestanden – afjestande
abgestorben – afjestorrwe
abgetakelt – afjetoakelt (heruntergekommen)
abgetan – afjedoahne
abgewinnen – afjewönne
abgezogen –afjetoage, afjestreept (das Fell abgezogen)
abgucken – afkicke. Kick nich ömmer af!
abhalten – afhole. Däm Kleene afhole. (aufs Töpfchen halten)
abhanden – afhande, wächjekoame
Abhilfe – Afhöllp
abkanzeln – afkanzele. Dä hätt mie ganz scheen afjekanzelt.
abknöpfen – afkneepele
abkühlen – afkeehle
abkürzen – afkärrte
Ablauf – Aflop Afleep
Ableben – Afläwe
ablehnen – aflähne
ablösen – afleese
abmachen – afmoake → abgemacht
Abmachung – Afmoakungk, Afmoakunge
abmagern – afmoagere
abmessen – afmäte
Abnahme – Afnoahme, Afnähmer
Abort – Abee, Abees
abraten – afroade
Abrechnung – Afräknungk, Afräknunge
Abreibung – Afriewungk, Afriewunge
Absage – Afsägg, Afsägge
Abschied – Afscheed
abschließen – afschlute
abschnüren – afschneere
abschreiben – afschriewe, afklaue. Dat hätt dä doch afjeklaut.
absingen – afsinge. Dat war öck afsinge. (statt bezahlen)
Absprache – Afsproak, Afräd. Wie mötte dat bespräke/beräde. Se häbbe sick verafräd.
abstechen – afstäke, afkrängele (schlachten)
Abtausch – Aftuusch
Abteil – Afdeel, Afdeele
abtragen – afdroage (Geschirr abräumen)
abwarten – afwachte. Wacht af, warscht seehne!
abweichen – afweeke
abzahlen – aftoahle, afstottere
Abzäunung – Aftienungk, Aftienunge
Abzeichen – Afteeken, Afteekens
abzirkeln – afzörrkele. Obber uck jenau afjezörrkelt!
ach – ach. Ach ach! (Bei dem zweiten Wort die Stimme heben. Zynisches Bedauern). Acheu! (Erstaunen)
achtgeben – achtjäwe, oppasse
Ackerwagen – Ackerwoage, Ackerwoages; Klapperwoage; Hälwoage; Leiterwoage
ade – adjee. Na dänn adjeeke!
Ader – Oader, Oadersch
Affe – Oap, Oapes; Oapke. Dä huckt wie e Oap oppem Leierkaste. Alle Oape moake noa!
ahnen – oahne, jeoahnt ≈ schwoane. Mie schwoahnt so wat.
albern – alwer ≈ lachrich, jnittrich, jibberich. Jibber doch nich ömmer romm!
Alkohol – Fusel; Fijuchel
allein – alleen
allmählich – allmählich ≈ mötte Tied
allseitig – allsiedich
allwissend – allweetend
alt – olt, öller, öllste
Altenteil – Oledeel
Alter – Oler, Olsche. Mien Oler, miene Olsche. (mein Mann, meine Frau)
altern – öller ware
ältlich – äwerwändlich (etwas wunderlich)
altklug – olbacksch
altmodisch – olmodsch
Ameise – Heemske, Heemskes. De Heemskes häbbe mie ekrioape! Hemskeshupe.
amen – oame. Dat is wie dat Oame önne Körch. (Das ist selbstverständlich.
amüsieren – ameseere; verlusteere. Häst die ameseert? – Wie e Boll oppem Mällkwioage!
an der/die/das – anne. annem Bom, anne Wand, ant hus
Anbau – Anbu, Anbute
anbiedern – anbeedere. He beedert sick an.
anbieten – anbeede. Häst du mie nuscht antobeede?
anbrechen – anbräke. Dä Hundert Mark sönnd schon anjebroake.
Andacht – Andacht. Se huckt doa wie so bleiche Andacht.
andere – andre; jänne. Goah opp jänne Sied. (Geh auf die andere Seite.)
anders – andersch; anderscht. Dat öss doch andersch wie bie Zandersch, unn bie Zandersch öss wädder andersch.
ändern – ändere; änderscht, jeändert
anderthalb – anderthalf. Anderthalf unn anderthalf, zwee unn dree unn dröddehalf (dreieinhalb)
andeuten – andiede
andienen – andeene
anfahren – anfoahre
anfassen – begrapschen (tadelnd)
anfeuern – anfeiere; anfiere
Anfrage – Anfroag; Anfroage
Anführer - Anfehrer
Anführung – Anferung; Anferunge
angeben – anjäwe; (protzen) sick speejele
Angeber – Anjäwer, Anjäwersch
angeblich – anjäwlich
angegriffen – anjejräpe
angeheiratet – anjehieroat; anjefriet
angehörig – anjeheerich
angeln – angele, jeangelt. Na mie scbient, du häst die Lies oppjeangelt! (sich was Böses eingebrockt)
angemessen – anjemäte
angewöhnen – anjewänne
Angleichung – Anjliekungk
Angst – Schiss, Schöss; A. haben – bubbere, bibbere
ängstigen – ängstije
anhalten – anhole
anheben – anhäwe
anhören – anheere
Ankauf – Ankop, Ankeepe
anketten – ankäde
angekommen – ankomme; auch: leicht verdorben – Dä Worrscht öss all e bösske anjekomme.
ankreiden – ankriede
ankündigen – ankindige
ankurbeln – ankurrbele; andrälle, andreeje
anlegen – anlägge
anleiten – anleede
anlernen – anleere; Anleertied
annähernd – anneejernd
Annahme – Annoahm, Annoahmes
anpflanzen – anplante
anpreisen – anpriese
anraten – anroade
anrechnen – anräkne
anreichern – anriekere
Anruf – Anrop
anschirren – anschörre, anspanne
anschließend – anslutend, hindenoa. De Koater kömmt hindenoa!
Anschnitt – Anschnött Anschnötte. (beim Brot) Knuust, Papännter.
anschwärzen – anschwärrte
ansiedeln – ansiedele
Anspielung – Anspälungk, Anspälunge
Ansprache – Ansproak, Ansproake; Räd
anstellen – anställe. Ställ die an, obber nich damlich
anstoßen – anstete
anstrengen – anstrände, strämme. Nu strämm die man bösske!
anteigen – andeeje. Brotke andeeje. Dä wöll hier möttbacke un hätt nich anjedeejt. (ist unerwünscht)
Anteil – Andeel, Andele; Part. Dat öss diene Part.
antreiben – andriewe
an und für sich – an unn förr sick
Anwärter – Anwöarder, Anwoadersch
Anweisen – anwiese, wiese
Anweisung – Anwiesungk
Anzeichen – Anteeken, Anteekens
anziehen – anteehne; anprämmse (enge Sachen anziehen)
Anzug – Antoch, Anteej
anzünden – anzinde, anstöcke, anpäsere
Apfel – Äppel, (unreife Ä.) Hölltkes. Äppel, päppel, pim pam puff. (Abzählvers)
Apparat – Aperoat, Apperoate. Dä moakt de dollst Dingersch ohne Aperoat!
Appetit – Apetiet, Janker. Mie jankert! (besonderen Appetit haben). He haut rönn dat dat Muhl schiemt!
April – Apröll. Apröll moakt wat he wöll.
Arbeit – Oarbiet, Oarbiete. De Oarbiet öss kein Hoas nich, se löpt nich wäch.
arbeiten – oarbiede, jeoarbied; schanze, ragge (schmutzige Arbeit), wurrache, wurrjele, marachele, peerze, rackere. Vom väle Oarbiede kräppeere däm Bur de Peerd!
ärgern – ärrjere, jeärrjert; zarje, zerje (einen anderen ärgern) Es wird gebeten, dem Seehund nicht zu zergen. (Siegfried Lenz: Suleyken); → fuckse, → jrimmeleere, → worrme, (sich ärgern); Mie koakt önn alle Täpp! Öck sie ärrjerboßig!
argwöhnisch – oarjwoahnsch
arm – oarm. Dat ös doch nich wie bie oarme Lied: säwe Kiner, een Hämd.
Ärmchen – Oarmkes
Arsch ‒ Oarsch, Noarsch, Moarsch. E Moarsch wie e Achtzich-Doalerpeerd.
Asche – Asch
Astern – Astere, Astersch
atmen – oatem, jeoatemt; jappe. He jappt noch.
auch – uck
auf – opp
Aufbau – oppbu
aufbereiten – oppberiede aufbessern – oppbätere
aufbieten – oppbeede
aufbrausen – oppbruse; terräbbele (sich aufregen). Nu terräbel die man nich!
aufbrechen – oppbräke
aufeinander – oppeenander
Aufenthalt – Appentholt
Auffahrt – Oppfoahrt, Oppfoahrte
Auffassung – Oppfoatungk, Oppfoahtunge
auffrischen – oppfrösche
aufgebläht – oppjepommst
aufgebracht – oppjebrocht
Aufgeld – Oppjölld, Oppjöllder
aufgerauht – oppjeruucht
aufgeräumt – oppjeriemt
aufgeschmissen - oppjeschmäte
aufgetakel t- oppjetoakelt
aufgewärmt – oppjewarmt
aufhacken – opphacke (graben)
aufhaken – opphoake (Haken lösen)
aufhalsen – opphalse
aufheen – opphäwe
aufheitern – oppheitere
aufhetzen – opphätze
aufklaren – oppkloare
aufknöpfen –oppknöppe (Knoten lösen)
aufkrämpeln – oppkrämpele
Auflage – Opploag, Opploages
Auflauf – Opplop, Oppleepe
auflehnen – opplähne → aufsässig
Auflösung – Oppleesungk, Oppleesunge
aufmachen – oppmoake
aufmuntern – oppmuntere
Aufnahme – Oppnoahm, Oppnoahme
Aufraffen – opprappele, opprabastele
Aufräumen – opprieme, oppkroassele
Aufregung – Oppräjungk, Oppräjunge
aufrufen – opprope
aufrütteln – oppröddele
aufs (= auf das) - oppet
ausagen – oppsägge; runnerhaspele
aufsässig – karäsich
Aufschneider – Oppschnieder, Oppschniedersch. → Angeber
Aufschrift – Oppschröfft, Oppschröffte
aufsetzen - oppsätte
aufspalten – oppspole. Jeliemt, jenoagelt unn oppjespole, wänn dat nich höllt, wat sull dänne hole!
aufspeichern – oppspiekere
aufspüren – oppspiere
aufstapeln – oppstoapele
aufstehen – oppstoahne; rutkrupe (aus dem Bett); opprabastle (mühsam aufstehen)
aufsteigen – oppstiege
aufstöbern – oppsteewere; utbaldowere (auskundschaften)
aufstreichen – oppstrieke; schmäre (Brot), kliere (dick aufstreichen)
auftakeln – opptoakele. Na dä nätt sick wädder oppjetoakelt. (frisiert und geschmückt)
aufteilen – oppdeele
auftischen – oppdösche
Auftrag – Oppdrach, Oppdräj
auftragen – oppdroage; (Kleidungsstücke) oppschleife
Auftrieb – Oppdröfft
Auftritt – Opptrött, Opptrötte
auf und ab – opp unn af
aufwarten – oppwoarde
aufweichen – oppweeke
aufwenden – oppwände
aufwiegeln – oppweejele
Aufzeichnung – Oppteeknungk, Oppteeknunge
aufziehen – oppteene, uze (jemand ärgern, foppen
Auge – Og, Ogge; Oges. Wat kiekst mötte Näs, hässt keine Oges? Na een Og röskeer öck!
Augenbraue – Ogebrue, Ogebrues
Augendiener – Ogedeener, Scheeskeruckser
Augendienerei – Ogedeenerie
Augenschein – ogeschien
Augenweide – Ogewied
ausarbeiten – utoarbiede
ausbaldowern – utbaldowere, utklamiesere, utkniewele
Ausbau – Utbu
Ausbauchung – Utbukungk, Utbukunge; Knubbel, Knubbels
Ausbessern – utbätere
Ausbeute – Utbied, Utbiede
Ausblasen – utbloase, utpuuste
Ausbleichen – utbläcke, utjebläckt (verblichen)
Ausbreiten – utbreede, utspreede
Ausdauer – Utdur. Wart schon ware, nuscht öss nu all! De eerschte Flins wart meistens nich got.
Ausdehnung – Utdähnungk, Utdähnunge
Ausdrücklich – utdröcklich
Ausdunsten – utdonnste; utlöffte
Ausessen – utäte. Nu gnaschel nich, ät ut!
ausfragen – utfroage, uthoale
Ausgabe – Utgoaw, Utgoawes
Ausgang – Utgangk, Utjäng
Ausgefranst – utjefranselt, utjefosselt
Ausgeleiert – utjeleiert; utjenuddelt
Ausgenommen – utjenoahme
ausgerechnet – utjeräkend
ausgesteuert – utjestiert
ausgezeichnet – utjeteekend
ausgiebig – utjäwich
ausgießen – utjeete
ausgleichen – utjlieke
ausgraben – utgroawe, utbuddele
aushalten – uthole
aushandeln – uthandele; utdinge
ausheben – uthäwe
ausheilen – utheele
Aushilfe – Uthellp
aushilfsweise – uthällpswies
ausholen – uthoale
aushöhlen – utheele
ausholzen – utholze
Ausklang – Utklangk, Utkläng
Auskleidung – Utkleedungk, Utkleedunge
ausklügeln – utkliejele, utkniewele
auskommen – utkoame
auskramen – utkroame
auskühlen – utkeehle
Auslage – Utloag, Utloages
Ausland – Utland; Utlännder
auslassen – utloate. Späck/Fätt utloate.
Auslauf – Utlop
auslegen – utlägge
ausleihen – utliehe
Auslese - Utläs
Auslieferung – Utleewerungk, Utleewerunge
Auslöser – Utleeser
auslüften – utlöffte. Schote (Arfte oderBohne) utlöffte.
Ausmaß – Utmoaß
ausmauern – utmure
ausmessen – utmäte
ausmustern – utmustere
Ausnahme – Utnoahm, Utnoames
ausplaudern – utplaudere; utplachandere; utkadreiere
Ausplünderung – Utplinderungk, Utplinderunge
auspumpen – utpompe, utplompe
ausquartieren – utkwarteere
ausräuchern – utreekere
ausrufen – utruppe (ut-ruppe), utreewere (ut-rewere)
ausräumen – utrieme (ut-rieme)
ausrechnen – uträkne (ut-räkne)
Ausrede – Uträd (Ut-räd)
ausreisen – utreise (ut-reise)
ausreißen – utriete (ut-riete); utröcke (weglaufen)
Ausruf – Utrop
ausruhen – utruhe, verruhe. Öck mott mie erscht verruhe.
ausrupfen –





























