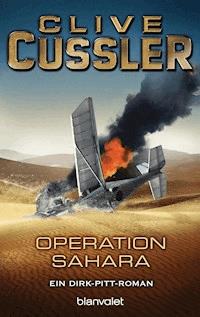
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
In der Sahara stoßen Dirk Pitt und sein Team auf eine gigantische Verschwörung, hinter der Malis Militärdiktator Karzim und ein skrupelloser Industrietycoon, der „Skorpion“, stehen. Wenn es Pitt nicht gelingt, die Pläne der beiden zu durchkreuzen, droht eine ökologische Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 849
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Operation Sahara
Roman
Übersetzt von Dörte und Frieder Middelhauve
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Sahara« bei Simon & Schuster, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 1992 by Clive Cussler
All rights reserved throughout the world.
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1993 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15218-5
www.blanvalet.de
In tiefer Dankbarkeit für die Hilfe von Dr. Hal Stuber (Umwelt-Chemiker), von James P. Walsh & Associates, Boulder, Colorado, der den überflüssigen Ballast strich und dafür Sorge trug, dass ich auf dem Boden der Tatsachen blieb.
Ausbruch
2. April 1865
Richmond, Virginia
Sie schien über dem geisterhaften Abendnebel zu schweben wie ein bedrohliches Ungeheuer, das sich aus dem Dunkel des Urwalds erhebt. Schwarz und geheimnisvoll hob sich ihre niedrige Silhouette gegen die Baumreihe am Ufer ab. Schattenhafte, phantomartige Gestalten bewegten sich im schwachen, gelben Licht der Laternen, während die Feuchtigkeit an den grauen aufragenden Flanken kondensierte und in die trägen Fluten des James River sickerte.
Ungeduldig wie ein Hund, der darauf lauert, dass ihm zur Jagd die Leine abgenommen wird, zerrte die Texas an ihrer Vertäuung. Ihre Geschützpforten waren mit schweren eisernen Klappen verschlossen, und die zehn Zentimeter dicke Armierung ihres Panzerdecks wies keinerlei Beschädigungen auf. Allein die weißrote Kriegsflagge oben am Mast hinter dem Schornstein, die reglos in der feuchten Luft hing, zeigte, dass es sich um ein Kriegsschiff der konföderierten Flotte handelte.
In den Augen der Landratten wirkte sie plump und hässlich, doch für Seeleute besaß sie ganz unverkennbar Charakter und eine gewisse Grazie. Die Texas war leistungsfähig, sie war tödlich; das letzte Exemplar einer Baureihe, die nach einer kurzen Phase anhaltender Siege jetzt zum Untergang verurteilt war.
Commander Mason Tombs stand auf dem Vorderdeck und zog ein blaues Tuch aus der Hosentasche, um sich den Schweiß, der sich unter seinem Uniformkragen gesammelt hatte, abzutupfen. Das Aufnehmen der Ladung verlief zu langsam, viel zu langsam. Die Texas würde für ihr Entkommen aufs offene Meer jede einzelne Minute der Dunkelheit benötigen. Ungeduldig beobachtete er seine Mannschaft, die unter Fluchen die Holzkisten über die Gangway und dann weiter durch eine offene Luke unter Deck wuchtete. Dafür, dass die Kisten Akten einer Regierung enthielten, die nur vier Jahre lang im Amt gewesen war, schienen sie außergewöhnlich schwer zu sein. Sie stammten von den von Mulis gezogenen Wagen, die in der Nähe des Docks standen und von den abgekämpften Überlebenden einer Infanteriekompanie aus Georgia streng bewacht wurden.
Tombs warf einen beunruhigten Blick nach Richmond hinüber, das nur zwei Meilen entfernt im Norden lag. Grant hatte Lees verbissene Verteidigung von Petersburg durchbrochen, und jetzt zog sich die angeschlagene Armee der Südstaaten auf Appomattox zurück und überließ die Hauptstadt der Konföderierten schutzlos dem Ansturm der Truppen der Union. Die Evakuierung war angelaufen, und in der Stadt herrschte eine heillose Verwirrung. Ein tobender und plündernder Mob füllte die Straßen. Explosionen ließen die Erde erbeben, und Flammen schossen hoch in die Nacht, als die mit Nachschub gefüllten Lagerhäuser und Arsenale in die Luft gejagt wurden.
Tombs war ehrgeizig und energisch, einer der herausragendsten Seeoffiziere der Konföderierten. Er war klein gewachsen, gut aussehend, hatte braunes Haar, dunkle Augenbrauen und einen mächtigen roten Bart. Seine olivschwarzen Augen blickten eiskalt.
Als Kommandant auf kleinen Kanonenbooten hatte sich Tombs in den Kämpfen vor New Orleans und Memphis als ernsthafte Bedrohung für die Sache des Nordens erwiesen. Danach kam er als Artillerieoffizier auf die Arkansas und später als Erster Offizier auf die Florida, ein berüchtigtes Kaperschiff. Das Kommando über die Texas hatte er eine Woche nach ihrem Stapellauf in der Rockettswerft in Richmond übernommen. In der Folgezeit regte er eine Reihe von Verbesserungen an und beaufsichtigte die Umbauarbeiten, die vor der kaum zu bewältigenden Reise flussabwärts, vorbei an tausenden Kanonen des Nordens, notwendig waren.
Der letzte Wagen entfernte sich jetzt vom Dock und verschwand in der Nacht; Tombs wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Ladevorgang zu. Er zog seine Uhr aus der Tasche, ließ den Deckel aufspringen und hielt das Zifferblatt ins Licht einer Laterne, die an einem Pfahl hing.
Es war zwanzig nach acht. Kaum acht Stunden blieben bis zum Sonnenaufgang. Das reichte nicht, um die letzten zwanzig Meilen des Spießrutenlaufs im Schutz der Dunkelheit zurücklegen zu können.
Ein offener Zweispänner, der von zwei scheckigen Pferden gezogen wurde, rollte heran und hielt neben dem Dock. Der Kutscher blieb stocksteif, und ohne sich umzudrehen sitzen, während seine beiden Passagiere zusahen, wie die letzten paar Kisten in den Laderaum gehievt wurden. Der dickere von beiden, der Zivil trug, ließ erschöpft die Schultern hängen, während der andere, in der Uniform eines Seeoffiziers, Tombs erspähte und ihm zuwinkte.
Tombs stieg über die Planke auf das Dock, lief auf dem Kai zum Zweispänner hinüber und salutierte zackig. »Es ist mir eine Ehre, Admiral, Herr Minister. Ich hatte nicht für möglich gehalten, dass von Ihnen jemand die Zeit zum Abschiednehmen finden würde.«
Admiral Raphael Semmes, der als Kommandant des konföderierten Kaperers Alabama wahre Ruhmestaten vollbracht und inzwischen das Kommando über die Flottille gepanzerter Kanonenboote auf dem James River innehatte, nickte und lächelte. Unter dem gewachsten Schnurrbart schob sich dabei der kleine Spitzbart unter der Unterlippe nach vorn. »Selbst ein Regiment Yankees hätte mich nicht davon abhalten können, Ihnen Lebewohl zu sagen.«
Stephen Mallory, Marineminister der Konföderierten, streckte die Hand aus. »Von Ihnen hängt zu viel ab, als dass wir uns nicht die Zeit nehmen würden, Ihnen Glück zu wünschen.«
»Ich habe ein starkes Schiff und eine tapfere Mannschaft«, erwiderte Tombs voller Selbstvertrauen. »Wir werden den Durchbruch schaffen.«
Semmes’ Lächeln verschwand, und seine Augen spiegelten eine böse Vorahnung wider. »Sollte Ihnen das nicht gelingen, müssen Sie das Schiff in Brand stecken und an der tiefsten Stelle des Flusses versenken. Auf gar keinen Fall darf es für die Union möglich sein, unsere Archive zu bergen.«
»Die Sprengladungen sind angebracht und scharf gemacht«, versicherte Tombs. »Der Schiffsboden wird weggesprengt, und die beschwerten Kisten versinken im Schlamm des Flusses, während das Schiff unter Volldampf noch eine gute Strecke zurücklegen wird, bevor es untergeht.«
Mallory nickte. »Ein guter Plan.«
Die beiden Männer im Zweispänner tauschten einen Blick aus. Nach einem Moment des Zögerns sagte Semmes: »Tut mir leid, dass ich Ihnen im letzten Augenblick eineweitere Aufgabe übertragen muss. Sie werden noch die Verantwortung für einen Passagier übernehmen müssen.«
»Einen Passagier?«, knurrte Tombs. »Hoffentlich niemand, der am Leben hängt.«
»Ihm bleibt keine andere Wahl«, murmelte Mallory.
»Wo ist er denn?«, erkundigte sich Tombs und sah sich auf dem Kai um. »Wir wollen jeden Augenblick ablegen.«
»Er wird bald eintreffen«, erwiderte Semmes.
»Darf ich fragen, um wen es sich handelt?«
»Sie werden ihn auf Anhieb erkennen«, sagte Mallory. »Und beten Sie, dass auch der Feind ihn erkennt, falls das nötig sein sollte.«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
Zum ersten Mal lächelte Mallory. »Das werden Sie schon begreifen, mein Junge. Ganz bestimmt.«
»Da gibt es noch etwas, das Sie wissen sollten«, wechselte Semmes das Thema. »Meine Spione haben berichtet, dass die Atlanta, eines unserer Kanonenboote, das im vergangenen Jahr den Panzerschiffen der Union in die Hände gefallen ist, jetzt bei der Marine der Nordstaaten Dienst tut und auf dem Fluss oberhalb von Newport News patrouilliert.«
Tombs strahlte. »Ja, verstehe. Die Texas hat ungefähr die gleichen Konturen und ganz ähnliche Abmessungen, sodass sie in der Dunkelheit gut mit der Atlanta verwechselt werden könnte.«
Semmes nickte und reichte ihm eine zusammengefaltete Flagge. »Die ›Stars and Stripes‹. Sie werden sie zur Tarnung brauchen.«
Tombs griff nach der Fahne der Union und klemmte sie sich unter den Arm. »Ich werde sie, kurz bevor wir die Geschützstellungen des Nordens bei Trent’s Reach erreichen, hissen lassen.«
»Dann viel Glück«, sagte Semmes. »Tut uns leid, dass wir nicht bleiben können, bis Sie ablegen. Der Minister muss noch einen Zug erreichen, und ich muss zurück und mich um die Zerstörung der Flotte kümmern, bevor uns die Yankees überrennen.«
Der Marineminister schüttelte Tombs zum Abschied die Hand. »Der Blockadebrecher Fox wartet auf der Höhe von Bermuda, um Ihre Kohlenvorräte aufzufüllen. Viel Glück, Commander. Das Heil der Konföderation liegt in Ihren Händen.«
Noch ehe Tombs etwas erwidern konnte, befahl Mallory dem Kutscher anzufahren. Tombs hob die Hand zu einem letzten Gruß und blickte dem Zweispänner verwirrt nach. Das Heil der Konföderation? Diese Worte ergaben überhaupt keinen Sinn. Der Krieg war verloren. Von Süden vorstoßend, marschierte Sherman durch Carolina heran, während Grant sich mit seinen Truppen wie eine Woge durch Virginia Richtung Süden wälzte. Es konnte sich nur noch um ein paar Tage handeln, bis Lee gezwungen sein würde, sich zu ergeben. Und Jefferson Davis würde sich bald vom Präsidenten der Konföderierten Staaten in einen gewöhnlichen Flüchtling verwandeln.
Wo sollte das Heil liegen, selbst wenn die Texas entkommen konnte? Tombs hatte nicht die leiseste Ahnung. Seine Befehle lauteten, die Archive der Regierung in einen neutralen Hafen seiner Wahl zu bringen und dort zu verharren, bis ein Kurier Kontakt zu ihm aufnehmen würde. Wie in aller Welt sollte das Herausschmuggeln von Akten die sichere Niederlage des Südens abwenden können?
Er wurde in seinen Gedanken von seinem Ersten Offizier, Lieutenant Erza Craven, unterbrochen.
»Der Ladevorgang ist abgeschlossen, die Ladung sicher verstaut, Sir«, meldete Craven. »Soll ich Befehl zum Ablegen geben?«
Tombs wandte sich um. »Nein, noch nicht. Wir müssen noch einen Passagier mitnehmen.«
Craven, ein hochgewachsener kurz angebundener Schotte, erwiderte in der für ihn typischen Art, einem Gemisch aus schottischem Akzent und der gedehnten Sprechweise des Südens: »Wäre besser, wenn er sich verdammt beeilen würde.«
»Hält Chefingenieur O’Hare sich bereit?«
»Hat seine Maschinen unter Volldampf.«
»Und wie steht’s mit den Mannschaften an den Kanonen?«
»Alle auf ihren Posten.«
»Wir halten die Geschützpforten geschlossen, bis wir auf die Flotte der Nordstaaten treffen. Wir können es uns nicht leisten, eine Kanone oder ein Mannschaftsmitglied durch einen Glückstreffer durch die offenen Pforten zu verlieren.«
»Es wird den Männern nicht passen, die andere Wange hinzuhalten.«
»Machen Sie ihnen klar, dass sie länger leben.«
Die beiden Männer drehten sich um und spähten in Richtung Küste, von wo aus sich Hufschlag näherte. Ein paar Sekunden später tauchte ein Offizier der Konföderierten aus dem Dunkel auf und ritt auf den Kai.
»Ist einer von Ihnen Commander Tombs?«, fragte der Offizier mit müder Stimme.
»Das bin ich«, erwiderte Tombs und trat einen Schritt vor.
Der Reiter stieg vom Pferd und salutierte. Er war staubbedeckt und wirkte erschöpft. »Mit Verlaub, Sir. Captain Neville Brown, ich befehlige die Eskorte Ihres Gefangenen.«
»Gefangener«, gab Tombs zurück. »Mir wurde gesagt, es sei ein Passagier.«
»Sie können ihn behandeln, wie Sie wollen.« Brown zuckte gleichgültig die Achseln.
»Wo ist er denn?«, erkundigte sich Tombs.
Seine Frage wurde sofort beantwortet. Eine geschlossene Kutsche rumpelte auf den Kai. Sie wurde von einer Abteilung Kavallerie in den blauen Uniformen des Nordens eskortiert.
Tombs wollte gerade seiner Mannschaft den Befehl geben, die Kanonen auszufahren und einen Enterversuch abzuwehren, als Captain Brown beruhigend sagte: »Keine Sorge, Commander. Das sind Jungs aus dem Süden. Die einzige Möglichkeit, sicher durch die Linien des Nordens zu gelangen, bestand darin, sich wie die Yankees anzuziehen.«
Zwei der Männer saßen ab, öffneten die Tür der Kutsche und halfen dem Passagier auszusteigen. Ein sehr großer, hagerer, bärtiger Mann betrat erschöpft die Planken des Kais. Er trug Fesseln an Handgelenken und Fußknöcheln, die mittels Ketten verbunden waren. Einen Augenblick lang musterte er mit ernstem Blick das Kanonenboot. Dann wandte er sich um und nickte Tombs und Craven zu.
»Guten Abend, Gentlemen.« Seine Stimme klang ein wenig hell. »Gehe ich recht in der Annahme, dass ich die Gastfreundschaft der konföderierten Marine genießen werde?«
Tombs war sprachlos. Stocksteif standen Craven und er da, boten ein Bild völliger Fassungslosigkeit.
»Mein Gott«, murmelte Craven schließlich. »Wenn es sich bei Ihnen um eine Fälschung handelt, Sir, dann aber um eine hervorragende.«
»Nein«, erwiderte der Gefangene, »ich versichere Ihnen, bei mir handelt es sich um das Original.«
»Wie ist das möglich?«, fragte Tombs völlig verdutzt.
Brown saß wieder auf. »Mir fehlt die Zeit für Erklärungen. Ich muss meine Männer über die Brücke von Richmond bringen, bevor sie gesprengt wird. Jetzt untersteht er Ihrer Verantwortung.«
»Was soll ich denn mit ihm anfangen?«, wollte Tombs wissen.
»Halten Sie ihn an Bord Ihres Schiffes gefangen, bis Sie den Befehl bekommen, ihn freizulassen. Das ist alles, was ich Ihnen sagen sollte.«
»Das ist verrückt.«
»Wie der Krieg, Commander«, erwiderte Brown über die Schulter, gab seinem Pferd die Sporen und ritt davon. Seine kleine, als Nordstaaten-Kavallerie verkleidete Abteilung folgte ihm.
Tombs wandte sich an Craven: »Lieutenant, begleiten Sie unseren ›Passagier‹ in meine Kabine und lassen Sie Chefingenieur O’Hare einen seiner Mechaniker schicken, der diese Fesseln abnehmen soll. Ich will nicht als Kommandant eines Sklavenschiffs sterben.«
Der Bärtige lächelte Tombs zu. »Vielen Dank, Commander. Ich weiß Ihre Freundlichkeit zu schätzen.«
»Sparen Sie sich Ihren Dank«, erwiderte Tombs grimmig. »Der Teufel wartet bei Sonnenaufgang auf uns.«
Zunächst kaum wahrnehmbar, dann immer schneller nahm die Texas flussabwärts Fahrt auf, wobei ihr die Strömung von zwei Knoten half. Kein Lüftchen regte sich, und abgesehen vom Stampfen der Maschinen, war es auf dem Fluss totenstill. Im fahlen Licht der Mondsichel glitt sie wie ein Geist über das Wasser – wie ein Wesen, das man eher spürte als sah, fast eine Illusion.
Nur die Bewegung verriet sie, sorgte für eine glitzernde Bugwelle, die sich am Ufer brach. Die Texas war ausschließlich für diesen einen Einsatz, ihre einzige Fahrt, auf Kiel gelegt worden. Die Schiffsingenieure hatten fantastische Arbeit geleistet: Sie war das leistungsfähigste Kriegsschiff, das die Konföderierten in den vier Kriegsjahren vom Stapel gelassen hatten.
Es war mit Doppelschrauben und einem Zwillingskessel ausgerüstet. Seine Länge betrug 60 Meter, seine Breite etwas mehr als 12 Meter. Die Texas hatte einen Tiefgang von nur zweieinhalb Metern. Die nach innen gewölbten, knapp drei Meter hohen Seiten des Rumpfes waren mit 15 Zentimeter dicken Eisenplatten verkleidet, dann folgte eine 30 Zentimeter dicke Schicht aus Pressbaumwolle, dann nochmals eine 50Zentimeter dicke Panzerschicht aus Eiche und Pinienholz. Die Panzerung setzte sich unter der Wasserlinie fort und endete schließlich am Bug in einem dicken Rammsporn.
Die Texas war mit nur vier Kanonen bestückt, aber die hatten es in sich. Zwei Blakely-Hundertpfünder mit gezogenen Läufen waren auf dem Vorder- und Hinterdeck auf Drehkränzen montiert, sodass mit ihnen auch Breitseiten geschossen werden konnten, und zwei weitere 23-Zentimeter-Geschütze, 64-Pfünder, deckten Back- und Steuerbord.
Die Maschinen waren nicht, wie das oft bei anderen Kanonenbooten der Fall war, aus Frachtdampfern ausgebaut worden, sondern fabrikneu und extrem leistungsfähig. Die schweren Kessel lagen unter der Wasserlinie, und ihre Schrauben mit einem Durchmesser von einem Meter konnten den Rumpf mit 14 Knoten oder fast 25 Stundenkilometern durch ruhiges Wasser vorantreiben – eine Geschwindigkeit, die von keinem Panzerschiff in beiden Flotten erreicht wurde.
Tombs war einerseits stolz auf sein Schiff, andererseits aber auch traurig, weil ihm bewusst war, dass der Texas möglicherweise nur ein kurzes Leben beschieden sein mochte. Doch er hatte sich fest entschlossen, dass sein Schiff und er den passenden Nachruf auf den schwindenden Ruhm der konföderierten Staaten schreiben würden.
Über eine Leiter stieg er vom Kanonendeck nach oben und betrat die Lotsenbrücke, eine kleine Konstruktion, die aussah wie eine Pyramide, deren Spitze man abgesägt hatte, und die sich auf dem Vorderteil des Panzerdecks befand. Er warf einen Blick durch die Sehschlitze in die Dunkelheit und nickte dann Leigh Hunt, dem schweigsamen Cheflotsen, zu.
»Wir werden bis zum offenen Meer Volldampf voraus laufen, Mr. Hunt. Sie sollten scharf Ausschau nach Sandbänken halten.« Hunt, der als Lotse des James River den Fluss wie seine Westentasche kannte, hielt die Augen nach vorn gerichtet und machte eine Kopfbewegung gen Himmel. »Das bisschen Mondlicht genügt mir, um mich auf dem Fluss zurechtzufinden.«
»Die Kanoniere der Nordstaaten werden es ebenfalls nutzen.«
»Kann schon sein, doch unser grauer Seitenanstrich wird vor den Schatten des Ufers kaum auszumachen sein. Wir geben kein leichtes Ziel ab.«
»Das wollen wir hoffen«, seufzte Tombs.
Er kletterte durch die hintere Luke und stand auf dem Dach des Panzerdecks, als die Texas Drewry’s Bluff erreichte und sich ihren Weg durch die vertäuten Kanonenboote von Admiral Semmes’ Flussflottille bahnte. Die Mannschaften der Schwesterschiffe, Virginia II, Fredericksburg und Richmond, die gerade schweren Herzens dabei waren, die Sprengung ihrer Schiffe vorzubereiten, brachen plötzlich in wildes Hurra aus, als die Texas vorbeischoss. Die Kriegsflagge der Konföderierten am vorderen Mast flatterte in der steifen Brise. Die Texas bot ein erhebendes Bild.
Tombs zog seinen Hut und grüßte mit ausgestrecktem Arm.
Ebenso plötzlich, wie das Schiff aufgetaucht war, war es hinter der nächsten Flussbiegung verschwunden. Nur sein Kielwasser verriet, dass es vorbeigekommen war.
Kurz vor Trent’s Reach – dort, wo die Armee der Nordstaaten den Flusslauf verbarrikadiert hatte und mehrere Artilleriestellungen lagen, befahl Tombs, die Flagge der Vereinigten Staaten zu hissen.
Hinter der Panzerung machten sich die Männer auf dem Kanonendeck kampfbereit. Die meisten der Matrosen hatten ihre Hemden ausgezogen, sich Taschentücher um die Stirn gebunden und warteten neben ihren Kanonen. Die Offiziere hatten die Uniformjacken abgelegt, trugen nur noch Unterhemden unter Hosenträgern und inspizierten ruhig das Deck. Der Schiffsarzt verteilte Adernpressen und zeigte den Männern, wie sie anzulegen waren.
Löscheimer standen übers Deck verteilt da. Sand wurde gestreut, um das Blut aufzusaugen. Pistolen und Säbel wurden ausgegeben, damit man Enterangriffe abwehren konnte, Gewehre wurden geladen und Bajonette aufgepflanzt. Die Luken zu den Magazinen unterhalb des Kanonendecks wurden geöffnet und das Hebegeschirr bereit gemacht, um Granaten und Pulver nach oben befördern zu können.
Unterstützt von der Strömung, machte die Texas 16 Knoten Fahrt, als ihr Bug gegen die Baumstämme der Barrikade krachte. Das Schiff durchbrach die Sperre, wobei der eiserne Rammsporn am Bug kaum einen Kratzer davontrug.
Ein alarmierter Wachposten der Nordstaaten sichtete die Texas, als sie aus der Dunkelheit hervorbrach, und feuerte seine Muskete ab.
»Feuer einstellen! Um Gottes willen, Feuer einstellen!«, schrie ihm Tombs vom Panzerdeck aus zu.
»Welches Schiff?«, drang die Stimme vom Ufer herüber.
»Die Atlanta, du Idiot. Erkennst du nicht die eigenen Schiffe?
»Wann sind Sie flussaufwärts gefahren?«
»Vor einer Stunde. Wir haben Befehl, bis zur Flussbarrikade und zurück nach City Point zu patrouillieren.«
Das Täuschungsmanöver gelang. Die Wachposten der Nordstaaten am Flussufer schienen zufrieden. Ohne weitere Zwischenfälle setzte die Texas ihre Fahrt fort. Tombs stieß erleichtert einen Seufzer aus.
Er hatte damit gerechnet, dass ein Kugelhagel sein Schiff empfangen würde. Jetzt, da die unmittelbare Gefahr gebannt war, fürchtete er, dass ein misstrauischer Offizier des Feindes telegrafisch flussauf- und -abwärts Alarm geben könnte.
Fünfzehn Meilen nachdem die Barriere passiert worden war, kam das Ende von Tombs’ Glückssträhne. Vor ihnen schälte sich eine schwarze drohende Masse aus der Dunkelheit heraus.
In unmittelbarer Nähe des Westufers, das Heck flussaufwärts, lag die Onondaga vor Anker. Das Panzerschiff der Union war mit zwei Geschütztürmen bestückt. Die Türme hatten eine 28-Zentimeter-Panzerung; die Rumpfpanzerung betrug 14 Zentimeter. Die Artillerie bestand aus zwei Dahlgren 38-Zentimeter-Glattrohrgeschützen und zwei 150-Pfündern von Parrott mit gezogenen Läufen. Die Onondaga nahm von einer Barke, die an Steuerbord vertäut war, gerade Kohle auf.
Die Texas hatte sie fast schon erreicht, als ein Matrose, der auf dem vorderen Geschützturm stand, das Kanonenboot der Konföderierten bemerkte und Alarm gab.
Die Mannschaft hielt im Kohleschaufeln inne und starrte in Richtung des Kanonenboots, das so unvermittelt aus der Nacht aufgetaucht war. John Austin, Kommandant der Onondaga, zögerte einen Moment; er fragte sich, ob ein Kanonenboot der Rebellen tatsächlich, ohne entdeckt worden zu sein, so weit den James River hatte flussabwärts fahren können. Dieser Moment erwies sich als verhängnisvoll. Als er seiner Mannschaft den Befehl gab, das Feuer zu eröffnen, passierte ihn die Texas gerade, kaum einen Steinwurf entfernt.
»Drehen Sie bei!«, schrie Austin, »oder wir eröffnen das Feuer und blasen Sie aus dem Wasser.«
»Hier ist die Atlanta!«, schrie Tombs zurück und hielt das Täuschungsmanöver bis zum bitteren Ende aufrecht.
Austin ließ sich nicht eine Sekunde lang hinters Licht führen; auch nicht, als er plötzlich die Flagge der Union am Mast des Eindringlings entdeckte. Er gab Feuerbefehl.
Für den vorderen Turm war es zu spät, ins Geschehen einzugreifen. Die Texas hatte ihn schon passiert und befand sich außerhalb des Feuerbereichs. Doch die beiden 38-Zentimeter-Dahlgrens im Innern des Heckturms der Onondaga spieen Flammen und Rauch.
Wie Dampfhämmer krachten die Granaten in die Flanke der Texas und trafen den hinteren, oberen Teil der Rumpfpanzerung. Eisen- und Holzsplitter streckten sieben Mann nieder.
Beinahe zur selben Zeit schrie Tombs durch die offene Dachklappe einen Befehl ins Kanonendeck hinunter. Die Geschützpforten schwangen beiseite, und die drei Kanonen, die gesamte Breitseite der Texas, nahmen den Turm der Onondaga unter Feuer. Die Granate eines Hundertpfünders flog durch eine der geöffneten Geschützpforten, traf ein Dahlgren-Geschütz und hinterließ im Geschützturm Rauch, Flammen und eine fürchterliche Verwüstung. Neun Männer wurden getötet und elf schwer verwundet.
Bevor die Kanonen der beiden Schiffe nachgeladen werden konnten, war die Texas wieder in der Nacht verschwunden und fuhr sicher um die nächste Flussbiegung. Der vordere Geschützturm der Onondaga feuerte blind einen Abschiedsgruß hinterher. Die Granaten schossen heulend über das Achterdeck der fliehenden Texas hinweg.
Verzweifelt trieb Commander Austin seine Mannschaft an, ankerauf zu gehen und um 180 Grad zu wenden. Es war vergebens. Die Höchstfahrt des Panzerschiffs lag nur etwas über sieben Knoten. Es bestand keine Hoffnung, das Rebellenschiff einholen zu können.
In ruhigem Ton sagte Tombs zu Lieutenant Craven: »Von nun an, Mr. Craven, verstecken wir uns nicht mehr hinter der Flagge des Feindes. Bitte hissen Sie die Farben der Konföderierten und lassen Sie die Geschützpforten schließen.«
Eilfertig sprang ein junger Midshipman auf den Mast zu, löste das Fall, holte die »Stars and Stripes« ein und hisste die diagonal gekreuzten Balken und Sterne auf rot-weißem Grund.
Craven stand neben Tombs auf dem Panzerdeck. »Jetzt sind alle alarmiert«, stellte Tombs fest, »das wird kein Zuckerschlecken von hier aus bis zum Meer. Mit den Küstenbatterien werden wir fertig. Die feindliche Feldartillerie ist nicht stark genug, um unserer Panzerung mehr als einen Kratzer zuzufügen.«
Tombs schwieg und warf einen besorgten Blick über den Bug auf das schwarze Ufer, das sich vor ihnen dahinzog. »Die Kanonen der Unionsflotte, die an der Flussmündung auf uns warten, sind am gefährlichsten.«
Noch bevor er den Satz beenden konnte, wurden sie vom Ufer aus unter Sperrfeuer genommen.
»Jetzt geht’s los«, murmelte Craven, während er sich schnell auf seinen Posten ins Kanonendeck zurückzog. Tombs blieb ohne Deckung hinter der Lotsenbrücke stehen, um sein Schiff gegen feindliche Einheiten, die möglicherweise den Fluss blockierten, ins Gefecht zu führen.
Granaten von unsichtbaren Batterien und Musketenfeuer von Scharfschützen trafen jetzt die Texas wie ein Hagelsturm. Obwohl seine Männer über seine Entscheidung fluchten, hielt Tombs die Geschützpforten weiter geschlossen. Er sah keinen Grund, seine Mannschaft der Gefahr auszusetzen und wertvolles Pulver und Kugeln an einen Feind zu verschwenden, den er nicht ausmachen konnte.
Zwei weitere Stunden war die Texas den Angriffen ausgesetzt. Ihre Maschinen liefen ruhig und gleichmäßig und schoben sie ein oder zwei Knoten schneller vorwärts als ursprünglich bei der Kiellegung vorgesehen. Dann und wann tauchten hölzerne Kanonenboote auf, feuerten ihre Breitseite ab und versuchten, die Jagd aufzunehmen. Die Texas ignorierte sie einfach und schoss an ihnen vorbei.
Plötzlich schälte sich die vertraute Silhouette der Atlanta aus dem Dunkel. Das Schiff lag quer zur Strömung mit drohender Breitseite vor Anker. Seine Steuerbordgeschütze nahmen das Ziel auf, als der Ausguck meldete, dass das Rebellenschiff entschlossen und mit voller Fahrt auf sie zurausche.
»Die wussten, dass wir kommen«, murmelte Tombs.
»Soll ich sie passieren lassen, Captain?«, fragte Hunt, der Lotse, und zeigte sich am Ruder bemerkenswert unbeeindruckt.
»Nein, Mr. Hunt«, antwortete Tombs. »Rammen Sie das Schiff knapp hinter dem Heck.«
»Wir drücken sie auf die Seite«, erwiderte Hunt, dem das Manöver sofort einleuchtete. »Zu Befehl, Sir.«
Mit einer Achteldrehung am Ruder hielt Hunt jetzt mit dem Bug der Texas genau auf das Heck der Atlanta zu.Zwei Granaten des ehemals konföderierten Schiffes krachten in die vordere Panzerung, durchschlugen sie und drückten die rückwärtigen Holzplanken 30 Zentimeter ein. Drei Mann wurden von Splittern verletzt.
Der Abstand verringerte sich schnell, und die Texas grub drei Meter ihres eisernen Rammsporns in den Rumpf der Atlanta. Dann durchstieß der Rammsporn das Achterdeck, kappte die Ankerkette, schleuderte die Atlanta um 90 Grad herum und drückte gleichzeitig ihr Deck herunter. Durch die Geschützpforten des Nordstaaten-Panzerschiffs schoss Wasser, und das Schiff sackte ab wie ein Stein, während die Texas buchstäblich darüber hinwegdonnerte.
Die Atlanta wurde auf ebenem Kiel in den Schlamm des Flusses gedrückt und kenterte dann, während die wild drehenden Schrauben der Texas ihren Rumpf nur um Zentimeter verfehlten, bevor sie das Wrack hinter sich ließen. Die meisten Männer der Atlanta konnten aus den Geschützpforten und Luken entkommen, doch mindestens 20 Mann gingen mit ihr unter.
Tombs und sein Schiff schlugen sich in ihrem verzweifelten Versuch, die Freiheit zu gewinnen, weiter durch. Das Gefecht begann erneut, und die Texas musste weiterhin konstantem Beschuss und der Verfolgung durch Kanonenboote standhalten. Die Telegrafendrähte, die von der Nordstaaten-Armee entlang des Flussufers gezogen worden waren, glühten. Bei Küstenbatterien und auf den Schiffen, die das Kanonenboot versenken und abfangen wollten, breitete sich eine Welle von Chaos und Verzweiflung aus.
Granaten und Massivkugeln krachten unaufhörlich mit solchem Getöse gegen die Panzerung, dass die Texas vom Bug bis zum Heck vibrierte. Ein 100-Pfund-Geschoss aus einer Dahlgren, die zu einer Geschützstellung in Ford Hudson, hoch über dem Flussufer, gehörte, traf die Lotsenbrücke. Mr. Hunt, der Lotse, taumelte, sein Kopf dröhnte. Obwohl er durch mehrere Splitter, die durch die Sehschlitze geschwirrt waren, verletzt wurde, hielt er am Ruder aus und steuerte das Schiff weiterhin genau in der Mitte der Fahrrinne.
Im Osten dämmerte es, als die Texas auf dem James River an Newport News vorbeidampfte und das tiefere Wasser in der weiten Bucht von Hampton Roads erreichte, wo drei Jahre zuvor das Gefecht zwischen Monitor und Merrimack stattgefunden hatte.
Es schien, als habe sich die gesamte Flotte der Nordstaaten formiert und zu ihrem Empfang gerüstet. Das Einzige, was Tombs von seinem Platz über dem Panzerdeck aus erkennen konnte, war ein Wald von Masten und Schornsteinen. Schwer bestückte Fregatten und Schoner auf der linken, Panzerschiffe und Kanonenboote auf der rechten Seite. Der schmale Kanal dahinter, der im Kreuzfeuer der Festung Monroe und Fort Wool lag, wurde von der New Ironsides gesperrt, einem gewaltigen Schiff mit eisenbeschlagenem Holzrumpf und 18 großkalibrigen Kanonen.
Jetzt erst befahl Tombs, die Geschützpforten zu öffnen und die Kanonen auszufahren. Für die Texas war der Zeitpunkt gekommen, sich zu wehren. Nun würde die Nordstaatenflotte ihre enorme Stärke zu spüren bekommen. Unter lautem Hurra legten sich die Männer der Texas ins Zeug und richteten die Kanonen; die Artillerieoffiziere hielten sich bereit.
Craven ging durch das Schiff, lächelte und scherzte mit den Männern, sprach Mut zu und gab Ratschläge. Tombs kam herunter und hielt eine kurze Ansprache, in der er über den Feind herzog, voller Optimismus in Hinblick auf ihren bevorstehenden Sieg und die Prügel, die die feigen Nordstaatler von seinen tapferen Südstaatenjungs beziehen würden. Dann kehrte er wieder auf seinen Posten hinter der Lotsenbrücke zurück, das Teleskop unter den Arm geklemmt.
Die Kanoniere der Nordstaaten hatten genug Zeit, um sich vorzubereiten. Signalflaggen, dass gefeuert werden sollte, sobald die Texas in Schussweite kam, wurden gehisst. Als Tombs durch das Fernrohr sah, kam es ihm so vor, als ob der Feind den gesamten Horizont ausfüllte. Eine unnatürliche Ruhe legte sich über das Wasser wie ein Fluch, während die Wölfe darauf warteten, dass ihr Opfer in eine Falle steuerte, aus der es offensichtlich kein Entkommen gab.
Konteradmiral David Porter, untersetzt, mit Vollbart, die flache Seemannsmütze fest auf dem Kopf, stand auf einer Waffenkiste, von der aus er gut das Kanonendeck seines Flaggschiffs, der Fregatte Brooklyn, überblicken konnte. Aufmerksam beobachtete er im ersten Morgenlicht die Rauchfahne des sich nähernden Panzerschiffs der Rebellen.
»Da kommt sie«, stellte Captain James Alden, Kommandant von Porters Flaggschiff, fest. »Hält wie der Teufel direkt auf uns zu.«
»Ein tapferes, edles Schiff auf seiner letzten Fahrt«, murmelte Porter, während die Texas allmählich das gesamte Blickfeld seines Fernrohrs anfüllte. »Ein unvergesslicher Anblick.«
»Sie ist fast in Reichweite«, meldete Alden.
»Hat keinen Zweck, kostbare Kugeln zu vergeuden, Mr. Alden. Befehlen Sie Ihren Kanonieren, noch zu warten.«
An Bord der Texas instruierte Tombs seinen Lotsen, der entspannt am Ruder stand und das Blut, das ihm von der linken Schläfe rann, ignorierte. »Hunt, passieren Sie die Reihe der Fregatten so nah wie möglich, damit die Panzerschiffe zögern zu feuern. Sie könnten ihre eigenen Schiffe treffen.«
Beim ersten Schiff der beiden Schlachtreihen handelte es sich um die Brooklyn. Tombs wartete, bis sie gut in Reichweite war, und gab dann Feuerbefehl. Das Buggeschütz der Texas, ein Blakely-Hundertpfünder, eröffnete das Gefecht. Die Granate mit Verzögerungszünder fuhr heulend über das Wasser, traf das Kriegsschiff der Nordstaaten, durchschlug die Bugreling und krepierte am Rohr des Parrot-Geschützes. Die Explosion tötete jeden Mann im Umkreis von vier Metern.
Jetzt eröffnete die Saugus, die mit einem Geschützturm bestückt war, aus ihren 38-Zentimeter Zwillingsrohren das Feuer auf die näher kommende Texas. Die Salve der beiden Massivgeschosse lag zu kurz, sodass die Kugeln wie flache Steine über das Wasser hüpften und die Gischt hoch aufspritzen ließen. Jetzt schwangen auch die übrigen Panzerschiffe ihre Geschütztürme herum, öffneten die Geschützpforten an Steuerbord und nahmen die Texas unter mörderisches Feuer, das die Panzerung des Schiffes erbeben ließ. Zu diesen angreifenden Schiffen gehörte neben Manhattan, Saugus und Nahant auch die Chickasaw, die erst kürzlich aus der Mobil Bay zurückgekehrt war, wo sie daran beteiligt gewesen war, das mächtige konföderierte Schlachtschiff Tennessee auf den Meeresboden zu schicken. Nun feuerte auch der Rest der Flotte, und die aufgewühlte See rund um das mit Höchstfahrt laufende Schiff erinnerte an kochendes Wasser.
Tombs rief durch die Luke nach unten Craven zu: »Den Panzerschiffen können wir nichts anhaben. Beantworten Sie deren Feuer nur mit dem Backbordgeschütz. Schwenken Sie Bug- und Heckgeschütz und nehmen Sie die Fregatten unter Feuer!«
Craven führte die Befehle seines Kommandanten aus, und innerhalb von Sekunden erwiderte die Texas das Feuer. Ihre Granaten durchschlugen die Planken der Brooklyn und explodierten im Innern des Schiffes. Eine detonierte im Maschinenraum, tötete acht Männer und verwundete ein weiteres Dutzend. Die zweite streckte die Bedienungsmannschaft eines Geschützes nieder, die sich gerade fieberhaft bemühte, das Rohr zu senken. Eine dritte Granate explodierte auf dem dicht bevölkerten Deck und sorgte für weiteres Blutvergießen und Verwirrung.
Die konföderierten Kanoniere luden und feuerten mit tödlicher Präzision. Sie verwandten kaum eine Sekunde auf genaues Zielen. Es war einfach unmöglich vorbeizuschießen. Jenseits der Geschützpforten nahmen die Yankee-Schiffe die gesamte Bildfläche ein.
Die Luft über Hampton Roads war erfüllt vom Donnern der Geschütze, den Detonationen der Granaten, dem Klacken der Geschützverschlüsse, dem Klappern der Kartuschen und sogar vom Musketenfeuer der Marinesoldaten der Nordstaaten auf den Brustwehren. Dicker Rauch hüllte jetzt die Texas ein und erschwerte den Kanonieren der Nordstaaten die Zielansprache. Sie schossen auf das Mündungsfeuer und hörten das Klingen, wenn ihre Kugeln die Panzerung des konföderierten Schiffes trafen, und das Heulen der Querschläger im Rauch.
Tombs schien es, als steuere er direkt auf einen ausbrechenden Vulkan zu.
Die Texas hatte nun die Brooklyn passiert und schickte ihr noch einen Abschiedsgruß aus dem Heckgeschütz herüber. Die Granate heulte so dicht an Admiral Porter vorbei, dass der Sog ihm für einen Augenblick die Luft zum Atmen nahm. Die Leichtigkeit, mit der das Rebellenschiff die Breitseiten der Brooklyn wegzustecken schien, machte ihn fuchsteufelswild.
»Signalisieren Sie der Flotte, den Gegner abzufangen und zu rammen!«, befahl er Captain Alden.
Aiden bestätigte den Befehl, doch er wusste, dass dies kaum möglich sein würde. Die unglaubliche Geschwindigkeit des Panzerschiffs verblüffte jeden Offizier. »Die Texas macht zu hohe Fahrt, als dass eines unserer Schiffe sie breitseits erwischen könnte«, bemerkte er ausdruckslos.
»Ich will, dass der verdammte Rebell versenkt wird!«, knurrte Porter.
»Selbst wenn das Schiff noch an uns vorbeikommt, entgeht es nie im Leben den Kanonen der Forts und der New Ironsides«, beruhigte Alden seinen Vorgesetzten.
Wie zur Bestätigung eröffneten die Panzerschiffe das Feuer, nachdem die Texas an der Brooklyn vorbei war und die nächste Fregatte in der Schlachtreihe, die Colorado, noch nicht erreicht hatte.
Die Geschosse der Nordstaaten kamen jetzt genauer. Donnernd schlugen zwei Massivgeschosse unmittelbar hinter dem Steuerbordgeschütz ein. Die dicke Panzerung wurde um mehr als einen Meter eingedrückt, und Rauch drang ins Innere des Panzerdecks. Ein weiterer Schuss hinterließ einen tiefen Einschusskrater unter dem Schornstein. Die nächste Granate traf genau dieselbe Stelle, durchschlug die bereits beschädigte Panzerung und explodierte mit schrecklicher Wirkung im Kanonendeck. Sie tötete sechs Männer, verwundete elf weitere und setzte Baumwolle und Holzsplitter in Brand.
»Ach, du große Scheiße!«, brüllte Craven, der sich plötzlich mit angesengten Haaren, zerfetzter Uniform und gebrochenem Arm zwischen Toten und Verwundeten wiederfand. »Holt den Wasserschlauch aus dem Maschinenraum und löscht das verdammte Feuer!«
O’Hare, der leitende Ingenieur, streckte seinen Kopf durch die Luke, die zum Maschinenraum führte. »Wie schlimm steht’s denn?«, erkundigte er sich mit bemerkenswert ruhiger Stimme.
»Kann Ihnen doch egal sein«, schrie Craven ihn an. »Sorgen Sie nur dafür, dass die Maschinen laufen.«
»Ist nicht so leicht. Meine Männer kippen in der Hitze um. Hier unten ist es heißer als in der Hölle.«
»Dann nehmen Sie’s als Vorgeschmack, bevor wir alle dort landen«, gab Craven kurz angebunden zurück.
Wieder erschütterte eine ohrenbetäubende Explosion die Texas von der Mastspitze bis zum Kiel, als sei sie von der Faust eines Riesen getroffen worden. Der Rand der Panzerung vorn an Backbord wurde wie von einem gigantischen Fleischermesser aufgeschlitzt. Die massiven Eisenplatten und Holzplanken wölbten sich und detonierten in einem Splitterregen, der die Bedienungsmannschaft des Blakely-Buggeschützes umriss.
Die nächste Granate durchschlug die Panzerung und explodierte im Schiffslazarett. Sie tötete den Schiffsarzt und die Hälfte der Verwundeten, die dort auf ihre Versorgung warteten. Das Kanonendeck sah aus wie ein Schlachthaus. Die einstmals fleckenlosen Planken waren pulvergeschwärzt und trieften vor Blut.
Die Texas war angeschlagen. Das ganze Gefecht hindurch machte sie Höchstfahrt, doch allmählich wurde sie in Stücke geschossen. Ihre Rettungsboote waren verschwunden, gleichfalls die beiden Masten. Der Schornstein sah aus wie ein Sieb. Die gesamte Panzerung war ein groteskes Gewirr aus verbogenem und durchlöchertem Eisen. Drei der Dampfleitungen waren unterbrochen und die Geschwindigkeit um ein Drittel gesunken.
Doch erledigt war sie noch lange nicht. Immer noch liefen ihre Maschinen im Takt, und ihre drei Kanonen trugen Tod und Verderben in die Flotte der Nordstaaten. Ihre nächste Breitseite durchschlug die Holzplanken der Fregatte Powhatan, eines alten Raddampfers. Kessel flogen in die Luft, der Maschinenraum wurde verwüstet. Die Powhatan hatte an diesem Tag die schwersten Verluste von allen Schiffen der Nordstaaten.
Tombs war ebenfalls schwer verwundet worden. Ein Granatsplitter steckte in seiner Hüfte, und ein Streifschuss hatte eine tiefe Furche in seine Schulter geschnitten. Dennoch kauerte er, unvernünftigerweise, immer noch ohne Deckung hinter dem Brückenhaus und gab Mr. Hunt Befehle, welchen Kurs er steuern sollte. Sie hatten das Schlachtfeld beinahe hinter sich.
Er warf einen Blick voraus auf die New Ironsides, die vor ihnen mit zugewandter Breitseite und geladenen Kanonen in der Fahrrinne lag. Er sah, dass die Kanonen von Fort Monroe und Fort Wool ausgefahren und schussbereit waren, und plötzlich wurde ihm schmerzlich klar, dass sie den Durchbruch nicht schaffen konnten. Mehr konnte die Texas einfach nicht vertragen.
Er dachte an die Mannschaft. Männer, die ihr Leben in die Waagschale geworfen hatten, denen außer Laden, Feuern und die Kessel unter Dampf zu halten alles egal geworden war. Sie waren über sich selbst hinausgewachsen, hatten den Tod ignoriert und ihre Pflicht erfüllt.
Der Kanonendonner verhallte und wich einer seltsamen Stille. Tombs richtete sein Rohr auf die New Ironsides. Er entdeckte einen Offizier, offenbar den Kommandanten, der über einer Panzerreling lehnte und ihn durch ein Teleskop beobachtete.
Genau in diesem Augenblick entdeckte er die Nebelbank, die sich jenseits der Forts der Mündung der Chesapeake Bay näherte. Wenn sie es schafften, diesen grauen Dunst zu erreichen und dahinter zu verschwinden, wäre es möglich, Porters Wolfsrudel zu entkommen. Tombs fielen Mallorys Worte zu dem Passagier ein: »Und beten Sie, dass auch der Feind ihn erkennt, falls das nötig sein sollte.« Durch die offene Luke rief er nach unten.
»Mr. Craven, sind Sie noch da?«
Unter ihm tauchte sein erster Offizier auf und blickte nach oben. Sein Gesicht, pulververschmiert, voller Blut und Schürfwunden, war in einem schlimmen Zustand. »Klar, Sir. Und ich wünschte bei Gott, ich wär’s nicht.«
»Bringen Sie unseren Passagier aus meiner Kajüte nach oben. Und sorgen Sie für eine weiße Fahne.«
Craven verstand, er nickte. »Zu Befehl, Sir.«
Der verbliebene 64-Pfünder und das Buggeschütz stellten das Feuer ein. Die Flotte der Nordstaaten war weit zurückgefallen, und die Geschütze der Texas konnten nicht so weit herumgeschwungen werden, dass sie die Schiffe weiter unter Beschuss hätten halten können.
Tombs war bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Er war todmüde, und seine Wunden schmerzten, doch seine Augen funkelten entschlossen. Er schickte ein Stoßgebet gen Himmel, dass die Kommandeure der Forts ebenso wie der Kapitän der New Ironsides ihre Fernrohre auf die Texas gerichtet haben mochten.
»Steuern Sie einen Kurs an, der zwischen dem Bug des Schlachtschiffs und Fort Wool hindurchführt«, wies er Hunt an.
»Zu Befehl, Sir«, bestätigte Hunt.
Tombs drehte sich um, als der Gefangene langsam die Leiter hinaufkletterte. Craven folgte ihm. In der Hand trug er ein weißes Tischtuch aus der Offiziersmesse, das an einem Besenstiel befestigt war.
Der Mann schien frühzeitig gealtert. Sein Kopf war schmal, das Gesicht hager und ausgezehrt. Offenbar ein Mensch, der vollkommen erschöpft war und dem der jahrelang erduldete Stress zu schaffen machte. Aus seinen tiefliegenden Augen sprach aufrichtiges Mitgefühl, als er die blutdurchtränkte Uniform von Tombs musterte.
»Sie sind schwer verwundet, Commander. Sie sollten sich unter Deck in ärztliche Behandlung begeben.«
Tombs schüttelte den Kopf. »Dafür habe ich keine Zeit. Bitte steigen Sie auf das Dach des Ruderhauses und bleiben Sie dort stehen, damit man Sie gut sehen kann«
Der Gefangene verstand und nickte. »Ja, ich begreife, was Sie wollen.«
Tombs blickte wieder zu dem Schlachtschiff und den Forts hinüber. Plötzlich blitzte es auf den Wällen von Fort Monroe auf, man sah eine schwarze Rauchwolke und hörte das Heulen der Granate. Eine riesige Fontäne grünweißen Wassers schoss empor.
Tombs gab dem hochgewachsenen Mann einen groben Schubs und schob ihn auf das Dach des Ruderhauses. »Bitte beeilen Sie sich, wir sind in ihrer Reichweite.« Dann griff er nach Cravens weißer Fahne und schwenkte sie wie verrückt mit seinem gesunden Arm.
An Bord der New Ironsides blickte Captain Joshua Watkins aufmerksam durch sein Fernrohr. »Sie schwenken die weiße Fahne«, bemerkte er überrascht.
Commander John Crosby, der erste Offizier, der ebenfalls durch ein Fernglas spähte, nickte bestätigend. »Verdammt seltsam, dass sie sich nach dem Gefecht, das sie der Flotte geliefert haben, jetzt plötzlich ergeben wollen.«
Plötzlich, vollkommen verblüfft, ließ Watkins das Fernrohr sinken, überprüfte die Linse, ob sie verschmutzt war, und richtete das Glas wieder auf das vom Gefecht übel mitgenommene Panzerschiff der Konföderierten. »Aber wer in aller Welt …« Der Captain justierte die Linsen. »Mein Gott«, murmelte er erschüttert. »Wen erkennen Sie da, auf dem Dach des Brückenhauses?«
Crosby war nicht leicht aus der Fassung zu bringen, doch jetzt wirkte er völlig verdattert. »Sieht aus wie … Das ist doch unmöglich.«
Die Kanonen von Fort Wool eröffneten das Feuer, und die Texas verschwand hinter einem Wasserschleier. Dann durchbrach sie mit bewundernswürdiger Entschlossenheit die Gischt und stürmte weiter auf die New Ironsides zu.
Watkins starrte fasziniert auf den hochgewachsenen, schlanken Mann auf dem Brückenhaus. Dann verwandelte sich sein Blick in dumpfen Schrecken. »Mein Gott, er ist es tatsächlich!« Er ließ das Fernrohr sinken, drehte sich um und sah Crosby an. »Signalisieren Sie den Forts, das Feuer einzustellen. Beeilen Sie sich, Mann!«
Die Kanonen von Fort Monroe hatten ebenfalls das Feuer auf die Texas eröffnet. Die meisten Granaten gingen über das Panzerschiff hinweg, doch zwei detonierten am Schornstein des Schiffes und hinterließen riesige Löcher in der gewölbten Wand. Eifrig luden die Bedienungsmannschaften ihre Kanonen nach, jede hoffte, dass sie es sein würde, die den endgültigen Treffer landete.
Die Texas war nur noch knapp 200 Meter entfernt, als die Kommandanten der Forts den Befehl Watkins’ bestätigten, und eine Kanone nach der anderen stellte das Feuer ein. Watkins und Crosby rannten zum Bug der New Ironsides und kamen gerade noch rechtzeitig, um einen flüchtigen Blick auf die beiden Männer in den blutbefleckten Uniformen der Südstaaten zu werfen – und auf den bärtigen Mann in verknittertem Zivil, der ihnen einen ruhigen Blick zuwarf und ihnen dann erschöpft und müde zuwinkte.
Schweigsam standen sie da. Sie wussten, dass dieser Anblick, dessen Zeuge sie geworden waren, für immer in ihrem Bewusstsein eingegraben sein würde. Und trotz des Sturms kontroverser Meinungen, der später um sie herum toben würde, waren sie und Hunderte anderer Männer auf dem Schiff und den Wällen der Forts absolut sicher, wer da an diesem Morgen inmitten der Zerstörungen auf dem konföderierten Panzerschiff gestanden hatte.
Nahezu 1000 Männer sahen hilflos zu, wie die Texas vorbeifuhr. Aus ihren Geschützpforten quoll Rauch; die flatternde Fahne hing zerfetzt am verbogenen Mast an der Heckreling. Man hörte keinen Laut oder Schuss, als sie in die Nebelbank hineinfuhr, darin verschwand und für immer aus den Augen verloren wurde.
Verschollen
10. Oktober 1931
Südwest Sahara
Kitty Mannock hatte das ungute Gefühl, dass sie geradewegs ins Nichts flog. Sie hatte sich verirrt, vollkommen und hoffnungslos verirrt. Zwei Stunden bereits wurde sie mit ihrem leichten kleinen Flugzeug von einem Sandsturm hin- und hergeschleudert. Der Sturm verhinderte jegliche Bodensicht. Einsam im weiten, undurchdringlichen Himmel kämpfte sie gegen die seltsamen Illusionen an, die sich in seltsamen Situationen einzustellen pflegen.
Kitty legte den Kopf in den Nacken und warf einen Blick durch die obere Windschutzscheibe. Das orangefarbene Glühen der Sonne war ganz und gar verblasst. Dann kurbelte sie zum wiederholten Mal ihr Seitenfenster herunter und warf einen Blick über den Rand des Cockpits. Sie sah nichts als eine nicht enden wollende wirbelnde Wolke. Der Höhenmesser zeigte 1500 Fuß an, hoch genug, um sämtliche Hochebenen des Adrar der Iforas zu überfliegen – von einigen Ausnahmen abgesehen. Der Adrar der Iforas war ein Ausläufer der Ahaggar-Berge in der Sahara.
Sie musste sich auf ihre Instrumente verlassen, um zu vermeiden, dass das Flugzeug abdrehte. Seit sie in den Sturm geflogen war, hatte sie bereits viermal bemerkt, dass sie an Höhe verlor und immer schneller vom Kurs abkam. Das waren sichere Anzeichen, dass sie in Richtung Boden zu kreisen begann. Da sie um diese Gefahr wusste, hatte sie ihren Flug jedes Mal ohne Zwischenfälle korrigiert, war in die Kurve gegangen, bis sich die Nadel in ihrem Kompass wieder auf den Südkurs von 180 Grad eingependelt hatte.
Kitty hatte versucht, den Spuren der Trans-Sahara-Piste zu folgen, sie aber kurz, nachdem sie der aus Südosten kommende Sandsturm überrascht hatte, aus den Augen verloren. Sie wusste nicht, wie weit der Wind sie vom Kurs abgetrieben hatte. Jetzt drehte sie nach Westen ab, um die Abweichung zu verstärken. Es war der vergebliche Versuch, den Sturm zu umfliegen.
Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich mutterseelenallein durch dieses Meer drohenden, konturlosen Sandes durchzukämpfen. Es handelte sich um einen Abschnitt, den Kitty am meisten fürchtete. Sie rechnete aus, dass sie noch weitere 400 Meilen fliegen musste, bevor sie Niamey, die Hauptstadt Nigerias erreichen würde. Dort würde sie auftanken, bevor sie ihren Langstrecken-Rekordflug in Richtung Kapstadt in Südafrika fortsetzte.
In ihren Armen und Beinen machte sich eine müde Gefühllosigkeit breit. Das dauernde Dröhnen und die Vibrationen des Motors forderten allmählich ihren Tribut. Seit ihrem Start in Croydon, einem Vorort von London, war Kitty nun beinahe 27 Stunden in der Luft. Aus der kalten Feuchtigkeit Englands war sie geradewegs in die Gluthitze der Sahara geflogen.
In drei Stunden würde es dunkel werden. Der infolge des Sandsturms aufgekommene Gegenwind verlangsamte ihre Geschwindigkeit auf 90 Meilen pro Stunde. Das waren 30 Meilen weniger, als ihre alte, bewährte Fairchild FC-2W, ein Hochdecker mit geschlossenem Cockpit und Kabine, der von einem 410-PS-Sternmotor von Pratt & Whitney angetrieben wurde, normalerweise schaffte.
Die viersitzige Maschine hatte früher einmal den Pan American-Grace Airways gehört und regelmäßigen Postdienst zwischen Lima und Santiago absolviert. Als das Flugzeug ausgemustert wurde, um einem neueren Modell Platz zu machen, das sechs Passagiere befördern konnte, hatte Kitty es gekauft und in der Passagierkabine Zusatztanks einbauen lassen. Dann machte sie sich daran, einen neuen Flugrekord aufzustellen: Sie war die erste Frau, die Ende 1930 im Alleinflug die Strecke von Rio de Janeiro nach Madrid in Rekordzeit schaffte.
Eine weitere Stunde versuchte sie, trotz der Windböen den vorgesehenen Kurs zu halten. Der feine Sand drang in die Kabine und setzte sich unter ihren empfindlichen Augenlidern und in ihrer Nase fest. Kitty rieb sich die Augen, doch damit verstärkte sie den Juckreiz bloß. Und was noch schlimmer war, sie konnte kaum noch etwas erkennen.
Kitty zog eine kleine Wasserflasche unter ihrem Sitz hervor, drehte sie auf und bespritzte ihr Gesicht. Sofort fühlte sie sich besser. Der nasse Sand hinterließ Spuren auf ihren Wangen und trocknete in der entsetzlichen Hitze innerhalb von Sekunden. Jetzt konnte sie zwar wieder sehen, doch ihre Augen schmerzten höllisch.
Plötzlich bemerkte sie ein Geräusch, möglicherweise auch dessen Fehlen, oder vielleicht einen winzigen Moment der Stille inmitten des Windgeheuls und des Motorengetöses. Sie beugte sich vor und warf einen prüfenden Blick auf die Instrumente. Die Anzeigen verrieten nichts Außergewöhnliches. Sie überprüfte die Treibstoffzuleitung. Jedes Ventil befand sich in korrekter Position. Schließlich schob sie das Ganze als Übermüdungserscheinung beiseite.
Dann fiel ihr diese Veränderung im allgemeinen Geräuschpegel erneut auf. Gespannt lauschte sie, konzentrierte sich vollkommen auf ihr Gehör. Die Aussetzer erfolgten jetzt häufiger. Sie tippte auf eine defekte Zündkerze in einem der Zylinder, und ihr Mut sank. Dann fielen die Zündkerzen, eine nach der anderen, aus. Der Motor fing an zu stottern, und die Tachometernadel bewegte sich zitternd nach links.
Ein paar Augenblicke später blieb der Motor abrupt stehen, und die Propeller drehten sich nur noch im Fahrtwind. Der einzige Ton, der nun an Kittys Ohr drang, war das Heulen des Windes. Kitty hatte keinerlei Zweifel. Sie wusste, weshalb der Motor ausgefallen war. Der Sand hatte den Vergaser verstopft.
Die ersten Schrecksekunden verflogen, während Kitty fieberhaft überlegte, was jetzt zu tun sei. Wenn sie irgendwie heil landen konnte, war es vielleicht möglich, den Sturm vorbeiziehen zu lassen und die Maschine zu reparieren. Das Flugzeug verlor allmählich immer mehr an Geschwindigkeit. Kitty drückte den Steuerknüppel leicht nach vorn und schwebte auf die unter ihr liegende Wüste zu. Es wäre nicht ihre erste Notlandung. Sie hatte bereits sieben überlebt. Bei zweien hatte sie Bruch gemacht, doch mehr als ein paar Verstauchungen und Hautabschürfungen hatte sie nie davongetragen. Allerdings hatte sie nie zuvor versucht, im fahlen Licht inmitten eines Sandsturms zu landen. Die eine Hand fest am Steuerknüppel, zog Kitty sich mit der anderen eine Fliegerbrille über die Augen, kurbelte das Seitenfenster herunter und steckte den Kopf aus dem Cockpit.
Immer noch vermochte sie nichts zu erkennen. Verzweifelt versuchte sie sich vorzustellen, wie der Boden wohl aussah. Sie wusste, dass der größte Teil der Wüste relativ flach war, es aber auch verborgene Senken und hohe Dünen gab, die nur darauf warteten, dass die Fairchild mit ihrer Pilotin an ihnen zerschellte. Kitty kam sich um fünf Jahre gealtert vor, als endlich, kaum zehn Meter unter ihrem Fahrgestell, der öde Boden plötzlich auftauchte.
Er war sandig und sah fest genug aus, um ihren Rädern Halt zu geben, und er war einladend eben. Sie ging in den Horizontalflug und setzte auf. Die großen Reifen der Fairchild hatten Bodenberührung, federten noch zwei-, dreimal und rollten dann leicht über den Sand hinweg. Das Flugzeug verlor an Fahrt. Während sich das Heckrad senkte und Kitty schon Atem holte, um einen Freudenschrei auszustoßen, tauchte plötzlich der Boden vor ihr weg.
Die Fairchild rutschte über die Klippe eines Steilhangs und fiel wie ein Stein in ein tiefes schmales Flussbett. Die Räder bohrten sich in den Sand, Fahrgestell und Propeller zersplitterten, und der Motor wurde nach hinten gedrückt. Dabei brach Kitty sich ein Fußgelenk und verstauchte sich das Knie. Gleichzeitig wurde sie nach vorn geschleudert. Normalerweise hätten die Gurte sie gehalten, doch Kitty hatte vergessen, die Schlösser einzuhaken. Ihr Oberkörper wurde nach vorn geschleudert. Ihr Kopf schlug gegen den Rahmen der Windschutzscheibe, und ihr wurde schwarz vor Augen.
Nur wenige Stunden nachdem sie von ihrem Auftankpunkt Niamey als überfällig gemeldet wurde, beherrschte das Verschwinden Kitty Mannocks die Schlagzeilen rund um die Welt. Eine groß angelegte Such- und Rettungsoperation war unmöglich. Die Erfolgsaussichten waren zu gering. Die Gegend in der Wüste, in der Kitty verschwunden war, war zum größten Teil unbewohnt und kaum erforscht. In einem Umkreis von 1700 Kilometern gab es kein Flugzeug. Im Jahre 1931 waren in der Wüste weder genug Männer noch genug Ausrüstung vorhanden.
Am folgenden Morgen wurde von einer kleinen motorisierten Einheit der französischen Fremdenlegion, die in der Oase Takaldebey im damaligen französischen Sudan stationiert war, eine Suchaktion gestartet. Da man annahm, dass Kitty irgendwo in der Nähe der Trans-Sahara-Piste heruntergekommen sein musste, arbeitete sich die Einheit in Richtung Norden vor, während ein paar Männer und zwei Wagen einer französischen Handelsfirma von Tessalit aus nach Süden fuhren.
Zwei Tage später trafen die beiden Suchtrupps aufeinander, ohne ein Wrack oder nächtliche Lichtsignale gesehen zu haben. Die Männer schwärmten 30 Kilometer zu beiden Seiten der Piste aus und versuchten es erneut. Nach zehn Tagen fürchtete der Kommandeur der Einheit das Schlimmste. Kein Mensch konnte ohne Essen und Trinken in der sonnenversengten Wüste so lange überleben.
In jeder größeren Stadt wurden für die beliebte Pilotin Andachten gehalten. Kitty, die neben Amelia Earhart und Amy Johnson zu den drei berühmtesten Pilotinnen zählte, wurde von einer Welt betrauert, die großen Anteil an ihren Abenteuern genommen hatte. Die attraktive Frau mit dunkelblauen Augen und langem rabenschwarzem Haar war als Tochter eines wohlhabenden Schafzüchters auf einer Ranch außerhalb von Canberra, Australien, geboren worden. Nach dem Abschluss an der höheren Töchterschule hatte sie Flugstunden genommen. Überraschenderweise hatten Mutter und Vater ihren Wunsch zu fliegen unterstützt und ihr einen gebrauchten Avro Avian-Doppeldecker mit offenem Cockpit und einem 80-PS-Cirrus-Motor gekauft.
Sechs Monate später war sie von einer Insel zur anderen, quer über den Atlantik, geflogen und schließlich unter den Hochrufen einer riesigen Menschenmenge, die bereits gespannt auf ihre Ankunft gewartet hatte, auf Hawaii gelandet. In ölverschmierter Bluse und Shorts, das Gesicht sonnenverbrannt, hatte Kitty müde gelächelt, vollkommen überrascht von dem unerwarteten Empfang. Später gewann sie die Herzen von Millionen, und ihr Name wurde zu einem Begriff für Rekordflüge über Ozeane und Kontinente hinweg.
Dies sollte ihr letzter Langstrecken-Rekordversuch sein, bevor sie einen alten Jugendfreund heiratete, dem in Australien die Nachbarranch gehörte. Nach ihren Erfolgen als Pilotin hatte sie allmählich die Lust am Fliegen verloren und freute sich nun darauf, sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Und wie viele andere aus den Pioniertagen der Fliegerei hatte auch sie die traurige Erfahrung machen müssen, dass man zwar berühmt wurde, es für Piloten jedoch kaum bezahlte Jobs gab.
Bis zum nächsten Morgen war Kitty bewusstlos. Die Sonne brannte auf die Wüste herab, als sie aus den Tiefen ihrer Ohnmacht erwachte, die Augen aufschlug und auf die zersplitterten Überreste des Propellers sah. Ihr Blick war getrübt. Durch Kopfschütteln versuchte sie den Nebel zu vertreiben, doch der Schmerz ließ sie keuchend nach Atem ringen. Vorsichtig tastete sie ihre Stirn ab. Keine offene Wunde, aber eine dicke Beule am Haaransatz. Sie untersuchte ihren Körper nach weiteren Verletzungen und entdeckte den gebrochenen Knöchel, der inzwischen in ihrem Fliegerstiefel stark angeschwollen war, sowie das verrenkte Knie.
Kitty schälte sich aus dem Gurt, drückte die Kabinentür auf und kletterte vorsichtig aus dem Flugzeug. Sie humpelte ein paar Schritte weiter, ließ sich langsam auf dem Sand nieder und zog Bilanz.
Glücklicherweise hatte die Maschine kein Feuer gefangen, doch die tapfere Fairchild würde niemals wieder fliegen. Drei Zylinder des Motors waren beim Aufprall gegen die Böschung gerissen. Die Motorhalterung war verbogen. Die Flügel waren erstaunlicherweise unbeschädigt, ebenso der Rumpf. Nur das Fahrwerk war plattgedrückt, und die Räder bogen sich nach außen.
Reparatur oder Weiterflug kam nicht mehr infrage. Kittys nächstes Problem bestand darin, ihre Position zu bestimmen. Sie hatte überhaupt keine Ahnung, wo sie gelandet war. Sie nahm an, dass sie sich in einem trockenen Flussbett befand, das nur von Zeit zu Zeit Wasser führte. In Australien bezeichnete man ein solches Wadi als Billabong. Nur dass dieses Wadi bestimmt seit Jahren kein Wasser mehr geführt hatte. Der Sandsturm hatte nachgelassen, doch die Abhänge des Wadis waren an der Stelle, an der sie sich befand, gut sechs Meter hoch, sodass sie keinen Blick auf die Umgebung werfen konnte. Das war auch besser so. Die Gegend war eintönig, menschenleer und in ihrer Hässlichkeit unbeschreiblich.
Sie verspürte plötzlich Durst, und bei dem Gedanken an Wasser fiel ihr wieder ihre Flasche ein. Sie hüpfte auf einem Bein zurück zur Kabinentür und zog die Flasche unter dem Sitz hervor. Von den zwei Litern Fassungsvermögen fehlte bereits ein Drittel. Kitty hatte das Gefühl, sie würde sich glücklich schätzen können, wenn sie damit länger als zwei, drei Tage auskam, und nahm kaum mehr als ein paar kleine Schlucke zu sich.
Sie musste versuchen, ein Dorf oder die Piste zu erreichen, entschied sie. Wenn sie in der Nähe des Flugzeugs blieb, bedeutete das den sicheren Tod. Die Fairchild war unmöglich auszumachen, es sei denn, eine Maschine flog direkt über sie hinweg. Immer noch wackelig auf den Beinen, richtete sie sich im Schatten des Flugzeugs auf und akzeptierte ihre missliche Lage.
Schon bald sollte Kitty die unglaublichen Temperaturunterschiede in der Sahara am eigenen Leib verspüren. Tagsüber kletterte die Temperatur auf 49 Grad Celsius und fiel nachts auf 4 Grad Celsius ab. Die Kälte während der Nacht war genauso mörderisch wie die Hitze am Tage. Nachdem sie zwölf Stunden die sengende Sonne ertragen hatte, hob sie eine tiefe Grube im Sand aus und kroch hinein. Sie rollte sich zusammen und schlief zitternd und unruhig bis zur Morgendämmerung.
Am frühen Morgen des zweiten Tages, bevor die Sonne anfing zu brennen, fühlte sie sich stark genug, um die Vorbereitungen zu treffen, das Flugzeug zu verlassen. Sie baute sich aus einer Tragflächenstrebe eine Krücke und aus der Bespannung einen provisorischen Sonnenschirm. Dann benutzte sie den kleinen Werkzeugsatz, um den Kompass vom Armaturenbrett des Cockpits abzubauen. Trotz ihrer Verletzungen war Kitty fest entschlossen, die Piste zu erreichen. Sie wusste, es gab keine Alternative.
Nun, da sie einen Plan hatte, fühlte sie sich besser, nahm ihr Logbuch zur Hand, und begann auf der ersten Seite mit einem zusammenfassenden Bericht über ihre sichere Landung und das heroische Vorhaben, unter den denkbar widrigsten Umständen zu überleben. Der Eintrag begann mit einer genauen Beschreibung der Bruchlandung und skizzierte dann ihre geplante Route nach Süden, entlang des Wadis, bis sie zu einer Stelle gelangen würde, an der es ihr möglich war, die Böschung hochzuklettern. War sie erst einmal aus dem Wadi heraus, wollte sie in östlicher Richtung weiterziehen, bis sie auf die Piste oder einen Stamm herumziehender Nomaden traf. Sie riss die Seite heraus und klemmte sie an das Armaturenbrett, damit eine Rettungsmannschaft ihrer Spur folgen konnte – auch wenn es unwahrscheinlich war, dass man das Flugzeug zuerst entdeckte.
Die Hitze wurde schnell unerträglich. Kittys Lage verschlimmerte sich noch dadurch, dass die Hänge des Wadis die Wärme und die Strahlen der Sonne reflektierten und es zu einem Brutkasten machten. Das Atmen fiel ihr schwer, und sie musste sich zusammenreißen, um ihr wertvolles Wasser nicht in langen durstigen Schlucken zu trinken.
Bevor sie sich aufmachte, löste sie die Schnürsenkel des Stiefels und zog ihn vorsichtig aus. Vor Schmerz stöhnte sie leicht auf und wartete, bis er nachließ, ehe sie den Knöchel mit ihrem langen Seidenschal bandagierte. Dann, Kompass und Wasserflasche am Gürtel befestigt, den Sonnenschirm in der Hand, die Krücke unter dem Arm, machte Kitty sich humpelnd unter der sengenden Sonne auf ihren Weg durch den Sand des Wadis.
Die Suche nach Kitty Mannock wurde im Laufe der Jahre immer mal wieder aufgenommen, doch weder sie noch ihr Flugzeug wurden jemals wieder gesehen. Es gab keinerlei Hinweis, keine Kamelkarawane stieß je auf ein Skelett in der Wüste, das mit einer altmodischen Fliegerkombination aus den Dreißigerjahren bekleidet war, kein Nomade stolperte jemals über das Flugzeugwrack. Das spurlose Verschwinden Kittys wurde zu einem der größten Geheimnisse der Fliegerei.
Die Gerüchte über ihr Schicksal wurden im Laufe der Jahrzehnte immer abenteuerlicher. Die einen behaupteten, Kitty habe den Absturz überlebt, leide jedoch unter Gedächtnisschwund und lebe heute unter einem anderen Namen in Südamerika. Andere glaubten, sie sei von einem Stamm der Tuaregs gefangen genommen und versklavt worden. Nur Amelia Earhardts Flug ins Nichts sorgte für noch mehr Spekulationen.
Die Wüste bewahrte ihr Geheimnis gut. Der Sand wurde zu Kitty Mannocks Leichentuch. Das Geheimnis ihres Fluges ins Unbekannte sollte erst ein halbes Jahrhundert später gelüftet werden.
TEIL I Durchgedreht
1
5. Mai 1996
Oase Asselar, Mali, Afrika
Die meisten Menschen sind vollkommen verblüfft über die Tatsache, dass man Tage oder Wochen durch die Wüste fahren kann, ohne ein Tier zu erblicken, Menschen zu treffen, das geringste Zeichen von Zivilisation zu entdecken. Der Anblick der Behausungen bedeutete deshalb für die elf Touristen in den fünf Landrovern und ihre Fahrer eine regelrechte Erleichterung. Verschwitzt und ungewaschen, erschöpft von der sieben Tage dauernden Fahrt durch menschenleeres Gebiet, freuten sich die Touristen, die bei »Backworld Explorations« die Fahrt »Quer durch die Sahara« gebucht hatten, wieder unter Menschen zu kommen und genug Wasser für ein erfrischendes Bad vorzufinden.
Vor ihnen lag das Dorf Asselar, vollkommen isoliert, mitten in der Zentralsahara. Das Gebiet gehörte zu Mali. Ein paar Lehmhütten gruppierten sich um einen Brunnen, der mitten in einem alten Flussbett lag. Im weiteren Umkreis lagen Hunderte von mehr oder weniger verfallenen Häusern. Jenseits davon, oberhalb der flachen Uferböschung, dehnte sich die endlose Ebene. Die vom Zahn der Zeit angenagten Häuser passten sich der dürren und farblosen Landschaft so gut an, dass das Dorf aus der Ferne kaum auszumachen war.
»Na, da liegt es.« Major Ian Fairweather, der Leiter der Safari, deutete nach vorn. Die Gruppe hatte sich um ihn versammelt. »Beim Anblick des Dorfes würde man nie auf den Gedanken kommen, dass Asselar früher einmal ein kultureller Knotenpunkt Westafrikas war. Fünf Jahrhunderte lang war der Ort eine wichtige Wasserstelle für die Handels- und Sklavenkarawanen, die auf ihrem Weg nach Norden und Osten hier durchzogen.«
»Warum ist der Ort so heruntergekommen?«, erkundigte sich eine Kanadierin in Top und Shorts neugierig.
»Als Folge der Kriege und Eroberungsfeldzüge der Mauren und Franzosen sowie der Abschaffung der Sklaverei. Der Hauptgrund ist allerdings wohl der, dass sich die Handelsrouten nach Westen und Osten näher zu den Küsten hin verlagert haben. Das endgültige Ende kam vor ungefähr 40 Jahren, als die Brunnen allmählich austrockneten. Der einzige noch funktionierende Brunnen, der auch heute weiter das Dorf versorgt, ist fast 50 Meter tief.«
»Nicht gerade das, was man sich unter einer Metropole vorstellt«, murmelte ein untersetzter Mann mit spanischem Akzent.
Major Fairweather lächelte gequält. Er war groß und schlank, hatte bei den Royal Marines gedient, rauchte eine lange Filterzigarette und sprach in knappen einstudierten Sätzen. »Heute leben in Asselar nur ein paar Tuaregfamilien, die das Nomadendasein aufgegeben haben. Im Wesentlichen ernähren sie sich von kleinen Ziegenherden und den Früchten des Sandbodens, der manuell mit dem Wasser des Brunnens bewässert werden muss, sowie von der Handvoll Halbedelsteine, die in der Wüste gefunden, hier geschliffen und dann mit dem Kamel in die Stadt Gao gebracht werden, wo sie als Souvenirs verkauft werden.«
Ein Anwalt aus London in tadellosem Khakianzug mit Tropenhelm wies mit einem Ebenholzstock zum Dorf. »Macht auf mich einen verlassenen Eindruck. Ich glaube, mich an den Text in Ihrem Katalog erinnern zu können:›Eingeborene tanzen zu Gesängen der Wüste vor den flackernden Lagerfeuern Asselarsc.‹«
»Ich bin sicher, dass unser Vorauskommando alle Vorbereitungen getroffen hat, damit Sie es bequem haben und Ihren Aufenthalt genießen können«, beruhigte Fearweather ihn selbstsicher. Einen Moment lang musterte er die Sonne, die hinter dem Dorf unterging. »Es wird bald dunkel sein. Besser, wir fahren in den Ort hinein.«
»Gibt’s dort kein Hotel?«, fragte die Kanadierin.
Fairweather unterdrückte einen gequälten Blick. »Nein, Mrs. Lansing. Wir kampieren in den Ruinen jenseits des Dorfes.«
Allgemeines Stöhnen bei den Touristen. Sie hatten auf ein weiches Bett und ein eigenes Badezimmer gehofft. Doch das war ein Luxus, der in Asselar von jeher unbekannt gewesen war.





























