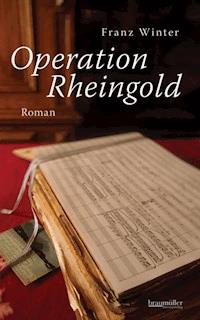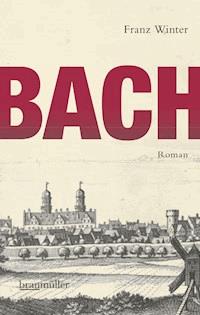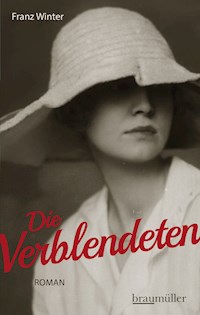18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Venedig, die "Serenissima", feiert ihren Abschied von der Weltbühne mit einem grandiosen Fest, in dem Luxus, Promiskuität, Geldgier, Spielsucht, Oper und Konzerte die Hauptrollen spielen. Antonio Vivaldi und das Mädchenorchester der Pietà ... Die Folgen dieses immerwährenden Karnevals sind Hunderte von Kindern, die verkauft oder weggelegt werden - die Knaben als billige Arbeitskräfte aufs Festland, die Mädchen verschwinden anonym hinter den Babyklappen der Waisenhäuser. Sie werden zu Krankenschwestern, Mägden oder Nonnen erzogen und viele von ihnen schiffsladungsweise als Siedlerbräute nach Übersee verkauft. Die Begabtesten aber werden zu Musikerinnen ausgebildet. Orchester entstehen, die von den berühmtesten Komponisten unterrichtet und mit eigens für sie geschaffenen Werken versorgt werden. So schreibt Antonio Vivaldi (1678-1741), der rothaarige Priester mit dem Liturgiedispens, seine brillantesten Oratorien und Konzerte (u.a. auch Die vier Jahreszeiten) für die Waisenhausmädchen des Ospedale Santa Maria della Pietà, genannt Orfanelle, und feiert mit ihnen seine größten internationalen Triumphe. Franz Winter verwebt meisterhaft das Leben des weltberühmten Komponisten mit dem Schicksal zweier Findlingsmädchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Franz Winter
Orfanelle
Ein Venedig-Roman
Franz Winter
Orfanelle
Ein Venedig-Roman
Die Berufsbezeichnungen der Orfanelle folgen der alten Schreibweise des Italienischen in den Registern der Pietà. Wortverkürzungen entstammen dem venezianischen Dialekt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2012
© 2012 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Coverbild:
Vincenzo Coronelli (1650–1718), Ansicht der Riva degli Schiavoni
ISBN E-Book: 978-3-99200-074-6
ISBN der Printausgabe: 978-3-99200-073-9
Meiner Tochter Lisa gewidmet
Fluch und Bann schleudert Gott gegen jene, die ihre Söhne und Töchter, seien es legitime oder natürliche, in dieses Hospedale della Pietà stecken oder stecken lassen, wenn sie Mittel und Möglichkeiten haben, sie selbst aufzuziehen, sie sind zum Ersatz aller Schäden und Auslagen für jene verpflichtet, sie können ihrer Sünden nicht losgesprochen werden, wenn sie diesen Pflichten nicht nachkommen, wie es klar der Bulle unseres Herrn und Papstes Paul III. zu entnehmen ist, erlassen am 12. November des Jahres 1548.
SCHLOSS WIESENTHEID
1741
Es war ein klagender Ton.
Ein klagender Ton, der schreiend eingekreist und überfallen wird, zu verenden droht, über Leitern zu entkommen versucht, was das Geschrei der anderen Instrumente nur noch wütender und wilder macht, dachte sie, als sie ihre Amati zwischen Schlüsselbein und Kieferknochen schob. Das kühle Holz jagte ihr Schauer vom Hals zum gesträubten Nackenflaum und von dort über den nackten Rücken ins eng geschnürte, schulterlose Mieder. Wenigstens beim Stimmen wollte sie den blutroten Körper noch nicht vor ihrem Schweiß schützen, erst wenn sie spielte, aber auch dann nur widerwillig, denn sie liebte, wie sich sein Vibrieren von ihrer bloßen Haut bis in ihre Knochen übertrug.
Erst seit Schönborn einmal, es mochte fast zehn Jahre her sein, während einer wilden Kadenz plötzlich neben ihr stand, in seiner knochigen Rechten ein Silberstilett, das er in ihren Ausschnitt schob, nicht ohne bei dessen Drehung die Haut ihrer rechten Brust zu ritzen, ihre Schweißtropfen auffing und diese, sich am frivol-entrüsteten Ekelgefühl seiner Gäste weidend, von der fadendünnen Blutrinne leckte, pflegte sie ein Tuch aus hauchdünnem, ausgebleichtem Leinen zwischen sich und ihr geliebtes Instrument zu legen. Zehn Jahre war das her, vielleicht zwölf oder mehr? Sie wusste es nicht, sie konnte die Jahre ihres Dienstes nicht mehr unterscheiden.
Aber an diesem Märzabend des Jahres 1741 war es ihr zum ersten Mal in ihrem dreiunddreißigjährigen Leben, von dem sie neunundzwanzig als Geigerin verbracht hatte, als würde die Oboe klagen.
Sie versuchte, ihren Tonleitern durch den atonalen Lärm zu folgen und hörte sie wie einen gefangenen Vogel in panischer Angst gegen ein todbringendes Netz flattern. Um dieses grausame Bild in sich wegzuwischen, riss sie hastig den Geigenbogen in die Luft, worauf alle Töne sofort erstarben. Die Musiker sahen sie, wie jedes Mal bei diesem Ritual, erwartungsvoll an. Sie forderte eben jenen Oboisten, der der Urheber jener atemlosen Flucht war, durch ein unerwartet herrisches Zeichen auf, den Kammerton anzublasen, was dieser auch nach einer irritierten Verzögerung tat. Der Lärm setzte mit einem Schlag wieder ein, schriller, weil jetzt nur die Blasinstrumente stimmten, die Oboen, die Chalumeaus, die Blockflöten, die Fagotte, zwei Hörner. Ohne Aufforderung wurde es nach wenigen Augenblicken wieder still und Pelegrina, die mit erhobenem Bogen gewartet hatte, strich nun das für alle verbindliche A. Die Streicher und die Gruppe des Continuo übernahmen es, die Bläser mischten sich abermals dazu, sodass der Lärm des Stimmens wie eine Wolke aus flirrendem Klang bald die ganze riesige Orangerie im Schlosspark zu Wiesentheid ausfüllte, einen lang gestreckten dem Grafen höchst angelegentlichen, frei stehenden Bau, in dem Pelegrina als Konzertmeisterin des Schönborn’schen Orchesters das abendliche Konzert angeordnet hatte – allerdings nur für den kleineren Teil der ihr unterstellten Musiker, weil sie für das vorgesehene Programm aus Werken ihres ehemaligen Lehrers Antonio Vivaldi nicht mehr als sechzehn Instrumentalisten benötigte. Das bittersüß nach Orangenblüten duftende, von Fackeln und Kerzen erleuchtete, von zwanzig Eisenöfen erwärmte Gewächshaus schien ihr der richtige Ort für ein Konzert, das nach einem langen deutschen Winter den Frühling mit der stürmischen Musik eines Venezianers begrüßen sollte. Auch ihre etwas zu theatralischbukolische Kostümierung, die sie auch ihren Musikern anbefohlen hatte, hielt sie trotz der herrschenden Fastenzeit für angemessen, galt es doch, wieder einmal den Versuch zu wagen, die seit dem dreiundzwanzigsten Todestag seiner Gemahlin, der verwitweten Gräfin Eleonore von Hatzfeld-Gleichen, ständig wachsende Melancholie ihres Herrn, des Grafen Rudolf Franz Erwein von Schönborn, wenigstens für die Dauer einer musikalischen Darbietung zu zerstreuen.
Durch die Tropfenfäden auf den hohen Fenstern sah sie Lichtpunkte, die sich verdoppelten, verdrei-, vervielfachten, sich vergrößerten und sich tanzend, wie es schien, dem Gewächshaus näherten. Die gräflichen Fackelträger bildeten Spalier für den Auftritt ihres Herrn samt Gefolge. Pelegrina riss abermals heftig ihren Geigenbogen in die Höhe. Der schien die augenblicklich erfolgte Stille, vier Herzschläge lang, zitternd auf seiner Spitze zu balancieren, ehe er wie in einer Kometenbahn mit seinem festgezurrten Schweif aus Pferdehaar auf die G-Saite ihrer Geige krachte, um jenen Frühlingssturm zu entfesseln, der als Sinfonia vor die Oper „L’Olimpiade“ gebannt war. Es war, als ob Spatenstiche von Blitzen Tausende Heckenvögel in einen Gewitterhimmel jagten, der die Eiskruste der Wintererde mit seinen warmen Wasserkaskaden aufsprengte, bereit machte für den Frühling, den die in schwarzer Luft flirrenden Himmelsgeschöpfe längst zu erwarten schienen, vibrierend vor Glück.
Die Flügel der stockwerkhohen Türen wurden aufgerissen, auf einer mit bleigrauem Samt überworfenen Doppelsänfte, getragen von acht schwarz livrierten, silber betressten Dienern, schwebte Graf von Schönborn neben seiner gichtgekrümmten Schwester in den Palast der überwinternden Orangenbäume, und mit ihm ein dunkel drohender Tanz, mit dem eintretende schwarz gekleidete Musiker den Raum nach und nach überschwemmten. Die Sinfonia erstarb, ertrank in einem schraubenden Rhythmus, der eine nie gehörte Melodie der Klage wie auf Wellen zu schaukeln schien. Pelegrina versuchte sich fieberhaft zu erinnern, wo sie eine solche Musik schon einmal gelesen hatte, Gerolama fällt ihr ein, die Cellistin, die an den dänischen Königshof verkauft worden war, damals, vor, sie weiß nicht mehr, wie vielen Jahren. Da hatte sie ihr solche Noten nachgespielt, in sinnloser Wut hatte sie ihr dieses schmerzerfüllte Geigenstück des deutschen Komponisten Bach mit dem Namen „Ciaccona“ aus dem vergitterten Fenster der Pietà nachgeschleudert, hinaus in die seidene Luft der Lagune, als sich die Gondel mit Gerolama dal Cello und jenem widerwärtigen Hellingstad, dessen Geliebte sie zu werden hatte, im Schiffsgewimmel des Hafenbeckens von San Marco verlor.
Jetzt sah sie das rot aufgedunsene Gesicht des Hofzwerges, auch er ganz in Schwarz, wie er beflissen immer mehr schwarz gekleidete Menschen, Männer und Frauen, alle mit weißen Blättern in den Händen, hereinwinkte, aufgeregt um ihr Podium dirigierte, auch den Knabenchor der Wiesentheid’schen Kreuzkapelle, sie sah Diener die Orangen-, Pomeranzen- und Lorbeerbäume mit schwarzen Tüchern überwerfen, als Schönborn seine langfingerige Hand hob, worauf die Woge der Musik auf ihrem Scheitelpunkt erstarrte.
„Signora Pelegrina! Es ist vorbei! Ich sagte es schon! Gestern und den Tag davor! Die Zeit der Buße ist gekommen! Ich tue Buße für mein sündiges Leben an Ihrer Seite! Finito, Pelegrina dal Violin! Der venezianische Karneval ist vorüber, für immer! E finito l’amor!“
Sie starrte in das fahle Gesicht des vierundsechzigjährigen Kaiserlichen Geheimen Rates, ihres Herrn und Liebhabers, dessen Arm noch immer in die Luft ragte, während sie hinter sich wahrnahm, wie die fremden Instrumentalisten schwarz gepolsterte Hocker zwischen ihre Musiker schoben, darauf Platz nahmen, wie der feiste junge Kapellmeister der Schönborn’schen Kirchenmusik wieselflink Notenblätter auf den Pulten verteilte, die Vivaldi-Noten, von denen einige zu Boden glitten, überdeckend, und Aufstellung nahm. Die Hand Schönborns wies auf das neu formierte Orchester, es wurde totenstill.
„Das ist die neue Musik! Teutsche Musik! Passio Secundum Matthaeum – des teutschen Compositore Johann Sebastian Bach aus Leipzig! Lausche Sie! Lerne Sie! Verstumme Sie! Einmal für alle Male!“
Als sich seine geöffnete Hand senkte und auf die noch immer offen stehende Doppeltüre hinter sich wies, begann der Todestanz jener „Passio Secundum Matthaeum“ von Neuem. Pelegrina versuchte, in den vertrauten Zügen ihres Herrn und Liebhabers, der sie vor mehr als zwölf Jahren aus dem Orchester der Pietà gekauft hatte, ein Zeichen für die Aufhebbarkeit seines Diktums, für den Zweifel an den eigenen Worten zu erhaschen, konnte aber durch ihren Tränenschleier nur erkennen, wie er die gichtigen Finger seiner verwitweten Schwester umschloss.
Plötzlich fühlte sie ihre Kleider hochgerissen, sie wich zurück, prallte auf den Kapellmeister, wandte sich entschuldigend nach ihm um, wurde von diesem rüde in Richtung des Hofzwerges gestoßen, der das Holzpodium erklommen hatte, wie ein dicker Hund hechelnd auf sie zu kroch, unter ihren Röcken verschwand, seinen Kopf zwischen ihre Beine trieb und sich, ihre Schenkel umklammernd, aufrichtete, sodass sie auf seinen Schultern zu sitzen kam und im Rhythmus der Musik bewegt wurde wie eine Puppe, die mit weit ausgestreckten Armen die Schwankungen des sich mit ihr drehenden Zwerges auszubalancieren versuchte, um ihr geliebtes Instrument nicht zu gefährden. Ohnmächtig vor Wut hieb sie mit dem Geigenbogen auf ihre Röcke, um den ihre Waden wie mit einem Schraubstock an sich pressenden Zwerg zu treffen, worauf dieser mit einem obszönen Lustgestöhn antwortete, im Sog der Musik nur noch wilder um die eigene Achse torkelte, sie plötzlich in die Innenseite ihres rechten oberen Schenkels biss und diesen wie besessen zu lecken begann.
Sie musste aufschreien, erstickte aber den Laut in der Beuge ihres Ellbogens. In ihrer Verzweiflung rammte sie die Geige unter ihr Kinn, doch ehe sie auch nur einen einzigen Ton ansetzen konnte, spürte sie, wie der Nackenschweiß des Zwerges von ihrem Schoß zu ihrer Gesäßfalte rann. Dann warf sie eine aberwitzige Kadenz aus dem „Gardellino-Konzert“ ihres Meisters Vivaldi in die Tränendünung des Todestanzes. Für wenige Augenblicke schien der venezianische Gardellino, der winzige blauhaubige Distelfink, von den Klangfluten des Deutschen verschlungen zu werden, konnte sich aber, flirrend in der Gischt, über die Brandung heben, sodass ein schillernder Regenbogen die Tiefe des Leids mit den höchsten Spitzen der Orangenbaumwipfel zu verbinden schien, bis der Zwerg, auf einen herrischen Verweis Schönborns hin, vom Podium sprang und mit Pelegrina hinkend aus dem gespenstischen Fackelschein des Gewächshauses stolperte.
„Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“, rief ihr der einsetzende Chor nach, als sich der Zwerg bückte und sie von sich auf den Kiesweg stieß, dem sie, Kleid und Unterröcke mit der Bogenhand raffend, durch den Park folgte, bis sie atemlos entlang der Längsfront des Seitentraktes von Wiesentheid rannte, eine Holztüre aufstieß und die Steintreppe hinauf zu ihren Zimmern hastete, vor denen ein Lakai neue Kerzen in die Wandarme steckte.
„Dominik, den Kutscher wecken! Er soll doppelt anspannen! Den kleinen Reisewagen! Jetzt! Gleich! Ich reise die nächste Minute! Rasch!“
Sie steht vor dem purpurroten Prunkkleid, das sie als Mätresse bei großen Anlässen zu tragen hatte. Mit einem Fußtritt stößt sie die Kleiderpuppe von der Tapetentüre, um eine Reisetasche aus dem Kabinett zu zerren, die sie wahllos mit Wäsche, Miedern, Röcken, Kleidern, Geldkatzen und gebündelten Briefen vollstopft, als sie den Chor von ferne „Sehet ihn, den Bräutigam“ singen hört, sie hält inne. „Sehet ihn, als wie ein Lamm!“ Behutsam hüllt sie ihre Geige in den pagodendurchsetzten morgenroten Schal aus Chinaseide, bettet sie in den hirschlederüberzogenen Holzkasten, entspannt den Bogen, versorgt ihn neben den anderen im Deckel des mit algengrünem Samt ausgeschlagenen Geigenkoffers, verschließt diesen sorgsam, reißt eine Kapuzenpelerine aus der dritten Lade der mit der Lieblingsblume Schönborns, der Feuerlilie, gefassten Kommode, greift das Gepäck und verlässt das Schloss.
Auf dem Weg zur Remise umspielt sie der Wind mit hellen Knabenstimmen, die tosende Klangadern aus pochenden Streichern, fließenden Holzbläsern, rufenden Chören umflechten, „O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet …“
Sie wirft dem Kutscher einen Beutel mit Münzen zu, „Nach Süden! Zur nächsten Poststation! So schnell du kannst!“, verstaut ihre Reisetasche auf dem Sitz vor sich, zieht den Wagenschlag in sein messingfunkelndes Kastenschloss und wartet, den Geigenkasten an sich pressend, mit rasendem Herzen darauf, dass die Fuchsstuten anziehen, während der Zwerg, der, um ihren Blick zu erhaschen, fortwährend wie ein schwarzer Ball in die Höhe springt, sein hohnvolles Lebewohl schreit.
„Addio, Maestra! Maestra dell’amore! Die Zeit der Buße ist gekommen! Carne vale! Fleisch, leb wohl! Addio, Pelegrina della Pietà! Saluti a Venezia! E complimenti a Don Antonio, il divino Maestro Vivaldi! Addio! Addio! Per sempre addio!“
Endlich rasselt die Kutsche über den Kies der unabsehbaren Kastanienallee auf das wappen-geschmückte Haupttor zu, das der Lakai durch die Wachen öffnen lässt, und verschwindet in den noch immer winterlich kahlen Eichenwäldern, den Hirschgründen des Grafen Rudolf Franz Erwein von Schönborn.
VENEDIG
Ospedale della Pietà, 1720
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.“
Die klare Stimme Pelegrinas war bis in den entferntesten Winkel des riesigen, unverputzten Saales zu hören, sie fand ihren Resonanzraum in der rohen Balkendecke, von der sie sich gleichmäßig über die sechshundert Mädchen verteilte, die auf Holzbänken an schier endlos aneinandergereihten Holztischen vor Hunderten von hellen Fladenbroten saßen, die sie fast geräuschlos in Hunderte von Milchschalen tauchten, um sie als erste Nahrung dieses Frühsommermorgens des Jahres 1720 zu sich zu nehmen, während Pelegrina ihren Wochendienst versah, der ihr auftrug, von der marmornen Lesekanzel neben dem beinahe die ganze Stirnseite des Refektoriums einnehmenden Abendmahlsbild die Mahlzeiten der Waisenmädchen von Santa Maria della Pietà durch das Lesen heiliger Texte dem Profanen zu entziehen und der größeren Ehre Gottes zu weihen, ein Auftrag, dem sie nur zu gerne Folge leistete, handelte es sich doch um die Woche, in der ihr Geburtstag liegen musste, wie ihr die Mutter Oberin versichert hatte, denn in dieser Aprilwoche vor zwölf Jahren sei sie der allerheiligsten Mutter der Barmherzigkeit anheimgegeben worden, so wie die eintausendeinhundertachtundachtzig anderen Mädchen der Pietà, des berühmtesten Ospedale der glorreichen Republik Venedig.
„Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab geben mir Zuversicht.“
Pelegrina verstummt, als sie zu Füßen des brotbrechenden Christus die Oberin in der plötzlich geöffneten Flügeltüre stehen sieht, die Blicke von sechshundert mit weißen Leinenbändern eingebundenen Mädchenköpfen auf sich bannend. Eine gefangene Schwalbe sichelt unter den mächtigen Balken dumpf gegen eines der hoch ins Mauerwerk eingelassenen Fenster. Regungslose Stille.
Auf ein Zeichen der groß gewachsenen Frau beendet Pelegrina rasch den abgebrochenen Vers, „… und ich werde wohnen im Hause des Herrn für immer und ewig“, was die Oberin mit einem herablassenden „Gelobt sei Jesus Christus“ abschließt, worauf alle Mädchen in die Höhe schnellen und wie aus einer Kehle „In Ewigkeit Amen!“ rufen.
„Geliebte Figliole!“, die hagere Nonne hinter der Oberin bedeutet den Mädchen, ihre Plätze wieder einzunehmen. „Wie ihr wisst, werden uns am heutigen Festtag der heiligen Katharina um die neunte Stunde neun Dutzend unserer geliebten Figlie di Comun, eurer geliebten Sorelle, verlassen, um in der Neuen Welt im Namen unserer gnädigsten Gottesmutter ihre segensreichen Pflichten als Ehefrauen und Mütter an der Seite von mutigen, gottesfürchtigen Siedlern zu übernehmen. Als da sind …“
Die Mädchen wagen nicht, von ihren Milchschalen aufzuschauen, als die Nonne das ledergebundene Geschäftsbuch aufschlägt und mit hoher Stimme zu lesen beginnt: „Maddalena dalla Cucina!“ Langsam, ohne den Blick zu heben, steht das dunkelhaarige, Maddalena genannte Mädchen auf. „Geh hin in Frieden!“, murmeln die anderen, „Deo gratias!“, antwortet Maddalena. „Ursula dal Giardino!“ „Geh hin in Frieden!“ „Deo gratias!“, flüstert Ursula, eine stämmige Blonde. „Anastasia dalla Tessitura!“ „Geh hin in Frieden!“ „Deo gratias!“, das flachsblonde, hoch aufgeschossene Mädchen bleibt stehen wie die vor ihr Aufgerufenen, einhundertfünf Mädchennamen lang.
Pelegrina, die regungslos auf ihrem Lettner verharrte, war gezwungen, die Wirkung des Urteils auf die Betroffenen zu beobachten, sie war bei Anlässen wie diesen bisher immer in der Reihe gesessen, mit gesenktem Kopf wie die anderen, wissend, dass sie nicht gemeint sein würde, sollte ihr doch nach den Regeln der Pietà als Musikerin, als „Figlia di Coro“, das Schicksal der „Figlie di Comun“, der „gemeinen Töchter“, erspart bleiben, als Siedlerbraut in die Länder jenseits des Ozeans verschifft zu werden. Aber die Angst blieb, während ihre Lippen tonlos das geforderte „Geh hin in Frieden!“ formten.
Kein Laut war zu hören, nur die Litanei der schrill gerufenen Namen, beantwortet vom Chor der sechshundert Mädchenstimmen und der einzeln gesprochenen Formel der Danksagung, die zum hundertfachen Ausdruck von Ohnmacht, Wut, Ergebung, Demut, Hilflosigkeit, Gehorsam, Verzweiflung, Selbstverleugnung, Trotz und Angst wurde. Kein Laut, außer dem matter werdenden Flügelschlag der verendenden Schwalbe auf dem Fenstersims, und dennoch flossen Tränen wie Regengüsse über kreidebleiche, totenblasse, über fieberrote Wangen.
„Geliebte Figliole di Comun, folgt nun Schwester Zephira zu eueren Schlafstellen, wo ihr aus den euch anvertrauten Sachen das Nötige für die Reise vorbereitet finden werdet, als da sind: ein Rosenkranz aus Ebenholz, ein leinenes Hemd, ein paar wollene Strümpfe, zwei Überröcke, einer aus Leinen, einer aus Tuch, ein Mieder, ein härenes Brusttuch, ein wollener Mantel, ein Paar lederne Schuhe. Ihr wechselt eure Schürzen gegen den Überrock aus Tuch und das Mieder, welches ihr über dem leinenen Unterkleid, das euch jetzt bekleidet, anlegt, den Rest verschnürt ihr in eueren Schürzen zu einem Bündel, bis auf den Mantel, der euch auf offener See gegen den Wind schützen wird, so wie euch das Schuhwerk sicheren Trittes durch unwegsame Gelände führen wird. Den Rosenkranz aber verwahrt ihr in der Kitteltasche, auf dass ihr ihn betend zur Hand habt. Das Kreuz aus Silber aber, das ihr seit dem Tage euerer ersten heiligen Kommunion an schwarzen oder weißen Bändern um den Hals tragt, sei euch für immerdar ein Zeichen, dass unser Herr nicht Leid noch Tod gescheut hat, um euch von eueren Sünden zu erlösen. Geht hin in Frieden!“
„Deo gratias!“, antworteten die Mädchen, und Pelegrina musste mit ansehen, wie die einhundertacht Aufgerufenen versuchten, aus den Reihen zu kommen, indem sie die Bänke überstiegen, gebückt, um keinerlei Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, sodass auch die zwischen ihnen Sitzenden aufstehen mussten, bis sich Hunderte von leinenweißen Gestalten ängstlich umeinander drängten wie Lämmer, die, gepfercht in sechs schmale Gassen, ihre Schur erwarteten. Dabei kam es zu fahrigen Berührungen, angedeuteten Umarmungen, Lippen huschten verstohlen über tränennasse Wangen, Hände lösten sich aus Händen, bis sich die zu Siedlerbräuten Bestimmten von den in den Gattern aus Tischen und Bänken Zurückbleibenden gelöst hatten und schweigend hinter Schwester Zephira in dem dunklen Gang verschwanden, der zu den Schlafsälen führte.
Pelegrina wagte nicht, ihren Platz unter den anderen wieder einzunehmen, als die Oberin das Zeichen zum Hinsetzen gab, selbst die Türflügel schloss und mit ruhiger, klarer Stimme fortfuhr, dass es Gott in seiner unendlichen Güte gefallen habe, den Priester seiner Heiligen Kirche, Don Antonio Vivaldi, den hochberühmten Virtuoso und Compositore, nach zweijähriger Abwesenheit als Maestro di Capella am Hof des durchlauchtigsten Prinzen Philipp von Hessen und Darmstadt zu Mantua, nunmehr als Maestro di Coro e de’ Concerti dem Ospedale della Santissima Maria della Pietà wiederum zuzuführen.
Pelegrina suchte den Blick Gerolamas, der dunkelhaarigen Cellistin, den diese sofort erwiderte, auch Santinetta dal Clavcin drehte den gesenkten Kopf ein wenig, um zu ihr emporsehen zu können, ebenso die immer heiter gestimmte Prudenza, die ihrer Schalmei die süßesten Töne zu entlocken wusste. Sie alle hatten die Zeit mit Don Antonio nie vergessen, nicht die sonntäglichen Messen, nicht die Oratorien an den hohen Festtagen, von denen weder Venezianer noch Fremde genug bekommen konnten, nicht die Akademien von San Rocco, San Giovanni e Paolo, San Zaccaria, nicht die Concerti vor Hunderten von schwarz verschleierten Zuhörern, deren kalkige Masken sie anstarrten, in den Palästen der vornehmsten Familien Venedigs, der Loredan, der Mocenigo, der Contarini, zu denen sie im goldenen Schimmer der untergehenden Sonne von der Riva degli Schiavoni den Gran Canal hinauf in Gondeln glitten, ein Schauspiel, das sie entbehren mussten, seit dem Tag, da ihr Maestro sie für immer, wie es schien, verlassen hatte, um seinen Ruhm in Mantua zu mehren. Doch jetzt durften sie erfahren, dass Don Antonio mit den Vorbereitungen zum Fest der Allerheiligsten Trinitatis seinen Dienst wieder aufnehmen würde, dass er als Vorboten neue Compositiones gesandt habe, „welche von den Maestre allsogleich zu praktizieren sind“. Margherita, Michaela und Cecilia, die wie alle Musikerinnen mit ihrem zwanzigsten Lebensjahr in den Lehrdienst gewechselt waren, neigten ergeben ihre Köpfe.
„Des Weiteren geruhen wir, auf Don Antonios Empfehlung hin, nach reiflicher Überlegung“, erhob die Oberin schneidend ihre Stimme, „in moda extra ordine, einer in Famiglia geborenen Figlia namens Anna aus Mantua ihrer von Gott dem Allmächtigen verliehenen Talente wegen unsere Arme zu öffnen, um sie dem disparaten Treiben der Welt für immer zu entziehen, der Vollkommenheit der Musik aber ganz anheimzugeben, zur größeren Ehre unserer allerheiligsten Mutter der Barmherzigkeit und zum Ruhme Venedigs. Santinetta dal Clavcin und Zabetta dal Sopran werden sich ihrer als Maestre in besonderer Weise annehmen.“
Die beiden Genannten deuteten eine demütige Verbeugung an, Prudenza zog die Schultern ein, um nicht aufglucksen zu müssen, wobei sie tonlos „in moda extra ordine“ wiederholte, was der Oberin nicht entging. Wie ein Peitschenhieb traf sie die obligatorische Schlussformel dieser außergewöhnlichen Morgenverkündigung.
„Figlie di Comun e Figlie di Coro, nützen wir den Tag und die Stunde! Ave Maria …“, die Mädchen schnellten in die Höhe, „gratia plena, Dominus tecum“, riefen sie wie aus einem Mund und beendeten das Gebet, ehe sie sich in einer langen Reihe zu je zweien formierten und an ihr Tagwerk gingen, eine jede an den ihr zugewiesenen Platz, die Figlie di Comun in der Küche, in den Magazinen, in den Kellern, den Werkstätten, den Webstuben, den Hühnerställen, zu den Wassereimern in den Gängen und zu den Waschzubern bei der Zisterne im Innenhof.
Zwölf der Dreizehn- bis Sechzehnjährigen begaben sich schweigend in den abgedunkelten, nur von Öllampen erhellten Raum der Ammen, von denen sie die gestillten Neugeborenen empfingen, um sie in der Sala degli Innocenti in ihre Kisten auf fortlaufenden Holzgestellen zurückzulegen, in denen die neuen Findlinge schliefen oder ihre kleinen Arme nach geschnitzten Vögeln, Schmetterlingen, Palmwedeln, Kreuzen, Kochlöffeln, Geigen oder Flöten streckten, die als Spielzeug an Zwirnsfäden über ihren Bettchen baumelten. Die Schreienden nahmen sie auf, legten sie auf leinenüberzogene Strohmatten, die den schmalen, fast zimmerlangen Tisch des Waschganges vor dem Stillraum bedeckten, lösten die ausgebleichten Flanellfaschen, um die kleinen Körper mit feuchten Windeln zu reinigen, die sie in wassergefüllten Ledereimern spülten, ehe sie die Mädchen erneut umwickelten und den leise summenden Ammen übergaben.
„Et incarnatus est de Spiritu Sancto“, wie ein Schleier senkte sich das Gespinst aus Worten und Harmonien vom Chorsaal durch das Stiegenhaus hinunter auf die Reihe der gehenden Mädchen.
„Und er ist Fleisch geworden durch den Heiligen Geist …“, in ihrem Kopf sang Pelegrina die niederschwebenden Worte des Glaubensbekenntnisses weiter, „… aus der Jungfrau Maria …“, sie würde ihnen auf der Geige das Geleit geben, in der Kirche der Pietà, am nächsten Sonntag, für den dieses Credo Don Antonios angesetzt war, noch ohne seine Anwesenheit. Jetzt konnte sie es kaum erwarten, endlich die Sandsteintreppe zu erreichen, um hinauflaufen zu dürfen, am Chorsaal vorbei, in ihr Übungszimmer, von dem aus sie letzte Blicke hinunterschicken konnte auf die über das große Meer befohlenen Schwestern, deren Schiffe wie immer von der Riva degli Schiavoni ablegen würden, um niemals wiederzukehren.
Sie erklomm einen der hölzernen Betschemel, den sie unter die hoch in die Mauer eingelassene, quadratische Öffnung geschoben hatte, stieg auf dessen Armbank, riss die trüben, bleigeränderten Glasscheiben auf und zog sich an den rostigen Gitterstäben in die Fensterdickung, um die Mole sehen zu können, von der die erste der drei Ruderbarken ablegte. Unter den etwa vierzig, ihre Leinenbündel an sich drückenden Mädchen konnte sie Maddalena dalla Cucina und Monica dalle Stalle erkennen, während weitere vierzig Mädchen begannen, sich auf den schmalen Holzbänken zusammenzudrängen, überwacht von einer grobknochigen Nonne, die ihre Namen auf einer Liste ab-hakte und diese dem Bootsmann übergab, neugierig beäugt von schwarzen Maskengestalten, Männern und Frauen, die sich in kleinen Gruppen eingefunden hatten, um sich am Schauspiel der Mädchenverschiffung zu weiden.
Plötzlich löst sich Ursula dal Giardino aus der dritten Gruppe, hetzt mit geschürztem Rock über die angrenzende Brücke in Richtung Arsenal, im selben Augenblick flieht Anastasia dalla Tessitura die Riva hinauf zur Piazzetta, während Rosana dalle Malate in der schmalen Gasse der Calle della Pietà unterzutauchen versucht. Wie auf einen geheimen Befehl hin tauchen männliche Gestalten aus dem Schatten des Ospedale und nehmen zu je zweien die Verfolgung auf. Die gaffenden Masken stieben auseinander, zerstreuen sich ein paar Schritte hinter die Flüchtenden, gierig darauf, sich kein Detail der Jagd entgehen zu lassen. Pelegrina presst ihre Stirn gegen den scharfen Falz einer Gitterstange, „Ave Maria, gratia plena, lass sie entkommen, Mutter des Herrn, schenk ihnen die Freiheit, schenk ihnen die Freiheit!“. Ihre Zunge vermag ihr Blut nicht von ihren Tränen zu unterscheiden, als sie mit ansehen muss, wie sechs Schergen der Pietà unter den höhnischen Rufen der Masken zwei der sich windenden, um sich schlagenden Flüchtigen zurückschleppen und die wild strampelnden Beine der Mädchen in Fußketten legen, die ihnen der Schiffskommissar gereicht hat.
„Figlie di Puttane! Hurentöchter! Schande unserer Stadt! Weg mit euch! Condannate! Verfluchte! Weg mit euch! Addio! Addio! Per sempre addio! Figlie di Puttane! Di Puttane! Condannate! Per sempre addio!“
Wie von vier Schraubstöcken gehalten, humpeln die Mädchen durch ein schreiendes, spuckendes Maskenspalier auf die mit gehobenen Rudern sich langsam von der Mole lösende dritte Barke zu, der sie von den Knechten wie angeschossene Enten nachgeworfen werden, aber Rosana ist nicht unter ihnen. Ohnmächtig vor Mitleid und Wut gleitet Pelegrina aus der Fensterdickung, findet ihre Übungsgeige auf dem Sockel des vierfachen, mit den Solostimmen aus der Sammlung „L’estro armonico“ belegten Notenpultes, erklettert die Armbank des Betschemels wieder und hofft verzweifelt, die Scheidenden mit dem zärtlich wiegenden Larghetto des ihr zur Übung anbefohlenen D-Dur-Concertos von Don Antonio zu trösten, während unten, im Hafenbecken von San Marco, die drei Barken ins Gegenlicht tauchen wie schwarze Schiffe von Verdammten.