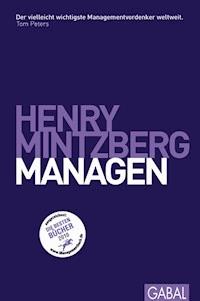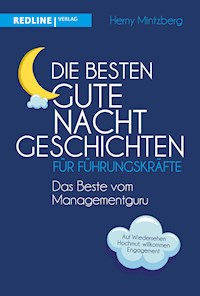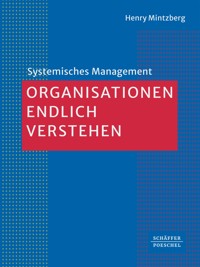
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer Welt von Organisationen, von unserer Geburt in Krankenhäusern bis zu unserer Beerdigung durch Bestattungsunternehmen. Dazwischen werden wir von Organisationen erzogen, beschäftigt, unterhalten und verärgert. Nach wie vor besteht sowohl in der Praxis als auch in der Lehre das Bedürfnis nach einem umfassenderen Verständnis von Organisationen, die so wesentlich für fast alles sind, was wir tun. Zu glauben, dass es nur einen Weg gibt, um Organisationen zu strukturieren, ist der schlechteste Weg, dies zu tun. Ein besserer Ansatzpunkt ist, verschiedene Arten von Organisationen zu erkennen. Mintzberg identifiziert sieben verschiedene Formen von Organisationen. Er erforscht diese Formen und die Kräfte, die sie über ihre Lebenszyklen hinweg antreiben. Seit einem halben Jahrhundert beobachtet Henry Mintzberg Organisationen, berät sie, beschäftigt sich mit ihnen. Das Buch ist eine meisterhafte Aktualisierung und Überarbeitung seines Klassikers »Structure in Fives« von 1983.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort1 Unsere Welt der OrganisationenTeil 1: Organisationen neu betrachtet2 Die Akteure und die Teile»Out of the box« denkenDie wichtigsten AkteureEine frühere DarstellungKetten, Knotenpunkte, Netze und Sets3 Kunst, Handwerk und Wissenschaft des OrganisierensEntscheidungsfindung als Kunst, Handwerk oder WissenschaftStrategieentwicklung als Handwerk plus Kunst mit ein bisschen WissenschaftManagement als Handwerk mit Kunst, aber nur begrenzter WissenschaftTeil 2: Die Bausteine des Organisationsdesigns4 Die Koordinierungsmechanismen5 Die Design-ParameterArbeitsstellen designen: SpezialisierungArbeitsstellen designen: FormalisierungArbeitsstellen designen: Training und IndoktrinationDie Superstruktur designen: Einheiten bildenDie Superstruktur designen: Die Größe der Einheiten bestimmenDie Superstruktur designen: Dezentralisierung entwirrenDie Superstruktur konkretisieren: Planungs- und KontrollsystemeDie Superstruktur konkretisieren: Querverbindungen6 Design im KontextAlter und GrößeTechnische SystemeUmweltMachtTeil 3: Vier Grundformen von Organisationen7 Die persönliche UnternehmungDie Grundstruktur der persönlichen UnternehmungBedingungen und Arten von persönlichen UnternehmungenDie Vor- und Nachteile der persönlichen Unternehmung8 Die programmierte MaschineDie Grundstruktur der programmierten MaschineBedingungen und Arten von programmierten MaschinenDie Vor- und Nachteile der programmierten MaschineSich mit Maschinen arrangieren9 Die professionelle VersammlungDie Grundstruktur der professionellen VersammlungBedingungen und Arten professioneller VersammlungenDie Vor- und Nachteile der professionellen Versammlung10 Der ProjektpionierDie Grundstruktur des ProjektpioniersBedingungen und Arten von ProjektpionierenDie Nachteile des Projektpioniers11 Die vier Formen zusammenbetrachtetDie vier Formen damals und heuteDie vier Formen im ÜberblickStrategieentwicklung in den FormenManagen in den FormenDie Formen in der echten WeltTeil 4: Sieben treibende Kräfte, die der Organisation zugrunde liegen12 Eine Kraft für jede FormKonsolidierung in der persönlichen OrganisationEffizienz in der programmierten MaschineKompetenz in der professionellen VersammlungKollaboration im Projektpionier13 Drei Kräfte für alle FormenDas Überstülpen der Separierung – auseinandergerissen werdenDie verbindende Kultur – enger zusammenrückenKonflikte (auseinanderdriften)Kultur und KonflikteTeil 5: Drei weitere Formen14 Die divisionale FormNach außen expandieren, nach innen akquirierenPhasen im Übergang zur divisionalen FormDie grundlegende divisionale StrukturDie zur programmierten Maschine getriebenen EinheitenDie Nachteile der Konglomerat-GründungDie divisionale Form über Unternehmen hinaus15 Die GemeinschaftDie grundlegende StrukturArten der GemeinschaftDie Vor- und Nachteile der Gemeinschaft16 Die politische ArenaDie Vorteile der politischen ArenaTeil 6: Die Kräfte in allen Formen ins Gleichgewicht bringen17 Ein Loblied auf die AnkerformDie Gefahren der ExzellenzGefahren und Segen der Kontamination18 Ein Hoch auf die HybridformenGemischte Hybride des GanzenKombinierte Hybride in den TeilenKooperation, Wettbewerb und Teilung19 Die Reise durch den Lebenszyklus in allen FormenEin Lebenszyklusmodell der OrganisationsstrukturGeburt: Das Start-up als persönliche UnternehmungJugend: Teilweise Erhaltung der persönlichen UnternehmungReife: Eine natürliche Struktur annehmenDie Mitte des Lebens: Plötzliche ÜbergängeÄlter werden: Sich erneuern, um zu überlebenUntergang: Natürlich oder politischTeil 7: Organisationen über die sieben Formen hinaus20 Outward-bound-OrganisationenBeschränkt durch Diversifikation und vertikale IntegrationExternes NetzwerkenOutsourcingPartnerschaften als Joint VenturesSchaffung einer Plattform für andereSich zusammenschließen für einen gemeinsamen ZweckSich an einen Tisch setzenDie Outward-bound-Formen21 Öffnung des OrganisationsdesignsStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6246-4
Bestell-Nr. 12057-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6247-1
Bestell-Nr. 12057-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6248-8
Bestell-Nr. 12057-0150
Henry Mintzberg/Jana Fritz/Britta Radonić
Organisationen endlich verstehen
1. Auflage, Januar 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Aus dem Englischen von Jana Fritz und Britta Radonić
Lektorat: Jana Fritz – TEXTECHT, Stuttgart
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Für Dulcie … endlich zusammen!
Vorwort
1979 habe ich The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research verfasst, insgesamt 512 klein bedruckte Seiten. Von all meinen Büchern gefällt mir dieses am besten; es ist flüssig und stringent geschrieben. Es war auch mein erfolgreichstes Buch, insbesondere in der gekürzten Fassung von 1983, Structure in Fives, 312 Seiten lang und etwas größer gedruckt.
Die vorliegende Ausgabe stellt eine Überarbeitung und Aktualisierung des Buches dar und ist weniger als Synthese organisationswissenschaftlicher Forschung zu verstehen als vielmehr als Zusammenfassung meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Organisationen. 1979 war es notwendig, die veröffentlichten Forschungsergebnisse zusammenzuführen, da es unheimlich viel Literatur zu diesem Thema gab, allerdings verstreut. Meine Bücher haben sie zusammengeführt. Nach wie vor besteht jedoch – sowohl in der Praxis als auch in der Lehre – das Bedürfnis nach einem umfassenderen Verständnis von Organisationen, die so wesentlich für fast alles sind, was wir tun.
Deshalb versuche ich hier, auf der Grundlage von Structure in Fives ein halbes Jahrhundert an Erfahrungen zusammenzutragen – sowohl meine eigenen als auch alles, was ich sonst finden konnte –, und Organisationen diesmal in sieben Formen zu unterteilen mit dem Ziel, Organisationen endlich zu verstehen!
Einsiedler können das Buch an dieser Stelle zur Seite legen, ebenso wie Pedantinnen, denn diese Fassung enthält weniger Referenzen als meine bisherigen Veröffentlichungen, und ich entschuldige mich nicht für die vielen Bezüge, die schon älter sind. Gute Erkenntnisse überdauern die Zeit ebenso wie guter Wein. Und ebenso wie gute Geschichten, von denen Sie in diesem Buch viele lesen werden – alte wie neue.
Ich gelte vielleicht eher als Managementtheoretiker, aber eigentlich bin ich Organisationstheoretiker. Fast mein ganzes Leben habe ich dem Versuch gewidmet, diese seltsamen Wesen besser zu verstehen. Wie ein guter Schachspieler von einem Spiel zum nächsten gehen kann und dabei die Situation auf dem Brett schnell erfasst, so habe ich aufgrund der vielen, vielen Jahre, die ich Organisationen beobachtet, beraten und erlebt habe, das Gefühl, sie instinktiv erfassen zu können: ihre Kultur, ihren Zustand, ja beinahe ihren Geruch. Überlegen Sie nur einmal, wie viele Erfahrungen und Geschichten sich im Laufe eines halben Jahrhunderts ansammeln können. Es soll eine Figur in einem Science-Fiction-Roman geben, die jedes Mal verrückt wird, wenn sie an gemähtem Gras vorbeikommt, weil sie es schreien hören kann. Keine Sorge, ich werde nicht verrückt, doch wenn ich mich Organisationen nähere, höre ich die Schreie – ob nun aus Freude oder Verzweiflung.
Bücher werden von Individuen geschrieben, aber immer mit Unterstützung von Organisationen (wie beinahe alles heutzutage). Deshalb gilt mein besonderer Dank der McGill University für ihre Unterstützung, ebenso unserer derzeitigen Dekanin Yolande Chan sowie Berrett-Koehler für ihr großes Engagement und insbesondere Neal Maillet, der mir als Partner bei diesem Buch zur Seite stand, so wie Steve Piersanti das bei allen bisherigen getan hat.
Auch andere Menschen haben mir sehr geholfen und viel Herzblut in dieses Buch gesteckt: Dulcie Naimer, die so viel beigesteuert hat – persönlich wie inhaltlich; Santa Balanca-Rodrigues, die mich seit mehr als 20 Jahren als Assistentin begleitet und jeden Tag besser wird; Jeremiah Lee, der dem Buch früh seine Richtung gegeben hat; Jeff Kulick, der beste Lektor, den man sich vorstellen kann; Alex Anderson, dessen Akribie und Sorgfalt meinen Mangel an Genauigkeit wettgemacht haben; Charles Marful, der mich davor bewahrt hat, die Kapitel 2 bis 6 zu verhunzen; Lars Groth, dank dessen detailliertem Feedback ich so manches Durcheinander aufräumen konnte, und Saku Mantere, dessen Unterstützung bei Kapitel 20 Gold wert war. Zudem danke ich David Peattie und Ashley Ingram für ihre hervorragende Arbeit in der Herstellung, Amy Smith Bell für ihr feinfühliges Lektorat, Susan Mintzberg für ihr inoffizielles Lektorat, Dave Dudley für seine tollen Grafiken sowie Hanieh Mohammadi, Karl Moore und P. D. Jose für ihre anderweitige konkrete Unterstützung.
1 Unsere Welt der Organisationen
Mit wie vielen Organisationen werden Sie heute in Kontakt kommen? Sind zehn übertrieben? Beginnen wir am Morgen: Als Erstes checken Sie Ihre Mails. Möglich machen das ein Handyhersteller und ein Internetanbieter. Für Ihr Frühstück sorgen Landwirte, Fabriken und Lebensmittelgeschäfte sowie Fluggesellschaften und Lkw-Fahrer. Dann machen Sie sich auf den Weg zur Arbeit in ein Unternehmen, eine staatliche Behörde oder eine Nichtregierungsorganisation (NGO) oder vielleicht zum Studium an eine Hochschule – entweder mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit Ihrem eigenen Fahrzeug, und das auf einer Straße, die von der Polizei kontrolliert und von der Stadt instand gehalten wird. Nachdem Sie in der Cafeteria zu Mittag gegessen haben, gehen Sie vielleicht zur Bank oder zum Training ins Fitnessstudio. Wieder zu Hause schlagen Sie mithilfe von Google etwas auf Wikipedia nach und sehen sich dann die Nachrichten im Fernsehen an, bevor Sie schließlich zu diesem Buch greifen, das von einem Verlag veröffentlicht wurde (und von einem Autor verfasst; ich bin allerdings keine Organisation). Ich habe mindestens 15 Organisationen gezählt. Wie viele habe ich vergessen?
Wir leben in einer Welt der Organisationen – von unserer Geburt im Krankenhaus bis zu unserem Begräbnis durch ein Bestattungsinstitut. In der Zeit dazwischen werden wir von Organisationen ausgebildet, beschäftigt, unterhalten und zur Verzweiflung gebracht. Doch was verstehen wir wirklich von ihnen?
Wenn Sie mehr über sich erfahren möchten – über Ihre Persönlichkeit, Ihre Ängste und was auch immer –, müssen Sie nur in eine Buchhandlung gehen und können dort aus Dutzenden von Ratgebern auswählen. Wenn Sie sich Sorgen über die Wirtschaft machen, können Sie unzählige politische Blogs lesen, um sich zu informieren. Doch wo auf dem Weg von unserer kleinen privaten Welt in die große Welt der Makroökonomie erfahren wir etwas darüber, wie diese sozialen Gebilde namens Organisationen funktionieren? (Übrigens: Die wichtigsten Punkte in diesem Buch sind gefettet.)
Willkommen bei Organisationen endlich verstehen.
Was ist überhaupt eine Organisation?
Stellen Sie sich vor, eine Siebenjährige fragt Sie: »Was sind eigentlich diese ›Organisationen‹, von denen du die ganze Zeit sprichst? Was ist eigentlich Google? Und wie kann eine Organisation ein Apfel sein?« Was antworten Sie? Dass es sich dabei um ein Gebäude handelt? Ein Logo auf den Gehaltsabrechnungen von Leuten, die man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennt? Einen ganzen Apfel kann man sich im Supermarkt ansehen, aber wo kann man hingehen, um sich das ganze Apple anzusehen? Alle Siebenjährigen und Erwachsenen, willkommen in der schwammigen Welt der Organisationen.
Einige Definitionen
Lassen Sie uns kurz etwas formaler werden, bevor wir weitermachen:
Eine Organisation lässt sich definieren als gemeinschaftliche, strukturierte Aktion, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Oder für Siebenjährige und Ältere ausgedrückt: Eine Gruppe von Menschen arbeitet gemeinsam in einem formalisierten Rahmen, um etwas zu erreichen. Und die Struktur einer Organisation lässt sich definieren als Muster von Beziehungen, die so gestaltet sind, dass die Akteure diese Aktion gemeinsam ausüben können.
Beginnen wir mit dem großen Ganzen: der schieren Bandbreite an Organisationen. Abbildung 1 stellt Organisationen nach Sektoren dar: öffentlicher Sektoröffentlicher Sektor (Staat), privater Sektorprivater Sektor (Unternehmen) und Nonprofit-SektorNonprofit-Sektor (hier sind die meisten Organisationen entweder genossenschaftlich organisiert und im Besitz ihrer Mitglieder, zum Beispiel Genossenschaften, oder sie haben keine Eigentümer, wie es bei Wohltätigkeitsverbänden, NGOs und privaten Universitäten der Fall ist).1 Viele dieser Organisationen sind Ihnen wahrscheinlich bereits ein Begriff; hier sind sie alle einmal versammelt:
Abb. 1:
Unsere Welt der Organisationen
Die schlechteste aller Organisationsformen
1911 veröffentlichte Frederick Taylor sein Buch Principles of Scientific Management, in dem er einen besten Weg (auch bekannt als »one best way«) vorstellte, die Arbeit in Organisationen zu strukturieren.2 Was er vorschlug, ist heute größtenteils vergessen, nämlich die Arbeiter während ihrer Tätigkeit mit der Stoppuhr zu messen und jedes Detail ihrer Tätigkeit genauestens zu analysieren – und sie dabei als Hände ohne Köpfe zu betrachten. Nicht in Vergessenheit geraten ist dagegen der Gedanke, dass es immer einen besten Weg gibt – ob für Werkstätten, Automobilunternehmen, Lebensmitteltafeln oder Massentierhaltungsbetriebe (ich sage nur: strategische Planung). Die Überzeugung, dass es einen besten Weg gibt, Organisationen zu strukturieren, ist jedoch die schlechteste Art und Weise, sie zu steuern. Denn Organisationen sind sehr verschieden. Vielleicht ist Ihnen zum Beispiel aufgefallen, dass ein Symphonieorchester anders tickt als eine Fabrik. Das haben allerdings noch nicht alle verstanden (siehe Kasten).
Ein effizientes Orchester
Ein junger Student einer Business School erhielt endlich Gelegenheit, das anzuwenden, was er gelernt hatte: Seine Aufgabe bestand darin, eine Organisation auszuwählen, mit der er nicht vertraut war, sich intensiv mit ihr zu beschäftigen und Vorschläge zur Effizienzsteigerung zu machen. Er entschied sich für ein Symphonieorchester, besuchte sein allererstes Konzert und erstellte folgende Analyse:
Über lange Phasen hatten die vier Oboe-Spielerinnen und -Spieler nichts zu tun. Die Anzahl der Oboen sollte deshalb reduziert und die Arbeit gleichmäßiger über die gesamte Konzertlänge verteilt werden, um die Aktivitätsspitzen und -täler zu beseitigen.
Alle 20 Violinistinnen und Violinisten spielten die gleichen Noten. Das scheint eine unnötige Doppelarbeit darzustellen, weshalb das Personal in diesem Bereich drastisch gekürzt werden sollte.
Veraltete Geräte sind ein weiterer Punkt, der genauerer Untersuchung bedarf. Dem Programmheft zufolge war das Instrument des ersten Geigers mehrere 100 Jahre alt. Bei Einhaltung normaler Abschreibungspläne läge der Wert des Instruments heute bei null, und es wäre schon längst die Empfehlung ausgesprochen worden, modernere Geräte anzuschaffen.
Viel Aufwand floss in das Spielen von Zweiunddreißigstelnoten, was eine unnötige Veredelung darzustellen scheint. Es wird empfohlen, alle Noten auf die nächstgrößere Sechzehntelnote aufzurunden. Infolgedessen könnten in größerem Umfang Trainees und geringer qualifizierte Arbeitskräfte eingesetzt werden.
Schließlich entstand der Eindruck einer zu häufigen Wiederholung bestimmter Passagen. Die Partituren sollten deshalb erheblich gekürzt werden. Es dient keinem nützlichen Zweck, dass die Hörner etwas wiederholen, das die Streicher bereits gespielt haben. Es wird geschätzt, dass bei Streichung aller redundanten Passagen die Gesamtspielzeit von zwei Stunden auf 20 Minuten reduziert werden kann. Dann wäre auch keine Pause nötig.3
Lustig, nicht wahr? Doch was wäre, wenn der Student anstelle des Orchesters eine Fabrik ausgewählt hätte? Dann wäre niemandem zum Lachen zumute, am allerwenigsten den Arbeiterinnen und Arbeitern. Diese Geschichte ist natürlich erfunden – allerdings nur in Bezug auf ihren Kontext. Es gibt unzählige solcher Geschichten. Einer Professorin der Harvard Business School gefiel es zum Beispiel, Krankenhäuser als »fokussierte Fabriken« zu bezeichnen.4 Aber mal Hand aufs Herz: Möchten Sie dort wirklich Ihr Kind zur Welt bringen? Und was ist mit den vielen Politikerinnen und Politikern, die der Meinung sind, dass der Staat wie ein Unternehmen geführt werden sollte? Sollten andersherum Unternehmen wie Staaten geführt werden? Und sollte Fußball in Europa mit der Ausrüstung des nordamerikanischen Footballs gespielt werden?5
Die größte, die größenwahnsinnigste, die kleinste und die merkwürdigste Organisation
Was ist die größte Organisation, die Ihnen einfällt? Meine Kandidatin ist nicht wirklich die größte, sondern eher die größenwahnsinnigste: Der britische National Health Service (NHS)National Health Service (NHS) rühmt sich seiner Größe und behauptet, nur die Rote Armee Chinas, Walmart und das Bahnnetz Indiens seien noch größer. Was für eine Messlatte! Doch ist das wirklich die Geisteshaltung, die Sie sich von einem Arzt wünschen, der Ihr Baby zur Welt bringt?
Welches ist die kleinste Organisation? Das habe ich früh herausgefunden, als ich für eine kleine Etiketten- und Aufkleberfirma arbeitete. Dort gab es zwei Manager: einen für die Produktion und einen für den Vertrieb. Sie wunderten sich, warum die Auftragszettel so lange brauchten, bis sie in der Produktion landeten, also analysierte ich den Prozess – ein bisschen wie Taylor. Ein Auftragszettel lag so lange auf dem Schreibtisch des eines Managers, bis dieser ihn unterschrieben hatte, und dann so lange auf dem Schreibtisch des anderen, bis dieser ihn ebenfalls unterschrieben hatte, nur um dann wieder an den ersten Manager zurückzugehen. Die Moral von der Geschicht’: Zwei Manager genügen bereits, um ein bürokratisches System zu schaffen.
Was ist die merkwürdigste Organisation, die Ihnen einfällt? Wie wäre es mit der Paperweight Collectors Association oder der Association of Association Executives? Vor einigen Jahren bin ich auf die Flying Funeral Directors of America gestoßen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, »ein allgemeines Interesse für das Fliegen und für Bestattungsdienste zu schaffen und dieses zu fördern, sich zum Zweck der Katastrophenbewältigung zusammenzuschließen und die Sicherheit beim Fliegen zu erhöhen«.6 Das nenne ich mal eine Mission: Sie konnten sich nicht entscheiden, ob sie die Passagiere beerdigen oder retten wollten.
Und welches ist die am weitesten verbreitete Organisation? Restaurants vielleicht. Wahrscheinlich gibt es bei Ihnen gleich um die Ecke eins. Doch überlegen Sie einmal, wie stark sich selbst Restaurants unterscheiden: von der Imbissbude um die Ecke über Fast-Food-Ketten bis hin zu Gourmetrestaurants und Cateringdiensten. Wir können genauso wenig einen besten Weg finden, sie alle zu strukturieren, wie wir einen besten Koch finden können, der in allen von ihnen Gerichte zubereitet.
Keine gemeinsame Sprache
Zwei kanadische Biologen treffen sich, um sich über ihre Forschungen auszutauschen. Der eine hat Bären untersucht, der andere Biber. Gehen wir jedoch einmal davon aus, dass sie keine Begriffe für diese unterschiedlichen Tierarten haben. Sie kennen lediglich das Wort Säugetier, ähnlich wie wir das Wort Organisationen verwenden. Sie diskutieren darüber, wo ein Säugetier am besten überwintert.
»Natürlich in einer Höhle«, sagt der Bärenspezialist.
»Machst du Witze?«, entgegnet der Biberexperte. »Dann kommen ihre Fressfeinde rein und nehmen sie sich zur Beute. Sie müssen eine Struktur aus Holz am Ufer eines Sees bauen, damit sie dort sicher schwimmen können.«
»Jetzt machst du aber Witze«, erwidert der Bärenspezialist scharf. »Säugetiere haben keine Fressfeinde!«
Sie reden aneinander vorbei, weil ihr Wortschatz begrenzt ist, genauso wie wir aneinander vorbeireden, weil uns die Begriffe fehlen, um über verschiedene Arten von Organisationen zu sprechen. Deshalb werden Orchester mit Fabriken verwechselt. Unser Fressfeind heißt Ignoranz: Er verspeist unsere Organisationen, indem er ihre Unterschiede ignoriert. Dieses Buch möchte Ihnen das nötige Vokabular liefern, um diesen Zustand zu überwinden.
Von fünf zu sieben (und darüber hinaus)
1983 veröffentlichte ich Structure in Fives, eine gekürzte Fassung von The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research, das 1979 erschienen war.7 Vor Kurzem hatte ich das Bedürfnis, das Werk zu überarbeiten, sozusagen als Synthese meiner rund fünfzigjährigen Erfahrung mit Organisationen. Dabei geht es mir insbesondere darum, die fünf Grundformen, die die Ausgangsbasis des damaligen Buches bildeten, auf sieben zu erweitern und sieben Kräfte vorzustellen, die die Struktur der jeweiligen Organisation bestimmen (siehe Kasten).
Die magische Zahl Sieben
Laut dem Dictionnaire des Symboles ist »Fünf die Zahl der Mitte, der Harmonie und des Gleichgewichts«.8 Das mag stimmen. Doch Sieben ist die Zahl der »Vollkommenheit«, sie symbolisiert die »menschliche Ganzheit«, also die Vollendung. Warum nehmen wir hier also nicht die Sieben?
In seinem berühmten Artikel »The Magic Number Seven, Plus or Minus Two« stellt der Psychologe George Miller die These auf, dass wir Dinge gerne in sieben Kategorien einteilen (die sieben Weltwunder, sieben Wochentage etc.), weil das der Menge an Informationseinheiten entspricht, die wir in unserem Kurzzeit- und mittelfristigen Gedächtnis abspeichern können.9 Man spricht hier auch von der Millerschen Zahl. »Die drei Weltwunder« klänge ein bisschen mickrig, während zwölf wiederum ein wenig einschüchternd wäre. Warum also nicht sieben für unsere Welt der Organisationen? Schließlich möchte ich Sie als Leserin oder Leser genauso wenig überfordern wie mich als Autor (zumindest, bis wir zu Kapitel 17 kommen).
Als ich begann, dieses Buch zu schreiben, unterhielt ich mich mit Jeremiah Lee, einem befreundeten Berater aus Boston, der meine Arbeit gut kennt. Er stellte mir eine Frage, die diesem Buch eine neue Richtung geben sollte. Da ich einige meiner bisherigen Bücher als Synthese verfasst hatte (über Strategie, Management und eine ausbalancierte Gesellschaft), schlug er vor, ich könnte doch eine Synthese dieser Synthesen anfertigen.10 Deshalb entschied ich mich, (a) den Titel dieses Buches in Organisationen endlich verstehen umzubenennen, (b) Management, Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung mit den zentralen Fragen der Organisationsgestaltung zu verbinden und (c) all das in einem flotteren Stil zu präsentieren, um alle anzusprechen, die Organisationen besser verstehen wollen. (Wie gelingt mir das bislang?)
Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, besteht dieses Buch aus sieben Teilen. Nach »Organisationen neu betrachtet« in Teil 1, in dem wir uns Organisationen genauer ansehen, einschließlich dahingehend, wie sie Kunst, Handwerk und Wissenschaft zur Entscheidungsfindung, Strategieentwicklung und Managementpraxis nutzen, stelle ich in Teil 2 die Grundbausteine des Organisationsdesigns vor, die Teil 3 dann zu vier Grundformen von Organisationen (persönlich, programmiert, professionell und projektbasiert) zusammenführt. Sie stellen den Kern dieses Buches dar.
Neben einem Set an Formen müssen wir uns die Organisationsgestaltung wie ein Netz aus Kräften vorstellen. Deshalb stelle ich in Teil 4 vier zentrale Kräfte (Konsolidierung, Effizienz, Kompetenz und Kollaboration) vor, die jeweils in einer der vier Grundformen maßgeblich wirken. Hinzu kommen drei weitere Kräfte, die in allen Formen vorkommen können (Separierung, verbindende Kultur und Konflikte). Diese drei Kräfte bedingen weitere Formen (divisionale Form, Gemeinschaft und politische Arena), die ich in Teil 5 beschreibe. Summa summarum macht das sieben Formen und sieben Kräfte.
In Teil 6 webe ich diese Kräfte durch die verschiedenen Organisationsformen und erläutere, wie sie die jeweilige Form auf feste Füße stellen, damit sie nicht ins Wanken gerät. Ich schaffe Mischformen und zeige, wie Organisationen ihre Form im Laufe ihres Bestehens ändern können.
In Teil 7 beschließe ich das Buch, indem ich es öffne und über die sieben Formen hinausgehe. Ich zeige, wie Organisationen erstens ihre Grenzen öffnen und sich nach außen orientieren und wie zweitens der Prozess der Organisationsstrukturierung für Design Doing geöffnet werden kann.
Einsiedler müssen Organisationen nicht verstehen, der Rest von uns aber schon – zumindest, wenn wir sie konstruktiv nutzen wollen. Was sind diese Wesen? Wie funktionieren sie? Wie können wir dafür sorgen, dass sie besser funktionieren? Diese Antworten sind wichtig, denn sobald Sie dieses Buch aus der Hand legen, warten Bären, Biber und andere Wesen der Organisationswelt auf Sie. Doch keine Angst: Hilfe naht!
1 Vgl. Henry Mintzberg: Time for the Plural Sector. In: Stanford Social Innovation Review 13, 3/2015, S. 28–33.
2 Frederick Taylor: Principles of Scientific Management, 1911. »Now, among the various methods and implements used in each element of each trade there is always one method and one implement which is quicker and better than any of the rest. And, this one best method and best implement can only be discovered and developed through a scientific study and analysis of all the methods and implements in use, together with accurate, minute, motion and time study.« (S. 25).
3 Mitte der 1950-Jahre im Rundschreiben eines US-amerikanischen Professors, einer kanadischen Militärzeitung und im Harper’s Magazine veröffentlicht, wahrscheinlich basierend auf einem anonymen, sich in London im Umlauf befindenden Memorandums, das ursprünglich in Her Majesty’s Treasury of the Courts erschien.
4 Regina E. Herzlingler: Why Innovation in Health Care Is So Hard. In: Harvard Business Review 84, 5/2006, S. 58–66.
5 Nordamerikanisch wohlgemerkt, nicht US-amerikanisch, denn die Sportart wurde an meiner eigenen Universität, McGill in Kanada, erfunden. Vgl. Montgomery, Marc: May 14, 1874. How Canada Created American Football. Radio Canada International, 4. Mai, 2015.
6 Flying Funeral Directors of America. In: The Encyclopaedia of Associations, Gale Directory Library, 1979.
7 Henry Mintzberg: Structure in Fives: Designing Effective Organizations, 1983; Henry Mintzberg: The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research, 1979.
8 Jean Chevalier und Alain Gheenbrant: Dictionnaire des Symboles, 1982.
9 Vgl. George A. Miller: The Magic Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. In: Psychological Review 63/1956, S. 81–97.
10 Vgl. Mintzberg: Structuring of Organizations; Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, und Joe Lampel: Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management, 2009; Henry Mintzberg: Simply Managing, 2013; Henry Mintzberg: Rebalancing Society: Radical Renewal beyond Left, Right, and Center, 2015.
Teil 1: Organisationen neu betrachtet
Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Organisation und bitten die Verantwortlichen, ein Bild von dieser sehen zu können. Mit großer Wahrscheinlichkeit zeigt man Ihnen das OrganigrammOrganigramm. Gibt es über diesen Ort nicht mehr zu erzählen, als wer wem übergeordnet ist? Es ist so, als würden Sie Freunde besuchen und das Familienalbum sehen wollen, doch was man Ihnen zeigt, ist der Stammbaum.
Es ist Zeit, unsere Organisationen neu zu betrachten. Kapitel 2 setzt sich mit den Akteuren in Organisationen auseinander und der Frage, wo diese wirken. In Kapitel 3 nutze ich ein Dreieck aus Kunst, Handwerk und Wissenschaft, um zu zeigen, auf wie vielfältige Weise in Organisationen Entscheidungen getroffen, Strategien entwickelt und Führung umgesetzt wird.
2 Die Akteure und die Teile
Vor einigen Jahren erschien eine Werbeanzeige eines Softwareunternehmens, die eine Zeichnung ähnlich wie die hier abgebildete enthielt. Sie behauptete, dass es sich dabei nicht um eine Kuh handele, sondern um eine Grafik, die die Teile einer Kuh darstellt. In einer gesunden Kuh wüssten die Teile nicht einmal, dass sie Teile sind; sie arbeiten einfach harmonisch zusammen. Die Anzeige fragte den Betrachter: Möchten Sie, dass Ihre Organisation wie ein Diagramm oder wie eine Kuh funktioniert?11
Das ist eine ernsthafte Frage! Kühe haben kein Problem damit, wie Kühe zu funktionieren, genauso wenig wie wir kein Problem damit haben, wie Individuen zu funktionieren, zumindest psychologisch gesehen. Warum fällt es uns dann so schwer, miteinander zu arbeiten? Liegt es daran, dass wir so sehr auf diese Diagramme fixiert sind?
11 Das Unternehmen möchte nicht namentlich genannt werden, da es seine Werbung geändert hat. Die Anzeige wurde von Anderson & Lembke aus New York entwickelt.
»Out of the box« denken
Wir sprechen immerzu davon, »out of the boxOut-of-the-box-Denken« zu denken, befinden uns jedoch innerhalb unserer Box, insbesondere im Organigramm (siehe Abbildung 2). (Die Formulierung tauchte das erste Mal im 18. Jahrhundert auf und verbreitet sich seitdem unaufhaltsam.)
Abb. 2:
Eine Organisationsstruktur
Ist das Organigramm die Organisation? Und ihr Skelett die Kuh? Sind die Kästchen des Organigramms die Führungskräfte der Organisation und die Linien zwischen ihnen ihre Unterhaltungen? Oder pferchen uns diese Kästchen einfach nur ein?
Das Organigramm hat natürlich seine Berechtigung. Wie eine Landkarte, die Städte verzeichnet und die Straßen, die diese miteinander verbinden, zeigt uns das Organigramm, wie die Teile und Personen zu Einheiten zusammengefügt werden und wie diese durch Weisungsbefugnisse miteinander verbunden sind – wer also an wen berichtet und mit welchem Titel. Doch wie eine Landkarte uns nichts über die Wirtschaft oder Gesellschaft des Ortes sagt, so sagt uns ein Organigramm nichts über die Dinge, die in der Organisation vor sich gehen, geschweige denn warum. Mitunter kann man aus dem Organigramm noch nicht einmal ablesen, womit die Organisation ihr Geld verdient. Was es uns dagegen verrät, ist Folgendes: Wir sind besessen von Autorität uns lassen uns von Status verführen: Wer steht über wem und all das (siehe Kasten).
»On top« wovon?
Die BegriffeTopmanagement »Topmanagement« und »Unternehmensspitze« verwenden wir eher beiläufig. Aber »on top« oder »an der Spitze« wovon? An der Spitze des Organigramms natürlich, auch an der Spitze der Gehaltsskala, vielleicht sogar an der Spitze des Hauptsitzes. Doch versetzt einen Chef die Tatsache, dass er sich an der Spitze einer Organisation sieht, auch in die Lage zu wissen, was in der Organisation vor sich geht? Kaum, wenn man alles andere als einem unterstellt betrachtet.
Unterhalb des Topmanagements befindet sich das Mittelmanagement. Es ist zweifelsohne in der MitteMittelmanagement des Organigramms angesiedelt, aber ist es auch mittelmäßig darüber im Bilde, was in der Organisation vor sich geht? Es gibt mittlere Führungskräfte, die Informationen einfach nach unten oder oben durchreichen, während es anderen gelingt, die Aktivitäten auf der unteren Ebene (der »Basis«) mit dem abstrakten Geschehen an der Spitze zu verbinden. Vielleicht sollten wir diese Personen dann eher Verbindungsmanager nennen?
Und was ist mit demBasismanagementBasismanagement? Haben Sie schon einmal davon gehört? Wenn es Topmanager und Mittelmanager gibt, muss es doch auch Basismanager geben, oder nicht? Selbst wenn Organisationen diesen Begriff nicht verwenden, wissen die entsprechenden Personen doch genau, wo sie sich im Organigramm befinden – und hoffentlich auch in der Organisation.
Wenn Sie diese Verzerrungen in Ihrer Organisation beseitigen möchten, schlage ich vor, dass Sie den Begriff »Topmanagement« so lange aus Ihrem Wortschatz verbannen, bis Sie bereit sind, den Begriff »BasismanagementBasismanagement« zu verwenden.
Abb. 3:
Eine Umstrukturierung
Und hier eine weitere Umstrukturierung: Betrachten Sie einmal Abbildung 3, und vergleichen Sie sie mit Abbildung 2. Sie stellt eine Umstrukturierung dar. Erkennen Sie den Unterschied? Die Führungskräfte, die neu im Organigramm verteilt wurden, sicherlich. Jede von ihnen hat nun einen neuen Titel oder einen neuen »Vorgesetzten« oder neue »Untergebene« (was für furchtbare Begriffe). Eine Organisation muss doch mehr sein als all diese Label und Herumkommandiererei! Wenn man es erst sehen muss, um es zu glauben, sollten wir unsere Organisationen dringend mit anderen Augen betrachten.
Umstrukturierungen sind so beliebt, weil sie einfach sind. Alles, was Sie dazu brauchen, sind Stift und Papier, am besten einen Bleistift mit einem guten Radiergummi oder einen Bildschirm mit einer großen LÖSCHEN-Taste: Hier kommt die Buchhaltung hin, hier das Marketing usw. Travis wird Verkehrsminister, Daphne Verteidigungsministerin. Dann werden sie alle losgeschickt … hinein ins vollkommene Chaos. »Wir haben hart trainiert, aber jedes Mal, wenn wir gerade ein Team bilden wollten, schien man uns umstrukturieren zu wollen. Erst als ich älter war, habe ich verstanden, dass wir jeder neuen Situation mit einer Umstrukturierung begegnen. Und es ist ja auch eine wunderbare Methode, um den Eindruck von Fortschritt zu erwecken, während man eigentlich Chaos, Ineffizienz und Demotivation produziert.« (Diese Aussage wird gewöhnlich dem römischen Marinesoldaten Petronius Arbiter 250 v. Chr. zugeschrieben, stammt aber scheinbar aus der Zeit um 1948.)
Stellen Sie sich dagegen eine architektonische Umstrukturierung vor, die neu ordnet, wo die Leute sitzen. Das mag aufwendiger sein, zumindest für die Organisationsdesigner, kann jedoch allen anderen die Arbeit erleichtern: Plötzlich sitzt Enid aus dem Ingenieursteam neben Max aus dem Marketing. Anstatt sich wie gewohnt übereinander zu beschweren, reden sie nun miteinander – zumindest am Kaffeeautomaten. Kein Chef weit und breit. Das nenne ich eine Umstrukturierung!
Die wichtigsten Akteure
Kühe bestehen aus echten Körperteilen wie Lunge, Leber, Gehirn und Darm. Diese verrichten echte Dinge (im Vergleich zu einem Lendensteak, das nichts für die Kuh tut, außer ihr Leben zu beenden). Ebenso bestehen Organisationen aus echten Teilen, mit Akteuren, die echte Dinge tun. Hier die wichtigsten im Überblick:
Die operativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die grundlegenden operativen Aufgaben in der Organisation zuständig: Produktherstellung, Kundenservice und alles, was diese Aufgaben direkt unterstützt. In einem Eishockeyteamoperative Mitarbeiter schießen sie die Tore, wehren Angriffe ab und halten die Ausrüstung instand. In einem Restaurant servieren sie die Lendensteaks und parken die Passats. In einem Fertigungsbetrieb sind sie die Einkäuferinnen, Maschinenführer, Vertriebsprofis usw.
Der Hilfsstab unterstützt den Betrieb indirekt. ErHilfsstab entwickelt das Informationssystem, übernimmt rechtliche Aufgaben und empfängt Gäste an der Rezeption. Zählen Sie einmal all die Unterstützungsdienste an einer Universität: Bibliotheken, Stellenvermittlung, Gehaltsabrechnung, Unterkünfte, Alumni-Netzwerk, Personal, Fakultätsklub etc. Es sind so viele, dass man sich fragt, ob es überhaupt noch Platz für die Professorinnen und Professoren gibt. (Mit »Stab« bezeichnet man mitunter auch eine Gruppe von operativen Mitarbeitern, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder an einer Universität (Stabsabteilung). Manchmal findet man den Begriff auch im gehobenen Management, etwa beim Stabschef im Militär.)
Die Analytikerinnen und Analytiker nutzen Analysen, um die Aktivitäten der Organisation zu steuern und anzupassen. Sie planen, terminieren, messen und budgetieren die Aktivitäten und schulen manchmal die Personen, die die Aktivitäten ausführen – sie führen sie jedoch nicht selbst aus. Zusammengenommen werden sie mitunter als Technostruktur der Organisation bezeichnet. Wie wir noch sehen werden, verfügen manche Organisationen über gar keine AnalytikerAnalytiker und keinen Hilfsstab, während andere unzählige davon haben.
Die Managerinnen und Manager überwachen all diese Aktivitäten und haben formal die Verantwortung für eine bestimmte Einheit in der Organisation oder für die gesamte Organisation. EineManagerEinheit ist ein Teil der Organisation, der durch seine formale Struktur bestimmt ist: die Notaufnahme in einem Krankenhaus, die Konditorei in einem Restaurantbetrieb, die erste Angriffslinie im Eishockey. Selbst in den kleinsten Organisationen werden diese EinheitenEinheiten im Organigramm dargestellt und bilden übereinander angeordnet die offizielle Befehlshierarchie der OrganisationBefehlshierarchie. Soldaten sind nach diesem Prinzip in Gruppen unterteilt, Gruppen in Züge, und nach oben setzt sich die Struktur fort als Kompanien, Bataillone, Brigaden und Divisionen, bis diese letztlich die Armee bilden. Jede Einheit hat ihren eigenen Manager – vom Unteroffizier bis zum General. Anderswo finden wir Managerinnen und Manager mit Titeln wie »Trainer« (Eishockey), »Bischof« (Kirche) oder »Regisseur« (Film). Manager, die für ein ganzes Unternehmen verantwortlich sind, werden in der Regel »Chief Executive Officer« (CEO) oder »Geschäftsführer« genannt. An sie berichten die anderen Mitglieder der C-Suite: der COO (Operatives), die CFO (Finanzen) und der CLO (Weiterbildung) usw. Mittlerweile ahmen immer mehr Organisationen Unternehmen nach und vergeben ebenfalls den Titel »CEO«. (Zumindest das Oberhaupt der katholischen Kirche heißt aber immer noch »Papst«.) Neben der Überwachung der Arbeit ihrer Einheit haben Managerinnen und Managern die Aufgabe, die Einheiten mit der Außenwelt zu verbinden: Eine Vertriebsleiterin trifft Kunden, der Papst wendet sich an die Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.
Die Kultur ist das System an Überzeugungen, die die Organisation durchziehen. Sie bietet allen Akteuren einen gemeinsamen Rahmen und haucht dem Skelett der Struktur im Idealfall Leben ein. Ebenso wie jeder Mensch eine Persönlichkeit hat, hat jede Organisation eine KulturKultur, Definition, eine Art und Weise, die Dinge zu tun – von eher unbestimmt bis sehr stringent. (Darüber hinaus findet man Kultur in Berufsfeldern wie der Medizin; in Funktionen innerhalb einer Organisation, beispielsweise Vertrieb vs. Marketing; und natürlich in Staaten, etwa Deutschland vs. Italien.) Ed ScheinSchein, Ed beschreibt Kultur seit Langem auf drei Ebenen12: An der Oberfläche befinden sich dieArtefakteArtefakte, die die Organisation bildlich repräsentieren (das Apple-Logo auf einem Laptop, das Kreuz für die katholische Kirche, die Freiheitsstatue für die Vereinigten Staaten). Etwas tiefer liegen dieWertekollektiven Werte, die sich in offiziellen Absichtserklärungen ausdrücken (die Zehn Gebote oder ein Mission Statement). Und auf der untersten Ebene befinden sich die manchmal unbewussten Grundannahmen, die sich in den Verhaltensweisen der Akteure widerspiegeln (Topqualität sicherstellen, Aufgaben schnell erledigen). In gesunden Organisationen manifestieren sich die kollektiven Werte in den GrundannahmenGrundannahmen; dies ist jedoch nicht immer der Fall. Mit Greenwashing bezeichnet man zum Beispiel leere Statements über Umweltverantwortung.
Die externen Einflusspersonen versuchen, das Verhalten der Organisation von außen zu bestimmen. HierzuEinflusspersonen zählen zum Beispiel Gewerkschaften, Gemeinden vor Ort und andere Interessengruppen, die Großunternehmen beeinflussen, sowie die Großunternehmen selbst, die versuchen, in Form von Lobbyarbeit Einfluss auf die Regierung zu nehmen. So betreibt Greenpeace Lobbyarbeit bei den UN-Klimakonferenzen, und die Fans von Flamengo Rio de Janeiro unterstützen ihre Fußballmannschaft. Im Unternehmenskontext werden viele EinflusspersonenStakeholder mittlerweile als Stakeholder bezeichnet, in Abgrenzung zu den Shareholdern, den Aktionären.13 Zusammen bilden alle diese Einflusspersonen eineexterne Koalitionexterne Koalition, die passiv, von einer Gruppe dominiert (bestimmend) oder in mehrere Gruppen unterteilt (gespalten) sein kann.14
Abb. 4:
Die Akteure und die Teile
12 Vgl. Peter Schein und Edgar H. Schein: Organisationskultur und Leadership, 2018.
13 Board Directors, die versuchen, direkten Einfluss auf den oder die CEO zu nehmen, können als Insider bezeichnet werden, während diejenigen, deren Einfluss nicht ganz so unmittelbar ist, Influencer sind. Wenn die Board Directors das Management dagegen beraten oder Mittel für die Organisation beschaffen, handeln sie auch als Hilfsstab. Zum Thema Stakeholder siehe R. Edward Freeman et al.: Stakeholder Theory: The State of the Art, 2010.
14 Vgl. Henry Mintzberg: Power In and Around Organizations, 1983.
Eine frühere Darstellung
Bücher werden linear geschrieben – ein Wort nach dem anderen, von der ersten bis zur letzten Seite. Für ein Tagebuch mag das gut funktionieren, in anderen Büchern aber muss diese lineare Reihenfolge etwas beschreiben, das alles andere als linear ist – hier: das Wesen von Organisationen. Diagramme, Abbildungen und andere Grafiken können uns dabei helfen, indem sie die verflochtene Wirklichkeit illustrieren. Stellen Sie sich also auf viele Abbildungen in diesem Buch ein.
Für die ursprüngliche Fassung dieses Buches habe ich eine Grafik entwickelt, die die Akteure in der Organisation darstellt (Abbildung 4). Die operativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bildeten die Basis, über ihnen befanden sich die Linienmanager – von der unteren über die mittlere bis zur höchsten Ebene (die höchste Ebene nannte ich strategische Spitze) – und seitlich die Analytiker und der Hilfsstab. Später habe ich dieKulturKultur als eine Art Heiligenschein ergänzt und um die Darstellung herumEinflusspersonen die Einflusspersonen. Das Diagramm wurde zu einer Art Logo für das Buch, und die Leserinnen und Leser machten sich einen Spaß daraus zu interpretieren, was sie da genau sahen: eine Lunge, den Kopf einer Fliege, eine Kidneybohne, weibliche Eierstöcke, einen umgedrehten Pilz oder Schlimmeres.
Als ich mit der Arbeit an dieser neuen Fassung begann, erkannte ich jedoch, dass sich die Abbildung zu sehr auf das konventionelle, hierarchische Verständnis von Organisationen stützt. Doch anstatt die Abbildung aus dem Buch zu entfernen, habe ich die Hierarchie aus der Abbildung entfernt. Wie Sie noch sehen werden, gibt es jetzt mehrere Versionen von ihr, die die Verschiedenartigkeit von Organisationen widerspiegeln: Einige ähneln der ursprünglichen Darstellung, andere sind flacher oder runder.
Ketten, Knotenpunkte, Netze und Sets
Sehen wir uns nun einige Verbindungen zwischen den Teilen an – und zwar in Form von KettenKette, KnotenpunktenKnotenpunkt, NetzenNetz und SetsSetKetten, Knotenpunkte, Netze und Sets, um besser zu verstehen, wie die Aktivitäten in einer Organisation fließen oder nicht fließen.
Nehmen wir eine Hochzeit. Das Ereignis selbst ist der Knotenpunkt: Die Gäste kommen von überall an einem zentralen Ort zusammen. Wenn es Zeit fürs Abendessen ist, formen die Gäste am Buffett eine Kette und bewegen sich in einer Reihe von einem Gericht zum nächsten. Dann nehmen sie an einem der Tische Platz, von denen es ein ganzes Set über den Raum verteilt gibt. Wenn dann das Tanzen beginnt, wird der Ort zu einem Netz interaktiver Handlungen: Die Gäste unterhalten und bewegen sich in alle möglichen Richtungen.
Die Organisation als Kette verstehen
Heute werden OrganisationenKette meist als Kette dargestellt, in der die Arbeit in linearer Abfolge verrichtet wird. So werden Fahrzeuge zum Beispiel Teil für Teil zusammengebaut, während sie das Montageband durchlaufen. Oder nehmen Sie das Double Play beim Baseball: vom Shortstop zum Second Baseman zum First Baseman.
Michael PorterPorter, Michael hat dieWertschöpfungsketteWertschöpfungskette als die Methode zum Organisieren von Arbeit eingeführt.15 Ein weiterer gängiger Begriff ist die Lieferkette; sie beschreibt die Logistik in der Organisation. Doch während Bücher linear sein mögen, ist vieles, was in Organisationen geschieht, nicht linear. Vernetzen sich Strategieprofessorinnen und -professoren an Universitäten in irgendeiner Form mit ihren Kollegen aus dem Marketing? Oder die Abteilungen Pädiatrie und Geriatrie in einer Klinik? (Letzteres wäre eine wirklich lange Kette.) Und selbst die Filialen einer Einzelhandelskette: Funktionieren sie wirklich als Kette? Vielleicht, deshalb ist es Zeit, die Kette aufzubrechen – in Knotenpunkte, Netze und Sets.
Die Organisation als Knotenpunkt verstehen
Ein Knotenpunkt ist ein Koordinationszentrum, ein Fokuspunkt der Aktivität. Wir nennen Flughäfen KnotenpunkteKnotenpunkt, wenn dort viele Passagiere umsteigen. Doch eigentlich ist jeder Flughafen ein Knotenpunkt, weil dort Flüge und Passagiere ankommen und abfliegen. Ebenso ist ein Krankenhaus ein Knotenpunkt für die Patienten und das Personal. In Krankenhäusern ist meist sogar jeder Patient ein Knotenpunkt: Die Patienten werden nicht bewegt, sondern die Dienstleistungen kommen zu ihnen: Krankenpflege, medizinische Versorgung, Essen, Sauerstoff. Ähnlich verhält es sich bei der Flugzeugmontage: Es kann einfacher sein, die Teile zum Flugzeug zu bewegen als das Flugzeug zu den Teilen.16 Selbst ein Manager kann als Knotenpunkt fungieren. Beobachten Sie einmal einen Fußballcoach beim Training.
Die Organisation als Netz verstehen
Wenn SieNetz ein Architekturbüro betreten, werden Sie feststellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähnlich wie die tanzenden Gäste auf der Hochzeit auf alle erdenklichen Arten miteinander interagieren – und zwar nicht in der sauberen Reihenfolge einer Kette oder dem konzentrierten Zusammenfluss eines Knotenpunkts. Netze oder Netzwerke sind Bewegungen von Menschen, Informationen und/oder Materialien, die kein festes Ende, keine feste Reihenfolge und kein Zentrum haben.