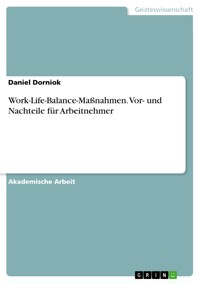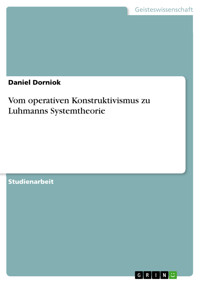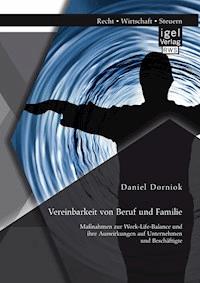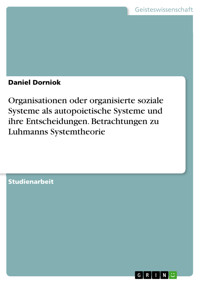
Organisationen oder organisierte soziale Systeme als autopoietische Systeme und ihre Entscheidungen. Betrachtungen zu Luhmanns Systemtheorie E-Book
Daniel Dorniok
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Soziologie - Arbeit, Ausbildung, Organisation, Note: 1.0, Universität Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Arbeit soll zeigen, was nach Luhmanns Systemtheorie Organisationen oder auch organisierte soziale Systeme als autopoietische Systeme erscheinen lässt, welche Theoriebausteine dazu nötig sind, welcher Operationen und Elemente es dazu bedarf und was in diesem Zusammenhang Entscheiden heißt. Zunächst soll in das Thema eingeführt werden, indem gezeigt wird, was soziale Systeme im Allgemeinen als autopoietische Systeme ausmacht und charakterisiert, um dann spezieller Organisationen als autopoietische Systeme zu beobachten. Im weiteren Verlauf werden die wichtigsten Begriffe zur Organisation wie Mitgliedschaft, Entscheidung, Zeit, Unsicherheit, Personal, Technik, Selbstbeschreibung und Rationalität näher beschrieben, um dann abschließend auf das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft einzugehen. Zudem soll gezeigt werden, auf welche Besonderheiten es beim Verhältnis zwischen funktional differenzierter Gesellschaft und organisierten Systemen ankommt. So wie jede Theorie ist auch diese Theorie „nur“ eine Konstruktion. Das Besondere an der Beobachtung des Beobachters Luhmann ist die Umstellung auf Differenz und der damit eingeleitete besondere Umgang mit Paradoxien. Paradoxien bzw. paradoxe Unterscheidungen sind nicht zu umgehen, im Gegenteil sie können sogar Möglichkeiten ermöglichen; im Falle des Systems zum Beispiel durch ein Reentry der Unterscheidung von System und Umwelt in das System und die durch die Orientierung des Systems an dieser Entscheidung mögliche Autopoiesis eben dieses Systems. In dieser Arbeit wird man auf diese Paradoxien stoßen, wobei die Paradoxie der Einheit der Differenz von System und Umwelt – welches „die“ Unterscheidung der Systemtheorie darstellt – also die Welt, allgegenwärtig ist und ausgeblendet wird. Daher wird alle Beobachtung je nach Wahl der Systemreferenz auf System oder Umwelt als „Ort“ der Beobachtung bezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass schon die Wahl der Systemreferenz bereits ein Entscheidungsprozess ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Autopoietische Systeme
3. Die Organisation als autopoietisches System
3.1. Mitgliedschaft und Motive
3.2. Entscheidungen
3.2.1. Die Paradoxie des Entscheidens
3.2.2. Zeitverhältnisse
3.2.3. Unsicherheitsabsorption
3.2.4. Risiko und Entscheidungen
3.2.5. Entscheidungsprämissen
3.2.6. Entscheidungsprogramme
3.2.7. Personal
3.3. Die Organisation der Organisation
3.4. Strukturelle Wandel
3.5. Technik
3.6. Selbstbeschreibung
3.7. Rationalität
4. Organisation und Gesellschaft
Literatur
1. Einleitung
Die folgende Arbeit soll zeigen, was nach Luhmann - in seiner Systemtheorie -Organisationen oder auch organisierte soziale Systeme als autopoietische Systeme erscheinen lassen, welche Theoriebausteine dazu nötig sind, welcher Operationen und Elemente es dazu bedarf und was in diesem Zusammenhang Entscheiden heißt.
Zunächst soll in das Thema eingeführt werden, indem gezeigt wird, was soziale Systeme im Allgemeinen als autopoietische Systeme ausmacht und charakterisiert, um dann spezieller Organisationen als autopoietische Systeme zu beobachten. Im weiteren Verlauf werden die wichtigsten Begriffe zur Organisation wie Mitgliedschaft, Entscheidung, Zeit, Unsicherheit, Personal, Technik, Selbstbeschreibung und Rationalität näher beschrieben, um dann anschließend, abschließend und den Schluss bildend auf das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft einzugehen. Zudem soll gezeigt werden, auf welche Besonderheiten es beim Verhältnis zwischen funktional differenzierter Gesellschaft und organisierten Systemen ankommt. Die Aufteilung dieser Arbeit wurde dabei aus Gründen der Adäquanz des Themas bewusst zum Teil an Luhmanns Einteilung des Themas in „Organisation und Entscheidung“ orientiert.
So wie jede Theorie ist auch diese Theorie „nur“ eine Konstruktion. Das Besondere an der Beobachtung des Beobachters Luhmann ist die Umstellung auf Differenz und der damit eingeleitete besondere Umgang mit Paradoxien. Denn die Theorie selbstreferenzieller autopoietischer Systeme „[...] arbeitet unter der Voraussetzung des Einschlusses des Ausschlusses der Paradoxie.“[1] Und weiter: „Die Paradoxie ist und bleibt ihr Satz vom Grunde, ihr transzendentaler Grundsatz.“[2] Alles Beobachten ist stets paradox, schon die Unterscheidung von System und Umwelt ist paradox, sie setzt sich selbst voraus. In Bezug auf ein System: „Ein System setzt sich selbst voraus, weil/obwohl es sich nicht selbst voraussetzen kann, d.h. A, weil Nicht –A.“[3] Paradoxien bzw. paradoxe Unterscheidungen sind nicht zu umgehen, im Gegenteil sie können sogar Möglichkeiten ermöglichen; im Falle des Systems zum Beispiel durch ein Re-entry der Unterscheidung von System und Umwelt in das System und die durch die Orientierung des Systems an dieser Entscheidung mögliche Autopoiesis eben dieses Systems. In dieser Arbeit wird man auf diese Paradoxien stoßen, wobei die Paradoxie der Einheit der Differenz von System und Umwelt – welches „die“ Unterscheidung der Systemtheorie darstellt – also die Welt, allgegenwärtig ist und ausgeblendet wird. Daher wird alle Beobachtung je nach Wahl der Systemreferenz auf System oder Umwelt als „Ort“ der Beobachtung bezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass schon die Wahl der Systemreferenz bereits zum Entscheidungsprozess gehört. Entscheidungstheorie ist somit zu begreifen als Theorie des selektiven Prozesses, deren Prämissen kontingent auf den Prozess selbst zu sehen sind.[4]
2. Autopoietische Systeme
Nach Luhmann entstehen Systeme über Ausdifferenzierung, sie differenzieren sich von ihrer Umwelt, setzen sich different zur Umwelt.[5] Sie werden auch erst durch diese Differenz beobachtbar. Beim Prozess der Ausdifferenzierung, dieser rekursiven Systembildung, kommt es somit zu einer Differenzierung von System und Umwelt, alles was nicht zur Organisation gehört, wird ausgeschlossen. Es wird eine Grenze gezogen, eine Differenz von Innen und Außen erzeugt: „Als System lässt sich demnach alles bezeichnen, worauf man die Unterscheidung von Innen und Außen anwenden kann.“[6] Wenn sich ein System selbst unterscheidet, spricht Luhmann in Anlehnung an Spencer Brown[7] vom Reentry, dem Wiedereintritt der Unterscheidung in sich selbst oder dem Wiedereintritt einer Form in eine Form.[8] Nur durch Selbstreferenz ist Fremdreferenz möglich. Fremdreferenzielles wird selbstreferenziell unterschieden, wenn ein System sich unterscheidet und zwar dadurch, dass es sich von dem unterscheidet, was es nicht ist, seiner Umwelt.[9] Zu der Unterscheidung von System und Umwelt kommt die Unterscheidung von System zu System.[10]Beziehungen zu anderen Systemen werden durch strukturelle Kopplungen ermöglicht. Und erst das heißt auch, „[...]dass ein System nur in bezug auf seine Umwelt als problematisch verstanden werden kann: Hätte es keine Grenzen, hätte es keine Probleme.“[11]
Die Autopoiesis eines Systems kann nur auf der Grundlage seiner eigenen operativen Geschlossenheit bestehen, also wenn das System sich selber durch seine eigenen Operationen produzieren und reproduzieren kann und ein selbstreferenzielles zirkuläres Gefüge bildet. Soziale Systeme bestehen aus Kommunikationen, rekursiv vernetzten Operationen,[12] sie reproduzieren sich somit in Ereignissen.[13] Eine Kommunikation ist eine „[...] autopoietische Operation, die rekursiv auf sich selbst zurückgreift und vorgreift [...].“[14] Kommunikationen gibt es nur in sozialen Systemen.[15] Durch Kommunikationen reproduziert sich das soziale System und durch Kommunikation entsteht bzw. aktualisiert sich auch immer Gesellschaft.[16]
Autopoietische Systeme unterscheidenden sich selbst, sind operativ geschlossen und kognitiv offen, anders geht es nicht, denn operative Geschlossenheit ist nur durch kognitive Offenheit möglich. Und ebenfalls gilt: Voraussetzung von Offenheit ist Geschlossenheit.[17] Ein System muss seine Umwelt auf bestimmte Ereignisse hin beobachten, um dann möglicherweise etwaige Irritation in Information zu transformieren.[18]