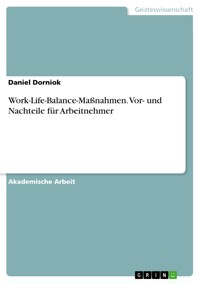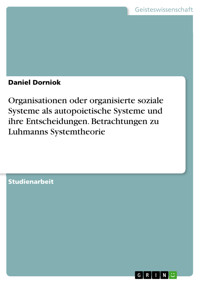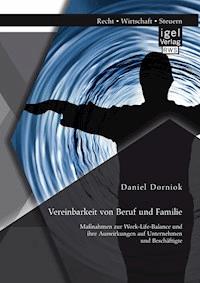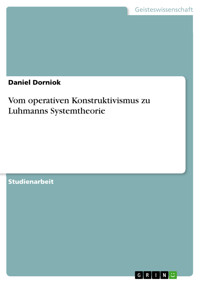
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Soziologie - Allgemeines und Theorierichtungen, Note: 1.0, Universität Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Systemtheorie will eine Universaltheorie sein. Eine Universaltheorie, die universal anwendbar und selbstreflexiv ist, insofern sie auch sich selbst als Gegenstand ihrer Theorie behandeln können muss. Da eine Universaltheorie ein kohärentes Theoriegebäude zum Ziel hat, kommt sie nicht darum herum, auch ihre eigene Erkenntnistheorie zu stellen. Luhmanns erkenntnistheoretische Position kann als Grundlage und zugleich als formgebend für seine Gesellschaftstheorie gesehen werden. Sie verhilft die Systemtheorie zu einer selbstreferentiellzirkulären Universaltheorie zu machen, die sich also selbst mit einbezieht und damit über das Auseinanderfallen von Erkenntnis und Gegenstand - wie noch in der Erkenntnis klassischer Erkenntnistheorien - hinausgeht. Gesellschaft wird in der Gesellschaft beobachtet, Gesellschaft beobachtet sich somit selbst. Es gibt keine Superposition der Beobachtung mehr, keinen archimedischen Punkt für die Entscheidung für Unterscheidungen, keine beobachtungsunabhängige Beobachtung. Es kann immer nur das beobachtet werden, was beobachtet wird. Die dem zugrundeliegende bzw. vorausgesetzte Unterscheidung kann nicht gesehen werden, sie ist der blinde Fleck der Beobachtung. Dem kann auch die Systemtheorie nicht entgehen, aber sie ist sich dieser Begebenheit bewusst und kann sie reflektieren. Wie sich und ob sich diese theoretische Position halten lässt und was dies schließlich für die Erkenntnis und dann auch Wissen und Wissenschaft bedeutet, soll das Thema dieser Arbeit sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 2
Universität Bremen
Diplomstudiengang
Soziologie
Daniel Dorniok
Page 4
1. Einleitung
Die Systemtheorie will eine Universaltheorie sein. Eine Universaltheorie, die universal anwendbar und selbstreflexiv ist, insofern sie auch sich selbst als Gegenstand ihrer Theorie be-handeln können muss. Da eine Universaltheorie ein kohärentes Theoriegebäude zum Ziel hat, kommt sie nicht darum herum, auch ihre eigene Erkenntnistheorie zu stellen. Luhmanns er-kenntnistheoretische Position kann als Grundlage und zugleich als formgebend für seine Ge-sellschaftstheorie gesehen werden. Sie verhilft die Systemtheorie zu einer selbstreferentiellzirkulären Universaltheorie zu machen, die sich also selbst mit einbezieht und damit über das Auseinanderfallen von Erkenntnis und Gegenstand - wie noch in der Erkenntnis klassischer Erkenntnistheorien - hinausgeht. Gesellschaft wird in der Gesellschaft beobachtet, Gesellschaft beobachtet sich somit selbst. Es gibt keine Superposition der Beobachtung mehr, keinen archimedischen Punkt für die Entscheidung für Unterscheidungen, keine beobachtungs unabhängige Beobachtung. „So wird der Erkenntnistheoretiker selbst Ratte im Labyrinth und muss reflektieren, von welchem Platz aus er die anderen Ratten beobachtet.“1Es kann immer nur das beobachtet werden, was beobachtet wird. Die dem zugrundeliegende bzw. vorausgesetzte Unterscheidung kann nicht gesehen werden, sie ist der blinde Fleck der Beobachtung. Dem kann auch die Systemtheorie nicht entgehen, aber sie ist sich dieser Begebenheit bewusst und kann sie reflektieren.
Wie sich und ob sich diese theoretische Position halten lässt und was dies schließlich für die Erkenntnis und dann auch Wissen und Wissenschaft bedeutet, soll das Thema dieser Arbeit sein.
Dabei kann nicht dezidiert analysiert werden, in wie weit der operative Konstruktivismus und der Formenkalkül von George Spencer Brown zusammenhängen, auch kann der Formenkalkül nicht explizit dargelegt werden, daher wird dieser wie bei Luhmann gehandhabt und gelegentlich auf ihn verwiesen.
Der Konstruktivismus ist nicht als einheitliche Theorie beschreibbar. Unter dieser Bezeichnung sind verschiedene Ansätze mit verschiedenen Schwerpunkten und Fokussierungen aus verschiedenen Disziplinen vereinigt. Er ist eher als „äußerst dynamischer interdisziplinärer Diskussionszusammenhang“2zu beschreiben. Allen Konzepten gemeinsam ist die spezielle Behandlung von Erkenntnis im Allgemeinen und auf eine ganz spezielle Weise die Auflösung einer ontologischen Sichtweise. Es kann daher aufgrund der Fülle an Arbeiten zu diesem
1Luhmann, 2001a: S.227
Page 5
Thema nicht näher auf die verschiedenen Spielarten des Konstruktivismus einge gangen werden, wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen aber kurz hervorgehoben werden. Zunächst soll in den operativen Konstruktivismus eingeführt werden, um dann zentrale Elemente wie Beobachtung zu behandeln, die dann direkt zu Paradoxien führen, um dann zu ze igen, wie diese „Erkenntnistheorie“ zur Systemtheorie als selbstreferentiell zirkuläre Unive r-saltheorie und zu verändertem Wissen- und Wissenschaftsverständnis führt.
2. Operativer Konstruktivismus
Der operative oder systemtheoretische Konstruktivismus „ersetzt Unterscheidungen wie Idee/Realität, Sein/Nichtsein, Subjekt/Objekt, Zeichen/Bezeichnetes usf. durch Untersche idungen wie Beobachtung (Unterscheidung/Bezeichnung) und System (System/Umwelt) als Modus der Beobachtung.“3Alle Erkennt nis ist nur durch Beobachtung zu erhalten und diese ist insofern unterscheidungsabhängig, als dass nur das in ihr Blickfeld gerät, was mit Hilfe der jeweils benutzten Unterscheidungen unterschieden werden kann. Beobachten können immer nur Systeme.
Zu beginnen ist daher mit autopoietischen Systemen und ihrer kognitiven Offenheit durch operative Geschlossenheit. Autopoietisch nennt Luhmann Systeme im Anschluss an die Konzeption von Maturana4, „die die Elemente, aus denen sie bestehen, durch die Elemente, aus denen sie bestehen, selbst produzieren und reproduzieren.“5Das Netzwerk der eigenen Operationen ist wiederum erzeugt durch eben diese Operationen. Die autopoietischen Systeme operieren aufgrund ihrer Geschlossenheit ausschließlich im Selbstkontakt; sie können keine Operationen außerhalb ihrer Grenzen durchführen. Alle Informationserzeugung und Verarbeitung findet somit innerhalb des Systems statt. Die Operation der Selbstreferenz ist die „Einheit, die ein Element, ein Prozeß, ein System für sich selbst ist“6, diese Einheit muss aktiv durch „relationierende Operationen“7erschaffen werden. Dies geschieht nach Luhmann und im Anschluss an George Spencer Brown8durch das „Treffen einer Untersche idung“. Jedes System, das sich auf sich selbst bezieht, muss sich von seiner Umwelt als Umwelt unterscheiden. Die Einheit der Differenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz ist somit wie-
2Schmidt,1990: S.7
3Krause, 2001: S.159
4Vgl. Maturana, 1988 und 1987
5Luhmann, 1995 b: S.56
6Luhmann,1987 c: S.58
7Luhmann,1987 c: S.58
Page 6
derum die Selbstreferenz. Diese stets mitlaufende Selbstreferenz ist Voraussetzung für jede weitere Form der Selbstreferenz und ermöglicht dem operativ geschlossenen System die kognitive Öffnung zur Umwelt. Nach dieser Konzeption kann „Kognition [...] nicht länger als Einfluß der Umwelt auf das System verstanden werden; und erst recht nicht als aktive Suche des Systems nach Information in der Umwelt.“9Erkennen wird nur möglich, wenn das System autopoietisch geschlossen operiert und sich gegen die Umwelt abgrenzt. Hier gibt es keine Informationen und keine Unterscheidungen, die Unterscheidungen sind immer eigene Leistungen des Systems. Im Prinzip ist dieser Gedanke nicht neu, Foerster argumentiert in Bezug auf kognitive Prozesse folgendermaßen, er denkt „kognitive Prozesse als nie endende rekursive Prozesse des (Er-) Rechnens [...]“10von Realität durch das jeweilige System. Und weiter: „Das Nervensystem ist so organisiert (bzw. organisiert sich selbst so), daß es eine stabile Realität errechnet.“11Das System hat auch nach Foerster selbst keinen direkten Kontakt mit der Umwelt, z. B. im Sinne einer Instrukttheorie, sondern es wird nur photochemisch oder akustisch durch Wellen gereizt und dann werden mit dem eigenen „Apparat“ daraus Informationen produziert, die in der Umwelt nicht vorhanden sind. Es wird zwar zugestanden, dass „da“ „etwas“ ist, was aber erst übersetzt wird. „Die Reaktion einer Nervenzelle enkodiert nicht die physikalischen Merkmale des Auges, das ihre Reaktion verursacht. Es wird lediglich das ‚so viel‘ an einem Punkt meines Körpers encodiert, nicht aber das ‚was‘.“12Auch Roth argumentiert ähnlich, er geht davon aus, dass ganz normale Wahrnehmungen, wie Farben oder perspektivisches Sehen, aber auch komplexere Funktionen, wie Bewusstsein und Ich-Identität etc. sozusagen als „Beobachtungmasken“ erzeugt werden, aber keinerlei Entsprechung in der Außenwelt haben, sondern im Gegenteil: „Wir wenden diese hochkomplexen Konstrukte auf die Welt an, sie sind ihr aber nicht entno mmen.“13Der radikale Konstruktivismus14Ernst von Glasersfelds ist geprägt vom traditionellen Skeptizismus und seinem Postulat „die Welt jenseits unserer Sinne und Begriffe nicht erkennen zu können.“15Er schließt hier schon das Erkennen einer ontologischen Wirklichkeit aus. Er nimmt vor allem Bezug genetischer Epistemologie Piagets mit seinen Prinzipien Assimilation und Akkommodation, durch die es zu Stabilität bzw. Perturbationen kommt, wobei das entscheidende daran die konstruktivistische Auffassung ist, dass der Verstand des Menschen sich
8Spencer Brown, 1997: S.3
9Luhmann, 1995 a: S.23
10Foerster, 1985: S.31
11Foerster, 1985: S.39
12Foerster, 1985: S.43
13Roth, 1997: S.253
14Vgl. Glasersfeld, 1997
15Glasersfeld, 1998: S.504