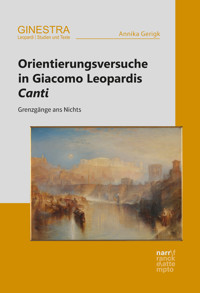
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ginestra. Periodikum der Deutschen Leopardi-Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Das Nichts stellt eine Konstante in Leopardis Werk dar, deren Darstellung bei Weitem nicht auf die bloße Nennung des ,nulla' beschränkt ist. Es erweist sich als polyvalente Denkfigur, die unter anderem auf Mangel, Abwesenheit, Wertlosigkeit, Zersetzung und Vergehen verweist. Durch eine genaue Betrachtung der unterschiedlichen Nichts-Konzeptionen wird eine gleitende Semantik sichtbar, die im ganzen Werk dynamisch bleibt. Diese entsteht durch die wiederholte Parallelisierung von gegensätzlichen Begrifflichkeiten wie ,Vernunft und Natur', ,Antike und Moderne', ,Dichtung und Philosophie', ,Materie und Geist', ,Leben und Tod', ,Inneres und Äußeres', etc. Dies ist aber nicht die einzige Funktion, die das Nichts in Leopardis Gedankenbewegungen einnimmt: Das Nichts entpuppt sich vielerorts als Orientierungspunkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Annika Gerigk
Orientierungsversuche in Giacomo Leopardis Canti
Grenzgänge ans Nichts
Umschlagabbildung: Ancient Rome; Agrippina Landing with the Ashes of Germanicus, exhibited 1839, Joseph Mallord William Turner. Tate, Accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856. Photo: © Tate
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395898
© 2023 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 1436-2260
ISBN 978-3-8233-8589-9 (Print)
ISBN 978-3-8233-0467-8 (ePub)
Inhalt
1Danksagung
Entstanden ist die vorliegende Arbeit als Dissertation an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Meinem Doktorvater Prof. Dr. Paul Geyer danke ich sehr herzlich für die Betreuung der Arbeit, die zahlreichen Gespräche zu dem Thema und die langjährige Unterstützung, die ich als Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl erfahren habe. Ich danke überdies meiner Zweitbetreuerin Prof. Dr. Frédérique Dubard, dem Vorsitzenden meiner Prüfungskommission Prof. Dr. Michael Bernsen und Prof. Dr. Irene Gambacorti. Besonders verbunden bin ich Prof. Dr. Barbara Kuhn, die mich in meiner Forschung unterstützt hat und mir die Publikation in dieser Reihe ermöglicht hat. Ich danke Prof. Dr. Blamberger und Dr. Martin Russel für die Zeit am Internationalen Kolleg Morphomata und die zahlreichen anregenden Gespräche, die ich dort führen konnte.
Ein großer Dank geht an meine Freundinnen und Kolleginnen, Martina Nappi, Dr. Cora Rok, Alina Lohkemper, Chiara Guerri, Julia Weber, Dr. Mariana Münning, Jenny Seifried, Dr. Ines Barner, Marta Dopieralski und Dr. Tanja Klemm, für Anregungen, Korrekturen und Beistand.
Meiner Mutter, die mich stets unterstützt hat, danke ich ebenfalls von Herzen; ebenso meinen Schwiegereltern, die mir jederzeit ideale Schaffensbedingungen in ihrem Haus geboten haben.
Zu guter Letzt möchte ich Matthias Schneider für seine Geduld, die Korrekturen und die vielen Gespräche zum Thema dieser Arbeit danken. Ihm soll das Buch gewidmet sein.
2Einleitung
Leopardis Rolle in der Literaturgeschichte scheint klar umrissen zu sein: als Pessimist, der sich bis zu seinem Lebensende beständig radikalisierte, als Poet des Weltschmerzes und als begnadeter Stilist. Und dennoch können die großen Erklärungsmuster, die sich innerhalb der letzten Jahrzehnte zur kanonisierten Deutung1 entwickelt haben, die Wirkung, die von Leopardis Werk ausgeht, nicht erklären. Leopardis Dichtung beinhaltet einen Widerspruch, den die Kunst gut kennt: Während Sprache die Fähigkeit zur Negation besitzt, zeigen und verweisen Bilder auf etwas und affirmieren es dadurch. Dieses Phänomen betrifft auch die menschliche Imagination: „Eine sprachliche Vorstellung kann sprachlich verneint werden, als Vorstellung ist sie aber unvermindert präsent; von der Verneinung bleibt das Bildhafte unberührt.“2 In diesem Zusammenhang müsste auch die Formgebung der Gedichte diskutiert werden, die in Leopardis Canti eine ständige Veränderung durchläuft.
Das ‚Nichts‘ kann nicht mehr aus Leopardis Werk verdrängt werden. So ist beispielsweise die Nichtigkeit der menschlichen Existenz, „tutto è nulla“3, ein konstantes Thema in Leopardis Werk, ebenso wie die mangelnde Bereitschaft der Gesellschaft, diese zu akzeptieren. Leopardis Negativität erweckte Kritik bei seinen Zeitgenossen: zu schwer, zu hoffnungslos, zu fortschrittskritisch. Die Behauptung, dass alle Menschen zwangsläufig und ausweglos unglücklich sind, möchte nicht jeder auf sich sitzen lassen. Der Dichter wiederum fühlte sich und seine Philosophie missverstanden. Er erwartete zwar von seinen Zeitgenossen, dass sie den Blick auf das ‚Nichts‘ richten, da es sich nicht mehr aus dem Bewusstsein streichen lässt, aber nicht, um ein Leben im ‚Nichts‘ zu führen, sondern um eben diesem zu entgehen. Eine weitere Analyse der Denkfigur des ‚Nichts‘ im Pessimismus oder Nihilismus könnte kaum noch einen nennenswerten Beitrag zur Leopardi-Forschung beitragen. Luigi Capitano legte 2016 eine beeindruckende Arbeit zum Nihilismus bei Leopardi vor.4 Stattdessen soll Leopardis ‚Nichts‘ in seinem poetischen Kontext erfasst werden, ohne die zahlreichen Gegenimpulse und Widersprüche in ein negatives Gesamtbild zu synthetisieren. Ebenso wenig soll dabei aber der negative Gehalt seiner Lyrik verkehrt oder verdeckt werden.
Die Sekundärliteratur weist ein beachtliches Spektrum an Deutungen auf, die entweder die Negativität betonen beziehungsweise überbetonen oder die sich an dem negativen Gehalt von Leopardis Dichtung reiben. Aufgrund des Negativitätsbias,5 einer kognitiven Verzerrung bezüglich der Wahrnehmung und Verarbeitung von Negativität, gestaltet es sich schwierig, einen neutralen Umgang mit Negativität zu finden. Dieser Bias kann sowohl Leopardi als auch dem Umgang mit seinem Werk innerhalb der Forschung zugeschrieben werden. Leopardis Werk besitzt zwar ein immenses negatives Potential, das über Jahrzehnte von der Kritik offengelegt wurde – dieses soll auch nicht abgestritten werden –, die gegenläufigen Elemente können jedoch nicht auf ihren ästhetischen Wert reduziert werden.6 Eine derartige Interpretation würde alle poetologischen Studien des Autors negieren. Ziel dieser Arbeit ist es, ein nuanciertes Bild von Leopardis ‚Nichts‘ in der Lyrik herauszukristallisieren und seine Relation zu positiven Impulsen zu analysieren. Eine solche Betrachtung des Werks ist nicht kompatibel mit der geläufigen Einteilung in Pessimismus-Phasen, da diese von einer beständigen Ausdehnung und Radikalisierung von Leopardis Pessimismus ausgeht. Seine Lyrik muss, ebenso wie sein Zibaldone, als rhizomatische Struktur gelesen werden, die sich einer eindeutigen Interpretation entzieht.
In Leopardis Werk finden Orientierungen statt, in denen der Dichter Grenzen erprobt und all jene, die seine Dichtung lesen, auf die Probe stellt. Ein poetisches Werk, in dem das Undefinierte auf die Spitze getrieben wird und Aussagen bisweilen ins Gegenteil verkehrt werden, führt beim Leser7 schnell zum Orientierungsverlust. In endlosen Variationen erkundet Leopardi durch Parallelismen, Analogien und Chiasmen Fragen zur Existenz. Dabei können dominante Gedankenbewegungen ausgemacht werden, die von der Forschung in Form von unterschiedlichen Phasen und Arten des Pessimismus kategorisiert wurden. Während durch dieses Raster die Lektüre von der Orientierungsarbeit befreit werden kann, gehen dadurch jedoch zentrale Eigenschaften der Leopardischen Poetik verloren; es wird vereindeutigt, was nicht sofort eindeutig sein soll und auch gar nicht eindeutig ist. „[I]l testo, così com’era, libero dalle interpretazioni sopravvenute e dalle formule critiche, era una fonte ricchissima di suggerimenti e di provocazioni, soprattutto era una messa in questione di un orizzonte culturale prestabilito e convenzionale.“8 Die vielen Widersprüche, die in einer genauen Lektüre offensichtlich werden, sind Teil des literarischen Programms – eine teils „tentativ-repetitive Denk- und Schreibweise“9, die keinen Anspruch auf Abgeschlossenheit erhebt. Der Zibaldone wird nicht als prosaische Übersetzung oder Vorform der Lyrik verwendet, sondern als Paratext, mit Hauptaugenmerk auf die Bilder, die Leopardi verwendet. Leopardis Werk enthält Leerstellen, die über den Zibaldone gefüllt werden können, die im Text jedoch durch andere Techniken evoziert werden, wie etwa die antikisierende Sprache im Bruto minore. Dabei ist es durchaus möglich, dass der prosaische und der poetische Text in der Conclusio divergieren.
Die Grundannahme dieser Arbeit ist, dass Leopardi in der Konstruktion seiner Gedichte die Beschaffenheit des Daseins, vor allem aber die Seins-Struktur der Illusion, unter negativem Vorzeichen erforscht. Dabei wird der komplexe Mittelweg deutlich, der ohne autoritäre, feststehende oder objektiv richtige Wahrheiten auszukommen sucht: der Versuch, ohne Selbstbetrug oder die Verneinung von menschlichen Bedürfnissen ein glückliches Leben unter unglücklichen Bedingungen zu führen – ein unmögliches Projekt, das der Sache nach keinen Abschluss finden kann. Vielmehr handelt es sich um ein zielloses Verfahren, das aus wiederholter Konstruktion und Dekonstruktion sowie auch Enthüllung und Verhüllung besteht.
Um das pessimistische Framing zu verlassen, wird dieser Begriff in der Arbeit, mit Ausnahme des Überblickskapitels (Kapitel 3), vermieden. Der Begriff Skepsis10 beschreibt Leopardis Weltsicht besser. Ohne den starken Bezug zur Dichtung könnte man Leopardi in Anlehnung an Eagleton wohl auch neben Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud und Wittgenstein in die Reihe der Antiphilosophen stellen:
Überzeugt davon, dass die Vernunft nicht zum Ursprung reicht, vertiefen sich die Antiphilosophen in eine ursprünglichere Wirklichkeit: Macht, Begehren, Differenz, Physiologie, Emotion, gelebte Erfahrung, religiöser Glaube, materielle Interessen, das Leben der gewöhnlichen Menschen und so weiter.11
Antiphilosophen praktizieren deshalb eine andere Form des Schreibens, in der sich die Grenze zwischen Literatur und Philosophie aufhebt, einen Schreibstil, der „geschriebener“, literarischer, bisweilen poetischer, aber auch unprofessioneller ist.12 In poetologischen Notizen zeigt sich, wie stark Leopardis Stilsuche mit einer inhaltlichen Seite verknüpft ist. In dieser Arbeit wird Leopardis ‚Nichts‘ in den literarischen Formen untersucht, in denen es verwendet wird, und wie es dort die Denkbewegungen steuert.
In Leopardis Werk finden sich zahlreiche Gegensätze, beispielsweise ‚Natur und Vernunft‘ oder ‚Antike und Moderne‘, die beständig in Beziehung zueinander gesetzt werden. Dadurch entsteht eine gleitende Semantik, die bei der wiederholten Lektüre vom Leser gelernt wird (Kapitel 4). Um die gleitende Semantik genauer betrachten zu können, lohnt sich ein Blick auf Leopardis ‚nulla‘ bzw. ‚niente‘. Dabei wird schnell ersichtlich, dass es sich hier, wie auch bei allen anderen wiederkehrenden Begriffen, um eine polyvalente Denkfigur handelt. In der Illusion zeigt es sich beispielsweise als seiendes Nichtseiendes bzw. als nichtseiendes Seiendes und wird dadurch zum Substanzproblem. In jungen Jahren verwendet Leopardi ‚das Nichts‘ noch als Oxymoron für eine solide Substanz, die das Gefühl der absoluten Kontingenz umschreibt, der sich das Subjekt nicht entziehen kann. Dann wiederum ist ‚das Nichts‘ das Ergebnis von Dekonstruktion. Die wissenschaftliche Analyse, die eigentlich einen Zugewinn an Informationen darstellen soll, geht mit einer Zersetzung einher, welche die Erkenntnis ins Nichts ausufern lässt. Durch die Vernunft wurde die Kontingenz des Daseins überhaupt erst enthüllt und kann nun nicht mehr verdeckt werden. An anderer Stelle verweist ‚das Nichts‘ auf Abwesenheit oder Mangel. Diese unterschiedlichen Nichts-Begriffe werden in ihrer Auswirkung auf Leopardis Gedankenprogramme untersucht. Dabei wird ein Zusammenspiel aus negativen und positiven Impressionen sichtbar. ‚Das Nichts‘ dient der Orientierung in dieser Struktur, und da der Orientierungsprozess nie endet, sind die Gehalte nicht fixiert und können jederzeit dem Geltungsraum des ‚Nichts‘ zugeordnet oder wieder entzogen werden.
Eine Eigendynamik entwickelt ‚das Nichts‘ in der Lyrik auch dadurch, dass die Bildsprache eine gewisse Autonomie besitzt. Vor allem der Widerstreit zwischen Imagination und Ratio wird nicht nur besprochen, sondern auch inszeniert. Wenn in Leopardis Gedichten argumentative und bildliche Darstellungen aufeinandertreffen, bleibt die bildliche Dimension von einer Negation des Arguments unangetastet. Die imaginative Dimension nimmt insofern eine autonome Rolle im Werk ein. In poetologischen Notizen zeigt sich, wie stark Leopardis Stilsuche mit einer inhaltlichen Seite verknüpft ist. Als bekanntestes Phänomen ist hier wohl das indefinito zu nennen. Leopardi greift zwar wiederholt die ihm so wichtige Illusion und ihre nichtige Seite an; das indefinito, das als Versuch der Verbildlichung der Illusion zu verstehen ist, besteht aber fort. Auch Leopardis bildliche Ebene ist kompliziert und selbst nicht vom Nichts unberührt, da sich die Mehrdeutigkeit hier ebenfalls abbildet. Leopardis Bildspender werden beständig verformt und weiterentwickelt. Das Kind, das häufig analog zur Natur oder zu Gott gedacht wird, oszilliert zwischen Beobachtungsobjekt und Aktant. Einerseits versinnbildlicht es Naivität, Natürlichkeit und ist für den Dichter von größter Bedeutung, da es mit seinen imaginativen Fähigkeiten, die es aus Illusionen schöpft, auf eine verlorene Form der Literatur verweist. Um wiederum das Schicksal der Menschheit zu verbildlichen, werden andererseits seine grausamen Qualitäten, die im Spiel beobachtet werden können, in den Vordergrund gerückt. Die komplexe Struktur, die sich aus diesen Analogien und den Polyvalenzen der einzelnen Begriffe entwickelt, kann entsprechend erweitert werden: Der Kontrast der Antike und der Moderne fügt eine historische Komponente hinzu, das ‚Ideale‘ und das ‚Reale‘ eine normative etc. Aus diesen Gebilden setzt sich die rhizomatische Struktur von Leopardis Werk zusammen.
Da in diesem komplexen Gefüge nicht jeder Text analysiert werden kann, werden exemplarische Texte ausgewählt, die ‚das Nichts‘ in besonderer Hinsicht verarbeiten. Ein erster Zugang zur gleitenden Semantik und ihrer Orientierung am ‚Nichts‘ erfolgt über das Gedicht L’infinito (Kapitel 4.5). Anschließend werden Gedichte im Rahmen typischer Themen des Autors analysiert. In Kapitel 5 werden Gedichte betrachtet, welche die Möglichkeiten einer tugendhaften Haltung des modernen Subjekts erörtern. Während im Bruto minore die Auseinandersetzung mit der Gegenwart des Poeten über eine literarische Rekonstruktion der Vergangenheit erfolgt, wird in dem satirischen Gedicht Palinodia al Marchese Gino Capponi die Gegenwart direkt ins Visier genommen. Beide Gedichte thematisieren die kollektive Entscheidung einer Gesellschaft, sich auf ihren reinen Verstand zu verlassen und ihre kreativen Fähigkeiten aufzugeben. Die Sicherheit, die in formalen Gleichungen, Statistiken, Logiksätzen etc. gesucht wird, ist in Leopardis Weltsicht ein ebensolches Trugbild wie die geliebten Illusionen (Tugend, Patriotismus, Liebe etc.) und dadurch auch dem Verfall ausgesetzt. In Kapitel 6 werden die Gegenüberstellungen in ihrer Verbildlichung als gescheiterte Gespräche betrachtet. Im Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie wird der Gegensatz von Leben und Tod betrachtet. In der Verarbeitung des Themas orientiert sich Leopardi am antiken Drama, in dem das Verhältnis des Chors zum Schauspieler auf der Bühne die Beschaffenheit der Welt verkörpert. Alla sua donna verdeutlicht die Nicht-Sichtbarkeit eines idealeren Seins. Im Canto notturno di un pastore errante dell’Asia antwortet der stille Mond nicht auf die Fragen des Hirten. Im Ultimo canto di Saffo und auch in einigen Gedichten des Aspasia-Zyklus (Kapitel 7) steht die Welt im Widerstreit mit dem Inneren des Subjekts. In diesen Gedichten bleibt offen, ob es sich um eine Externalisierung der Gefühle handelt oder um eine feindliche, deprivierende Natur, die das Innere einem Mangel unterzieht. An La ginestra und Il tramonto della luna können abschließende Gedanken zur gleitenden Semantik und zur Polyvalenz des ‚Nichts‘ erörtert werden (Kapitel 8).
Zur Analyse werden Passagen aus dem Zibaldone herangezogen, um Leopardis poetisches und philosophisches Verständnis zu erläutern. Die Lyrik soll dabei jedoch auf ihren eigenen Aussagewert untersucht werden, denn nimmt man das Vorhaben des Dichters ernst, dann existiert neben der philosophischen Erkenntnis auch eine poetische Erkenntnis, die auf Imagination basiert.
3Zugänge zu einem unübersichtlichen Werk
Die Forschung hat über Jahrzehnte hinweg, in dem Versuch Leopardis Lyrik näher zu kommen, sein Werk anhand von zwei (bzw. drei oder vier) Pessimismus-Phasen1 eingeteilt. Für diese Einteilung werden hauptsächlich die Verhältnisse ‚Natur und Mensch‘ sowie ‚Natur und Vernunft‘ erörtert. Der Forschungsstand diesbezüglich ist weitestgehend kanonisiert.2 Dabei geht man davon aus, dass für Leopardis Werk eine beständige Entwicklung hin zu einem intensiveren Pessimismus charakteristisch ist. Wanning fasst diesen Zugang zum Werk unter dem Begriff ‚Entwicklungshypothese‘ zusammen.3 Die erste Phase wird als pessimismo storico bzw. pessimismo antropologico bezeichnet. In dem Verhältnis Natur und Mensch dominiert eine natura madre.4 Das Unglück der Menschheit basiert laut Leopardi auf einer zunehmenden Rationalisierung, die den Menschen von der Natur entfremdet: Ein historischer Fehler, der in den Überlegungen teilweise mit dem Sündenfall korreliert.5 Aus einigen Passagen kann ein finalistischer Weltentwurf gelesen werden, in dem die Natur die Stelle von Gott einnimmt.6 Klar ist in dieser Phase jedoch, dass der Mensch seinen unglücklichen Zustand nicht aufheben kann, ohne wieder in ein Resonanzverhältnis7 zur Natur zu treten. Offen bleibt, wie dies zu bewerkstelligen ist, da der Mensch durch die Vernunft handlungsohnmächtig geworden ist. Die mezza filosofia,8 die Leopardi im Zibaldone ausführt, kann für einen kurzen Zeitraum den Menschen zur Aktion bewegen. Canzonen wie All’Italia, Ad Angelo Mai und Nelle nozze di Paolina handeln von einer Wiedererweckung des Patriotismus in Italien, der das Land wieder zu seiner verlorenen Größe zurückführen soll. Die ‚negative Realität‘, die Leopardi allen Überlegungen gegenüberstellt, zersetzt aber jede Bemühung um einen positiven Ausweg. Es gibt keine einfachen dauerhaften Lösungen. Der Wunsch nach einer ‚Rückkehr‘ in den Naturzustand bleibt eine unerfüllbare Sehnsucht. Mit dieser verknüpft Leopardi eine Gesellschaftskritik: „La natura leopardiana è l’antitesi della società contemporanea.“9 Als Einfluss wird in dieser Phase vor allem Rousseau genannt.10 Demnach entsteht Leopardis anthropologische Theorie aus seinen philosophischen Studien. Timpanaro geht aber davon aus, dass Leopardi das Konzept einer heilsamen Natur hauptsächlich aus seinen Lektüren antiker Literatur entwickelt.11 Für Janowski ist die erste Phase dadurch gekennzeichnet, dass mit konstantem Bezug zur Antike „elegische, idyllische, lyrische Momente sich zu meditativen und moral-patriotischen [sic!] Themen gesellen“.12 Leopardi selbst unterscheidet philosophische und poetische Erkenntnis, die sich häufig sogar diametral gegenüberstehen.
Die Grenze zur nächsten Phase zieht Janowski 1821,13 Binni erst nach 1823.14 Die zweite Phase, der sogenannte pessimismo cosmologico, ist charakterisiert durch die Annahme einer grausamen Natur. Diese vernachlässigt ihre Schöpfung und versagt ihr das Glück, nach dem sie sich sehnt. Das Leben wird jetzt als asymmetrischer Kampf gegen die Natur definiert, da die Natur keinem vorgegebenen Plan folgt, der für die Menschen ersichtlich ist.15. Die Mutter Natur wird zur „matrigna“16 oder zur „empia madre“17, was vor allem im Dialogo della Natura e di un Islandese deutlich wird.18 Alle Lebewesen müssen permanent an der Unerfüllbarkeit ihrer Wünsche leiden. Der Mensch – mit seinem antisozialen Wesen19 – ist auf einen „individualismo esasperato e doloroso che tocca quasi i limiti di un totale anarchismo“20 zurückgeworfen. Bei Binni vermischen sich hier die Begriffe pessimismo cosmologico und Nihilismus – „un nichilismo che investe la natura e giunge alle forme di un nichilismo esistenzialistico profondo e ricco di modernissime anticipazioni.“21 Leopardis Materialismus führt ihn zu einer Definition der Natur als Kreislauf: „[I]l fine della natura universale è la vita dell’universo, la quale consiste ugualmente in produzione, conservazione e distruzione dei suoi componenti“22 [Der Zweck der universellen Natur ist das Leben des Universums, das gleichermaßen aus Herstellung, Erhalt und Zerstörung seiner Komponenten besteht]. Diesem Zyklus unterliegt eben auch der Mensch, der ertragen muss, dass er nicht im Zentrum des Kosmos steht. Später hat Leopardi laut Janowski „[d]en optimistischen Fortschrittsgedanken [seiner Epoche …] mit immer bitterer Schärfe bekämpft und auf dem Boden einer materialistischen Weltauffassung einen Nihilismus des Verstandes entwickelt.“23 In dem Augenblick, in dem die Natur negativiert wird, errichtet er neue positive Gegenpole. Die Kunst rückt an die Stelle der Natur. Ebenso die Vernunft, die nicht mehr Schuld hat an dem Leiden der Menschheit und jetzt als möglicher Ausweg in Stellung gebracht werden kann. Durch die Vernunft als Teil des menschlichen Intellekts24 erhält der Mensch die Fähigkeit, seine geringe Größe und seine Bedeutungslosigkeit im Universum zu erkennen.25 Durch den Intellekt kann der Mensch dann idealerweise erkennen, dass er in seiner Evolution nur unnützes Wissen erlangt habe. Dann könne er versuchen, die Evolution rückabzuwickeln.26 Überlegungen zur Rückkehr in eine frühere Form des ‚Seins‘ ziehen sich durch das ganze Werk. Zu nennen sind hier vor allem: Der ‚Urzustand‘ bzw. ‚Vorbewusstseinszustand‘, die Römische Republik27 oder eine kooperative Gesellschaft wie Leopardi sie in La ginestra beschreibt.28
Als nächste Radikalisierung wird häufig die Abkehr vom Satz des Widerspruchs – non potest idem simul esse et non esse29 [etwas kann nicht zugleich sein und nicht sein] – genannt. Die Grundlage für diese Überlegungen ist erneut die conditio humana: Der Mensch ist für Leopardi ein Widerspruch in sich, da er durch seine Vernunftfähigkeit unglücklich ist, jedoch durch „la cura di preservare la propria esistenza“30 [den Selbsterhaltungstrieb], trotzdem fortbesteht.
Non si può meglio spiegare l’orribile mistero delle cose e della esistenza universale […] che dicendo essere insufficienti ed anche falsi […] i principii stessi fondamentali della nostra ragione. Per esempio, quel principio, estirpato il quale cade ogni nostro discorso e ragionamento ed ogni nostra proposizione, e la facoltà istessa di poterne fare e concepire dei veri, dico quel principio Non può una cosa insieme essere e non essere, pare assolutamente falso quando si considerino le contraddizioni palpabili che sono in natura. L’essere effettivamente, e il non potere in alcun modo esser felice, e ciò per impotenza innata e inseparabile dall’esistenza, anzi pure il non poter non essere infelice, sono due verità tanto ben dimostrate e certe intorno all’uomo e ad ogni vivente, quanto possa esserlo verità alcuna secondo i nostri principii e la nostra esperienza. (Zib. 4099)
[Man kann das schreckliche Mysterium der Dinge und der universellen Existenz nicht besser erklären, als zu sagen, dass die fundamentalen Prinzipien unserer Vernunft selbst unzureichend und auch falsch sind. Zum Beispiel jenes Prinzip, das, einmal beseitigt, jede Diskussion und jede Argumentation und jeden Satz beendet und die Fähigkeit selbst das Wahre begreifen und bilden zu können; ich sage, jenes Prinzip „Etwas kann nicht zugleich sein und nicht sein“ erscheint absolut falsch, wenn die spürbaren Gegensätze, die in der Natur bestehen, betrachtet werden. Tatsächlich zu sein und dennoch in keiner Weise glücklich sein zu können und aufgrund einer angeborenen Ohnmacht, die untrennbar mit der Existenz verbunden ist, vielmehr nicht in der Lage zu sein, nicht unglücklich zu sein, sind zwei Wahrheiten, die über den Menschen und jedes Lebewesen so gut bewiesen und gewiss sind, wie alle Wahrheiten nach unseren Prinzipien und Erfahrungen sein können.]
Indem Leopardi grundlegende Prinzipien der Logik kritisiert, stellt er die allgemeine Erkenntnisfähigkeit des Menschen in Frage. Das gegenseitige Verständnis innerhalb der Kommunikation ist nicht mehr gesichert, denn er selbst erkennt den Satz als Grundlage für alle Diskussionen und Argumentationen an (siehe Kapitel 6 und 8.6). Die Abkehr bringt Leopardi zwar in die Nähe eines gefährlichen Relativismus, der jedoch durch die Eigenartigkeit von Leopardis Texten keinen Einfluss auf die politischen Bewegungen seiner Zeit hatte.31
Um die unglückliche conditio humana, die alle Logik aushebelt, zu beschreiben, verweist er auf den Dialogo della Natura e di un Islandese (1824), also auf einen fiktiven Dialog. Hier wird deutlich, warum auch eine Unterscheidung in einen literarischen und einen philosophischen Pessimismus problematisch ist, obwohl Leopardi selbst häufig Anlass dazu gibt, diese Unterscheidung zu treffen: „Questa è conclusione poetica, non filosofica“32 [Dies ist die philosophische Schlussfolgerung, nicht die literarische] – wobei derartige Aussagen nicht frei von Ironie sind. Obwohl einzelne Stücke oder Strophen in Gedichten zumeist einer Tendenz zugeordnet werden können, sind sie dennoch eindeutig literarisch. Die theoretischen Texte bedienen sich, wie in dem oben genannten Beispiel, an dem literarischen Korpus und erheben die Texte dadurch über den literarischen (fiktiven) Aussagewert: Sie erhalten den Anschein von Realität. Die philosophischen Texte weisen dadurch eine starke Hybridität auf. Der Widerspruch aus Philosophie und Dichtung deckt sich in Leopardis Theorien teilweise mit dem Widerspruch aus Ideal und Realität. Hinter dem Begriff ‚real‘ verbergen sich ein phänomenologisches Konzept und eine materialistische Weltauffassung; das heißt, der Begriff ist bei Leopardi eng verbunden mit der individuellen Erfahrung von Negativität und dem Paradigma, dass alles Materie ist. Hierzu zählt beispielsweise die Unmöglichkeit, eine glückliche Existenz zu führen. Im Zusammenspiel mit der Idee, die unter anderem die Illusion umfasst, wird die ‚reale‘ Welt beständig hinterfragt.
Pessimismus wird häufig als Resultat von gesellschaftlichen Krisen gedeutet: Krieg, Autoritätsverlust der Kirche, Kontingenz, die kopernikanische Wende etc. In seiner Studie Kritik und Krise33 zeigt Reinhart Koselleck, dass die Gesellschaft seit Rousseau ein permanentes Krisenbewusstsein besitzt. Auch wenn diese Krisen sichtbar sind und sogar explizit benannt werden, ist die negative ‚Realität‘ in Leopardis Werk dennoch ein übersteigertes literarisches Konstrukt. Lange fand dies keine Beachtung, da Leopardis Biographie als Ursache für die Negativität in seinem Werk verstanden wurde, beziehungsweise immer noch zur Deutung herangezogen wird. Und auch in der Forschungsgeschichte des Pessimismus-Begriffs wird auf den negativen Filter verwiesen, den das Subjekt über die Welt legt. Pauen lehnt in seiner Studie zum Pessimismus einen Zusammenhang zwischen Pessimismus und Krisen ab. Stattdessen sieht er den Pessimismus als Denkalternative zum Idealismus und identifiziert zwei gängige Strömungen, die sich aber häufig überschneiden:
Kurz zusammengefaßt ließe sich ‚Pessimismus‘ […] bestimmen als eine metaphysische oder kulturhistorische Deutung, die auf einem kosmologischen oder geschichtsphilosophischen Hintergrund zu einer radikal negativen Bewertung des Bestehenden kommt. Dabei beruft sich die Bewertung zwar in der Regel auf die Perspektive des einzelnen Subjekts, die Theorie insgesamt erhebt aber den Anspruch, objektive Aussagen über die Wirklichkeit und den historischen Prozeß zu machen; der metaphysische Pessimismus glaubt gar, bis zu den ‚Prinzipien des Seins‘ vorgestoßen zu sein.34
Auf den ersten Blick würde Leopardis teoria del piacere35 reichen, die jedem Menschen die Fähigkeit, wirklich glücklich zu sein, abspricht, um Pauens Definition zuzulassen. Leopardi selbst wehrte sich gegen eine subjektive Verortung seines negativen Gedankenguts, mit dem er sich bereits durch seine Zeitgenossen konfrontiert sah, „il proprio fato | creder comune“ (Palinodiaal Marchese Gino Capponi, V.11-12) [sein eigenes Schicksal halten für allgemeingültig]. Sein Denken wollte er nicht durch seine angeblich unglückliche Existenz begründet sehen. Leopardi selbst bezeichnete seine Philosophie als philosophie désespérante.36 Im Dialogo di Tristano e di un amico nennt Tristano die „filosofia dolorosa“ nicht subjektiv, sondern ‚wahr‘ und überführt den Gedankengang in eine Parodie:
[S]o che, malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn’inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera. La quale, se non è utile ad altro, procura agli uomini forti la fiera compiacenza di vedere strappato ogni manto alla coperta e misteriosa crudeltà del destino umano.37
[Ich weiß nur, dass ich, ob krank oder gesund, die Feigheit der Menschen verachte, jeden kindischen Trost und Selbstbetrug verschmähe und den Mut habe, die vollständige Hoffnungslosigkeit zu ertragen, furchtlos in die Wüste des Lebens zu blicken, mir das menschliche Unglück nicht im Geringsten zu verschleiern und alle Konsequenzen einer traurigen, aber wahren Philosophie anzunehmen. Einer, die, wenn sie zu nichts anderem nützt, den starken Menschen die stolze Genugtuung verschafft, die verborgene und geheimnisvolle Grausamkeit des menschlichen Schicksals jeder Hülle entkleidet zu sehen.]
Die Wahrheit wird paradoxerweise zur Kompensationshandlung und nimmt dadurch selbst die Funktion ein, die sie eigentlich negiert.38 Trotz aller Widersprüche wurden in der Forschung Leopardis Lebensgeschichte – vor allem die trübseligen Episoden – und die Einteilung seines Werks in unterschiedliche Pessimismus-Phasen seit mehr als einem Jahrhundert miteinander verwoben. Der Schluss vom kranken Körper und einem von der Welt abgeschnittenen Leben auf ein negatives Schaffen galt seit de Sanctis in großen Teilen der Leopardi-Forschung als gesetzt: „La sua costituzione fisisca, la solitudine, la concentrazione, dovettero di buon ora avvezzarlo a vedere scuro, e sentire nella propria infelicità della vita.“39 Infolgedessen wurden ihm Pessimismus, Nihilismus, Misanthropie etc. attestiert. Benedetto Croce fasste Leopardis Leben und Werk als vita strozzata40 zusammen. Auch wenn die aktuelle Forschung sich von biographischen Lesarten41 fernzuhalten sucht, findet sie dennoch beständig Wege zurück. Selbst die Rekonstruktion der Reihenfolge der Entstehung einzelner Texte spiegelt das biographische Phänomen wider. Die Untersuchungen, ob Leopardi La ginestra oder Il tramonto della luna zuletzt verfasste, werden zur Frage nach einem heroischen Abschluss oder dem totalen Überdruss am Ende seines Lebens. Vor allem aber dient zur Einteilung in Phasen zumeist eine berühmte autobiografische Passage aus dem Zibaldone, in der Leopardi seinen Übergang vom naiven zum sentimentalischen Geist, vom Poeten zum Philosophen, vom antiken zum modernen Menschen beschreibt:
Nella carriera poetica il mio spirito ha percorso lo stesso stadio che lo spirito umano in generale. Da principio il mio forte era la fantasia, e i miei versi erano pieni d’immagini, e delle mie letture poetiche io cercava sempre di profittare riguardo alla immaginazione. Io era bensì sensibilissimo anche agli affetti, ma esprimerli in poesia non sapeva. Non aveva ancora meditato intorno alle cose, e della filosofia non avea che un barlume […]. Sono stato sempre sventurato, ma le mie sventure d’allora erano piene di vita, e mi disperavano perchè mi pareva […] che m’impedissero la felicità, della quale gli altri credea che godessero. Insomma il mio stato era allora in tutto e per tutto come quello degli antichi. […] La mutazione totale in me, e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì […] dentro un anno, cioè nel 1819, dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai a sentire la mia infelicità in un modo assai piú tenebroso, cominciai ad abbandonar la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose […], a divenir filosofo di professione […], a sentire l’infelicità certa del mondo in luogo di conoscerla […]. Allora l’immaginazione in me fu sommamente infiacchita […]. E s’io mi metteva a far versi, le immagini mi venivano a sommo stento, anzi la fantasia era quasi disseccata […]; bensì quei versi traboccavano di sentimento. (Zib. 143-144)
[In meiner poetischen Laufbahn hat mein Geist die gleichen Entwicklungsstadien durchgemacht, wie der menschliche Geist im Allgemeinen. Zu Beginn lag meine Stärke in der Phantasie und meine Verse waren voller Bilder und in meinen poetischen Lektüren suchte ich immer Zugewinn für meine Imagination. Zwar war ich auch sehr empfindsam, was Affekte betrifft, aber in der Poesie konnte ich sie nicht ausdrücken. Ich hatte die Dinge noch nicht kontempliert, und ich hatte nicht die geringste Ahnung von Philosophie. Ich war immer unglücklich, aber meine Missgeschicke waren zu jener Zeit voller Leben und sie verzweifelten mich, denn es erschien mir, als würden sie mich am Glück hindern, von dem ich glaubte, dass die anderen es genossen. Kurz gesagt, mein Zustand war voll und ganz wie der eines antiken Menschen. Die totale Veränderung in mir und der Übergang vom antiken zum modernen Menschen, geschah innerhalb eines Jahres, das heißt im Jahr 1819, in dem ich – meiner Sicht und der kontinuierlichen Ablenkung durch meine Lektüre entzogen – begann, mein Unglück derart finsterer zu fühlen, die Hoffnung zu verlieren, intensiv über die Dinge zu reflektieren, Berufsphilosoph zu werden und das sichere Unglück der Welt zu fühlen, statt es zu kennen. An diesem Punkt war die Imagination in mir ermattet und wenn ich mich anstellte, Verse zu dichten, kamen die Bilder mir nur unter starken Mühen, im Gegenteil, die Phantasie war quasi vertrocknet. Stattdessen überliefen diese Verse vor Gefühl / Stattdessen quoll Gefühl aus diesen Versen.]
Man könnte also sagen, dass Leopardi die Einteilung seines Werks in zwei Phasen durch diese Darstellung seiner Werkgenese selbst vorgenommen hat, auch wenn er sie nicht genau datiert. Insbesondere die mutazione totale ist ein geflügeltes Wort in der Leopardi-Forschung. Dabei wird jedoch der inszenatorische Charakter des Fragments ignoriert. Deutlich wird dies im Bruto minore (1821) und in dem zugehörigen Prosatext Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte, in dem – ebenfalls die Unterteilung in conoscere und sentire aufgreifend – die Zwangsläufigkeit dieser Entwicklung hinterfragt wird (siehe Kapitel 5.1). Die Einteilung, die am Werk vorgenommen wird, geht insofern mit einer Verallgemeinerung einher, die einem genaueren Blick nicht standhält.
Abschließend lässt sich zu der Einteilung in Phasen noch anmerken, dass sich Elemente der zweiten Phase bereits in der ersten erkennen lassen. So etwa die feindliche Natur, die schon in der Canzone Per una donna inferma di malattia lunga e mortale aus dem Jahr 181942 zu erkennen ist: „Nostra famiglia a la natura è gioco“ (V.117) [Unsere Familie ist für die Natur ein Spiel]. Dieses Spiel der Natur greift Leopardi später in der Palinodia al Marchese Gino Capponi (wahrscheinlich zwischen 1832 und 1834) wieder auf. Die positive Natur klingt in Per una donna nur in den Versen 127-128 an, „in cor gentile | quel che natura fe’“ [im edlen Herzen, das die Natur geschaffen hat]. Biral erkennt in den früheren Schriften eine Hoffnung, die in den späteren verloren gegangen ist,43 Leopardis Werk weist aber, wie so oft, beide Tendenzen auf. Wie in Kapitel 5 zu sehen sein wird, evoziert er Hoffnungen, während er sie gleichzeitig verneint.
In einer Arbeit über Leopardi kann man dem biographischen Problem kaum entkommen. Den Autor und das lyrische Ich44 zu trennen oder zu verknüpfen, bleibt schwierig. Auch deshalb, weil Leopardis Tagebucheinträge und Briefe teilweise einen inszenatorischen Charakter besitzen und die poetischen Texte dramaturgische Akte beinhalten, die als persönliche Bekundungen betrachtet werden können.45 In dem Brief vom 24. Mai 1832 an Louis de Sinner beschreibt Leopardi seine Lebensphilosophie. Die Passage entstand als Reaktion auf die Anschuldigung, die Negativität seines Werks sei auf seine körperliche Verfassung zurückzuführen und war Leopardi so wichtig, dass er sie vermutlich auf Französisch verfasste, damit sie einem breiteren Publikum zugänglich sei:
Quels que soient mes malheurs, qu’on a jugé à propos d’étaler et que peut-être on a un peu exagérés dans ce journal, j’ai eu assez de courage pour ne pas chercher à en diminuer le poid ni par de frivoles espérances d’une prétendue félicité future et inconnue, ni par une lâche résignation. Mes sentiments envers la destinée ont été et sont toujours ceux que j’ai exprimés dans Bruto minore. Ç’a été par suite de ce même courage, qu’étant amené par mes recherches à une philosophie désespérante, je n’ai pas hésité a l’embrasser toute entière; tandis que de l’autre côté ce n’a été que par effet de la lâcheté des hommes, qui ont besoin d’être persuadés du mérite de l’existence, que l’on a voulu considérer mes opinions philosophiques comme le résultat de mes souffrances particulières, et que l’on s’obstine à attribuer à mes circonstances matérielles ce qu’on ne doit qu’à mon entendement. Avant de mourir, je vais protester contre cette invention de la faiblesse et de la vulgarité, et prier mes lecteurs de s’attacher à détruire mes observations et mes raisonnemens plutôt que d’accuser mes maladies.46
[Ja, meine Leiden, die man für gut befunden hat, vor der Öffentlichkeit vielleicht mit einiger Übertreibung auszubreiten, die habe ich mir freilich weder durch billige Hoffnungen auf ein angebliches Glück in einem unbekannten Jenseits, noch durch feigherzige Resignation erleichtern wollen, und meine Gefühle dem Schicksal gegenüber sind immer noch geradeso, wie ich sie in meinem Bruto minore ausgedrückt habe. Demselben mutigen Wollen bin ich gefolgt, als ich, durch meine Forschungen zu einer Philosophie der Hoffnungslosigkeit geführt, mir diese ohne Zögern ganz zu eigen machte. Wenn man demgegenüber meine philosophischen Überzeugungen als ein Ergebnis meiner Leiden zu betrachten beliebt, so geschieht es lediglich im Namen der menschlichen Feigheit, die das Bedürfnis hat, sich den hohen Wert des Daseins einzureden. So schreibt man beharrlich den äußeren Umständen meines Lebens die Früchte meines Nachdenkens auf die Rechnung. Bevor ich sterbe, will ich mich wehren gegen diese Erfindung der Schwäche und Gemeinheit und bitte meine Leser, dass sie meine Beobachtungen und Beweisgründe umzustoßen sich mühen, anstatt meine Krankheiten zu beschuldigen.]
Durch die Geistesverwandtschaft, die Leopardi zu Brutus bekundet, inszeniert er sich selbst heroisch. Die Passage sorgte aber ironischerweise dafür, den Bruto minore autobiographisch zu lesen. Dabei wird der selbstinszenatorische Charakter ebenso außer Acht gelassen wie der Umstand, dass es sich bei der Figur Brutus um ein schriftlich übermitteltes Bild handelt, das in der Literatur eine beachtliche Ambivalenz aufweist und die sich Leopardi für seine Lyrik aneignet. Vielmehr dient die Figur als Projektionsfläche für Leopardis Philosophie. Einen Fremdbezug über den Selbstbezug herzustellen, sollte dabei nicht als autobiographischer Akt überbewertet werden.47 Die Hypothese, dass das Werk eines Autors durch seine Biographie beeinflusst wird, lässt sich kaum von der Hand weisen und bleibt verlockend, um den negativen Gehalt der Dichtung einfach zu erklären oder auch von sich fern zu halten. Wenn die Negativität nur das Resultat eines unglücklichen Lebens48 war und keinen universellen Gehalt besitzt, wird ihr die Bedrohlichkeit entzogen. Bei einem den ‚negativen‘ Schriftstellern zugeordneten Poeten besteht das größte Problem in einem biographischen Zugang darin, dass der Blick durch diesen Filter verzerrt wird. Widersprüche werden seltener hinterfragt, Nuancen nicht mehr erkannt. Negativität ist zwar unumstritten ein Leitmotiv, in den Interpretationen verstellt sie jedoch die Sicht auf positive Impulse, obwohl diese ebenso entscheidend für die Bedeutung von Leopardis Werk sind. Prete bringt dies auf den Punkt:
[R]esterà da comprendere come da Leopardi a Baudelaire, da Hölderlin a Nietzsche, da Artaud a Bataille, la critica della ragione ha coniugato poesia con corpo, per indicare a mancanza, per raccontare la morte del senso, per dare parola al sogno di una mutazione.49
Leopardis Werk beinhaltet ein komplexes Zusammenspiel aus negativen und positiven Impulsen, die unterschiedliches Deutungspotential anbieten und unterschiedliche Zugänge eröffnen. Bini geht davon aus, dass das Werk eine Spannung zwischen dem Ideal und der Realität evoziert, die eine Desillusionierung einleitet, aus der ein ästhetischer Ausweg gewählt wird: „[A] beautiful poetry which is born out of an ugly truth. The correlation of philosophy and poetry could not have been more absolute.“50 Für die Relation von Welt und Kunst bedeutet dies, dass das Ideal auf der ästhetischen Ebene festgesetzt wird, während die Realität an der Unerreichbarkeit jenes Ideals krankt. Der Verstand führt dem Subjekt unerlässlich vor, was es nicht haben kann, statt das Ideal abzuschaffen. Wanning, der als Hauptaussage der Canti die Allgegenwärtigkeit des ‚Nichts‘ beziehungsweise der ‚Leere‘ sieht, betrachtet hingegen in seiner Kontrasthypothese das Ideal als Gegenpol zur Negativität: „Durch die Existenz punktueller positiver Erfahrungen dringt die Negativität des Daseins ins Bewußtsein und offenbart zugleich ihre Ausweglosigkeit“51. Die positiven Impulse, die durch ästhetische Mittel entstehen, ermöglichen erst den Zugang der Negativität zur Psyche. Dadurch beschreibt er einen Stillstand des Subjekts im Nichts:
Wer die absolute Kontingenzerfahrung und die dialektische Grundstruktur des Selbstbewußtseins nicht nachvollziehen oder nicht ertragen kann, der wird nach metaphysisch-dogmatischen Auswegen suchen, mit anderen Worten, er wird die Dialektik von Sein und Nichten, in der sich Werden und Vergehen vollziehen (vgl. Hegel, Logik, 1812-1816: I, 44), zum absoluten Sein oder zum absoluten Nichts hin stillstellen.52
Auch Bohrer sucht einen Zugang zu dem Werk über die Ästhetik und führt noch eine weitere Pessimismus-Kategorie ein: den Stimmungspessimismus, eine apriorisch negative Gestimmtheit, die er hauptsächlich in den Canti und im Zibaldone verortet und die er als primär poetisch ansieht. Ein Charakteristikum des Stimmungspessimismus ist das „reflektive Ausbalancieren des positiven und negativen Impulses, wodurch erst die Unendlichkeit, die Nicht-Abschließbarkeit der Negativität entsteht.“53 Positive Impulse werden zwar real empfunden, dienen dann aber der weiteren Negativierung der Gesamtaussage. Negativität wird als ästhetisches Leitmotiv und eine Art Gegenmodell zur ästhetischen Sublimierung verstanden. Insofern ähneln sich die Theorien von Wanning und Bohrer, variieren jedoch im Effekt. Laut Bohrer entstehen tatsächlich positive Effekte in der Psyche des Rezipienten, bei dem die „dialektische Gleichzeitigkeit von Verzweiflung und Hoffnung“54 zu einer Stärkung der eigenen Hoffnung führt.55 Andere Überlegungen zu Leopardi gehen davon aus, dass das Ideal nur ironisch angesprochen wird und der Dichter sich tatsächlich davon distanziert.56 Ironie ist aus Leopardis Werk nicht wegzudenken und insbesondere in den Operette morali und in den Paralipomeni offensichtlich. Ironie dient der Distanzierung vom Gehalt, revidiert ihn aber nicht.
Welchen Effekt Leopardis Lyrik beim Rezipienten nun auslöst, hängt vermutlich von dessen Fähigkeit ab, Negativität zu ertragen. Wannings Annahme, dass jeder Zugang zu Leopardi einer der genannten Hypothesen zuzuordnen sei, ist kritisch zu betrachten. Analysen der letzten Jahre, die ihren Fokus auf einzelne Gedichte legten, konnten leisere positive Nuancen zeigen, die sich jedoch vehement gegen die brachiale Kategorisierung stellen, so etwa Stillers Analyse des Gesangs57, Pretes Lektüre des Zibaldone58 und Kuhns Saffo-Analyse59.
Die Pessimismus-Hypothesen, unter denen das Werk traditionell betrachtet wurde, ermöglichen zwar einen einfachen Einstieg in ein unzugängliches Werk,60 sie versperren aber vor allem das Verständnis für seine Beschaffenheit: die rhizomatische Struktur, die trotz oder aufgrund ihrer repetitiven Eigenarten voller Mehrdeutigkeiten steckt. Fest steht, dass Leopardis poetisches Denken in seiner Aussagekraft immer auch erschaffend funktioniert: Formgebung und Bildsprache weisen oft in eine andere Richtung als das negative Argument. Prete richtet sich deshalb in seinem Vorwort des Manuale di filosofia pratica (eine Sammlung früher Einträge des Zibaldone) gegen die Zuschreibung zum Pessimismus:
Le osservazioni del Manuale mostrano come la voce pessimismo sia davvero la più impropria per definire lo svolgimento del pensiero leopardiano. Perché fino all’ultimo il poeta ha accolto nella lingua della poesia – e nel pensiero che è suo ritmo – il deserto e il fiore, il tragico e la leggerezza, il cerchio ineludibile della finitudine e il vento del desiderio, della sua incolmabile apertura.61
Einer der Gründe für die Komplexität dieses Zwischenspiels und die immense Menge an Interpretationsansätzen für Leopardis Werk ist die Polyvalenz der Begrifflichkeiten. Statt die Semantik der Begriffe innerhalb einzelner Phasen festzusetzen, muss der Leser sie vielmehr innerhalb der einzelnen Kontexte deuten. Dies gilt nicht nur für die viel diskutierten Gegensatzpaare, sondern auch für Leopardis ‚Nichts‘.
4Eine gleitende Semantik und die Orientierung am Nichts
Ein allgemeines Charakteristikum, das Leopardis Werk durchzieht, ist die Paarung von Begrifflichkeiten wie Vernunft und Natur, Antike und Moderne, Dichtung und Philosophie, Materie und Geist, Leben und Tod etc., die wiederholt als Gegenbegriffe auftauchen. Leopardis Werk weist dadurch eine Tendenz auf, die typisch für seine Zeit ist:
Die Serie von Begriffen und Gegenbegriffen, die die Literatur der Aufklärer und ihrer Gegner prägt, wie Vernunft und Offenbarung, Freiheit und Despotie, Natur und Zivilisation, Handel und Krieg, Moral und Politik, Dekadenz und Fortschritt, Licht und Finsternis läßt sich beliebig verlängern, ohne daß die gesetzten Begriffe jemals den Charakter verlieren, ihre Gegenbegriffe zugleich mitzusetzen und auszuschließen.1
Dies führt dazu, dass Leopardis Naturbegriff nicht ohne den Vernunftbegriff auskommt und die Antike immerzu die Kontrastfolie der Moderne darstellt. Strittig ist, ob es sich nun um Dichotomien handelt, ob teilweise ein dialektisches Verhältnis2 entsteht. Dieses ist jedoch fundamental durch das Übergewicht des Nichts gestört. Eine Auflösung in der Dichtung bietet sich an; dass die Dichtung Leopardis Leben bestimmt hat und in einer sinnlos erscheinenden Welt eine sinnvolle oder sinnstiftende Funktion einnimmt, dürfte wohl der kleinste Nenner sein. Aber können die vielfältigen Überlegungen aus unterschiedlichsten Disziplinen hierauf reduziert werden? Zumindest gibt es Versuche, einen literarischen Blick auf die Welt anzuwenden und dadurch Orientierung, wenn schon keinen Halt, zu finden. Dass allgemeine Aussagen zu Leopardis Denkbewegungen nicht so einfach sind und es sich vielmehr um ein Gleiten zwischen literarischen und außerliterarischen Konzepten handelt, kann an Leopardis Natur-Begriff verdeutlicht werden:
[O]ra indicando la natura naturans, ora la natura naturata,3 ora la natura ex parte subiecti (natura di qualche cosa, intesa come tendenza alla vita, come istinto a perpetuarsi), ora la natura ex parte obiecti (complesso di tutto ciò che esiste, che per la sua conservazione sacrifica gli elementi di cui è costituito), ora la natura quale principio informatore e finalistico dell’ordine cosmico, ora la natura come fato, meccanismo cieco.4
Die Tendenz, Gegensätze als Pole zu verstehen, die sich gegenseitig ausschließen und binäre Kategorien bilden, wird durch die Polyvalenz der Begrifflichkeiten konterkariert. Ebenso polyvalent wie die Natur ist auch Leopardis Vernunft-Begriff, der nur teilweise einen Gegenpol zur Natur darstellt. Er verwendet ihn für das allgemeine Erkenntnisvermögen des Menschen und in diesem Sinne als Teil des Menschen. Dann wiederum ist die Vernunft ein Werkzeug, das dem Menschen die komplexe Realität vermittelt.5 Richtet er sein Leben danach aus, so wird die Vernunft zur vernichtenden Waffe, während sie gepaart mit der Imagination durchaus vor irreführenden Trugbildern bewahren kann. Das Verhältnis der Natur (Imagination) zur Vernunft wird in seiner Ausgangssituation mit dem Verhältnis der Poesie zur Philosophie parallelisiert. Der Kategorienwechsel erweitert die Polyvalenz, da Kategorien einander gegenübergestellt werden, deren Vergleiche nicht zu identischen Resultaten führen. Kognitive und kreative Erkenntnissysteme, Ursprungsideen, Metaphysik, Naturwissenschaften, allerlei Logoi und menschliche Praktiken verschwimmen in diesen Begrifflichkeiten und müssen beständig neu verhandelt werden. Da Leopardi enge philosophische Exaktheit ablehnt, kann ihm dies auch kaum zum Vorwurf gemacht werden. Leopardi praktiziert analogisches statt logisches Denken.
Analogisch soll […] ein Denken heißen, das sich der Übergänge bedient und die begrifflichen Grenzen durchlässig oder „porös“ hält. Logisches Denken drängt auf Unterscheidung des Ähnlichen, analogisches Denken sucht Ähnlichkeiten im Verschiedenen. Logisches Denken drückt sich aus in Definitionen, analogisches Denken in Vergleichen.6
Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass auch Leopardi nicht auf „die moderne Tugend des Differenzierens“7 verzichten kann. Die Gegenüberstellungen und die Polyvalenz produzieren den kaleidoskopartigen Charakter seiner Literatur, der sein Werk besser beschreibt als Widersprüchlichkeit.8 Auf der Ebene der Canti sorgt die Polyvalenz für eine Kette von Assoziationen, die aus den unterschiedlichen Kontexten gewonnen werden kann und auf der Mikroebene des einzelnen Gedichts die Mehrdeutigkeit steigert. Im Folgenden wird dieser Übertragungseffekt als gleitende Semantik9 bezeichnet. Innerhalb dieser findet eine ständige Bedeutungserweiterung der Signifikanten statt; dabei entsteht eine rhizomatische Struktur von Signifikaten. Der Einstieg in die Struktur kann über unterschiedliche Signifikanten erfolgen, die dann den Assoziationsvorgang auslösen. Eine Einteilung des Werks in Phasen schwächt diesen Effekt ab, indem sie eine endgültige Umdeutung suggeriert, und sie vereindeutigt die Texte, wo keine Eindeutigkeit gewollt ist.
Das bekannteste Beispiel für Parallelisierungen – die Verhältnisse ‚Natur und Vernunft‘ verhalten sich parallel zu Poesie und Prosa – kann als folgende Assoziationskette gelesen werden: Die Sprache der Natur ist die Poesie, die Sprache der Vernunft die Prosa, weshalb sich der Dichter der Sprache der Natur und der Philosoph der Sprache der Vernunft bedient. Zeitlich verortet wird die Thematik durch den Gegensatz der Antike zur Moderne. Der antike Mensch denkt wie ein Dichter und erhält seine Inspiration aus der Natur. In den poetologischen Kommentaren aus dem Jahr 1821 fällt die Trennung zwischen Poesie und Prosa scharf aus:
Così a scuotere la mia povera patria, e secolo, io mi troverò avere impiegato le armi dell’affetto e dell’entusiasmo e dell’eloquenza e dell’immaginazione nella lirica e in quelle prose letterarie ch’io potrò scrivere; le armi della ragione, della logica, della filosofia ne’ Trattati filosofici ch’io dispongo; e le armi del ridicolo ne’ dialoghi e novelle Lucianee ch’io vo preparando. (Zib. 1394)
[Um meine arme Heimat zu wecken, werde ich die Waffen des Affekts und des Enthusiasmus und der Eloquenz und der Imagination in der Lyrik und in der literarischen Prosa, die ich schreiben konnte, gebraucht haben; die Waffen der Vernunft, der Logik, der Philosophie in den philosophischen Traktaten; und die Waffen des Lächerlichen in den Dialogen und den lukianischen Novellen,10 die ich vorbereite.]
Affekt, Imagination, Enthusiasmus und Eloquenz werden als Grundlagen einer Dichtung im naiven Sinne beschrieben und die Ursprünge seines eigenen philosophischen Handwerks in der Antike verortet und explizit nicht in der Moderne.11 Innerhalb der Canti verschwimmen die Grenzen zwischen Poesie und Prosa aber stärker, als es häufig in seiner Theorie anklingt, da eine naive Dichtung die Gegenwart nicht erfassen kann und auch die Philosophie deshalb Eingang in seine Dichtung finden muss, um einen Aktualitätsanspruch zu besitzen. Seine Tätigkeit als Schriftsteller stellt er damit als einen patriotischen Beitrag dar, wodurch sie bereits die ästhetische Dimension durchbricht.
Die Lektüre und Relektüre von Leopardis Texten schult den Rezipienten durch Repetition und den Einsatz von rhetorischen Mitteln in einer gleitenden Semantik. Obwohl die Leopardischen ‚Gegensatzpaare‘ die Tendenz aufweisen, in einer parallelen Konstruktion zueinander zu stehen, deren Grundlage im folgenden Kapitel noch erläutert wird, ergibt sich durch die Polyvalenz ein Bewegungsraum, der das zunächst starr wirkende System aufbricht. Teilweise entsteht die Polyvalenz überhaupt erst durch das Aufbrechen der gleitenden Semantik. Begriffe werden chiastisch neu gepaart, und dadurch kann beispielsweise der Mensch in den Gedichten als Teil der Natur oder von ihr ausgeschlossen dargestellt werden, die Vernunft kann vernichtend wirken oder eine kreative Form des Denkens ermöglichen. Durch dieses Verfahren entsteht ein Flimmern12 zwischen den Bedeutungen. Der Einstieg in diese Struktur kann in jedem Text über unterschiedliche Signifikanten erfolgen, die dann den Assoziationsvorgang auslösen und die Mehrdeutigkeit innerhalb der Canti steigern. Dadurch kommt der kaleidoskopartige Charakter zustande, der Leopardis Werk ausmacht.
Doch wonach richtet Leopardi seine gleitende Semantik aus? Sind es lediglich die Verbindungen, die er selbst herstellt, oder unterliegen ihnen Konzepte, die Ähnlichkeiten produzieren? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, bietet sich eine Analyse des Gedankenprogramms von Leopardis ‚Nichts‘ an. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die ‚Geschichte des Nichts‘ gegeben, um zu verdeutlichen, wie Leopardi in dieser zu verorten ist, und danach werfen wir einen genauen Blick auf Leopardis ‚Nichts‘ und seinen Einfluss auf die gleitende Semantik.
4.1Leopardis Grenzgänge ans Nichts
Die Geschichte der Erforschung des Nichts beginnt zumeist bei Parmenides, für den sich ‚das Nichts‘ nicht denken lässt, weshalb er den Fokus auf ‚das Sein‘ legt. Parmenides entbindet ‚das Sein‘ von individuellen und damit heterogenen Vorstellungen einzelner Menschen, indem er es an eine Gottheit bindet. Für Parmenides sind Sein und Denken deshalb identisch:
Dasselbe ist Denken und der Gedanke, daß IST ist; denn nicht ohne das Seiende, in dem es als Ausgesprochenes ist, kannst du das Denken antreffen. Es ist ja nichts und wird nichts anderes sein außerhalb des Seienden, da es ja die Moira daran gebunden hat, ein Ganzes und unbeweglich zu sein. Darum wird alles bloßer Name sein, was die Sterblichen in ihrer Sprache festgesetzt haben, überzeugt, es sei wahr: Werden sowohl als Vergehen, Sein sowohl als Nichtsein, Verändern des Ortes und Wechseln der leuchtenden Farbe.1
Denken und Sein fallen zusammen, weil sie sich gegenseitig bedingen und das eine nur durch das andere existiert. Dieses Denken erhebt das eine, ganze und bleibende ‚Sein‘ zu seinem einzigen Gegenstand und damit zum einzigen Gegenstand des wissenschaftlich-philosophischen Denkens.2 Ebenso schließt er alles aus, was nicht durch das Denken erkannt werden kann, und damit alle Sinneserfahrungen: „Ontischen Bestand hat nur, was durch das Denken (λόγω) faßbar ist, die Sinne liefern nur Trug, Nichtseiendes, das sich für Seiendes ausgibt.“3 Auch ‚das Nichts‘ lässt sich nicht denken oder kommunizieren. Alles Zeitliche wird aus diesem ‚Sein‘ ausgeschlossen, da dieses ‚Sein‘ nicht vergeht und auch zuvor nicht gewesen ist. Begriffe wie ‚Werden‘ sind deshalb leere Worthülsen. Diese Überlegungen bedeuten aber auch, dass alles, was gedacht werden kann, wahr und beständig ist. Dies führt zu einer radikalen Überschätzung der menschlichen Vernunft und zu einem Relativismus, der in einer Kultur nihilistische Züge annehmen kann. Tugend und Moral wird zur Frage der geschickteren Argumentation, weil alles wahr oder falsch sein kann.
Deutlicher wird dies noch bei dem Sophisten Gorgias, einem Zeitgenossen von Sokrates, der – vermutlich als Reaktion auf Parmenides – in einer bis heute radikalen Form ‚das Sein‘ in Frage stellt:
1. Es ist nichts.
2. Wenn etwas wäre, so wäre es nicht zu erkennen.
3. Wenn etwas wäre und es erkennbar wäre, so wäre es doch nicht mitzuteilen.4
Nicht nur ‚das Sein‘, sondern ebenso die Fähigkeit es zu erkennen oder über es zu sprechen werden in Frage gestellt. Stegmaier sieht darin eine Vorwegnahme der kopernikanischen und der kommunikativen Wende.5 Obwohl das Nichts nicht gedacht und ebenso wenig kommuniziert werden kann, lässt es sich denken, dass ‚das Nichts‘ nicht gedacht werden kann. Dadurch dass ‚das Nichts‘ sich eignet, um das Denken zu hinterfragen, wird das Problem ‚des Nichts‘ selbstreferentiell: „Das Denken ist das Nichts des Seins, und wenn sich das Denken auf sich bezieht, folglich das Nichts als Nichts denkt, überbietet es zugleich das Sein in radikaler Weise.“6 Aus diesen Überlegungen lassen sich endlose Schleifen bilden. Die gnadenlose Überschätzung der Rationalität und des Logos wird schließlich wieder stufenweise über Sokrates, Platon und Aristoteles zurückentwickelt.7
Hegel unterscheidet in der Wissenschaft der Logik ‚das Sein‘ und ‚das Nichts‘ durch die Methode der ‚bestimmten Negation‘: Alles ‚Sein‘ ist unterschiedsloses ‚Sein‘. Da über dieses ‚Sein‘ keine weiteren Aussagen getroffen werden können, ist es ebenfalls ‚Nichts‘. Denn es kann durch nichts bestimmt werden. Umgekehrt kann ‚das Nichts‘ ebenfalls durch nichts bestimmt werden, weshalb es gleichfalls ist. Hegel trennt durch das Verfahren der Unterscheidungen das Denken von einem präexistierenden Fremdbezug. Stattdessen ist sein System selbstreferentiell, es entwickelt sich aus sich selbst heraus und stützt sich selbst.8
An Hegels System kann Nietzsche nicht festhalten. Stattdessen kommt er zu dem Ergebnis, dass der Nihilismus mit all seinen Konsequenzen akzeptiert werden muss: Das Leben als Summe von Kontingenz und Evolution zu betrachten, auch wenn durch den Verlust und die Haltlosigkeit, die damit einzieht, ein „lähmendes Entsetzen“9 zu erwarten ist. Das Unterfangen, sich komplett auf den Nihilismus einzulassen, bedarf laut Nietzsche der vollkommenen Aufgabe von Illusionen und Unwahrheiten. Es wird zum Ziel, alle möglichen Unwahrheiten aufzudecken, wie etwa die eines vorgegebenen Sinns oder Ziels des Lebens. Dies bedeutet ein ständiges Hinterfragen vermeintlicher Wahrheiten, also auch derer, die der Nihilismus selbst erschafft. Indem der Nihilismus sich selbst zum Beobachtungsgegenstand macht, wird er reflexiv. Die Ziellosigkeit dieses paradoxen Verfahrens hat Nietzsche selbst erkannt:
Man hat nur spät den Muth zu dem, was man eigentlich weiß. Daß ich von Grund aus bisher Nihilist gewesen bin, das habe ich mir erst seit Kurzem eingestanden: die Energie, der Radikalism, mit der ich als Nihilist vorwärts gieng, täuschte mich über diese Grundthatsache. Wenn man einem Ziele entgegengeht, so scheint es unmöglich, daß „die Ziellosigkeit an sich“ unser Glaubensgrundsatz ist.10
Indem Nietzsche die Aufdeckung des Nihilismus zum Teil des Nihilismus erklärt und dadurch nicht nur ‚das Nichts‘, sondern auch der Nihilismus als selbstreferentiell enttarnt wird,11 bietet der Nihilismus durch seine Zielsetzung einen Halt in der Haltlosigkeit und negiert ihn umgehend wieder.
Dieser selbstbezügliche Begriff des Nihilismus dementiert als Operation (seine Aufdeckung) deren Resultat (den scheinbaren Gegenstand). Nietzsches nihilistisches Nichts tut sich so immer dort auf, wo etwas, an das man sich letztlich zu halten versucht, sich der Vergegenständlichung entzieht, wo es sich weder denken noch aussprechen lässt, sondern schlechthinnige Ungewissheit bleibt, die Angst erregt. Es wird als beängstigende Desorientierung erfahren. Weil er in keiner Weise zu vergegenständlichen ist und schon bloße Benennungen Gegenstände vorspiegeln, hat Nietzsche in dem Satz, den er dann veröffentlichte, selbst den Namen ‚Nihilismus‘ weg- und nur Auslassungspunkte übriggelassen. So blieb er freilich auch den Leser(inne)n verborgen, sollte ihnen vielleicht verborgen bleiben, weil den meisten von ihnen kaum der Mut zuzutrauen war, von ihm wissen zu wollen.12
Leopardi trennt sich von Nietzsche schon allein durch die unterschiedliche Sicht auf die Illusion, doch auch Leopardis Gedankenbewegungen zum ‚Nichts‘ führen dazu, dass sein Verfahren ins Ziellose ausufert. Bei oberflächlicher Betrachtung lassen sich Leopardis Betrachtungen zum ‚Nichts‘ in zwei Kategorien aufteilen, die aber einer eingehenden Analyse nicht standhalten: Die persönliche Nichts-Erfahrung und die Spekulation über ‚das Nichts‘. Die persönliche Nichts-Erfahrung begegnete uns bereits eingangs, weil sie als Stütze der persönlichen Pessimismus-These dient. Vor allem in Briefen des jungen Leopardi wird ‚das Nichts‘ zu einer Totalität erklärt, die das Subjekt umgibt und schließlich übernimmt:
Tutto è nulla al mondo, anche la mia disperazione, della quale ogni uomo anche savio, ma più tranquillo, ed io stesso certamente in un’ora più quieta conoscerò, la vanità e l’irragionevolezza e l’immaginario. Misero me, è vano, è un nulla anche questo mio dolore, che in un certo tempo passerà e s’annullera, lasciandomi in un vôto universale, e in un’indolenza terribile che mi farà incapace anche di dolermi. (Zib. 72)
[Alles ist Nichts in dieser Welt, auch meine Verzweiflung, die jeder Mensch – der weise, aber auch ruhiger ist, und sicherlich auch ich selbst in ruhiger Stunde – als vergeblich, irrational und imaginär betrachten wird. Ich Elendiger. Vergeblich und ein Nichts ist auch dieser mein Schmerz, der nach einer gewissen Zeit vergeht und nichtig wird, mich in einer universalen Leere zurücklässt und in einer schrecklichen Trägheit, die mich sogar unfähig macht, zu klagen.]
Derartige Beschreibungen finden sich ebenso in den tagebuchartigen Einträgen des Zibaldone





























