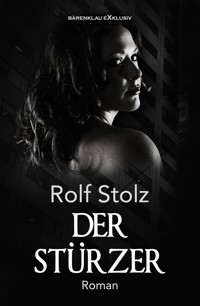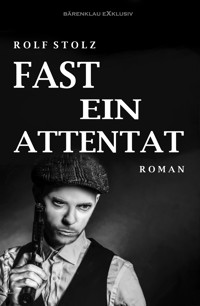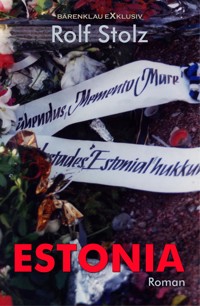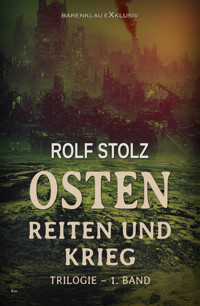
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
REITEN UND KRIEG ist der erste Band der Trilogie OSTEN.
Deutsche Verhängnisse, Geschichten einer Minderheit in der Minderheit – teils Mittäter, teils Opfer. Menschen, die das Glück suchen und stattdessen Richtung Krieg marschieren, gehen am Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts in die Städte des Westens. Innerlich kommen sie nicht vom Osten und seinen Dörfern los, bleiben Fremde im unsichtbaren Ghetto. Zwar können sie mit korrigierten Ahnenpässen ihre Wurzeln verheimlichen und sich retten, aber der Preis des Mitmachens ist, von Erinnerungen zerstört zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rolf Stolz
Osten
Reiten und Krieg
Roman-Trilogie – 1. Band
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Claudia Weber nach Motiven, 2025
Lektorat/Korrektorat: Stephanie Burmeister
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau (OT), Gemeinde Oberkrämer. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
www.baerenklauexklusiv.de
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Osten
Reiten und Krieg
Zuvor
Mit von der Partie sind …
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Das Buch
REITEN UND KRIEG ist der erste Band der Trilogie OSTEN.
Deutsche Verhängnisse, Geschichten einer Minderheit in der Minderheit – teils Mittäter, teils Opfer. Menschen, die das Glück suchen und stattdessen Richtung Krieg marschieren, gehen am Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts in die Städte des Westens. Innerlich kommen sie nicht vom Osten und seinen Dörfern los, bleiben Fremde im unsichtbaren Ghetto. Zwar können sie mit korrigierten Ahnenpässen ihre Wurzeln verheimlichen und sich retten, aber der Preis des Mitmachens ist, von Erinnerungen zerstört zu werden.
***
Für E. S. –
sie wusste am Anfang,
was aus mir werden wird.
Führe uns zusammen aus den Völkern.
Es kann aber niemand zwei Herren dienen, es sei denn,
er verriete sie beide und sich zugleich.
Und der Gerechte, was hat er getan?
Osten
Reiten und Krieg
Romantrilogie – 1. Band
von Rolf Stolz
Zuvor
Immer schon gab es Helden – Sieger, ehe sie der Genickbruch ereilt, einstige Sieger, auf dem Rücken zappelnd und Schonung erflehend, und traurige Helden, die noch vor dem ersten Kampf ihre Segel gestrichen haben und mit wenig Blut an den Händen als kleinwüchsige Cromwells sich aufschwingen zum Tyrannen über die schmalen Felder zwischen Abbruchhäusern und Abfallhalden. Solch einer ist Edgar, der Held dieses Buches, und so sind auch die Gefährten geraten, die seine Ausfahrten begleiten.
Der Roman erinnert an die vielen Namenlosen, die seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts von Osten her ins Ruhrgebiet kamen – angelockt von der Aussicht auf Arbeit und Aufstieg, oft verhöhnt als »Polacken« und angefeindet als lästige Konkurrenten, manchmal aber auch offen und gut aufgenommen von jenen Einheimischen, die nicht nur sich selbst sahen. Klügere, Durchgeistigtere werden beklagen, dass zwischen der ersten und der letzten Seite uns nicht jene wunderbaren Menschen begegnen, die alles über ihr Zeitalter wissen und die verstanden haben, wie der Hase gelaufen war, ehe der Wolf ihn zwischen den Zähnen hatte. Keine meiner Gestalten bewältigt die Welt und übertrifft sie. Sie schlagen ihre Bahn ein – manchmal, indem sie zur Bahn gehen, um fort- und vorwärtszukommen – aber oft genug benutzen sie die auch für Heimweh und Heimkehr. Am Ende wird auch mit denen, die die Zügel versuchsweise einen Augenblick halten durften, radikal Schlitten gefahren. Und doch sind sie Helden, die aufrecht unter die Kufen geraten und der Lawine entgegengehen.
Der Roman schaut auf die Geschichte deutscher Verhängnisse aus dem Blickwinkel von Nachfahren jener Juden, die nach der Dreiteilung Polens sich im späten achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhundert mit ihrem Übertritt zum Christentum den protestantischen Deutschen anschlossen. Als Minderheit in der Minderheit, als Fremde, die ihre Fremdheit verbergen und doch nicht von ihrer Herkunft loskommen, können sie mit Chuzpe und mit geschickt korrigierten Ahnenpässen einigermaßen erfolgreich vertuschen, wer sie sind. So gelingt es ihnen, mitzumachen und sich zerstören zu lassen.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ruhrgebietsstadt Neufeld: Im Haus von Laura Saarow, der Witwe des 1944 gestorbenen Eisenbahnbeamten Edwin Saarow, leben die Familien von dreien ihrer fünf Kinder. Im Erdgeschoss wohnen zusammen mit der Mutter die jüngste Tochter Lina, deren Mann Josef Antall und zwei Kinder, im ersten Stock Lauras älteste Tochter Ellen und deren Mann Edgar Saarow, im Dachgeschoss Lauras jüngster Sohn Karl mit seiner Frau Irene und ihrem Sohn. Ein Zimmer dort ist umstritten und steht leer.
Karl, der als spätes und letztes Kind immer eine Art Kronprinz war, ist mit Ellen geradezu symbiotisch verbunden, während beide die anderen Geschwister fast wie Außenstehende betrachten – Ottmar, den Ältesten, der sich rar macht, Luise, die mittlere Schwester, die als Kleinkind im Ersten Weltkrieg zu einer Tante nach Sachsen-Anhalt kam und erst als junge Frau zurückkehrte, und auch Lina, die im Haus das Aschenputtel spielt.
Laura, Edwin, Edgar, Josef und Irene stammen aus dem Osten, aus der bis zum Versailler Vertrag deutschen Provinz Posen. Edwin kam schon 1905 ins Ruhrgebiet und holte Laura nach. Alle ihre Kinder wurden in Neufeld geboren. Edgar und Josef sind seit Ende der zwanziger Jahre hier, Irene seit 1946. In vielem leben sie wie in einem zeitweiligen Exil. Haus und Großfamilie sind eine Art selbstgewähltes Miniaturghetto, das mit den Einheimischen nur die nötigsten Kontakte unterhält. Man fühlt sich anders und ist anders. Leitmotive, Weltsicht und Verhaltensrepertoire dieser Sorte Mensch zeigen oft sprunghafte Wechsel zwischen misstrauischer Vorsicht und vertrauensseliger Naivität, zwischen zögernder Unentschiedenheit und spontaner Radikalität, zwischen Veränderungslust und Veränderungsscheu, zwischen Allmachtsphantasien und Vernichtungsfurcht.
Die zentralen Figuren des Romans werden in unauflösliche Widersprüche hineingeboren, arrangieren sich mit ihnen provisorisch und werden doch mit den Doppelbödigkeiten und Zerrissenheiten ihrer Zwischenexistenz nicht fertig: Bauern, die keine Bauern sein wollen, sondern sich zu Krautjunker-Bohemiens stilisieren; Fahrdienstleiter, die lieber wieder auf ihrem Dorf wären und ihre Söhne zurückschicken wollen in die alte Heimat; Protestanten, die ihr jüdisches Erbe innerlich verfestigen und nach außen hin ableugnen; Heimatlose, die als von vornherein verlorene Minderheit mit aller Macht über Generationen an ihrer Sprache und ihrem Land festgehalten haben, aber nicht bleiben können und überall fremd in der Fremde sein werden.
Von dem zum Protestantismus konvertierten Juden Abraham Krakauer, der 1780 sich in einer westpolnischen, später eine Zeit südpreußischen Kleinstadt ansiedelt, seinen Namen in Martin Krakowski ändert und fortan um die Aufnahme in die deutsche Minderheit und in die »gute Gesellschaft« kämpft, wechselt das Geschehen zu den Erben derer, die im achtzehnten Jahrhundert Sumpfwildnis und Sandböden kultivierten. Im zwanzigsten Jahrhundert kommen die Söhne und Enkel der einstigen Neusiedler mitten hinein in Krieg, Unterdrückung, Vertreibung.
Die Romantrilogie OSTEN ist auch ein später Nachruf für die verlorene Landschaft und Kultur zwischen den großen Strömen, zwischen Oder, Warthe und Weichsel, ein Abgesang auf das verschwundene Gegeneinander, Miteinander und Ineinander von Deutschen, Polen und Russen, von Protestanten, Juden, Katholiken und Orthodoxen. Aber vielleicht lebt in Menschen, die mehreres auf einmal sind, die nicht sich auflösen lassen in die armselige Kargheit eines Lebens ohne Widerspruch, ohne Brüche, ohne Unberechenbarkeit diese Welt der Uneindeutigkeiten weiter.
Als ich dieses Buch schrieb, habe ich mich nicht gefragt, ob jemand außer mir es lesen wird. Ich wusste: Einzelne unbeirrbare Freunde, der eine oder andere Bekannte und eine Handvoll mir zum großen Teil auf ewig unbekannt bleibender Leser werden es lesen – aus Neugier, aus Pflichtgefühl oder aus sonstigen, unerfindlichen Gründen. Aber ob jemand es unbedingt und mit finsterer Entschlossenheit lesen WILL, ob jemand all das, was nur zu oft unter dem weiten Mantel der Generalamnesie zum Verschwinden gebracht wird, erfahren will, erschien mir bei der Niederschrift ebenso zweifelhaft wie zweitrangig.
Mein Buch handelt, lässt man einige wenige besondere Einblendungen beiseite, von wenigen Menschen in einem uns fern und unbegreiflich gewordenen überschaubaren Zeitabschnitt vor mehr als fünfzig und zum Teil fast hundert Jahren. Es spielt am Rande der großen Ereignisse, außerhalb der maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen und oft entfernt von dem, was damals die große Masse bewegte. Nur Tote kommen vor – Tote, die ich gekannt habe und andere, von denen ich sagen hörte, und vor allem ganz frei erfundene Tote. Eher selten und beiläufig ähneln sie den Lebenden in der einen oder anderen Eigenschaft, finden sich an ihnen einzelne Züge eines noch unter uns Lebenden.
Mein Buch ist ein Requiem, in den Worten eine gespenstische unablässige Wiederkehr dieser Menschen. Deshalb musste ich es schreiben: Für sie, die es nicht mehr gibt, aber die es gegeben hat und die voller Mut und Todesangst waren.
Mein Buch kreist um eine einzige Menschengruppe. Sie waren Verworfene, Hinausgeworfene aus allen alten Sicherheiten und Verfolgungsgewissheiten, verstreut über alle Straßen und Winkel. Sie, wird man sagen, erhielten die verdiente Quittung für ihren Verrat am alten Glauben und am alten Volk. Das ist nicht einmal ganz falsch, denn sie nahmen insgeheim diese Abrechnung an, nahmen selbst erdachte Sühnegefahren und Prüfungen auf sich, um die Sache wieder auszugleichen. Sie wussten von Anfang an, dass es weder einen Weg zurück noch ein spätes Erneut-Gut-Machen geben würde. Sie versuchten die Quadratur des Kreises, sie versuchten das Allerunmöglichste, nämlich zugleich drinnen und draußen zu sein, eine Heimat zu finden und ein Fremder in dieser Heimat zu bleiben. Im unsichtbaren Herz, in allen Lebensgefühlen hatten sie sich nicht einen Hauch losgerissen von ihren Vorfahren, sie trugen weiter in sich die Hoffnung auf den Erretter, der am Ende der Tage wiederkehren wird aus der Verbergung, um alle Tränen zu trocknen und der Trennung ein Ende zu machen. Sie lebten auf den Schwelbränden und an den Aschenhängen, sie flohen, sie wurden vertrieben, sie töteten und wurden getötet und töteten sich selbst, sie wuchsen heran, liebten und hofften und gingen hinab zu den Vätern.
Wenn die Adler sinken oder längst schon in Stücke gebrochen sind, dann sind es nur noch die Angeworbenen, die Hinzugekommenen, die Fremden, die das Schwert nicht von sich werfen und nicht fliehen. Weil sie nie eine Heimat hatten, halten sie sich nur aus diesem einen Grund an ihrer jetzigen, versuchen sich jedenfalls zu halten an ihr. Könnten sie auch auf der anderen Seite der Front sein? Es wäre möglich, aber jetzt sind sie auf dieser Seite und können nicht hinüber und hin und her wechseln wie all die gewöhnlichen Hilfstruppen, die durch Geld, Angst und Dummheit zeitweise gewonnen waren und die zur Not zurückfinden in ihren alten Dreck. Die Rhomäer wussten das und die diversen Verführer in den Bunkerkellern in Berlin auch. Nur die Verrückten und die von Anfang an Verlorenen kämpfen, wenn der Kampf schon vorbei ist.
Was waren das für Menschen, waren sie wie wir? Juden waren sie und auch keine Juden, ganz besondere Juden, sie alle und alle gleich. Die einen näher, die anderen ferner, die einen wussten es kalt oder geängstigt und die anderen ahnten es aufgeschreckt oder trotzig. Aber weil alle es waren, war es in allen sichtbar und mit bloßen Händen zu greifen. Sie waren Juden, und was sie waren, sind andere jetzt und von jetzt in die fernsten Ewigkeiten. Alle anderen rings herum ahnten es oder wussten es sogar, und manche sagten es, wenn sie gerade aus dem Raum gegangen waren und manche, wenige, die sich hervorwagten mit ihrer Wut und ihrem Hass, sagten es, wenn sie noch zugegen waren. Oft genug aber gingen sie hinaus im Augenblick kurz davor oder taten, als hätten sie es nicht gehört und als wäre es nicht ausgesprochen. Sie, die so viel sprachen, schwiegen untereinander und schwiegen miteinander und gegenüber ihren Kindern schwiegen sie erst recht und doppelt und dreifach. Sie schwiegen und warteten, was ihnen geschah. Sie schwiegen auf der Flucht und zwischen zwei Fluchten. Sie schwiegen, weil sie Juden waren und weil sie keine Juden waren wie die anderen, wie die jüdischen Juden. Sie schwiegen, bis sie sich ganz verschwiegen hatten, bis sie verschwunden waren hinter ihrem Schweigen, bis selbst dieses Schweigen mit ihnen verschwunden war, bis von ihnen keine Rede mehr sein konnte, bis sie ihre Flucht vergessen und deren winzige Spuren verwischt hatten und mit diesen ihren erzwungenen unsühnbaren Verrat.
Niemand kennt die Gerechten. Die Völker kennen sie nicht und die Mörder kennen sie nicht. Unter den Mördern müssen sie leben als Mörder, dass ihnen darin die unverkürzte Schuld bleibe. Kaum kennen sie sich selbst, kaum wissen sie, dass sie gerecht waren und gütig inmitten des Mordens, und sich zu helfen in der schmalen Spanne, bevor schlussendlich ihr lange verzögertes Sterben beginnt, wissen am allerwenigsten sie.
Mit von der Partie sind …
NEUFELD
Edwin Saarow, Bruder von Edgar Saarow Senior, verheiratet mit Laura Sommerfeld, einer Schwester von Ludwig Sommerfeld; zuerst in Kolmar, dann in Neufeld, Bergstraße.
Die Kinder von Laura und Edwin Saarow:
- Ottmar Saarow, verheiratet mit Hedwig Kron; ihre Kinder: Alfred und Helga; in Neufeld, Sandstraße.
- Ellen Saarow, verheiratet mit Edgar Saarow Junior, in Neufeld, Bergstraße.
- Luise Karger, verheiratet mit Paul Karger; ihre Tochter: Renate; in Neufeld, Marienburger Straße.
- Karolina Antall, verheiratet mit Josef Antall; ihre Töchter: Karla und Petra; in Neufeld, Bergstraße.
- Karl Saarow, »der kleine Karl«, verheiratet mit Irene Ornat, ihre Söhne: Wolfgang und Jürgen; in Neufeld, Bergstraße.
Robert Feinbier, verheiratet mit Eugenie Ornat, Cousine von Irene Saarow; in Neufeld, Kriegerstraße.
Helmut Saarow, Neffe von Edwin Saarow, in Neufeld, Weststraße.
Ewald Sommerfeld, Cousin von Laura Saarow, verheiratet mit Maria Schott; ihre Kinder: Alma, Amalie (»Male«), Anne und Walter Sommerfeld, verheiratet mit Maria (»Mia«) Gornik; in Neufeld, Sandstraße.
Ernestine Strutzberg (»Tante Struppi«), Witwe; ihre Kinder: Willi und Marie; in Neufeld, Glogauer Straße; Marie heiratet Karl Saarow, »der große Karl«.
KOLMAR
Hans Abraham, verheiratet mit Regine Thrams, Nichte von Klara Ornat; nach dem Krieg in einem Dorf bei Kreiensen, dann im Sauerland; ihre Kinder: Doris und Wolfgang;
Leonore Abraham, Schwester von Hans Abraham; nach dem Krieg in Pirna, später im Sauerland.
Ruth Friedländer (»Tante Ruth«), Cousine von Edgar Saarow Senior; nach dem Krieg in Lüneburg.
Eduard Ornat, verheiratet mit Klara Welk; zuerst in Konin, dann in Siebenschlösschen bei Kolmar, nach dem Krieg in Hagenow.
Die Kinder von Klara und Eduard Ornat:
- Elisabeth (»Betty«) Gasch, verheiratet mit Robert Gasch (»Herrchen«), in Wongrowitz, später in Dorsten; ihre Kinder: Horst und Ulla.
- Hermann Ornat, verheiratet mit Sieglinde Rosen; in Wongrowitz, nach dem Krieg in Goslar, ihre Kinder; Inge, Hans und Friederike.
- Paul Ornat, in Wongrowitz; in Rußssland 1943 gefallen.
- Willy Ornat, in Siebenschlößchen, später im Ruhrgebiet, nach dem Krieg in Goslar verheiratet mit Anna Fürstenau aus Schlesien.
- Ruth Lenz, in Posen, nach dem Krieg in Uelzen und später in Hagen; war verheiratet mit dem im Krieg verschollenen Emil Lenz, von ihm die Kinder Achim, Wolfgang, Petra und Rosemarie; heiratete nach dem Krieg Oswald Seehaus, ließ sich scheiden und heiratete Ernst Schmiele.
- Frieda Kromann, verheiratet mit Willi Kromann, in Spiegel, später in Goslar; ihr Kind Karoline.
- Anna Ornat, in Kolmar, verheiratet mit Simon Ornat, nach dem Krieg in Dorsten und später in Neufeld; ihre Kinder Daniel, Raphael und Beate.
- Irene Saarow, verheiratet mit Karl Saarow; in Siebenschlösschen, später in Wongrowitz, nach dem Krieg in Neufeld.
- Martin Ornat, verheiratet mit Sibylle Koll; in Siebenschlösschen, später in Düren; ihre Kinder Simon und Anke.
Willi Ornat (»Bongo«), Neffe von Eduard Ornat wie auch von Klara Welk, in Wongrowitz, nach dem Krieg in Neufeld und später in Salzuflen.
Karola und Karin Arndt, Töchter der Nachbarn von Eduard und Klara Ornat; Karola ist nach dem Krieg Chefsekretärin in Berlin, Karin geht ins Rheinland.
OSTEN
Edgar Saarow Senior (»der alte Edgar«), Bruder von Edwin Saarow, verheiratet mit Mathilde Dederichs.
Die Kinder von Mathilde und Edgar Saarow Senior:
- Karl Saarow (»der große Karl«), in Osten, später in Neufeld, verheiratet mit Marie Strutzberg, nach deren Tod verheiratet mit Paula Abraham; 1941 auf Kreta gefallen.
- Hedwig (»Hete«) Sommerfeld, in Osten, später in Berlin, verheiratet mit Siegfried Sommerfeld.
- Edgar Saarow Junior, in Osten, später in Neufeld, verheiratet mit Ellen Saarow.
- Horst Saarow, in Osten, später in Waldmühle, nach dem Krieg in Lechersiefen, verheiratet mit Elisabeth Hürtgen (»Liesel«); ihre Kinder: Hartmut, Felix und Donata.
- Ernst Saarow, in Osten; im Krieg auf der Krim verschollen.
- Hilda Schlender, in Osten, nach dem Krieg im Rheinland, verheiratet mit Willi Schlender.
- Gerta Saarow, in Osten, später in Hagen.
- Inge Saarow, in Osten, später in Hagen.
Nachbarn von Edgar Saarow Senior: Leopold Erdmann und Albert Siwertz.
FRIEDEBERG, später HAGENOW, dann NEUFELD
Daniel Krüger, Cousin von Edgar Saarow senior und Edwin Saarow, verheiratet mit Else Sommerfeld, Schwester von Laura Sommerfeld; ihre Kinder: Dorothea (»Doro«) und Heinrich (»Heinz«).
KONIN
Lisa und Cornelia Krüger, Schwestern, Nichten von Eduard Ornat; nach dem Krieg in Berlin, später im Rheinland.
BERLIN
Ludwig Sommerfeld, Bruder von Laura Saarow, verheiratet mit Anna (»Änne«) Kramer; ihre Kinder: Siegfried Sommerfeld, verheiratet mit Hete Saarow; Helmut, Friedrich, Esther, Raphaela.
BALGA (Ostpreußen)
Margot Ornat, Nichte von Eduard und Klara Ornat; ihr Kind: Ursula (»Ulla«).
Erstes Kapitel
Etagen
Zweiter Mai 1951. Ellen schrie von unten her, mit all der Kraft einer starken, groß und breit geratenen Frau: »Für unser Kind wird das sein, wir brauchen das Kinderzimmer. Ihr habt genug Platz, ihr kommt hin. Sowieso waren wir zuerst da.« Sie war nicht allein: Sie hatte ihren Ritter keine zwei Schritte entfernt auf die oberste Treppenstufe gescheucht. Die andere Frau, jünger und zwei Köpfe kleiner, die oben an der Treppe den besseren Platz hatte, mittendrin im Kampf, wollte erst eins draufsetzen, dass eine alte Kuh mit vierzig nicht mehr kalben wird, aber dann besann sie sich und blieb ruhig. Sie schwieg auch deshalb, weil sie gerade jetzt an Ellens Totgeburt und an ihr eigenes, nach zwei Monaten totes Kind denken musste. Die unausrottbaren Innenbilder stopften ihr fürs erste den Mund.
Strittig war eine Kammer, zwischen Dachschräge und Dachwohnung eingeklemmt, vielleicht drei mal drei Meter groß. Früher hatte sie jahrzehntelang leer gestanden wie der ganze Speicher und die einstigen Dienstmädchenkammern, in denen sich vor hundert Jahren der erste Erbauer und Hausherr, ein calvinistischer Sektenprediger, Nacht für Nacht ausgetobt hatte und seine ganze Wut über die Unbekehrten und das verrottete Schöpfungsgemache abgeworfen hatte auf die Mägde unter ihm, und sein heißer Verschüttungsschweiß und der kalte Angstschweiß seiner Höllenträume waren eingezogen in die Wände und zurückgeblieben in den knarrenden rotbraunen Dielen.
Seit der Krieg vorbei war, seit Karl zurückgekommen war, verlaust und angeschossen, aber doch noch ziemlich vollständig, der jüngste der beiden Söhne, der wirkliche Prinz, der geborene Gewinner, wohnte er hier oben über allen, mit Irene, die noch keine dreißig war und doch schon ein totes Kind hinter sich hatte und ein lebendiges mit sich, Jürgen. Der war jetzt weggesperrt, damit er nichts mitbekam von dem Streit, und er musste doch genug hören, um zu wissen, wer da aufeinander los ging und dass es ernst war, kein kleiner Krieg.
Es war eben kein Streit wie jeden Tag. Die Sache wurde nicht besser und leichter davon, dass sie alle zusammenhingen und aneinanderhingen. Karl hatte seine Schwester geliebt, Ellen, die älteste der drei Schwestern, seit er denken konnte, er hatte sie geliebt, bevor sie Edgar näher an sich heranließ und danach und bevor er Irene kennenlernte und dem Schwesterchen fast das Herz brach, obwohl sie da doch längst verheiratet war, und danach liebte er sie immer noch und sie ihn, immer weiter fort, bis beide abmachten fast fünfzig Jahre nach dem Geschrei, kein halbes Jahr getrennt.
Edgar und Karl standen sich seitlich vom Treppengeländer gegenüber, kaum einen Meter auseinander. Beide rot im Gesicht, die Spucke im Mund zusammengesammelt, um gleich loszuspucken, Schweiß auf der Stirn und unter den Achseln. Edgar brüllte was von den Koffern, in denen nur Dreck sei, man könne sie ungeöffnet wegwerfen. »Allenfalls die Nutten-kleidchen, die könnt ihr noch verkaufen. Langsam will die sowieso keiner mehr.« Das letzte DIE war wie ausgezirkelt, es passte auf die Kleider und auf die Frau, die sie trug. Das gab Karl den Rest. Er machte auf dem Absatz kehrt. Erst fürchtete Irene, er würde sich wegschleichen und das auf sich und auf ihr sitzenlassen ohne klare Rache, aber dann kam er keine Minute später zurück.
Er war nach unten und durch Linas Wohnung gerannt, in den Schuppen hinter der Waschküche und hatte sich mit einem Beil bewaffnet. Er hatte zurück den Weg außen ums Haus genommen, durch das rote Holztor, den dunklen Zwischengang, fünf Meter über die Straße (lass die Nachbarn denken, was sie denken, wie sie da von weitem glotzen mit offenem Hals), wieder in die Tür und die Treppe hoch. Unten in der Wohnung wollte Lina, die den Lärm natürlich gehört hatte, aber den Teufel nicht herauskam aus ihrer Tür, ihm auf dem Rückweg noch etwas sagen und sozusagen mitgeben, was wusste sie noch nicht so genau und es blieb bei dem Wollen wie bei ihr fast immer. Der jüngste Bruder und die jüngste Schwester, die kurze Jahre die Allerjüngste war und mittendrin, die haben sich einfach keine Schnitte zu sagen.
Karl war an der großen Schwester vorbei, nicht ansehen, keinen Ton sagen, sich nicht aufhalten lassen, blieb auf dem letzten Treppenstück auf halber Höhe stehen, schlenkerte drohend und lächerlich mit dem Beil und brüllte: »Geh jetzt da weg aus unserer Etage. Da oben sind wir. Drei gegen zwei, das müsst ihr endlich begreifen. Was kann ich dafür, dass ihr weniger seid. Nach dem nächsten Reich werdet ihr immer noch zwei sein und wir sind dann vielleicht schon zu viert oder fünft.«
Wenn Karl brüllte, was selten genug geschah, war er gleichzeitig auch irgendwie ruhig, wusste, wer er war und wer die anderen waren und wo bei denen die tiefsten Wunden saßen. Allerdings konnte er nicht wissen, dass es kein nächstes Reich geben würde. Wie nach den zwölf statt tausend Jahren aus dem einen großen Reich zwei kleine Reichlein geworden waren, wurde nach vierzig statt hundert Jahren aus den zweien wieder EINS und doch kein neues Reich und unterwegs wurde aus Karls Schwester eine allein, die zurückblieb ganz ohne Mann. Schon vorher ohne Kind war sie seltsam angedüstert geworden, aber jetzt wurde sie schwarz. Die Trauerkleider und die Trauer wuchsen in sie hinein, sie schlief keine Nacht mehr, ohne immer wieder aufzuwachen in der einen Angst, die Fremden würden sie jetzt holen kommen. Über den Tag sann sie nach über die Strahlen, die aus den benachbarten Wohnungen gegen sie gerichtet wurden und über den Verwünschungszauber der Alten im Erdgeschoss, die so freundlich lächelte bei jeder Begegnung. Wie die Verfolger und Festnehmer alle im Anfang gut tun, ehe sie die Flammen heiß genug haben, dass die lange langsam sich einfressen können und am Ende kaum Asche zurückbleibt.
Edgar ging nicht weg. Er spuckte aus, und das war bei ihm, der nicht einmal auf dem Hof oder im Garten sich das zugelassen hätte, nicht einmal ganz ohne Zeugen, ein fatales Zeichen, dass die Brücken zurück komplett fort waren, dass er außer sich war und frei von all seinen Haltungen und Rücksichten. Er hob den Kopf, stellte sich hin, als wolle er salutieren und dann das Gewehr in Anschlag nehmen und hinter sich bringen, was getan werden musste: »Komm doch, ich bin hier. Pass auf, wie du gleich unten liegen wirst. Ich breche dir alle Knochen einzeln und das Genick obendrauf.« Karl nahm zwei Stufen auf einmal, zögerte kurz, aber da war schon Irene zwischen ihnen und packte sein Beil. Aus lauter Überraschung ließ er es los.
Irene stand zwischen den Männern, ihr Kopf auf Augenhöhe mit ihrem Mann, das Beil halb ausgestreckt gegen Edgar. Mit einem Zittern in der Stimme, das alle sonst bemerkten, nur sie selbst jetzt nicht, schrie sie: »Seid ihr völlig verrückt geworden? Wollt ihr so verrecken und uns alle ins Unglück bringen? Ihr gebt euch jetzt beide die Hand und jeder zieht ab in seine Wohnung! Los schon! Sonst … Ich habe noch das Beil.« Karl bewegte sich als erster, taperte wortlos hoch, hielt Edgar die Hand hin, der starrte sie einen Augenblick lang an, als sei sie ein unbekanntes Flugobjekt. Dann ergriff er sie, hielt sie so kurz wie möglich in seiner, am liebsten keine Zehntelsekunde, drehte sich wandwärts und machte, dass er nach unten kam. Er packte seine Frau am Arm, schob sie regelrecht in Richtung Wohnungstür und verschwand mit ihr in ihren zwei Räumchen, ohne ein Wort, ohne noch mehr Niederlage zu schmecken und noch mehr sinnlose Wut sinnlos herauszuschleudern.
Nur wenige wussten, dass Laura, Karls Mutter, Irene lange oder auch immer und bis zum Schluss abgelehnt hatte, weil sie sich für ihren Sohn etwas Besseres ausgedacht und gewünscht hatte. Anfangs zeigte sie ihr Missfallen ganz offen, aber später war es innendrin wohl immer noch da. In dieser so gütigen und geradezu heiligen Frau, die eigentlich zu allen freundlich war, lächelnd und ohne Schärfe. Es hatte auch damit zu tun, dass Karl der Jüngste und Letzte war, etwas Besonderes in dieser Fünferreihe, die ihr unter Hitler das Mutterkreuz in Bronze eingetragen hatte, zum Silbern fehlte nur noch ein Kind, und so war es zwar nicht das mit den Schwertern und Brillanten für das Doppeldutzend, den fröhlichen Wurf im Jahresabstand von unter zwanzig bis Mitte vierzig, aber doch eine Belobigung für gelieferten Aufwuchs.
Das Mädchen aus Polen, so hatte Laura Irene genannt. Das war eine ganz besondere Spitze, denn geboren waren beide vielleicht zwanzig Kilometer auseinander, nur dass Adolphshaim und Siebenschlösschen bei Lauras Geburt zu Deutschland gehörten und bei Irenes Geburt nicht mehr. Aber das war ja nicht gemeint – Laura dachte an jene Gegend im russischen Polen, aus der Irenes Eltern stammten. Das russische Polen war eben richtiges Polen. Das verlorene Land aber, wo es ja auch die Polen gegeben hatte, reichlich, allzu reichlich, das war Deutschland und blieb Deutschland und fertig.
Nicht, dass Laura Irene für eine Polin hätte halten können oder ihre Eltern, die sie zwar nie kennengelernt hatte, von denen sie aber durch ihren Mann und durch Ellen genug gehört hatte, als beide zurückkamen von den Hochzeitsfeierlichkeiten in Siebenschlösschen. Laura hatte nicht mitfahren können, obwohl sie es wollte, aber immer waren es alle möglichen Gründe in der Sache und den Sächelchen, die Kinder und die Hühner und was auch immer, warum sie nicht mitfahren durfte, wenn es nach Osten ging. Sie kam niemals wieder nach Adolphshaim oder überhaupt in die Gegend, vor dem Krieg nicht und im Krieg nicht und danach auch nicht. Danach hätte sie es außerdem kaum noch geschafft, selbst wenn es erlaubt gewesen wäre.
Aber man musste nicht ein Pole sein, um aus Polen zu kommen. Man konnte ziemlich deutsch daherkommen und doch klebte einem all das an, was polnisch und unordentlich war, außerhalb der Ordnung und außerhalb der Zeit, und das meinte sie, wenn sie sagte das Mädchen aus Polen. Wie seltsam, dass Irene diese kleine Frau mit ihrem begrenzten Wissen und ihrer offenkundigen Dörflichkeit immer achtete, auch als die schon lange tot war und dass sie, die böse werden konnte über Lebende und über Tote, nie ein schlechtes Wort über Laura sagte, eher etwas wie Die war die Einzige, die etwas wert war in der ganzen Bergstraße.
Gut, ein schlechtes Wort sagte sie auch nicht über Edwin, Lauras Mann, den sie nur zweimal kennengelernt hatte für einige Tage, zuerst auf der Erkundungsreise zu ihrem Verlobten und dann ein halbes Jahr später, als der Herr Schwiegervater mit Ellen zu ihrer Hochzeit gekommen war. Als Irene für immer nach Neufeld kam, war er schon unter der Erde. Aber sie sagte auch nichts Gutes über ihn, nur so siebendeutige Dinge wie Der war damals so dick geworden, viel zu dick, und deshalb ist er auch bald dann gestorben. Sie machte sich schon ihre Gedanken, warum er dick geworden war. Stämmig war er immer, aber nicht dick, und dick wurde er nach und nach, als Karl und Ottmar in den Krieg gingen, noch dazu freiwillig, und er fürchten musste, dass die Regierung, die er hasste und fürchtete, den Krieg gewönne und nach dem Krieg mit allen aufräumen werde, die nicht ganz koscher waren, die die Bücher und die Pässe nicht in reiner Ordnung hatten. Als seine erste Angst vorbei war, blieb er dennoch dick und wurde immer dicker. Er spürte, dass zwar ziemlich sicher die Regierung unter den Schlitten kommen wird und vielleicht endet der Führer mittenmang an der Laterne vor der Reichskanzlei, aber er sah mit zuen Augen, dass der Osten mit unter den Schlitten kommen wird und weg ist für ihn und für immer. Damit war auch die allerkleinste Hoffnung hinüber, die er die vierzig Jahre vor sich hergeschoben hatte wie der Gartenzwerg die Karre und der Säufer seinen Bauch, diese Hoffnung, dass er zurückkehren wird auf das Land oder jedenfalls Karl für ihn zurückkehren wird, der ausersehen ist als der Stammhalter, der Stellvertreter und Fortsetzer, der wirkliche Sohn. Auch wenn der ihn manches Mal gequält hatte – damals, als er mit sechs Jahren zu den Eltern sagte »Ich will aber nicht in die Schule, ich will Trapper werden« und dann mit vierzehn, als er es durchdrückte, in die Hitlerjugend zu kommen. Aber der Junge war doch, als er fünfunddreißig nach der Schule keine Lehrstelle als Mechaniker oder Elektriker fand, ohne großes Murren nach Joachimsthal gegangen, in das Landjahr und wusste so immerhin, was ein Pflug und eine Sense war. Auch wenn er danach Maler und Lackierer gelernt hatte und nun bei der Bahn gelandet war, wie Edwin anno 1905. Und weil Karl bei der Hitlerjugend schon Hauptscharführer gewesen war, also eine Art Oberfeldwebel für ein halbes Hundert Untergebene, musste er nicht erst wie der Alte in die Rotte und den Gleisbau, sondern durfte gleich zur Güterabfertigung. Und das, obwohl eigentlich sonst immer der Weg ins Büro über die Rotte führte, wenn man nur die Volksschule hatte.
Nichts hätte Karl retten können in Irenes Augen, eigentlich nichts, auf die Dauer jedenfalls nichts. Es war eben ein Wettlauf ohne Beine. Sie hatte ihm das Beil abgenommen, und er hatte es sich abnehmen lassen, weil er tat, was sie wollte, fast immer. Aber was hätte es ihm geholfen, wenn er zugeschlagen hätte? Ein Augenblick der Überraschung, zu was dieser sonst so ruhige Mann fähig ist, des Erschreckens, dann Blut, Grauen und damit ganz allein zu sein in der Welt. Ohne das Beil aber war der verhinderte Mörder und ausgebliebene Held ohne jeden Zauber, ohne Macht, war er geschlagen von Anfang an.
Zweites Kapitel
Züge
Meeresstille und glückliche Fahrt, diese Haltung eines durcheinander nach Ruhe suchenden und kalten Protestantismus hatte Edgar schon von seiner Familie übernommen. Es floß hinein die mehrfache Versuchung der Kolonisatoren, die sich weit nach Osten vorgekämpft hatten, die erbärmliche Dörfchen am Rhein und im Alpenvorland verlassen hatten, um freizukommen und ihren einmal angenommenen Gegenglauben zu bewahren. Sie gerieten in die sandige und moorige Weite des westlichen Polen, als Ackerknechte und Dorfschulzen oder als hochmütig-großsprecherische Niemande, mit einem Hass für große Kriege und die Unterjochung einiger Völker, aber ohne das geringste Stück Macht in Händen, von ihren eigenen Leuten verlacht und mit obskuren Titeln gekrönt. Dies Wissen um die Gespaltenheit und Doppelung aller Dinge, schon aus dem Mut der auf Eroberung Fortgehenden und schon aus der Angst der fremden Minderheit, der an keinem Tag ihr Abend sicher war und die nur das Jahr ihrer sicheren Vertreibung nicht im Voraus kennen konnte. Dieses Misstrauen gegenüber den Außenstehenden, denen man nicht entgehen konnte und mit denen man handeln und Landstücke tauschen musste, diese Angst vor Verrätern in der eigenen kleinen Zahl, vor Frontenwechslern. Dazu das gemeinsame Sich-Abschließen, das Zurückhalten der Kinder aus dem polnischen Dorf, selbst die Bronikowskis und Malkowskis, die nicht aus der Gegend waren und sich hier eingekauft hatten, sprachen damals die angeblich fremde Sprache besser als die angeblich eigene, und waren auf dem Wege, das Lager zu tauschen, als der erste Krieg begann.
Schweigsamkeit über Tage und stundenlange Kutschfahrten hinweg, unphantastisches Bilanzieren der gesehenen Wälder und Straßenhändler in schmucklosen lutherischen Sätzen, der von der eigenen Arbeit mit den eigenen Händen, vom Heranwachsen und Wegsterben in der Ewigkeit der Familienexistenz diktierte Ablauf der Zeit, die langen hellen Tage der überhitzten Sommer und die konturlosen Winterabende, die guten Stuben, feierlich schwarz und leblos, in denen sich die Landbesitzer besuchten. Wie sie nach der Kirche zusammenstanden und so vieles nicht sagten, das schon Geschehene und nicht zu Ändernde beschwiegen. Ein Gefühl, zum Land zu gehören, und ein Wissen, es vielleicht verlassen, aber niemals es aufgeben zu können. Der einstige Westen und einstige Süden lag jenseits aller Horizonte.
An den Sonntagen fuhren sie mit den Kutschen zum Gottesdienst. Bei Tonn an der Post wurde auf einem großen Hof gehalten. Dort stehen sie alle zusammen – die einen, weil das Geld für den Gasthof nicht reicht, die anderen, weil sie aus irgendeinem Grunde Verzicht üben, die dritten, weil sie einen Eindruck machen wollen mit ihrem Maßvollsein und ihrer Ordentlichkeit. Auch die Jugendlichen stehen in einem Kreis, machen ihre Späße. Gastwirt Tonn kommt manchmal heraus, spricht mit diesem und jenem, ohne dass man gleich sagen würde, er holt seine Schäfchen an den Bieraltar. Bei ihm kann auch sonntags eingekauft werden, all das, was man donnerstags auf dem Markt und in den Geschäften am Markt nicht gefunden oder vergessen hat.
1920 konnten die gerade erst wie sie glaubten für jetzt und immer Hierhergekommenen nicht fortgehen wie die Lehrer und Postverwalter es mussten, sie konnten ihre Erde nicht zu Geld machen und mit sich nehmen. Sie flohen nicht, nicht zu früh und nicht früh genug. Sie waren Untertanen des preußischen Königs und des Zaren und des deutschen Kaisers gewesen, nun unterstanden sie der polnischen Regierung und wussten noch nicht, dass ein Geheimer Staatsrat mit kleinem Bärtchen fünf Jahre lang ihr unerwählter Anführer sein würde.