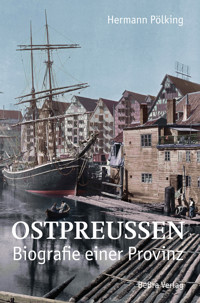
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ostpreußen ist so anders, so einmalig in seiner Art. Vielleicht, dass unbewusst in diesen Herzen und Hirnen ein fremder großer Mythos lebt.« Was Thomas Mann vor über hundert Jahren schrieb, wird in Hermann Pölkings Buch nachvollziehbar. Er macht die Geschichte der einst östlichsten Provinz Preußens mit einer Fülle von Fakten, Bildern und Karten anschaulich und erzählt dabei nicht nur von den teils dramatischen politischen Ereignissen, sondern auch von Landschaft und Wetter, von den Eigenheiten der Bewohner oder vom abenteuerlichen Zustand der ostpreußischen Straßen. »Hier ist ein ganz außergewöhnliches Porträt entstanden, ungewohnte Menschen kommen zu Wort, bestechende Abbildungen runden den Gesamteindruck ab. Wer sich in die Geschichte der einst östlichsten Provinz Deutschlands vertiefen will, dem sei dieses Buch dringend empfohlen. Ostpreußen ist entrückt in Erinnerung und Geschichte. Dort aber ist es noch sehr lebendig. Dass dem so ist, wird auch ein Verdienst von Hermann Pölking bleiben.« ANDREAS KOSSERT
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2086
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Königsberg, Juli 1945
„An einem dieser prächtigen Tage ging ich über die menschenleere Hagenstraße.
Ein Wägelchen rollte an mir vorbei. Zwei Kinder hatten die Händchen an der Deichsel und trotteten den Weg nach Juditten. Auf dem Gefährt aber lag eine Kiste, groß genug, um den Leib eines kleinen Kindes aufzunehmen, ein Strauß Feldblumen auf ihr.
Daneben war noch Platz für den Spaten. Zwei Kinder schickten sich an, ein drittes zu beerdigen. Weit und breit kein Erwachsener!“
Paul Ronge
Hermann Pölking
OSTPREUSSEN
Biografie einer Provinz
BeBra Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
E-Book im BeBra Verlag, 2023
3., überarbeitete u. erweiterte Auflage
© der Originalausgabe:
BeBra Verlag GmbH, 2023
Asternplatz 3, 12203 Berlin
Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin
Umschlag: typegerecht berlin (Titelfoto © Bestand Königsberger Denkmalamt,
Archiv der Wissenschaften, Warschau, IS-Pan, Kolorierung: Julio Olmo Poranzke)
ISBN 978-3-8393-0166-1 (epub)
ISBN 978-3-89809-216-6 (print)
www.bebraverlag.de
INHALT
PANORAMA EINER PROVINZDie Menschen und die Verhältnisse
Ein Land, das ferne leuchtet
Eine preußische Provinz
Ostpreußische Mischung
Rom und Sinte
Fünf Jahreszeiten und kein Sommer
Den Strömen das Land
Die fremden Nachbarn
Bereisung einer Provinz
Das Oberland
Das Ermland
In Masuren
Preußisch-Litauen
Das Memelland
Die Elchniederung
Das Samland
Königsberg
Die Kurische Nehrung
Natangen und Barten
Westpreußen in Ostpreußen
Vaterland und Muttersprachen
Das Astpraißische
Masuren, Polen oder Preußen?
Die Litauisch und Kurisch sprechen
VOM STAMMESLAND ZUR PROVINZPrußen und Preußen
Auf Mission im Prußenland
Das Reich der Polen und Piasten
Der Deutsche Orden
Die Litauerkriege
Der Preußische Bund
Das Großreich der Litauer
Das Königliche Preußen im polnisch-litauischen Staat
Das Herzogtum Preußen
Hohenzollern-Land
König in Preußen
Ännchen von Tharau
Kantograd
Nach der Großen Pest
Der Siebenjährige Krieg
Die drei Teilungen Polens
Krieg und Sieg
Der Feldzug Napoleons
Regulierung und Separation
Der Russlandfeldzug und die Befreiungskriege
Vom Liberalismus zum Nationalismus
Die liberale Provinz
Revolution und Revolutionäre
Die deutschen Einigungskriege
DIE PROVINZ IM KAISERREICHTeil des Reiches
Kühn nach Deutschland
Politik und Parteien
Das liberale Königsberg
Staatsaufgaben
Ostpreußens Militär
Eisenbahnen und Chausseen
Öffentliche Dienste
Schüler und Schulmeister
Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Landwirtschaft
Ein Land der Pferde
Die Industrialisierung
Glaubensangelegenheiten und Überzeugungen
Protestanten und Erweckte
Die Katholiken – Glaube, Politik, Nation
Ostpreußens Juden
Die Sozialdemokratie
Heimatkunde
Verlorene Menschen
Schwere Zeiten
Der Tod stört das Leben nicht
DER ERSTE WELTKRIEGDer Krieg im Osten Deutschlands
August 1914
Die Schlacht bei Gumbinnen
Tannenberg
Erich Ludendorff und Paul von Hindenburg
Aufmarsch zur Schlacht
Sieger und Besiegte
Tod eines Feldherrn
Der Krieg im Osten und die Revolution
Die östlichste Front
Was vom Krieg bleibt
Kriegsalltag und Wiederaufbau
Die Novemberrevolution
KÖNIGSBERGER REPUBLIKOstpreußen, Westpreußen und Polen
Das neue Polen
Die Volksabstimmungen
Danzig und der Korridor
Volkstumskämpfe
Große und nicht so große Politik
Litauen und das Memelland
Der „Litauische Aufstand“
Kapp – ein Putschist aus Ostpreußen
Die Parteien der Provinz
Wirtschaft, Alltag und Kultur
Im wirtschaftlichen Notstandsgebiet
Moderne Zeiten, Kultur und Un-Kultur
OSTPREUßEN IM NATIONALSOZIALISMUSDie Herrschaft der NSDAP
Ein Gau und sein Leiter
Hochburg des Nationalsozialismus
Gegner und Opfer, Täter und Mitläufer
Mitwisser und Bekenner
Antisemitismus und Judenverfolgung
Wirtschaft und Alltag
Gewerbe, Landwirtschaft und Siedlung
Szenen des Alltags
Nationalsozialistische Expansionspolitik
Die Heimsuchung des Memellandes
Aufrüstung und Wehrmacht
OSTPREUßEN IM ZWEITEN WELTKRIEGDer Krieg gegen den Nachbarn
Der Überfall auf Polen
Soldau, Stutthof, Zichenau
Der Feldzug im Osten
Hauptquartiere im Wald
Der Krieg gegen die Sowjetunion
Die Mörder von Garsden und Heydekrug
Heimatfront
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter
Kriegsalltag
Die Ermordung der ostpreußischen Juden
Die Ermordung der ostpreußischen Sinti und Roma
Das Jahr 1944
Der Krieg kommt über die Grenze
Das Attentat in der Görlitz
Juli 1944 – Die Flucht beginnt
August 1944 – Der Vormarsch der Roten Armee
Bomben auf Königsberg
Ein Partisanenkrieg
Oktober 1944 – Die Herbstoffensive
Das letzte Aufgebot
DAS ENDE EINER PROVINZDie Januaroffensive der Roten Armee
Angreifer und Verteidiger
Der Angriff im Norden
Die Flucht über die Weichsel
Im Kessel Ostpreußen
Zufluchtswege
Flucht über das Eis
Im Heiligenbeiler Kessel
Kriegsgräuel
Im Angesicht des Untergangs
Terror, Rache und Vergeltung
Das Ende des Krieges
Die Festung Königsberg
Das Ende in Königsberg
Das Kriegsende in Samland und Weichselniederung
DIE DREITEILUNG OSTPREUßENS
Sterben und Überleben in der Heimat
Chitler kaputt!
Kenigsbergskaja oblast
Das Memelland – daheimgeblieben, heimgekehrt und zugewandert
Ermland-Masuren – Umsiedlung und Polonisierung
Die Zwangsausreise der Deutschen
Zuflucht und neue Heimat
ANHANG
Nachwort zur Neuauflage
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Ortsregister
Personenregister
Nachweis der Abbildungen
Verzeichnis der Karten
Als dieses Bild der Hohen Lauben im Jahr 1915 in Marienburg entsteht, gehört die Kreisstadt noch zum Bezirk Marienwerder der Provinz Westpreußen. Der Ort, mit dessen Namen die meisten Deutschen „Ostpreußen“ assoziieren, kommt erst 1920 zu Ostpreußen.
„Nun steht der Vollmond am blauschwarzen Winterhimmel. Der Wind schweigt, der Frost steigt aus den Lüften, und alles Land um den Strom liegt geduckt und schläft. Nur die Memel schläft nicht, sie knurrt wie ein böser Hund, sie stöhnt, und manchmal brüllt sie in verhaltenem Zorn.“[1]
Eugen Kalkschmidt
Panorama einer Provinz
Die Menschen und die Verhältnisse
Ein Land, das ferne leuchtet
„Ich schiebe den Vorhang beiseite, und wir sehen ein kleines ostpreussisches Städtchen. Kleine Lerchen gehen geschäftig ihrem Werkeltag nach; sie glauben, dass der liebe Gott das ganze Weltall expreß für sie allein gemacht hat.“[2] Der hier den Blick auf die Bühne seines Lebens gewährt, ist ein kräftiger, sinnenfroher Mann, geboren im Jahr 1858 in Tapiau im nördlichen Ostpreußen. Er malt das Wesentliche. „Ich erhielt den Namen: Franz Heinrich Louis Corinth. Mein Vater war Bürger von Tapiau und meine Mutter eine geborene Buttcher, verwitwete Opitz. Meine Paten waren außer den Geschwistern meines Vaters der Kaufmann William Bauer, welcher an der Deime eine Dampferstation nebst einem Kolonialwarenladen inne hatte“[3], erinnert sich Lovis Corinth 1924 in seiner Autobiographie Meine frühen Jahre. Ostpreußen konnte seine Menschen prägen, stellt Corinths Frau Charlotte nach dem Tod des Malers fest, denn „im Grunde war sein Wesen ernst.“ Und weiter: „Seine Heimaterde gab ihm Melancholie und Schwerblütigkeit. Aber sie gab ihm auch eine gewaltige Kraft, sein Lebenswerk auszuführen, das hohe Ziel zu erreichen, welches er seinen Gaben gesetzt hatte: dass aus dem kleinen ostpreußischen Gerbermeisterssohn ein großer deutscher Maler werde. Auch strotzende Sinneskraft gab ihm die Heimaterde.“[4] Durch die Heimaterde von Corinths Geburtsort fließen Deime und Pregel, die Deime zweigt in Tapiau vom Pregel ab. Der Pregel mündet hinter Königsberg ins Frische Haff, die Deime ins Kurische Haff, sie hat über den Großen Friedrichsgraben auch eine Kanalverbindung zur Memel. Tapiau ist ein Ort, an dem Dampfer Station machen können. Hier beginnt unser Panorama eines in die Geschichte entschwundenen Landes.
Impressionistisch erinnert sich der Schriftsteller Siegfried Lenz an seine masurische Heimat: „Keine leuchtende Wachsamkeit, kein heller Traum liegen in diesen Bildern, die Heiterkeit wirkt nicht nutzlos, und das Licht enthält keine Herausforderung: Genügsamkeit, Bescheidung, Ergebenheit, fragloses Einverständnis geben sich überall zu erkennen.“[5] Nicht die satte Agrarlandschaft um Tapiau hat der in Lyck im kärglichen masurischen Süden Ostpreußens geborene Lenz vor Augen. „Ich denke an tief an den Boden geduckte Strohkaten, an die viel erwähnte Unberührtheit der Seeufer. Ich denke an eingeschneite Höfe inmitten terroristischer Winter, an den zögernden Wuchs genügsamer Kiefern, an lautlose Heide und an unentmutigende Armut auf sandigen Feldern. Rauchfahnen von kleinen, altmodischen Schleppern stehen in der Luft, behäbige Fahrzeuge, die große Flöße über die Seen manövrieren. Treidelfischer wuchten mit harten Rufen die Leinen des Hauptnetzes unter der Eisdecke entlang. Die Stille schilfbestandener Buchten, das flimmernde Geheimnis der Moore, der quietschende Treck der Pferdewagen zu den Märkten, das trübselige Schweigen zahlreicher Kriegerdenkmäler: all dies gehört zur Landschaft Masurens. (…) Und es gehören zu ihr Bilder einer gern photografierten Schwermut des Feierabends: wehende, zerrissene Netze vor armseligen Fischerhütten, alte, reglose Männer auf schiefen Holzbänken, Kinder in dürftigen Kitteln, die sich mit lebendigem Spielzeug begnügen müssen, mit Hahnche, Huhnche und Ferkelchen, sowie kahle, holprige Marktplätze, niedergebrannte Holzfeuer der Flößer und die unvermeidlichen Erntewagen.“[6]
Es muss etwas Besonderes gewesen sein an den ostpreußischen Landschaften. Noch inmitten des Krieges schreibt eine 22-Jährige, die es als Lehrfräulein in die östlichste Provinz verschlagen hat: „Hier in Ostpreußen habe ich das Gefühl, freier atmen zu können.“[7] Noch ist die Provinz eine Idylle. „Das Land ist still, schön, weit – die Städte haben große Marktplätze und kleine Häuser und meistens sehenswerte alte Backsteinkirchen.“[8] Im Mai 1942 schreibt Marianne Günther an ihre Eltern in Köln aus dem kleinen Ort, in dem sie ihre erste Lehrerstelle angetreten hat: „Von meinem Fenster habe ich einen wunderbaren Blick. Durch die sattgrünen Wiesen schlängelt sich die Nehne, und am Horizont hebt sich der Wald scharf und dunkel in den Himmel. Seit ein paar Tagen ist die Wiese übrigens übersät von Sumpfdotterblumen und sieht von weitem wie ein gelbes Meer aus. Dazu ertönt den ganzen Tag das ‚Kuckuck-Kuckuck‘ aus dem Wald.“[9] Am Abend zeigt sich ihr das Land von einer dunklen Seite: „Soeben kam ich nach Haus. Der Sturm heult. Der Mond steht im ersten Viertel, da war es nicht ganz so dunkel. Die Wolken jagten dahin, und sehr geheimnisvoll hob sich der schwarze Wald vom etwas helleren Himmel ab. Wie ich so dahinradelte, fühlte ich mich recht glücklich.“[10] Alt Gertlauken, der Ort dieser Idylle im Landkreis Labiau, hat zu dieser Zeit etwa 800 Einwohner.
Die Ehefrau des Freiherrn Guido von Kaschnitz-Weinberg nennt sich als Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz. Auf sonntäglichen Fahrten und Fußwanderungen entdeckt die Tochter eines Offiziers, die in Berlin und Potsdam aufgewachsen ist, in ihren fünf Königsberger Jahren „die kargste Gegend“. Sie kennt Italien, Griechenland, den Orient und Nordafrika. In ihren im Jahr 1973 erscheinenden „Aufzeichnungen“ mit dem Titel Orte denkt Marie Luise Kaschnitz noch einmal an Ostpreußen zurück: „Ein Land ohne Wein, ohne Nußbäume, Kastanien und Platanen, dafür betrachtet man einen Halm Strandhafer mit ebenso gespannter Aufmerksamkeit wie die treibenden Wolken über dem Feld. Das blendende Märzlicht, die schmelzenden tropfenden Eiszapfen zwischen Winter und Winter, von denen man sieben zählte zwischen Oktober und Mai. Dann der kurze heftige Sommer, Jasmin, Flieder, Kastanien, Tulpen und Rosen, alles auf einmal in Blüte und schon der Frucht zutreibend, die Johannisbeeren schon rot und schwarz. Die Rohrdommeln, die fetten weißen Maiglöckchen, die großen Raubvögel niederstoßend, die jungen Pferde auf den Koppeln, und hinter den Buchenwäldern der lange weiße menschenleere Strand.“[11]
In der Großstadt Königsberg geboren und aufgewachsen ist Immanuel Birnbaum. In den 1920er und 1930er Jahren lebt und arbeitet er als Journalist in Warschau. Birnbaum ist Jude und Sozialdemokrat, bei Kriegsbeginn 1939 flieht er aus Polen nach Schweden. Der Schüler Birnbaum kommt zur damaligen Kaiserzeit aus seiner Heimatprovinz nur einmal heraus, ins benachbarte Westpreußen, und entdeckt nicht das östliche Land der sattgrünen Felder, der dunklen Nadelwälder und kristallenen Seen, sondern ein anderes: „Immerhin unternahm ich eine einsame Fußwanderung am Frischen Haff entlang bis nach dem westpreußischen Danzig, das ein so ganz anderes, von bürgerlichen Bauherren geprägtes Stadtbild bot als das vom alten Herzogsschloß beherrschte Königsberg. Schon auf dem Weg durch das katholische Ermland mit seinen Kruzifixen am Straßenrand und seinen Domkirchen in den Bischofsstädten Braunsberg und Frauenburg traten mir völlig neue Eindrücke entgegen. Auch die Natur veränderte sich in der Landschaft zwischen Braunsberg und Elbing. Statt der Kiefernwälder und der Birken, statt der Sanddünen und Steilküsten sah ich auf dieser Wanderung zum ersten Mal Buchenwald ohne Unterholz und mit hohem Laubdach, das mir vorkam wie eine Kirchenwölbung.“[12]
Birnbaum leitet von 1953 bis 1972 das Ressort Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Zur Zeit der Ostpolitik Willy Brandts ist er stellvertretender Chefredakteur, ein Vordenker der Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn Deutschlands. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hält es ihn ebenso wenig in der Heimat wie Lovis Corinth. Der ist als 22-Jähriger von der Kunstakademie Königsberg nach München an die dortige Akademie gewechselt. Birnbaum geht zum Jurastudium in die bayerische Residenz. „Die Schule war ich mit der Reifeprüfung los. Nun wollte ich mich auch des Elternhauses mit seinen – letzten Endes religiösen – Spannungen entziehen und schließlich aus dem deutschen Kolonialgebiet, als das ich die ostpreußische Heimat mit ihrer Ordensromantik und ihren Grenzlandproblemen immer empfand, endlich einmal hinaus ‚ins Reich‘ kommen, wo Romanik und Gotik ihre Bauten nicht aus Ziegeln, sondern aus Stein gewölbt hatten.“[13]
Der Redakteur und Schriftsteller Paul Fechter stammt aus dem westpreußischen Elbing. Die Stadt am Frischen Haff gehört wegen ihrer rein deutschsprachigen Einwohnerschaft von 1920 bis 1939 zu Ostpreußen, nachdem als Folge der Verträge von Versailles der größte Teil der Provinz Westpreußen polnisch geworden ist oder zur Freien Stadt Danzig gehört. Von 1937 bis 1939 ist Fechter Redakteur des Berliner Tageblatts, 1933 bis 1942 gibt er die literarische und wissenschaftliche Zeitschrift DeutscheRundschau mit heraus. In seiner Literaturgeschichte aus dem Jahre 1941 äußert er sich opportunistisch-emphatisch zu Hitlers Mein Kampf, nach 1945 schreibt er für das Feuilleton der Zeit. Für Fechter ist die Heimat strahlend schön und geschichtslos: „Das Land zwischen Weichsel und Memel lag so herrlich gegenwartsnah, so völlig auf zeitloses Sein gestellt unter den großen Himmeln des Ostens, dass die Vergangenheit machtlos blieb neben dem Glanz und der strahlenden Sonne der Gegenwart. Vielleicht sprach auch eine Art von Raumgefühl mit: auch die Geschichte war für uns im Westen lokalisiert. Alles Wesentliche, was wir auf der Schule lernen mussten, von Karl dem Großen bis zu den Stauferkaisern, von Luther bis zu Schiller und Goethe, hatte sich weit jenseits der Weichsel abgespielt, auf dem Boden des Reichs, das für unser schlummerndes Denken eben im Westen lag. Bei uns war’s schön; Geschichte geschah woanders.“[14]
Viele müssen so empfunden haben, Künstler, Publizisten, Architekten, Wissenschaftler. Käthe Kollwitz, Lovis Corinth, Hermann Sudermann, die Brüder James und Arthur Hobrecht, Bruno und Max Taut sowie Erich Mendelsohn, Hannah Arendt und viele andere in Ostpreußen Geborene machen sich auf zu einer Karriere im „Reich“. „Wenn wir Ostpreußen nach Berlin reisten, hieß es: ‚Wir fahren ins Reich.‘ Im Gegensatz zum Reich lebten wir ‚in der Provinz‘“[15], erinnert sich Marion Gräfin Dönhoff. Der auf Gut Neucken im Landkreis Preußisch Eylau geborene Magnus Freiherr von Braun, 1932/33 Minister in den konservativ-reaktionären Kabinetten von von Papen und Schleicher und Vater des Raketenpioniers Wernher Freiherr von Braun, im Rückblick: „Gewohnheitsmäßig sagte man in meiner Jugend noch, wenn man an eine westliche Universität ging: Ich studiere ‚im Reich‘.“[16]
Ein Lübecker aus München gibt im August 1929 in einem Gespräch mit der Königsberger Allgemeinen Zeitung seine Sicht der Ostpreußen wieder. 1929 ist der Autor der Buddenbrooks von Rauschen im Samland mit dem Dampfer auf die Kurischen Nehrung nach Nidden gereist, einige Wochen später bekommt er den Literaturnobelpreis verliehen. 1930 baut er sich von diesem Geld ein Sommerhaus in Nidden. Thomas Mann: „Der Ostpreuße ist so anders, so einmalig in seiner Art. Vielleicht, dass unbewusst in diesen Herzen und Hirnen ein fremder großer Mythos lebt.“[17] Im Urlaub an der Samlandküste, dem Haff und auf der Nehrung stellt er fest: „… hier finde ich die Brücke zum slawischen Kulturkreis. Ich muß immer an Tolstoi denken.“[18]
Der Ostpreuße hat häufig nicht reichsdeutsch klingende Namen. In den Suleyken-Geschichten von Siegfried Lenz heißt der immer lesende Großvater Hamilkar Schaß. Ein „magerer, aufgescheuchter Mensch (…), der Zeit seines Lebens nicht mehr gezeigt hatte als zwei große rosa Ohren“ ist der Adolf Abromeit. Es treten in So zärtlich war Suleyken noch auf die beiden etwas tumben Vettern Urmoneit, der wagemutige Schneider Edmund Vorz, der gemütliche Gendarm Schneppat und mit seinen drei Söhnen von drei Frauen der leicht kriminelle Binnenschiffer Alec Puch. Solche Menschen machen keine große Geschichte, ihnen wird mitgespielt. In der Nachbemerkung zu den 1955 erschienenen Geschichten aus dem fiktiven masurischen Dorf Suleyken spricht Lenz seinem erdachten Personal die Eigenschaften seiner Landsleute zu: „Gleichgültig und geduldig lebten sie ihre Tage, und wenn sie bei uns miteinander sprachen, so erzählten sie von uralten Neuigkeiten, von der Schafschur und vom Torfstechen, vom Vollmond und seinem Einfluß auf neue Kartoffeln, vom Borkenkäfer oder von der Liebe. Und doch besaßen sie etwas durchaus Originales – ein Psychiater nannte es einmal die ‚unterschwellige Intelligenz‘.“[19]
Die Bürger des Deutschen Reichs denken bei Ostpreußen weniger wie Thomas Mann an Tolstoi als an Sibirien. Fast 50 Jahre lang reicht hinter der Stadt Memel, 22 km längs der Reichsstraße Nr. 132, das Bismarck-Reich als schmaler Streifen nordöstlich auslaufend bis an das Kurhaus des Kaufmanns und Hoteliers Willy Karnowsky (Spezialität: Krebsgerichte!)[20]: „In Nimmersatt, wo das Deutsche Reich sein Ende hat“, weiß der Volksmund. Am Schlagbaum zwischen Nimmersatt und Polangen im russischen Kurland stehen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs Kosaken des Zaren und schützen Russland vor germanischen Einfällen.
Geht es Thomas Mann in Ostpreußen um geistige Nahrung, bei Willy Karnowsky in Nimmersatt um feine Krebsspeisen, assoziiert der ungebildete Kenner mit der Landschaft jenseits der Weichsel gerne Getränke. „Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, in Pillkallen ist es umgekehrt“, wird über Stadt und Land im äußersten Nordosten der Provinz gedichtet: Ostpreußen, ein Trakehner- und Trinker-Land! Der aus Frankfurt stammende letzte Feuilletonchef der Königsberger Hartungschen Zeitung, Erich Pfeiffer-Belli, gestattet diese Verallgemeinerung: „Der Reim paßte endlich auf jede ostpreußische Stadt, man war weit fort von allem, von Berlin zumal, lebte in Isolation, die in manchem Punkt splendid, in vielen anderen Punkten das Gegenteil davon war.“[21] Pfeiffer-Belli sieht in ostpreußischer Trunksucht einen metaphysischen Ausgleich für die Strenge des Lebens dort: „Die Ostpreußen lebten ihr Leben viel intensiver, viel hingegebener an Tag und Stunde. Sie wußten viel stärker von dem widerrufbaren Geschenk des Daseins, weil ihr Kampf um dieses Dasein viel härter war als anderswo. Sie genossen darum auch anders, feierten tollere Feste, gingen mit dem Alkohol recht großzügig um, und ihre Mahlzeiten waren ausgedehnt.“[22]
Rudolf Nadolny, der in Groß Stürlack im masurischen Kreis Lötzen geboren ist, in Lötzen und Rastenburg zur Schule geht, gewinnt als Diplomat auf Botschafterposten beim Völkerbund, in Schweden, der Türkei und der Sowjetunion Weltsicht. Er hat eine Erklärung für die einmalige Art der Menschen, die nicht nur aus der Andersartigkeit der Landschaft und des Klimas kommt. „Ostpreußen ist ungefähr ebenso Siedlungsland wie Amerika. Seine Einwohnerschaft stammt in derselben Weise von Einwanderern aus vielen Ländern, die im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert dem Ruf des Deutschen Ritterordens folgten oder auch noch später einwanderten oder dort angesiedelt wurden. Nur dass die noch im Lande verbliebenen alten Preußen keine Rothäute waren, sondern als ein baltischer Stamm ebenso Indoeuropäer wie die Einwanderer, dass sie sich, soweit sie den Prozess der Unterwerfung und Bekehrung überstanden, entweder mit den Einwanderern vermischten oder auch bis heute als altpreußische Familien erhalten haben.“[23] Auch Nadolny hat Ostpreußen den Rücken gekehrt, für den Juristen ist hier im Jahr 1902 keine Karriere zu machen. Er steigt in Berlin für kurze Zeit zum Leiter des Büros des Reichspräsidenten Friedrich Ebert auf.
Der 1905 geborene Königsberger Max Fürst, der es vom Schreiner zum Schriftsteller bringen wird, durchstreift zu Beginn der Zwanzigerjahre als Leiter einer bündischen jüdischen Jugendgruppe fast die gesamte ostpreußische Heimat. 1925 zieht es ihn nach Berlin; 1935 muss er nach Palästina emigrieren. Im dazwischen liegenden Jahrzehnt besucht er immer wieder die Provinz. „Dann begann mein Herz doch schneller zu schlagen, als der Zug in Dirschau über die lange Weichselbrücke donnerte. Ich brauchte nicht aus dem Fenster zu sehen, die Namen der aufgerufenen Stationen und der kleineren Orte, an denen der Zug nicht hielt, wusste ich auswendig und sah auch die Landschaft im Dunkeln.“ Er passiert im Zug die Marienburg, die Stadt Elbing mit der Schichau-Werft, die Besitzungen des Fürsten Dohna in Schlobitten, endlich Braunsberg und Heiligenbeil. Dann sieht der Heimkehrer erstmals das Frische Haff. „Es ist doch seltsam, wie das Herz schlägt, wenn man der Heimat näher kommt. Man kennt schon jeden Baum, jeden Pfad, Ponarth mit neuen Fabriken, Gärtnereien und der Brauerei. Jetzt schnell alles zusammenpacken, und dann stand ich alleine auf dem Bahnhof in Königsberg.“[24]
Dem Literaten Fechter aus Elbing, dem Diplomaten Nadolny aus Masuren, dem kurzzeitigen Reichsminister von Braun, dem sozialdemokratischen Journalisten Birnbaum und zwei Millionen anderer einst heimischer Ostpreußen bleiben die Erinnerungen. Sie haben überlebt. Aber heimatlos zu werden ist ein schweres Schicksal. Der Schriftsteller Peter Härtling schreibt im Januar 2004 über eine Erfahrung seines Freundes Max Fürst, der 1978 fern von Königsberg, in Stuttgart, gestorben ist: „Er hat lernen müssen, wie leicht ein Land aus einem Leben verloren geht.“[25] Und er zitiert Fürst: „Es ist leicht, über Ostpreußen zu schreiben, ich sehe es klar vor mir, es ist mein Orplid, versunken in Geschichtslosigkeit.“[26] Max Fürst aus Königsberg hat es schmerzhaft erleben müssen: „Auch heute noch kann es geschehen, dass ein Land aus den Schlagzeilen verschwindet und keine Versammlung der Heimatvertriebenen es in die Aktualität zurückholen kann.“[27]
Auch dieses Buch kann das nicht. Dieser Rückblick ist nicht sentimental, er will wenig Bekanntes und Vergessenes in der Geschichte verorten, durch Nachrichten, aus Zeugnissen und Erinnerungen – damit Ostpreußen unvergessener Teil der deutschen Geschichte bleibt.
Eine preußische Provinz
Was meint Ostpreußen? Was ist Ostpreußen bis zu seinem Ende im Jahr 1945? Eine Landschaft? Ein deutsches Land? Eine deutsche Provinz?
Eine Landschaft ist es nicht. Dafür ist das Land von der samländischen Steilküste zu den masurischen Seen, von den Wüstendünen der Kurischen Nehrung über die Kiefernwälder der Johannisburger Heide bis zu den satten Wiesen der Elbinger Niederung zu vielgestaltig. Ostpreußen ist auch nie ein deutsches Land wie etwa Bayern, Sachsen oder Anhalt. Und es ist auch keine „deutsche“, sondern eine Provinz Preußens.
Im Jahr 1837 zählt das Gebiet der Provinz Ostpreußen neben zwei Dritteln deutschsprachigen Einwohnern ein Drittel polnisch- und litauischsprachige Einwohner.[28] Vom Zweiten Thorner Frieden 1466 bis zum Vertrag von Wehlau im Jahr 1657 bzw. dem Vertrag zu Oliva im Jahr 1660 untersteht das Gebiet des einstigen Ordensstaates und ab 1525 eines weltlichen „Herzogtums Preußen“ der Oberhoheit eines polnischen bzw. eines polnisch-litauischen Staates. Bis zum Zusammenschluss deutscher Staaten zum Norddeutschen Bund im August 1866 ist Ostpreußen auch nie Teil eines Deutschen Bundesstaates. Zu „Deutschland“ als Staat gehört es erst seit der Kaiserproklamation in Versailles 1871. Mit ihr entsteht das von Bismarck geschaffene zweite Deutsche Reich. Aber es ist auch keine „Provinz“ dieses Deutschlands.
Ostpreußen ist das, was sein Name sagt: der Osten des Staates Preußen. Zu ihm gehört es als Provinz. Preußen ist ein Staat, seit 1701 regiert von einem König. Bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation um 1803/1806 gehören viele „Seiner Majestät Staaten“ zu diesem „Reich Deutscher Nation“. Aber nicht alle. Und nie die „Provinz Preußen“.
Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gilt Ostpreußen als fernes Land. „Litauische Geschichten“, Romane und Theaterstücke verfasst der „Richter und Dichter“ Ernst Wichert. Der in Insterburg geborene, in Pillau und Königsberg aufgewachsene Autor, im Hauptberuf Jurist, erinnert sich in seinen 1899 erschienenen Memoiren an die Gründe: „Denn über die erste Hälfte dieses Jahrhunderts hinaus blieb die östliche Provinz von dem Körper der Monarchie entlegen, nicht nur politisch in besonderer Stellung, sondern auch wirtschaftlich auf sich selbst gewiesen, vielleicht in regerem Verkehr mit dem Auslande – über See –, als mit dem Westen Preussens. Brauchte man doch, bevor die Eisenbahn Mitte der fünfziger Jahre eröffnet wurde, zur Reise von Königsberg bis Berlin in der Schnellpost drei Tage und zwei Nächte, und von Litauen oder Masuren aus auf schlechten Wegen erst Königsberg zu erreichen, war auch nicht zu jeder Jahreszeit leicht. So wars nur ein kleiner Teil der Bewohner, der über die Weichsel hinauskam.“[29]
Ein Ostpreußen gibt es dem Namen nach seit 1773. König Friedrich II. („der Große“) erhält mit der ersten Polnischen Teilung Gebiete, die bis 1466 zum Staat des Deutschen Ordens gehörten und seitdem als „Königliches Preußen“ dem polnischen König unterstanden. Seine Beamten nennen die neu gewonnen Territorien „Neu-Preußen“. Friedrich verordnet am 31. Januar 1773 per Kabinettsordre ein neues Namensverzeichnis: „Übrigens finde Ich die Benennung Meiner aquirirter dortigen Provinzen unter dem Namen von Neu-Preußen, da das Wort ‚Neu‘ nur vor neu aufgefundenen Ländern gebraucht zu werden pfleget, garnicht schicklich und dahero, daß ins künftige Meine alte preußische Provinzen Ost-Preußen und die aquirirte West-Preußen genannt werden sollen.“[30] Noch setzt sich Ostpreußen im Sprachgebrauch nicht durch. Bis 1824 spricht man allgemein von der „Provinz Preußen“, wenn im Sinne Friedrichs „Ost-Preußen“ gemeint ist.
Der Name Ostpreußen tritt im Jahre 1815 als geographische Bezeichnung in neuer Verwendung auf. In der am 30. April 1815 erfolgten Verordnung über die verbesserte Einrichtung der Provinzialbehörden werden in der bisherigen Provinz „Preußen“ wie auch in „Westpreußen“ zwei Regierungsbezirke gebildet. In (Ost-)Preußen sind es der Bezirk „Litauen“ mit der Hauptstadt Gumbinnen und ein Bezirk „Ostpreußen“ mit der Hauptstadt Königsberg. Im Jahre 1824 werden die Provinzen Preußen und Westpreußen zu einer Provinz mit dem Namen „Preußen“ vereinigt. Bei der erneuten Teilung 1877 wird nicht mehr nur ein Regierungsbezirk, sondern gleich der ganze östliche Teil der Provinz „Ostpreußen“ genannt. In ihr existieren fortan die Regierungsbezirke Königsberg und Gumbinnen. 1905 geben diese Regierungsbezirke Kreise an einen neuen Bezirk Allenstein ab.[31]
Von 1806 bis 1866 ist Preußen als „Königreich“ völlig souverän, denn der Deutsche Bund, dem es angehört, ist ein Staatenbund und „Westpreußen“, „Posen“ und die „Provinz Preußen“ sind nicht Teil des Deutschen Bundes. Von 1866 bis 1871 dann ist das Königreich Preußen ein Teilstaat des Norddeutschen Bundes, seit 1871 des Deutschen Kaiserreichs. Jetzt hat es zwar noch Staatlichkeit (wie heute die Länder der Bundesrepublik Deutschland), aber keine Souveränität mehr. Noch bis 1937 wird eine „Preußische Staatsbürgerschaft“ in den Pässen, die die deutschen Länder ausstellen, ausgewiesen. Mit ihr ist man ab 1871 automatisch auch „Deutscher“. Allerdings kann der vorbestrafte Tilsiter Wilhelm Voigt, später bekannter als Hauptmann von Köpenick, noch 1906 aus dem mecklenburgischen Wismar „als ein für die öffentliche Sicherheit und Moralität“ gefährlicher „Ausländer“ in den Staat abgeschoben werden, dessen Staatsbürger er allein ist: Preußen.
x
Der Verlust der Souveränität kann den Herrschenden in Preußen egal sein, denn Preußen ist die dominierende Macht im deutschen Kaiserreich. Der Reichskanzler ist – mit einer kurzen Ausnahme – immer zugleich preußischer Ministerpräsident. Auch zu Zeiten der Weimarer Republik nennt sich der Staat, zu dem Preußen jetzt als „Freistaat Preußen“ gehört, noch Deutsches Reich. Als sich die Demokratie zur Einparteien-Diktatur unter einem „Führer“ wandelt und dieser das „Dritte Reich“ proklamiert, wird Preußen nicht aufgelöst. Von 1933 bis 1945 übt formal der Reichskanzler Adolf Hitler selbst die Geschäfte eines „Reichsstatthalters“ in Preußen aus, den er nach dem „Führerprinzip“ in den deutschen Ländern an die Stelle der Parlamente gesetzt hat. Die Befugnisse des Reichsstatthalters in Preußen hat er auf Hermann Göring übertragen. Der ist in der Nazi-Diktatur vieles; neben dem Reichsluftfahrtminister und Präsident des gleichgeschalteten Reichstags auch noch preußischer Ministerpräsident.
Christopher Clarks monumentales 800-Seiten-Werk Preußen – Aufstieg und Niedergang beginnt mit dem Satz „Am Anfang war Brandenburg.“ Damit stellt Clark klar, dass das karge, „des Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse“ Brandenburg der staatliche Kern des Staates Preußen ist und nicht das ehemalige Ordensland und Herzogtum zwischen Weichsel und Memel. In dessen Besitz kommen die Brandenburger Hohenzollern erst 1618, mehr als zwei Jahrhunderte nach ihrer Belehnung mit der Mark Brandenburg durch den Deutschen Kaiser im Jahr 1415. Das Preußenland überträgt dem Staat, der aus den verstreuten einzelnen Territorien der Dynastie der Hohenzollern entsteht, im Jahr 1701 lediglich den Namen. Es ist nicht seine Keimzelle. In der Folge eines hohenzollernschen Zentralismus wird Preußen dann immer mehr vom eigenständigen Herzogtum zur Provinz.
Ostpreußen gibt es nur bis zur bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs am 8. Mai 1945, den Staat Preußen immerhin noch bis zum 25. Februar 1947. An diesem Tag stellt der Alliierte Kontrollrat mit dem Gesetz Nr. 46 fest: „Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden werden hiermit aufgelöst. Staats- und Verwaltungsfunktionen sowie Vermögen und Verbindlichkeiten des früheren Staates Preußen sollen auf die Länder übertragen werden.“ Der australische Historiker Clark, der an der Universität Cambridge lehrt, kann sein Werk deshalb mit dem Satz „Am Ende war nur noch Brandenburg“ beenden. Tatsächlich ist Ostpreußen im Februar 1947 gänzlich von der Landkarte gelöscht. Von der Provinz Pommern bleibt Deutschland immerhin der vordere Teil, von Schlesien noch ein Zipfelchen um Görlitz. Ostpreußen aber entschwindet 1945 vollends in die Geschichte.
Ostpreußische Mischung
1928 tritt die Studienassessorin Ida Kunigk vor eine Klasse der Tilsiter Königin-Luisen-Oberschule für Mädchen in der Saarstraße. Die gebürtige Insterburgerin hat gerade in Königsberg ihr Staatsexamen gemacht. Die 28 Oberschülerinnen sind der neuen Lehrerin unbekannt, und so wirft sie einen Blick ins Klassenbuch. Sie stößt auf ein wahres namentliches Vielvölkergemisch: „Auch von Königsberg her kenne ich manchen dieser Namen, aber so massiert kommen die Kosgalvies, Skripstakies, Prapolinat, Zaggaurs, Gestigkeit nicht vor. Bei Treinatis stutze ich.“[32] Die junge Studienassessorin glaubt in diesem Namen eine Verbindung zwischen litauischem und griechischem Sprachgut zu entdecken. „Der griechische Name Mamatis, der mir vertraut ist, klingt rhythmisch genau wie Sobilatis, Treinatis, Freinatis. Ein aschblondes Mädchen mit Zöpfen heißt Kairies. Das ist wenigstens kürzer. (…) Es ist richtig erleichternd, dass die nächste einen niederdeutschen Namen trägt: Löschke, dass eine andere Berlin heißt. Dann wird es französisch: Courvoisier. Hugenotten haben wir selbst in der Familie, da kenne ich mich aus. Dann erhebt sich die Frage: Soll ich nun Irmgart Dujart sagen oder den Namen französisch aussprechen? Leichter ist es mit dem offensichtlich litauischen Namen Schulmeistrat. Die Dora Bastian gar, deren Namen nun wirklich kein Rätsel aufgibt, wird in ihrem Paß Bastinas genannt. Sie kommt täglich über die Brücke aus Übermemel zur Schule.“[33] Neun Mädchen haben einen litauisch klingenden Namen, in Tilsit keine Überraschung. Schon „Übermemel“ jenseits des Flusses gehört zu „Kleinlitauen“ – dem Memelgebiet. „Dann stutze ich bei Katja Gorbunoff. Ein Blick in das Klassenbuch bestätigt meine Vermutung: griechisch-orthodox. Also russischer Abstammung. Bei dem Namen Manglitz ist das nicht so einfach.“ Später wird Gretel Manglitz der Lehrerin erzählen, dass ihre Großmutter beim Vornamen „Benyna“ gerufen wird. Jetzt weiß Ida Kunigk, dass die Vorfahren des Mädchens aus dem Baltikum kommen. „Andere Namen, die auf ‚ski‘ endigen, sind eindeutig aus dem Polnischen. Die dreisilbigen, die auf ‚er‘ endigenden Namen, wie Scharfetter, Spießhöfer, Schweighöfer stammen großenteils aus dem Salzburgischen; auch ein Teil der zweisilbrigen läßt diese Herkunft vermuten. Die Ebnöthers aber sind Schweizer, die Wallners und Wittwers auch. Dagegen die Witts kommen aus Holland, sind noch Mennoniten. Bei dem Namen Schattauer gerät man vollends ins Schwimmen: Ich tippe auf Salzburger Herkunft, der Kollege, der ihn trägt, leitet ihn von ‚chateau‘ also aus dem Französischen her. Die Problematik des Namens John liegt ähnlich. John hießen die Engländer, die mit ausgeprägtem Geschäftssinn und Pferdeverstand hierher kamen, nachdem die Provinz zum Land der Pferde geworden war.“[34]
Spross einer Familie, deren Vorfahren aus vielen Völkern stammen, ist auch der Schriftsteller Ernst Wiechert, der als Sohn eines Försters in Kleinort im masurischen Kreis Sensburg aufwächst. „Von den Eltern meiner Mutter habe ich nur ihren Vater gekannt. Sein Familienname war französischen Ursprungs, und ich schließe nicht nur daraus und aus seinem dunklen Haar, dass hier ein fremdes Blut durch viele Schicksale seinen Weg in unsre masurische Verschlossenheit gefunden hat.“[35] Wiecherts Großvater lebt als Gastwirt in der Einsamkeit des Waldes der Johannisburger Heide am Ufer der Kruttina, die in den Beldahn-See in der Masurischen Seenplatte mündet. „Mein Großvater heiratete dann ein paar Jahre später ein zweites Mal, und dadurch wurden wir mit einer Familie verbunden, die sicherlich, nicht nur ihrem Namen nach, polnischen Ursprungs war. Und so kann ich, auch mit bescheidener Phantasie, mir denken, dass germanisches, slawisches und romanisches Blut sich in mir vereinigt hat. (…) Am Rande meiner Erinnerung erscheint schließlich noch eine dritte Familie als ein blutverwandter Zweig, die meiner Heimat viele tüchtige Lehrer geschenkt hat, die ohne Zweifel litauischen Ursprungs war und die mich durch ihr hervorragendes Mitglied, meine Tante Veronika, von Kind an mit der Fülle der Märchen, Sagen und Geschichten beschenkt hat, die von jeher ein Merkmal dieses Volksstammes gewesen sind.“[36]
Die Familie des Malers Lovis Corinth ist alteingesessen und bodenständig. „Vater wie Mutter waren ostpreußische Autochthone, arbeiteten und sparten den Pfennig zum Gulden und zum Thaler. Seit Generationen hatte sich Enthaltsamkeit und eiserner Fleiß nebst einem ausgesprochenen Eigensinn und Sucht nach Erwerb entwickelt. Der Vater meines Vaters war Bauer, der wohl in die Pregelniederung gezogen war, um neues Land zu kolonisieren. Der Vater meiner Mutter war ein Tapiauer Schuhmachermeister und Besitzer mehrerer Häuser in der Altstraße von Tapiau.“[37]
Der Schriftsteller Hermann Sudermann stammt aus dem Kreis Heydekrug, der ab 1920 zum Memelgebiet gehört. Seine Familie ist nicht autochthon, sondern zugezogen. Dass Sudermann zum Memelländer wird, liegt am Lauf der großen Welt- und einer kleinen Familiengeschichte. Seine Vorväter sind niederländische Täufer, Mennoniten, die sich im 16. Jahrhundert im damals zur polnischen Krone gehörenden Weichsel-Nogat-Delta niedergelassen haben. Sudermanns Vater Johann wächst in der Elbinger Niederung auf. Die gehört zu jener Zeit schon zu Westpreußen und damit zum preußischen Staat. Im Staate Preußen dürfen Mennoniten kein Land neu erwerben, deshalb wandern viele landlose Mennoniten nach Russland aus. Johann Sudermann ist kein Hoferbe und macht sich so nach Osten auf. Der Weg führt ihn über See und zu Land nach Memel. Bevor er nach Riga weiterreisen kann, gerät er bei Memel in einen heftigen Schneesturm und muss die Reise unterbrechen. Er bleibt im Memelland, heiratet hier die protestantische Tochter eines auf See verschollenen Seemanns aus Pillau und wird Bierbrauer im kleinen Dorf Matzicken in der Nähe von Heydekrug. „Darum bin ich ‚zwischen den Wäldern‘ geboren, darum ist das Memelland (…) meine Heimat geworden. Wäre jenes Schneetreiben nicht gewesen, so würde ich heute wohl ein Deutschrusse sein“[38], stellt Sudermann 1922 fest.
Dass es lange noch Ostpreußen gibt, die das prußische Erbe ihrer Vorfahren betonen, zeigt das Beispiel der gräflichen Familie Kalnein im Kreis Bartenstein. Die Grafen Kalnein stammen von prußischen Edlen ab, die sich früh mit der Herrschaft des Deutschen Ordens arrangiert und daher Besitz und Stellung behalten haben. Der vorletzte Eigentümer des Kalneinschen Besitzes, der 1928 stirbt, hört auf den doch heidnisch klingenden Namen Natango Weidewuth Graf von Kalnein.[39]
Eine multi-ethnische Herkunft schützt nicht vor nationalen Ressentiments, erfährt der junge Max Fürst. Die Fürsts sind keine sehr reiche, aber als Einzel- und Großhändler gut etablierte Familie jüdischer Herkunft in Königsberg. „Mein Onkel Felix, der das Geschäft in der Wassergasse erbte, war der älteste Sohn. Er heiratete Ida – ich habe ihren Mädchennamen vergessen – aus Marggrabowa, einer ostpreußischen Grenzstadt zu Russisch-Polen. Eine sehr agile und lebenslustige Frau. Ich glaube nicht, dass meiner Großmutter Ida genehme war, weil sie mit ihrem polnischen Namen und ihrer Geburtsstadt nicht in unsere deutsche Familie hineinpasste.“[40] Die Heimatstadt der angeheirateten Ida Fürst ist die Kreisstadt von Oletzko im Regierungsbezirk Gumbinnen. Marggrabowa als Geburtsort kommt selbst einer Königsberger Hausangestellten der Familie Fürst noch zu polnisch vor. Max Fürst über deren Reaktion auf das neue Familienmitglied: „Lockalein, das ewige Dienstmädchen (…) prägte auf sie den berühmten Satz ‚fremd bleibt fremd‘. Das war vernichtend.“[41]
Eine Mädchenklasse in der oberländischen Kreisstadt Osterode (Opr.) im Jahr 1925. Der Kreis Osterode kann aus sprachlichen Gründen auch zu Masuren gezählt werden, denn im Süden wird in den Dörfern auch in den 1920er Jahren vielfach noch polnisch gesprochen.
Otto Schneidereit wird im Dorf Praßlauken geboren. Die Familie übersiedelt dann in das 100-Einwohner-Dorf Ackmonienen, das zum Kirchspiel Pillupönen im Landkreis Stallupönen gehört. Dort arbeitet der Vater als Landbriefträger. 1922 zieht die Familie weiter ins Dorf Perkuhnlauken, das später nach Gumbinnen eingemeindet wird. Schneidereit ist ein guter Schüler. Trotzdem kommt der Lehrer der Dorfschule nicht auf die Idee, den Sohn eines Landbriefträgers für eine höhere Schule in der Stadt vorzuschlagen. Vier Jungen aus seiner Klasse sollen auf das Realgymnasisum im nahen Gumbinnen. Ihre Familien sind alle „besser gestellt“, und sie haben typisch deutsche Namen: „Nur Kurt Buttgereit (…) trug einen nichtdeutschen Namen, wie fast alle Schüler unserer Klasse. Unser Klassenlehrer tröstete uns manchmal: Ihr seid zwar allesamt nicht germanischer Abstammung, könnt aber von großem Glück sagen, dass ihr jetzt zur deutschen Nation gehört.“[42]
Doch gibt es noch höhere Hürden zu überwinden als die sprachlichen. „Die Schranke der Konfession war vor dem 19. Jahrhundert wirksamer als die Gemeinsamkeit der Sprache“, konstatiert der Historiker und Archivar Kurt Forstreuter.[43] Deshalb empfinden lutherische Kleinlitauer im Norden Preußens und katholische Großlitauer im Zarenreich, Masuren in Ostpreußens Süden und Polen im angrenzenden Masowien kaum Gemeinsamkeiten. Die Sprache könnte verbinden, aber die Konfession trennt Ostpreußen mitten im Leben wie auch im Tod.
Der Kreis Stallupönen ist wie 32 der 37 ostpreußischen Landkreise zu mehr als 95 % protestantisch. Die Protestantin Erna Wallrath aus Oschnaggern, am Grenzfluss Lepone zum katholischen Litauen gelegen, erinnert sich an die dörflichen Beerdigungen in den 1920er und 1930er Jahren: „Natürlich ging das ganze Dorf, der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Auch Frau Kaukas gehörte zur Trauergemeinde. Die Familien Kaukas und Prapolinat waren katholisch. Üblicherweise mischten sich die Konfessionen nicht, doch wie stark das auf einzelne Bereiche zutraf, hing doch von den jeweiligen Leuten persönlich ab. Frau Kaukas zum Beispiel meinte, wie alle, zur Dorfgemeinschaft zu gehören, unabhängig von der Konfession, und ging selbstverständlich zur Beerdigung. Frau Prapolinat jedoch ging nicht.“[44]
Die Prapolinats sind im 18. Jahrhundert aus dem damals mit Polen verbundenen Litauen wenige Kilometer über die Grenze nach Oschnaggern zugezogen. Spätere Generationen haben auch in den Nachbardörfern Plimballen, Wanaikischken und Woynothen gesiedelt. In Litauen wie in Polen hat die katholische Gegenreformation gesiegt, in Ostpreußen mit Ausnahme des Ermlandes das Luthertum. Alle Litauer jenseits der Grenze sind im 18. Jahrhundert katholisch, die Litauer in Ostpreußen Protestanten. Tatjana Hetzel hat die Geschichte der Familie ihrer Mutter Erika Prapolinat erforscht. Sie entstammt einer kleinen Minderheit litauischer Ostpreußen, die fremd bleiben unter preußischen Litauern – Katholiken litauischer Abstammung. Ein Teil der Verwandtschaft von Erika Prapolinat – Oma Eva, Onkel Georg und Tante Berta Prapolinat – lebt in Plimballen, Kreis Stallupönen. „Die Prapolinats waren die einzigen Katholiken im Dorf. So war es schwierig, entsprechende Ehepartner zu finden. (…) So kam es vor, dass man entweder gar nicht heiratete, obwohl ein nettes Mädchen, das einem auch gut gesonnen war, gegenüber wohnte, aber evangelisch war, oder man zog in die Ferne und kümmerte sich nicht um konfessionelle Traditionen und um elterliche Bedenken. So kam es, dass Georg und Berta unverheiratet blieben und mit der Mutter zusammen den Hof bewohnten und bewirtschafteten bis zur Flucht, auf der Oma Eva 85-jährig bei Preußisch Eylau starb.“[45]
Rom und Sinte
Vier Wochen nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Mauthausen am 6. Mai 1945 hat der damals 22-jährige Sinto Reinhard Florian nichts anderes im Sinn, als heimzukehren: „Ich wollte unter allen Umständen schnell zurück nach Hause. Nach Ostpreußen! In meine Heimat. Von da komm’ ich. Da gehöre ich hin!“[46] Aber auch das Opfer des Nationalsozialismus, am 24. Februar 1923 in Matheningken im Kreis Insterburg als fünftes Kind von Reinhard Habedank aus Puskeppeln im Kreis Ragnit und seiner Frau Florentine Florian, gebürtig aus Reckeitschen, geboren, lassen die Sieger des Zweiten Weltkrieges nicht zurück in die Heimat. Aus der hatten 1942 die Nationalsozialisten den 19-Jährigen in Arbeits- und Konzentrationslager verschleppt.
Im 20. Jahrhundert lebt in Ostpreußen die größte Gruppe der Minderheit der Sinti im Deutschen Reich. Etliche Sinti-Familien sind seit Generationen in der Provinz ansässig. Sie heißen Broschinski, Dambrowski, Klein, Herzberg, Anton, Large, Ernst oder wie die Eltern des KZ-Überlebenden Habedank und Florian. Sie sprechen das ortsübliche Plattdeutsch und fühlen sich der Heimat verbunden. Mehrheitlich leben die ostpreußischen Sinti als Sesshafte. „Ich war doch Deutscher, ein Deutscher aus Ostpreußen“, sagt Reinhard Florian in einem der Interviews, die die Basis seines Buches, in dem er sein Überleben als Sinto schildert, bilden.[47] „Der Krieg hatte daran nichts geändert. Wie sollte ich mich auch anders fühlen? Ich bin groß geworden in Deutschland und kenne kein anderes Land. Ich spreche auch nur Deutsch.“[48] Selbst wenn sie wie Reinhard Florian überlebende Insassen von Konzentrations- und Arbeitslagern sind, verweigern die bundesdeutschen Behörden Sinti und Roma aus Ostpreußen, Hinterpommern oder Schlesien bis in die 1970er Jahre einen deutschen Pass. Sie erhalten sogenannte Fremdenpässe, in denen Berufe angegeben werden müssen. Meist steht dann darin „Landfahrer“ oder „Musiker“. Die 1970 gegründete Gesellschaft für bedrohte Völker kämpfte für die Wiedereinbürgerung dieser Sinti und Roma. Und hatte damit Erfolg.[49]
In der Erinnerungsliteratur der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wird häufig anekdotisch von den ostpreußischen Sinti berichtet. Fast immer transportieren diese Berichte Vorurteile, die sich aus Unwissenheit und Rassismus speisen. Solche Berichte lassen sich allerdings in der Erinnerungsliteratur aller deutschen Regionen finden. An der Chaussee von Nettschunen nach Schillehnen an der Memel, etwa 6 km vor der Einmündung der Scheschuppe in die Memel, liegt auf dem Nordufer des Flusses die etwa 420 Einwohner zählende Gemeinde Giewerlauken. Birkallnis, der östlichste Teil dieser Gemeinde, macht den Ort auch in der weiteren Umgebung bekannt. Denn in Giewerlauken lebt eine Gruppe sesshafter Sinti. „Mehrere Grundstücke standen in ihrem Eigentum, die jeweils von einer ganzen Sippe bewohnt waren. Diese Volksgruppe hatte wenig, oder besser gesagt, überhaupt keine Neigung, einer ständigen Beschäftigung nachzugehen oder in ein festes Arbeitsverhältnis im allgemein verstandenen Sinne einzutreten. Die Grundstücke wiederum waren einmal nicht so groß, dass die darauf sesshaften Sippen von den Erträgen hätten leben können und zum anderen bestand gerade dieser Ortsteil der Gemeinde aus fliegendem Sand.“[50]
Die älteren Männer hätten gelegentlich ein paar Körbe geflochten oder einige Reisigbesen gebunden. „Die männlichen Mitglieder der Sippen befassten sich mehr oder weniger mit einem bescheidenen Pferdehandel, der auch nicht den größten Gewinn brachte, weil nur mit Gebrauchspferden der unteren Preisklassen gehandelt wurde.“[51] Der Chronist des Kreises Ragnit, Walter Broszeit, kolportiert die üblichen Vorurteile. Ergraute Pferdchen seien über Nacht zu glänzende Rappen geworden, ein schon alterslahmes Tier sei am Markttag wie ein Dreijähriger vorgeführt worden. „Diese und ähnliche Methoden hatten zu größter Vorsicht der übrigen Handelswilligen geführt, so dass der Handel oft nur unter Zigeunern abgewickelt wurde.“[52] Die Frauen der Sippen, so Broszeit, schwärmen zum Betteln von Lebensmitteln und Kleidung in die umliegenden Dörfer aus. Sie hätten zum Eintausch gegen Lebensmittel oder auch zum Verkauf die Körbe und Reisigbesen mitgenommen. „Die Aktivitäten einzelner Zigeunerinnen gingen oft über die Erwartung freiwilliger Gaben hinaus und haben diese Volksgruppe mehr in Verruf gebracht als es für sie insgesamt zutraf.“[53]
Sinti siedeln schon lange in Ostpreußen. „Deshalb dürfte es kein Zufall sein, dass um 1785 der Nachweis der ursprünglichen Herkunft der ‚Zigeuner‘ in Königsberg erfolgte“, vermutet Uwe Neumärker, Historiker und Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin in einem Vortrag im Jahr 2013.[54] Der 1753 in Osterode geborene Christian Jakob Kraus ist seit 1781 Professor für praktische Philosophie an der Königsberger Universität. Er besucht im Jahr 1784 fast täglich eine Gruppe litauischer und preußischer Sinti in einem Königsberger Gefängnis. Kraus untersucht ihre Sprache, Herkunft, „Physiognomie“ sowie den „Charakter“. „Drey Dinge sind mir an den Zigeunern interessant; ihre originale Sprache, ihr uneuropäischer Körper, und ihr unbürgerlicher Charakter. … (D)iese drey Puncte sind ebenso viel wichtige Probleme für den Forscher der Geschichte der Menschheit.“[55] Anhand der Sprachforschungen gelingt es Kraus, die Herkunft der Sinti aus Indien nachzuweisen. Er korrigiert einige Vorurteile der Anthropologie seiner Zeit, so die Vorstellung, dass die Hautfarbe der „Zigeuner“ abfärbe oder durch Körperpflege abzuwaschen sei.[56]
Der 1799 in Kassel geborene Leopold Karl von Heister ist seit 1830 Offizier im Grenadierregiment König Friedrich Wilhelm I. (2. Ostpreußisches) Nr. 3 in Königsberg, die „Dritten Grenadiere“. Er steigt dort bis Ende August 1841 zum Major auf. Ab Mitte Juni 1842 bis Ende März 1843 ist er in diesem Rang Kommandeur des I. Bataillons im 1. Landwehr-Regiment. In seiner Königsberger Zeit verfasst Karl von Heister ethnographische und geschichtliche Notizen über die Zigeuner, die er 1842 bei der Königsberger Verlagsbuchhandlung Gräfe und Unzer publiziert.[57] Das Buch schließt mit einem Kapitel „Die Zigeuner Ostpreußens“. Für das Verfassen dieses Kapitels hat sich der Autor von Königsberg aufs Land begeben. Als von Heister am 10. August 1842 von Labiau nach Labagienen am Kurischen Haff wandert, kann er erstmals seinen spärlich im Selbststudium erworbenen Wortschatz anwenden. Bis dahin hat er keinen großen Kontakt zu „Zigeunern“ gehabt. „Die Spannung war sehr groß, endlich Leute eines Volkes näher kennen zu lernen, mit dem ich mich seit Jahren beschäftigt hatte, und welches mir dadurch interessant und, ich bekenne es gern, auch werth geworden ist.“[58]
Es sei schwierig zu bestimmen, wie viele „Zigeuner“ sich in Ostpreußen aufhielten, schreibt von Heister. Da gebe es unterschiedliche Angaben. „Es erklärt sich dies aber sehr leicht dadurch, dass diese Fremdlinge, wenn gleich nicht eigentlich heimatlos, doch überaus oft den Aufenthaltsort wechseln. Es sind die Namen von 18 Familien bekannt, worunter aber einige sehr zahlreiche Mitglieder haben, so dass die Annahme von 140 Seelen für diesen Volksstamm der Wahrheit ziemlich nahe kommen wird.“[59] Als Familiennamen notiert von Heister Dombrovski, Koslovski, Broszaski, Paskobski, Cziblinski, Morgenstern, Habedank, Hermann, Bothmert, Larsze, Anton, Böhmée, Reinhard, Klein und Benjamin. „Die vielen polnischen Namen deuten wohl an, von wo sie zunächst zu uns kamen. Die Frage, was diese Leute treiben, wovon sie sich ernähren, muss leider dahin beantwortet werden, dass ihre Existenz eine sehr unsichere Grundlage hat und dass bei ihnen wie bei allen Zigeunern fast allgemein die entschiedenste Arbeitsscheu hervortritt.“[60]
Planwagen einer ostpreußischen Sintifamilie auf der Markstraße am Kurfürstenplatz in der Kreisstadt Labiau im Jahr 1935. Im Hintergrund der Turm der Stadtkirche. In diesem Jahr beginnen die Nationalsozialsten mit der brutalen Ausgrenzung der Sinti und Roma.
Komme eine „wandernde Bande“ von Sinti in die Nähe ihrer Wohnorte, so erwache „unwiderstehlich“ der Hang zum Vagabundieren bei den Ansässigen. „Ein Theil der Zigeuner sammelt Lumpen was Gelegenheit zum Wandern giebt.“[61] Die Mehrzahl aber handele mit Pferden. Man sehe sie als Händler zahlreich auf dem Pferdemarkt in Wehlau und auch auf den Wochenmärkten in Tilsit, in Labiau und anderen Städten. Sie hätten Pferdeverstand. „Man wird nicht leicht einer Zigeunerfamilie begegnen, die nicht ein, auch zwei Pferde bei sich hat und die keineswegs in schlechtem Futterzustande sind.“[62]
Auch die heute allgemein verwendete Eigenbezeichnung der Roma und Sinti findet der forschende Major heraus. „Rom“ sei die von ihnen bevorzugte Bezeichnung. In Russland würde man sie „Mellelle“ – Schwarze – nennen, die in anderen Ländern lebenden „Rom“ würden die hiesigen Rom, also die deutschen, „Lallere-Sinte“ bezeichnen. „Fast alle Zigeuner reden drei, auch vier Sprachen Deutsch, Litthauisch, Polnisch und wie es in den Signalisements heißt: Aegyptisch.“[63] Die meisten Roma und Sinti in Ostpreußen bekennen sich nach von Heister zur katholischen Religion. Sie ließen aber ihre Kinder auch in den evangelischen Kirchen taufen, „oft nur weil die Bewohner des Dorfs, wo sie sich niederlassen, keine Heiden unter sich dulden wollen“.[64] In einzelnen Orten würden die Kinder vom protestantischen Pfarrer konfirmiert.
In Labagienen darf von Heister die Wohnung einer Rom-Familie betreten. „In dem Hinterstübchen eines Bauernhauses fand ich eine sehr hübsche junge Frau mit einem quittengelben Säugling an der Brust, die mich freundlich und ohne Scheu willkommen hieß, als ich meinen Wunsch aussprach, eine Zigeunerbehausung kennen zu lernen. Um aber einen Platz zu gewinnen, musste eine große Sau mit erwachsenen Ferkeln zur Stube hinaus, die kaum 12 Fuß im Quadrat hatte. Obgleich grenzenlos schmutzig, sah es doch bei weitem wohnlicher aus, als ich mir vorgestellt hatte.“[65] In dem Raum wohnen vier Erwachsene, vier Kinder und der Säugling. Solche Wohnverhältnisse sind im ganzen 19. Jahrhundert nicht nur für arme Sinti und Rom-Familien typisch.
Die Familie in Labagienen zahlt mit der Aufzucht der Ferkel die Miete, sammelt Lumpen, geht manchmal für den Bauern aufs Feld und hat von ihm ein Stück Land gepachtet, auf dem sie Kartoffeln anbaut. „Da ich den Säugling auf den Arm nahm und wunderschön fand, hatte ich das Herz der Mutter, die mich übrigens auch sofort angebettelt hatte, gewonnen.“[66] Bettelei verbinden fast alle Quellen des 19. und 20. Jahrhunderts mit den Roma und Sinti.
Karl von Heister berichtet seinen Lesern: „viel hört man von ihren Diebereien besonders an Pferden erzählen“. Wegen der Nichtachtung des Eigentums hätten die „Fremdlinge“ auch in Ostpreußen den schlechtesten Ruf. Den möchte der preußische Offizier mit Sympathien für die „Fremdlinge“ korrigieren. „Dies scheint aber nicht ganz begründet. Vom Jahre 1836 bis (18)42 wurden gegen 40 Zigeuner beiderlei Geschlechtes in die Correktionsanstalt in Tapiau abgeliefert und unter diesen ist wie die eingesehenen Akten ergeben auch nicht ein Individuum eines Verbrechens wegen detentirt worden, sondern es hatten sich Alle allein des Vagabondirens schuldig gemacht.“[67]
Fünf Jahreszeiten und kein Sommer
„Die Stadt ließ einen die Nähe Rußlands besonders stark empfinden, vor allem an den Winterabenden, wenn hoher Schnee lag, der Wind ohne Unterbrechung aus Nordosten blies und den sternenübersäten Himmel von Wolken reinhielt“[68], schreibt Erich Pfeiffer-Belli über Königsberg. Ostpreußen kann ein kaltes Land sein. Der Schriftsteller Horst Biernath ist in Lyck geboren, aufgewachsen aber in Königsberg und Braunsberg. Zur deutschen Sprache hat er ein geflügeltes Wort beigetragen: „Vater sein dagegen sehr.“ Biernath ist vom leichten Fach. Er erinnert sich an ein Bonmot: „Es gab Leute, die vom ostpreußischen Jahresablauf zu behaupten wagten, es gebe hier neun Monate Winter und drei Monate keinen Sommer.“[69]
Das Urteil eines Mannes aus Korsika fällt etwas gnädiger aus, als dieser sich auf St. Helena an seine Zeit in Ostpreußen vom Februar bis Juli 1807 erinnert: „Sieben Monate Winter und kein Sommer.“ Napoleon Bonaparte zieht sich angesichts des langen Winters oft mit seiner Geliebten, der polnischen Gräfin Maria Walewska, in die Federbetten des Schlosses Finckenstein des Burggrafen zu Dohna-Schlobitten zurück. Das ungewohnte, dem Kaiser der Franzosen bald verhasste nordische Klima und der unabsehbare Winter mit den vielen Witterungsumschlägen gefährden auf Monate nicht nur seine eigene Behaglichkeit, sondern auch die Kriegstüchtigkeit seiner Armee. Napoleon hat 1807 in Ostpreußen seine Lektion nicht gelernt, sonst wäre er nur sechs Jahre später nie nach Moskau gezogen.
Lovis Corinth über die Kälte in seiner Heimat: „Dort im Norden ist ein Winter ein ganz anderer Zeitraum, als man es sich im übrigen Deutschland denkt. Der Wind von Russland läßt Flüsse und eigentlich alles erstarren.“ Bei strengen Minusgraden wurde es nur für die Schulkinder gemütlich: „Die Schule gab, wie im Sommer bei zu großer Hitze, ebenso bei allzu großer Kälte, oft sogar mehrere Tage hintereinander, Kälteferien.“[70]
Ostpreußen hat lange, strenge Winter, einen schnellen Frühlingsübergang, kurze heiße Sommer und schöne, im Innern der Provinz häufig ausdauernde Herbstwochen. Für den Kreis Lötzen in Masuren gilt wie für die ganze Provinz: „Der Juni bringt in der zweiten Hälfte sehr warme Tage und damit einen schroffen Übergang zum Sommer. Juli und August haben die höchsten Wärmegrade aufzuweisen. Die hohen Durchschnittstemperaturen in diesen Monaten bleiben hinter denen Mittel- und Westdeutschlands nicht zurück; überhaupt ist der Sommer in Ostpreußen gegenüber den westlichen Gebieten Deutschlands durch eine sehr viel intensivere Sonnenbestrahlung gekennzeichnet. So hatte Lötzen im Jahr 1935 eine Sonnenscheindauer von 1 675 Stunden, Königsberg 1 577, Aachen 1 140 Stunden.“[71]
Für Erich Pfeiffer-Belli ist Königsberg am schönsten im Sommer. „Dann spürte man die nahe See, und das bunte glückliche Treiben auf den Bahnsteigen, von denen aus man an den Strand fuhr, war von unbeschwerter Jugendlichkeit. Königsberg genoß seinen Sommer mit den hellen Nächten, die der laute Schlag des Sprossers quälend-sehnsüchtig durchlärmte.“[72]
Das mittlere Klimabild Ostpreußens im Jahresverlauf weist gegenüber der Mitte und dem Westen Deutschlands erhebliche Unterschiede auf. In Memel scheint die Sonne am häufigsten im Deutschen Reich. Die Stadt hat 400 Stunden Sonnenschein mehr als Aachen[73] und kann sich mit dem Schweizer Tessin messen. „1926–1937 wurde im Durchschnitt eine Sonnenscheindauer von über 1 700 Stunden jährlich ermittelt, wobei auf die Monate Mai bis September 1 169 Stunden entfielen. Kopenhagen hatte in der gleichen Zeit nur 1 200 Stunden Sonnenschein im Jahr, in den Sommermonaten sogar nur 825 Stunden. Lugano (Tessin) kommt zwar auf 2 227 Stunden Sonnenschein jährlich, hat aber von Mai bis September auch nur 1 200 Stunden und damit etwas mehr als Memel.“[74] 68 Tage im Jahr wird in Memel eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad gemessen. An durchschnittlich 160 Tagen im Jahr regnet es.
Beständiger als in anderen Teilen Deutschlands ist das Wetter im Herbst. Er beginnt zumeist mit mehreren schönen Wochen von Anfang September bis Mitte Oktober; überhaupt ist der September in Ostpreußen der wetterbeständigste Monat. In Königsberg herrscht ein anderes Wetter als im Innern der Provinz. Marie Luise Kaschnitz erlebt 1938 in ihrem sechsten Jahr in Königsberg ihren ersten Herbstanfang im Samland: „Der Herbst ist nicht wie in Baden ein farbiger leuchtender Aufschwung zum Ende hin. Die Traurigkeit des Novembers ist schon in den grauen, windigen Tagen, die Blätter sind nicht golden, sondern braun, müde, verknittert.“[75] Ab Mitte Oktober verschlechtert sich die Witterung, es wird feuchtkalt. „Zum Monatsende künden vereinzelte Schneeschauer schon den nahenden Winter. Trübe, regnerisch, mitunter auch stürmisch zeigt sich der November. Frostperioden folgen auf Tauwetter in raschem Wechsel. Erst um Weihnachten herum trifft beständiges Frostwetter ein.“[76] Die Lehrerin und Schriftstellerin Agnes Harder kann in Preußisch Holland im Oberland die Winter – „ritsche, ratsche!“ – hören, „denn knirschte die Säge, so wusste ich, der Winter kam bald. Dann wurde das Tor aufgemacht und die Fuhre Torf hereingebracht, und mein Vater ging herunter und beobachtete, wie der Bauer in seinem Pelz den Torf in die großen grünen Weidenkörbe zählte und 100 nach 100 in den Stall gebracht wurden.“[77]
Im ostpreußischen Winter hat Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten festgestellt, dass der Pferdeschlitten dem Kraftwagen noch lange überlegen ist. „Es gab unangenehme Schlittenfahrten bei eisigem Wind oder auch bei Schneesturm, der mitunter meterhohe Schneefälle auftürmte. Meist fuhr man über diese bizarren Gebilde einfach hinweg; das Durchschaufeln der Schneewehen wurde erst mit dem zunehmenden Autoverkehr in den zwanziger Jahren erforderlich. Vor dem Ersten Weltkrieg ließen die wenigen Autobesitzer aus dem Lande ihre Wagen im Winter stehen.“[78] „Schlittenfahrten waren andererseits für alle Beteiligten sehr reizvoll. Die Pferde bekamen für Schlittenfahrten stets eine Glocke an das Sielzeug gebunden. Das helle Gebimmel der Glocken war in solcher Winterzeit weit über die verschneite Landschaft zu hören“[79], erinnert sich Alfred Schiedat, der Sohn eines Kleinbauern, in seiner Geschichte des ostpreußischen Dorfes Bumbeln im Kreis Gumbinnen. „Bei regelmäßigem, reichlichem Schneefall in unserer Gegend waren (…) alle Straßen und Wege in Bumbeln schwer zu befahren. Ohne Schlitten war an eine Beförderung von Lasten, z.B. Dungfahrten, nicht zu denken.“[80]
Sind Ostpreußen zu Scherzen aufgelegt, behaupten sie, es gebe in ihrer Provinz nur einen einzigen garantiert frostfreien Monat, den Dezember. Denn üppiger Schneefall und starker Frost setzen meist erst nach Weihnachten ein.[81] Januar und Februar sind dann die kältesten Monate.[82] Flüsse und Seen bedeckt monatelang, oft bis in den April hinein, eine feste Eisdecke. Schneestürme fegen über Wiesen und Felder. Aber das Frostwetter ist trocken und beschert den Menschen auch schöne klare Tage mit Sonnenschein.[83] Der Südosten Masurens ist über 100 Tage mit einer Schneedecke bedeckt. In Westdeutschland liegt nur etwa 20 Tage, an der Oder etwas über 50 Tage Schnee.
Marggrabowa im Kreis Oletzko im nordöstlichen Masuren ist die kälteste Stadt Deutschlands. 155 Tage im Jahr fallen die Temperaturen unter null Grad, in Königsberg nur an 111 Tagen. Klausen im Kreis Lyck hat 54,7 Eistage, an denen die Temperatur ständig unter dem Gefrierpunkt bleibt – gemessen über einen Zeitraum von 20 Jahren – Königsberg aber nur 43,4 Tage. In Marggrabowa liegt die Jahresmitteltemperatur bei 5,7 Grad, in Königsberg bei 6,7 Grad. München hat ein Jahresmittel von 7,4 Grad, Berlin sogar von 9,0 Grad.[84]
Während in Masuren bereits kontinentales Klima herrscht, beschert die Ostsee Königsberg, dem Samland, dem flachen Norden bzw. Nordwesten der Provinz ein milderes Seeklima. Dass der Kreis Goldap im Osten ein anderes Klima als die Küstenregion hat, erfährt die Bahnverwaltung in jedem Winter, wenn sich die Lokomotiven auf der Bahnstrecke von Blindgallen nach Szittkehmen in der Rominter Heide festgefahren haben: „Wegen der Höhenlage einerseits und der langen Einschnitte andererseits war sie im Winter sehr schnell verschneit. Wenn die Eisenbahndirektion in Königsberg von uns hörte, dass auf dieser Strecke schon Vorspannlokomotiven und Schneepflüge eingesetzt wurden, wunderte man sich dort sehr, da sonst nirgends in Ostpreußen solche Schwierigkeiten so früh auftraten.“[85] Aber auch im samländischen Königsberg kann das Wetter extrem werden. Der in Pillau und Königsberg aufgewachsene Dichter Ernst Wichert erinnert sich an kalte Zeiten und kindliche Winterfreuden in den 1840er Jahren: „In einem Winter stellte sich überraschend so starker Frost ein, dass das Tief bis weit in die See hinaus gefror, was seit Menschengedenken nicht geschehen war und sich auch meines Wissens seitdem nicht wiederholt hat. Drei Tage lang war das Eis so haltbar, dass man nach der Nehrung hinübergehen und auf der spiegelblanken Fläche Schlittschuh laufen konnte. Ganz Pillau war auf dem Eise.“[86]
Unvergessen ist der „Eiswinter 1929“. Am 9. Februar 1929 werden in Marggrabowa (Treuburg) minus 42,0 Grad gemessen, der ewige Kälterekord in Deutschland. Der Jahrhundertwinter beginnt in Ostpreußen spät, erst am 15. Januar 1929. An diesem Tage hat der Rechtsanwalt und spätere Vertriebenenfunktionär Linus Kather in der Nähe von Gerdauen eine Treibjagd auf Hasen mitgemacht. „Unser Glück war es, daß wir gegen die Gewohnheit das Schüsseltreiben ziemlich früh verließen, denn unterwegs begann es derartig zu schneien, daß wir für die beiden letzten Kilometer vor Königsberg drei Stunden gebraucht haben. So schafften wir es, während hunderte von Kraftwagen damals monatelang in der Provinz festgehalten wurden.“[87] In der großen und anhaltenden Kälte mit mehr als 40 Grad unter Null verlieren die Rehe in Kathers eigenem Revier im Hegewald bei Seeburg im Kreis Rößel die Scheu vor den Menschen und suchen in ihrer Nähe Hilfe. Von den 400 Rehen, die Kather im von ihm gepachteten Hegewald vermutet, werden 65 erfroren gefunden.[88]
Auch der Pfarrer des Seebades Kahlberg auf der Frischen Nehrung, Ernst Froese, erinnert sich an den Eiswinter: „Für die Fischer war der Winter 1928/29 ein sehr großer Fehlschlag. Bis zum Neujahrsfest war der Fang nur mäßig. Nach dem 1. Januar 1929 setzte langanhaltender, sehr scharfer Frost ein. Nicht bloß das Haff fror zu, sondern auch die See. Wir erleben fast jedes Jahr, dass die See am Rande voll Eis liegt, das aus der Weichsel bei Weststrom herübergetrieben wird und sich am Rande festsetzt. Diesmal aber geschah etwas, worauf sich die ältesten Leute nicht besinnen konnten, dass sie’s schon einmal erlebt hätten. Die See fror zu. Anfangs vielleicht nur ½ km breit, so dass man hinten noch das offene Wasser sehen konnte. Dann verschwand auch dieser Wasserstreifen und, soweit das Auge sehen konnte, war eine weiße tote Masse, wo sonst die Wellen und Wogen ihr lustiges Spiel treiben. Das blieb wohl 10 Wochen lang so, – immer dasselbe starre Bild, – weiß – tot. Es konnte einem Angst werden vor diesem Wintertod. Die Fischer standen manches Mal auf den Dünen und schauten, ob nicht Bewegung käme in diese Eismassen. Sie rührten sich nicht. Die Räuchereien standen still und verlassen, kein Schornstein rauchte, kein Gesang der arbeitenden Mädchen war zu hören. Der Winter hielt alles in seinem strengen Bann.“[89] Am Frühlingsanfang 1929 liegt das Eis des Haffs noch ganz fest, erst allmählich fängt es an, sich zu rühren. Es schiebt sich zu Eisbergen. Dann wird es nach einigen Tagen vom Südwind fortgetrieben und der Strand eisfrei. Die Fischer von Kahlberg und Tolkemit können ihren Beruf wieder ausüben.
In der Memelniederung hat man eine eigene fünfte Jahreszeit. Für sie haben die Menschen im Memelland und in der Elchniederung ein besonderes Wort: „Schaktarp“. Die Dokumentarfilmerin, Journalistin und Autorin Ulla Lachauer erklärt: „Das heißt ‚zwischen den Zweigen‘ und ist ein Bild für den Zwischenzustand – nicht fest, nicht flüssig, nicht gangbar, nicht schiffbar. Das Wort kommt aus dem Litauischen, ist wohl auch mit einem altpreußischen verwandt.“[90] „Schaktarp“ ist der Zustand der „Wegelosigkeit“, die man beim russischen Nachbarn „Rasputiza“ nennt. Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommen bei Hochwasser und „Schaktarp“ jedes Jahr Menschen ums Leben.
Im Frühjahr sind im Memeldelta die Überschwemmungen abhängig von der Schmelzwassermenge, die in das Haff fließt. Bei viel Schmelzwasser ist das schmale Memeler Tief nicht imstande, die Wassermassen in die Ostsee abzuführen. Der Pegel im Haff steigt an und überschwemmt große Teile der Niederung. Höher gelegene Bauernhöfe ragen dann wie Inseln hervor, andere stehen unter Wasser. Die Bewohner müssen während dieser Zeit auf ihre Dachböden ziehen, die Möbel und auch die Tiere im Stall „hochstellen“. In der Niederung ist man dafür gerüstet und hat vorgesorgt für Mensch und Tier. Das einzige Verkehrsmittel ist jetzt der Kahn, den jeder Haushalt besitzt. „Das war die Zeit, in der die Bewohner der uneingedeichten Niederung ihr Vieh auf den Heuboden aufgestallt hatten, nur mit Booten zu ihrem Häusern gelangen konnten und deren obere Stockwerke beziehen mussten, da in den unteren Räumen das Wasser stand. In Ruß wurden auf dem Dachboden der Kirche für diese Zeit auch Särge bereitgehalten.“[91]





























