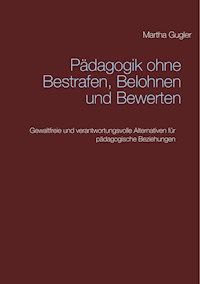
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In dieser Arbeit geht es um gewaltfreie Methoden in der (Heil-)Pädagogik. Wenn pädagogisches Handeln auf Kontrolle und Bewertung des Verhaltens ausgerichtet ist, verhindert dies gute Beziehungen und Entwicklung zur Selbständigkeit. Dennoch glauben Pädagogen oft, nur so ihrer Verantwortung gerecht werden zu können. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, Menschen ohne Machtausübung zu führen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Konzepte für gewaltfreie Beziehungen mit Kindern beinhalten unter anderem Gleichwürdigkeit, Partizipation, Authentizität und das Beachten aller Bedürfnisse. Das Ziel dieser Arbeit ist es, diese Prinzipien vorzustellen und auf pädagogische Beziehungen mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung zu übertragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Einleitung
Erwachsene mit geistiger Behinderung und Kinder
2.1 Kinder
2.2 Erwachsene mit geistiger Behinderung
2.3 Benutzung des Begriffs der geistigen Behinderung
2.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten
2.4.1 Lebenserfahrung
2.5 Gewalt und Ausgrenzung
2.5.1 Bedürfnisse
2.5.2 Fehlende Fähigkeiten und daraus resultierende Abhängigkeit
2.5.3 Pädagogische Beziehungen
2.6 Pädagogische Ziele
2.6.1 Selbständigkeit
2.6.2 Selbstwertgefühl und Selbstgefühl
2.6.3 Integrität
Strafe, Belohnung und Bewertung als Gewalt
3.1 Gewalt
3.2 Macht
3.3 Bestrafung und Belohnung als Machtmittel
3.3.1 Definition von Strafe
3.3.2 Definition von Belohnung
3.3.3 Kritik an Machtmitteln im Allgemeinen
3.3.4 Kritik an Bestrafung
3.3.5 Kritik an Belohnung
3.4 Definitionsmacht und Bewertung
3.4.1 Schuldzuweisung
3.4.2 Untersagen bestimmter Gefühlsäußerungen
3.4.3 Belehrung
3.4.4 Bewertung des Kindes
3.4.5 Kommunikationssperren
3.5 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Grundlegendes für eine gewaltfreie und verantwortungsvolle Pädagogik
4.1 Vorbildfunktion
4.2 Bedürfnisse des Kindes erfüllen
4.3 Kooperation des Kindes
4.4 Der Konflikt zwischen Integrität und Kooperation
4.5 Verantwortung
4.5.1 Soziale und persönliche Verantwortung
4.5.2 Verantwortungsbereich der Erwachsenen
4.5.3 Entwicklung von sozialer und persönlicher Verantwortung
4.6 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Das Herstellen einer gleichwürdigen Beziehung
5.1 Gleichwürdigkeit
5.2 Beziehung
5.3 Akzeptanz und Anerkennung der Persönlichkeit
5.4 Erleben und Bedürfnisse des Kindes ernst nehmen
5.5 Empathie
5.6 Interesse für das Kind
5.7 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Führung und Autorität
6.1 Führung
6.2 Autorität mit Einfluss
6.3 Persönliche Autorität
6.4 Authentizität und Kongruenz
6.5 Bedürfnisse der Erwachsenen als natürliche Grenzen
6.6 Entscheidungen treffen
6.7 Konsequenz und Regeln
6.8 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit
7.1 Persönliche Entwicklung
7.2 Entwicklungsmöglichkeiten durch Kinder
7.3 Verletzungen aus der eigenen Kindheit verarbeiten
7.4 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Partizipation
8.1 Bei Regeln und Entscheidungen
8.2 Bei der Konfliktlösung
8.3 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Kommunikation
9.1 Aktives Zuhören
9.2 Persönliche Sprache
9.3 Gewaltfreie Kommunikation
9.4 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Wenn es nicht funktioniert
10.1 Zur Menschlichkeit gehören Fehler
10.2 Veränderung braucht Geduld
10.3 Ungehorsam als Suche nach Integrität
10.4 Transfer zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Fazit
11.1 Zusammenfassung
11.2 Reflexion und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Tabelle 1: Schwere Verhaltensstörungen in Bezug zum Grad der geistigen Behinderung
Tabelle 2: Kommunikationssperren
Danksagung
Die Beschäftigung mit meiner Fragestellung hat mir nicht nur viel Freude bereitet, sondern mich auch zum Nachdenken gebracht und einige Veränderungen in mir angestoßen. Darum gilt mein besonderer Dank allen, die mich in diesem Prozess begleitet und unterstützt haben, die mit mir diskutiert haben, die mich auf neue fachliche oder persönliche Erkenntnisse gestoßen haben, die mich durch interessierte und kritische Fragen in Erklärungsnot gebracht haben und die mir immer wieder gezeigt haben, wie wichtig und gefragt die Themen dieser Arbeit sind.
1 Einleitung
Im Praxissemester arbeitete ich in einer WfbM (Werkstätte für behinderte Menschen), in der oft gestraft wurde, wenn Menschen mit Behinderung gegen Regeln verstießen. Ich hatte den Eindruck, dass dies kein besonders effizienter Weg war, um das Ziel (der Bestrafung) zu erreichen. Noch dazu schien die Bestrafung dem entgegenzustehen, was ich als langfristige pädagogische Ziele empfinde, also z.B. Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwertgefühl, Teilhabe, Mitbestimmung oder Bildung. Nachdem ich mich etwas mehr mit Strafen auseinandergesetzt hatte, fiel mir auf, wie wenig ich im Studium über den konkreten Umgang mit Regelverstößen und Konflikten im Alltag gelernt und nachgedacht hatte. Bestrafen und ähnliche auf Kontrolle ausgerichteten Erziehungsmittel (wie Schimpfen, Belehren, Belohnen) hatte ich in der Praxis als gängig und alternativlos erlebt und daher weitestgehend unreflektiert übernommen. Dabei wäre fachliche Reflexion gerade hier enorm wichtig. Im Folgenden wird zu sehen sein, dass Bestrafungen, Belohnungen und Bewertungen (in Form von Kritik, Schimpfen, aber auch Loben) abwerten und abhängig machen. Darum sind sie letztendlich als Ausübung von Macht und passiver Gewalt zu sehen. Damit widersprechen die oft alltäglichen pädagogischen Verhaltensweisen den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention1 nach Achtung vor Würde und Autonomie jedes Menschen.
Gleichzeitig scheinen viele Pädagoginnen ratlos zu sein, weil sie zwar gerne gewaltfreie Beziehungen aufbauen möchten, aber keine Alternativen zu traditionellen Methoden sehen, ohne ihre Verantwortung zu vernachlässigen. Während der Erstellung dieser Arbeit war auffällig, auf welch großes Interesse das Thema stieß: Sozialarbeiter, Lehrerinnen, Heilerziehungspfleger und sogar fachfremde Personen wollten diese Arbeit lesen. Doch nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion scheint es kaum eine Reflexion über in der Praxis angewandte Erziehungsmittel und gewaltfreie Alternativen zu geben. Stephanie Lutz schreibt in ihrer Diplomarbeit über Strafen (im Allgemeinen), dass es nur wenig aktuelle Literatur in diesem Bereich gibt (Lutz 2012: 50–51). In meiner Recherche in Bezug auf Erwachsene mit geistiger Behinderung konnte ich gar keine passende Literatur finden. Zwar gibt es verschiedene Konzepte für den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen wie Selbst- oder Fremdaggressionen, jedoch fand ich keine Vorschläge zum gewaltfreien Umgang mit weniger existenziellen unerwünschten Verhaltensweisen.
Mit ‚unerwünscht‘ sind in dieser Arbeit Verhaltensweisen gemeint, die von Pädagoginnen aus gutem Grund nicht akzeptiert werden können, z. B. weil sie gesundheits- oder fremdgefährdend sind, weil wichtige Regeln gebrochen werden oder weil sie Konflikte fördern. Oft ist dies jedoch nicht eindeutig. Darum ist es unabdingbar immer zu reflektieren, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Verhalten zu akzeptieren oder die Rahmenbedingungen anzupassen. Entsprechende Überlegungen würden jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen, darum werden sie hier bewusst ausgeklammert. Die Theorie scheint sich bereits mit dieser Thematik zu beschäftigen. Wie allerdings mit den Verhaltensweisen angemessen umgegangen werden kann, für die es keine Möglichkeit der Akzeptierung gibt, scheint kaum thematisiert zu werden. Dabei sind sowohl solche Verhaltensweisen als auch Reaktionen in Form von Strafe, Belohnung und Bewertung meiner Erfahrung nach in den meisten Einrichtungen Alltag. Sie belasten, wie im Folgenden zu sehen sein wird, sowohl Pädagoginnen als auch Menschen mit Behinderungen - in Form von Frustration, Hilflosigkeit, Schuldgefühlen, Gewaltspiralen etc..
Um hierfür Lösungsvorschläge zu finden, nutzte ich darum Literaturrecherche in einem verwandten Gebiet. Im Bereich der Kindheitspädagogik gibt es sehr viele Ansätze zum gewaltfreien Umgang mit unerwünschtem Verhalten. Dies hängt wohl auch mit dem im Jahr 2000 in Kraft getretenen § 1631 Abs. 2 BGB zusammen, der Kindern ein Recht auf gewaltfreie Erziehung zusichert. Darum werden in dieser Arbeit die Gedanken aus dem Bereich der Kindheitspädagogik herangezogen, um Überlegungen für gewaltfreie Pädagogik gegenüber Erwachsenen mit geistiger Behinderung anzustellen. In den einzelnen Kapiteln werden entsprechende Ansätze zunächst für pädagogische Beziehungen mit Kindern vorgestellt. Am Ende jedes Kapitels werden Hypothesen formuliert, ob und wie die beschriebenen Zusammenhänge auf die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden können. In Kapitel 2 wird dieser Transfer näher erläutert und es werden entsprechende Kriterien erarbeitet.
Die konkreten Fragestellungen zu dieser Arbeit lauten also: Wie wirken sich Bestrafung, Belohnung und Bewertung auf Kinder und auf Erwachsene mit geistiger Behinderung aus? Welche gewaltfreien Alternativen haben Pädagoginnen, um verantwortungsvoll alltäglichen Konflikten und unerwünschtem Verhalten zu begegnen oder diesen vorzubeugen? Ziel dieser Arbeit soll es sein, sowohl pädagogischen Fachkräften als auch Laien Anregungen zu geben, um gute Beziehungen zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung und Kindern aufzubauen. Vielleicht geben manche Vorschläge sogar den Anstoß, sich persönlich weiterzuentwickeln und über Beziehungen im alltäglichen Umfeld nachzudenken. Gleichzeitig können die Ergebnisse und aufgestellten Hypothesen Möglichkeiten für weiterführende Forschung bieten.
Für eine geschlechtergerechte Sprache wird im Folgenden auf geschlechtsspezifische Bezeichnungen so weit wie möglich verzichtet. Wo dies nicht möglich ist, wird in ungefähr gleichen Anteilen entweder die weibliche oder die männliche Form verwendet.2
1 Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2006 von der UN verabschiedet und ist seit 2009 in Deutschland völkerrechtlich verbindlich. Sie fordert unter anderem Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen und signalisiert damit eine Abkehr von der bisherigen auf Fürsorge ausgerichteten Behindertenpolitik. (Bielefeldt 2009: 4)
2 Ich schließe mich damit Margret Göth und Ralph Kohn in einem hier nicht weiter verwendeten Buch an: „Um einerseits weder Frauen noch Männer durch ein generisches Maskulinum oder ein generisches Femininum unsichtbar zu machen und andererseits lesbar zu bleiben, werden im Text beide Formen in einem ungeplanten Wechsel verwendet“ (2014: 2). Auch in der Übersetzung Dagmar Mißfeldts des im Folgenden häufig verwendeten Buches „Vom Gehorsam zur Verantwortung“ wird so gegendert (Juul und Jensen 2009). Da die Unleserlichkeit des Genderns häufig kritisiert wird und vielleicht sogar Gefahr läuft, die wichtige Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit in ein negatives Licht zu rücken, soll hier versucht werden, eine angenehme und doch gleichberechtigende Alternative aufzuzeigen. Außerdem lassen sich auf diese Weise direkte Zitate, die ausschließlich die männliche Form benutzen, ohne Veränderung in eine geschlechtergerechte Sprache integrieren.
2 Erwachsene mit geistiger Behinderung und Kinder
In dieser Arbeit werden Überlegungen angestellt, wie Vorschläge zur Gewaltfreiheit in pädagogischen Beziehungen zu Kindern auf pädagogische Beziehungen zu Erwachsenen mit geistiger Behinderung übertragen werden können. Darum sollen in diesem vorbereitenden Kapitel relevante Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Personengruppen und der entsprechenden pädagogischen Beziehungen untersucht werden.
2.1 Kinder
Laut dem „Wörterbuch der Pädagogik“ erstreckt sich Kindheit rechtlich gesehen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, entwicklungstheoretisch gesehen bis zum Beginn der Geschlechtsreife (Böhm und Seichter 2018: 268). Die Auffassung von Kindheit ist kulturell und historisch geprägt, unterliegt stetigem Wandel und wird als ‚Konstruktion‘ der Kindheit bezeichnet (Böhm und Seichter 2018: 268). Aus pädagogischer Sicht gehört zur Kindheit, dass es Erwachsene gibt, die das Kind erziehen möchten. Dies ist gesetzlich als „Recht auf Erziehung“ in § 1 Abs. 1 SGB VIII verankert: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“.
2.2 Erwachsene mit geistiger Behinderung
Geistige Behinderung wird von der Weltgesundheitsorganisation folgendermaßen definiert: „Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten […] wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten“ (DIMDI 2013). Nach Wolfgang Jantzen3 wird geistige Behinderung üblicherweise aufgeteilt in zwei Untergruppen. Bei der einen wird von Lernbehinderung gesprochen, die meist mit sozialen Ursachen in Verbindung gebracht wird (Jantzen 2016: 150–151). Auf der anderen Seite stehen mäßige, schwere und sehr schwere geistige Behinderung, hier wird meist von biologischen Ursachen ausgegangen (ebd. 150–151). Jantzen zweifelt dies an, er vermutet auch bei der zweiten Gruppe als Ursache soziale Gewalt in einer stupiden Umgebung4 (ebd. 169). Er weist auf den Umstand hin, dass gehörlose Kinder vor ca. 100 Jahren relativ oft auch eine geistige Behinderung hatten, wenn sie in Institutionen lebten (ebd. 149). Die Ursache lag hier in Ausgrenzung und Hospitalisierung, also in der fehlenden Möglichkeit, an Sprache und Kultur teilzunehmen (ebd. 149). Jantzen hält solch eine Isolation generell für den Ursprung geistiger Behinderung (ebd. 149). „Ein Defekt […] führt grundsätzlich zu einer veränderten Beziehung zu den Menschen und zur Welt. Sofern sich die Umgebung nicht auf die anderen Bedingungen seitens der Person einstellt, ist diese Person in einer Dauersituation sozialer Isolation. Und Isolation hat außerordentlich schädigende Folgen für den Aufbau der Persönlichkeit“ (ebd. 22). Jantzen führt an, dass Menschen mit geistiger Behinderung häufig auch psychiatrische Diagnosen haben, „d.h. emotional gestört sind“ (ebd. 164). Dies ist in Tabelle 1 im Anhang deutlich zu sehen: bei zunehmendem Grad der geistigen Behinderung nehmen körperliche Aggression, selbstverletzendes Verhalten und Destruktivität zu. Valerie Sinason5 schreibt unter Bezug auf Rutter et al. auch, dass die Mehrheit der Menschen mit leichter geistiger Behinderung aus sehr benachteiligten sozialen Verhältnissen stammen (Sinason 2000: 28).
Was das Erwachsenenalter bei geistiger Behinderung ausmacht, wird vor allem im Vergleich zu Kindern deutlich, darum wird dies in Kapitel 2.4 aufgezeigt.
2.3 Benutzung des Begriffs der geistigen Behinderung
In dieser Arbeit wird bewusst von geistiger Behinderung gesprochen und auf Apostrophierung oder Euphemismen verzichtet. Es braucht klare Begriffe für eine Verständigung, ohne die weder fachlich noch politisch Verbesserungen für diese Personengruppe erzielt werden können (Theunissen, Hoffman und Plaute 2000: 127) 6. Auch wenn der Begriff der geistigen Behinderung inzwischen stigmatisierenden Charakter hat, garantiert ein Etikettenwechsel keine Besserstellung der so bezeichneten Menschen, denn nicht die Begriffe diskreditieren, sondern Menschen und deren Einstellungen7 (ebd. 127). So kommt es wohl auch, dass neu eingeführte Begriffe immer wieder innerhalb weniger Jahre negative Bedeutung erlangen (Sinason 1992: 40).8 Der Begriff der geistigen Behinderung selbst wurde Ende der 50er Jahre von der Elterninitiative ‚Lebenshilfe‘ vorgeschlagen, um Begriffe wie ‚Schwachsinn‘ oder ‚Idiotie‘ aufgrund ihres stigmatisierenden Charakters abzulösen (Theunissen, Hoffman und Plaute 2000: 126). Auch Apostrophierung und „Sogenanntismus“ (Kobi 2000: 73) können kritisch hinterfragt werden. Sie sind vielleicht der erste Schritt in dem, was Sinason „Euphemismusprozess“ (1992: 40) nennt: es wird die Auffassung erkennbar, ein Begriff sei negativ besetzt und deswegen eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Doch Emil E. Kobi9 kritisiert, dass man sich auf diese Weise von einem Begriff distanziert, um ihn dann jedoch wieder zu benutzen (Kobi 2000: 74). Kobi spricht allgemein von einer Tendenz, geistige Behinderung und die damit beschriebene Personengruppe „durch Wortentzug, Tabuisierung und Entgrenzung aufzulösen“ (ebd. 73). Dabei erkennt er keine zielgerichtete Aktion, sondern eher eine „Stimmungswelle im Mainstream gutmenschelnder Political und Pedagogical Correctness“ (ebd. 73). Sinason vermutet dahinter eine Furcht, Unterschiede klar zu benennen (Sinason 1992: 52), z.B. aus einem Schuldgefühl gegenüber der Person mit Behinderung heraus, weil man selbst keine geistige Behinderung hat (ebd. 43).
Es ist zu fragen, was diese Prozesse für Menschen mit geistiger Behinderung bedeuten, z.B. in Bezug auf ihr Selbstbild oder ihre alltäglichen Interaktionen. Ihrer Einschränkung, die sie selbst wahrscheinlich täglich und sehr konkret erleben, wird anscheinend oft mit Unsicherheit und Sprachlosigkeit begegnet. Sie selbst werden mit einer Vielzahl von Begriffen bezeichnet. Die Aussage einer jungen Frau zeigt dies eindrücklich: „I’ve got Down’s syndrome, special needs, learning disability and a mental handicap”10 (ebd. 40). Dass Euphemismen dem Erleben der Betroffenen außerdem nicht gerecht werden, zeigt die Aussage eines Mannes mit Zererbralparese: „I wish I did have a learning difficulty; not being able to learn is the least of my problems“11 (ebd. 40).
Unsicherheit und Sprachlosigkeit gegenüber Stigmata wie geistiger Behinderung sind nach Erving Goffman12 die Regel (Goffman 1975: 28–29). Menschen bemühen sich gegenüber Stigmatisierten stark, kein offenes Erkennen des Stigmas zu zeigen (ebd. 56). Dies kann die Situation vor allem für die Stigmatisierten angespannt und unsicher machen (ebd. 56). Darum bemühen sich Menschen mit offensichtlichem oder bekanntem Stigma meist zu verhindern, „dass das Stigma sich zu mächtig aufdrängt. Es ist das Ziel des Individuums, Spannung zu vermindern, das heißt, es sich und den anderen zu erleichtern, das Stigma verstohlener Aufmerksamkeit zu entziehen und spontane Einbeziehung in den offiziellen Inhalt der Interaktion zu fördern“ (ebd. 129). Das könnte in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung bedeuten, dass sie die ganz selbstverständliche Benennung ihrer Behinderung (spontane Einbeziehung nach Goffman) als angenehmer empfinden als peinliches Schweigen oder Zögern, das durch die Suche nach Euphemismen zustande kommt. Sinason schlägt vor, zu unterscheiden zwischen Begriffen, die von vornherein herabwürdigende Bedeutung hatten, und solchen, die erst durch Bedeutungsveränderung als diskreditierend erlebt werden (Sinason 1992: 48). Der Begriff der geistigen Behinderung hatte wie oben beschrieben ursprünglich keinen negativen Charakter. In dieser Arbeit wird darum von Menschen mit geistiger Behinderung geschrieben.
2.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Um Vorschläge machen zu können, inwieweit die unten ausgeführten Inhalte von Kindern auf Erwachsene mit geistiger Behinderung übertragen werden können, sollen hier zunächst Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Personengruppen erörtert werden. Zunächst ist es jedoch wichtig zu betonen, dass Erwachsenen mit geistiger Behinderung und Kindern nicht gleichgesetzt werden. Gerade der Entwicklungsstand von Erwachsenen mit geistiger Behinderung scheint häufig mit dem von Kindern verglichen zu werden, indem ein ‚geistiges Alter‘ angegeben wird; dies ist jedoch kritisch zu sehen: „Geistigbehinderte sind nicht ‚Große Kinder‘ und werden durch derartige Vorstellungen in problematischer Weise infantilisiert“ (Kobi 2000: 70). Der Vergleich mit Kindern ist aber nicht deswegen problematisch, weil eine Infantilisierung eine Herabsetzung von Menschen mit geistiger Behinderung bedeuten würde. Der Eindruck einer Herabsetzung kann nur dann entstehen, wenn von einem geringeren Wert der Vergleichsgruppe (in dem Fall der Kinder) ausgegangen wird. Die Übertragung von Prinzipien der Kindheitspädagogik auf die Arbeit mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung ist allerdings dann problematisch, wenn Eigenschaften einer erwachsenen Person übergangen werden. Darum sollen in diesem Kapitel die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Personengruppen ausführlich analysiert werden. In den darauffolgenden Kapiteln wird der Transfer bewusst in gesonderten Unterkapiteln stattfinden, um eine Vermischung zu vermeiden.
2.4.1 Lebenserfahrung
Ein erster offensichtlicher Unterschied zwischen Erwachsenen mit geistiger Behinderung und Kindern ist das Alter. Mit zunehmendem Alter geht eine steigende Lebenserfahrung einher. Auf wie viel mehr Erfahrungen Erwachsene mit geistiger Behinderung tatsächlich aktiv zurückgreifen können, kann hier nicht beantwortet werden, vor allem wegen der wahrscheinlich individuell sehr unterschiedlichen Antworten. Relevant für diese Arbeit ist, dass Erwachsene schon wesentlich länger durch ihre Umwelt beeinflusst und damit wohl auch verändert werden.
Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft viele dieser Erfahrungen negativ. Im Kapitel 2.2 wurde bereits gezeigt, dass der Großteil dieser Personengruppe in sozial benachteiligten Verhältnissen aufwächst oder durch organische bzw. genetische Normabweichungen soziale Isolation erfährt. Hinzu kommt die Belastung durch die geistige Behinderung selbst (Sinason 2000: 154). Wie hoch all diese Belastungen sind, zeigt die deutlich zunehmende Tendenz von körperlicher Aggression, selbstverletzendem Verhalten und Destruktivität bei zunehmendem Grad der geistigen Behinderung (siehe hierzu Tabelle 1 im Anhang) (Jantzen 2016: 165). Sowohl Jantzen (2016: 165) als auch Sinason (2000: 154) halten diese Verhaltensweisen für Kompensationen der Belastungen. Die Belastungen müssen also sehr hoch sein. Sinason spricht sogar davon, dass Traumata regelmäßig Teil eines Lebens mit Behinderung sind. „Wenn wir betrachten, welchen emotionalen Niederschlag geistige Behinderung findet, dann stoßen wir automatisch auf Verlust und Trauma. Beinahe jeder Patient, der überwiesen wird13, fast jeder Fall, der in Supervisionsgruppen vorgestellt wird, spiegelt schmerzlich die zentrale Stellung des Traumas wider“ (ebd. 29).
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen mit geistiger Behinderung ist also die Menge an (oft negativer) Lebenserfahrung.
2.5 Gewalt und Ausgrenzung
Die gegenwärtige Erfahrung von Gewalt und Ausgrenzung scheint dagegen eine Gemeinsamkeit beider Personengruppen zu sein. Lothar Böhnisch14 schreibt, dass in unserer Gesellschaft zwar Kinderfreundlichkeit hochgehalten wird, dass hierbei aber ein Widerspruch besteht zu alltäglicher, nicht eingestandener Kinderfeindlichkeit (Böhnisch 2017: 84). Das ‚Wörterbuch der Pädagogik‘ schreibt ebenfalls von einer Tendenz zur Kinderfeindlichkeit, die sich z.B. in kinderfeindlicher Städteplanung, inhumanen Zügen der Schule und latenter physischer und psychischer Gewalt gegenüber Kindern zeigt (Böhm und Seichter 2018: 269). Grundlage hierfür sind die Dominanz Erwachsener gegenüber Kindern und die gesellschaftliche Orientierung auf Leistung, Konkurrenz und Profit (ebd. 269). Böhnisch schreibt, dass Erwachsene gegenüber Kindern zur emotionalen und körperlichen Macht verführt sind, weil außerhalb der Familie die Möglichkeiten der Selbstwertschöpfung schwinden (Böhnisch 2017: 83). Er bezieht sich auf Thiersch, der von der Gefahr spricht, dass Erwachsene sowohl ihre Position als auch ihren Vorsprung durch Alter, Erfahrung und Wissen nutzen, um das Erleben und die Selbständigkeit von Kindern zu unterdrücken (ebd. 83). Dies wird in Kapitel 3 und besonders in 3.4 noch deutlicher. Nach Annedore Prengel15





























