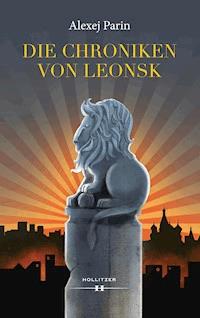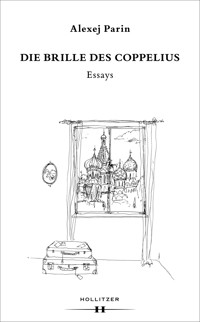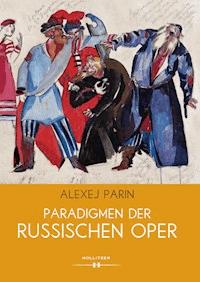
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hollitzer Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum ist die Herrscherfigur in der russischen Oper so allmächtig? Welche Psychologie und nationale Identitäten verbergen sich hinter diesen Charakteren? Warum werden die singenden und tanzenden Gegenspieler immer so bezaubernd und gleichzeitig so furchterregend dargestellt? Wer verbirgt sich wirklich hinter den Feindbildern der russischen Komponisten? Wie schlagen sich die zwei großen Überlieferungen – das ‚heilige Russland' und der Mythos Sankt Petersburg – und ihr Machtspiel in der Oper nieder? Welche Mythen oder Symbole liegen Figuren wie Boris Godunow und Marfa, Kontschak und der Alten Gräfin, Tatjana und German, Polen und Kitesch zugrunde? Wie sind die Geschlechterrollen in der russischen Oper definiert? Der renommierte russische Opernkritiker Alexej Parin beantwortet diese und viele andere Fragen mit einer klaren, jedoch vielschichtigen Sprache und setzt die russische Oper in einen europäischen Kontext. Dabei nähert er sich der russischen Oper aus verschiedenen Blickwinkeln und unter Einsatz eines erstaunlich vielschichtigen Methodenapparats: Ansätze der Kulturgeschichte, Geschichtsphilosophie, Gender-Studies, Mythologie sowie der analytischen Psychologie und philosophischen Hermeneutik werden herangezogen, um die russische Operngeschichte – von Werstowski und Glinka bis Prokofjew und Schostakowitsch – in ihrem ganzen Facettenreichtum darzustellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALEXEJ PARIN
PARADIGMEN DER RUSSISCHEN OPER
Aus dem Russischen von Anastasia Risch und Christiane Stachau
Lektorat: Johann Lehner (Wien, Österreich)
Korrektorat: Tatjana Marković, Teresa Profanter (Wien, Österreich)
Layout und Cover: Nikola Stevanović (Belgrad, Serbien)
Druck und Bindung: Interpress (Budapest, Ungarn)
Umschlagbild: Fjodor Fedorowski. Kostümskizze für die Szene „In der Schenke“aus Modest Mussorgskis Oper Boris Godunow, 1927.© Museum des Bolschoi-Theaters, 2014
Alexej Parin: Paradigmen der russischen Oper
Wien: HOLLITZER Verlag, 2016
Aus dem Russischen von Anastasia Risch und Christiane Stachau *
* Die Kapitel 1 und 2 wurden von Anastasia Risch, die Kapitel 3–7 sowie das Vorwort von Christiane Stachau übersetzt.
Die Übersetzung wurde dankenswerterweise von Tatjana Schischkina großzügig unterstützt.
Originaltitel: Хождение в невидимый град. Парадигмы русской классической оперы(Moskau: Agraf 1999)
© HOLLITZER Verlag, Wien 2016
HOLLITZER Verlagder HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH, Wien
www.hollitzer.at
Alle Rechte vorbehalten.
Die Abbildungsrechte sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft worden.
Im Falle noch offener, berechtigter Ansprüche wird um Mitteilung des Rechteinhabers ersucht.
ISBN 978-3-99012-270-9 hbk
ISBN 978-3-99012-271-6 pdf
ISBN 978-3-99012-272-3 epub
INHALT
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
KAPITEL IOPFERUNGSGLOCKEN UND KRÖNUNGSGELÄUT: DER ZAR
KAPITEL IIDIE POLOWETZER ORGIE IN PARIS: DER FEIND
KAPITEL IIIELEGIE AUF DEN VERSCHNEITEN WEITEN DES WELTALLS: DER DICHTER
KAPITEL IVFRAU, MANNWEIB, STAREZ: DIE HELDIN UND IHR UMKREIS
KAPITEL VFEUER, WASSER UND DAS LICHT OHNE FLAMME: DAS ALLERHEILIGSTE
KAPITEL VIFURCHTERREGENDE ALTE, BLÜHENDE SCHÖNHEIT, VERHÄNGNISVOLLE KARTE: DER MYTHOS PETERSBURG
KAPITEL VIIBIRKEN VOR SÄULENPORTALEN: DIE HEILIGE RUS GEGEN PETERSBURG
ANHANG
VERZEICHNIS DER AM HÄUFIGSTEN GENANNTEN RUSSISCHEN OPERN
AUSWAHLBIBLIOGRAFIE DES AUTORS
ANMERKUNGEN
VORWORTZUR DEUTSCHEN AUSGABE
Seit dem Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, nach dem Zerfall der Sowjetunion und den ersten Versuchen, in Russland eine Zivilgesellschaft aufzubauen, eröffnete sich für die Russen die Möglichkeit, ungehindert am Alltag und an den Höhepunkten des europäischen Musiktheaters intensiv teilzuhaben. Echte Interessenten, die einst „nicht ausreisefähig“ waren, begannen nun mit eigenen Augen und Ohren das Beste, was der Westen zu bieten hatte, zu erleben.
Bayreuth mit dem Ring des Nibelungen in der Inszenierung von Harry Kupfer unter der Stabführung von Daniel Barenboim, die Salzburger Festspiele in der Epoche von Gerard Mortier, die Bregenzer Festspiele mit den Inszenierungen von David Pountney, die Wiener Festwochen mit ihren ultrakühnen Novitäten in allen Sparten internationaler Theaterkunst – so sah die – keineswegs vollständige – Liste der ersten überwältigenden Eindrücke aus.
In meinem Leben verbanden sich diese Eindrücke mit persönlichen Kontakten. Die Ausführenden vieler grandioser Projekte wurden meine Gesprächspartner, manche sogar Freunde. Das erste Interview mit Gerard Mortier im Jahr 1992, der erste Vortrag vor der Gesellschaft der Freunde der Wiener Staatsoper, im Jahr 1992 und die Bekanntschaft mit dem damaligen Rektor der Universität Wien, Alfred Ebenbauer, und dem jungen Kritiker Christoph Wagner-Trenkwitz, die regelmäßige Teilnahme am Seminar der Bregenzer Festspiele und die Gespräche mit Alfred Wopmann, die Vorträge auf dem Symposium der Salzburger Festspiele und die Artikel für die Zeitschrift Opernwelt nach der Bekanntschaft mit Imre Fabian – all das bereicherte mich nicht weniger als die unmittelbaren Eindrücke im Theater. In meinen Vorträgen und Artikeln trat ich vor allem als Vertreter der russischen Kultur in Erscheinung und versuchte sowohl meine innere Beziehung zum ganzen Reichtum dieser Kultur darzustellen als auch welchen Niederschlag er in verschiedenen Werken des Musiktheaters gefunden hat.
Indessen war für mich – geboren 1944 in einer großen, wohlsituierten Mediziner-Familie, die 1947 den Vater als „Volksfeind“ verlor und ihn erst im Oktober 1953, kurz nach Stalins Tod, wiederbekam – die russische Kultur nur Hintergrund, fast unsichtbare Grundlage, das noch unerkannte Fundament des Lebens. Ich begann früh, Fremdsprachen zu lernen, begann früh, fremdsprachige Poesie und Prosa im Original zu lesen und in sie hineinzuwachsen wie in meine natürliche Umgebung. Ich verliebte mich – zuerst in die Musik von Strawinsky und Prokofjew, dann in die von Bach und Mozart, wurde zum regelmäßigen Konzertbesucher, zum Opernfanatiker und verschlang alle nur verfügbaren Tonaufnahmen. Die westliche Kultur wurde für mich im sowjetischen Kontext zum Zielort meiner inneren Emigration. Deshalb musste ich in den neunziger Jahren nach der „russischen Seele“ in mir erst einmal suchen, musste meine Verbindung zur russischen Musik und zur russischen Kultur im Ganzen neu durchleben.
Meine Lehrer im Prozess der Erkenntnis des Musiktheaters waren in Russland Experten aus der Ballettwelt: die berühmte Tanzwissenschaftlerin, Chronistin und Analytikerin Wera Krassowskaja und der Ballett-Kritiker Wadim Gajewski, ein begeisterter romantischer Essayist. In der westlichen Welt wurden meine Mentoren die Innsbrucker Komparatistin Maria Deppermann, der Freiburger Philosoph Ludwig Wenzler, der Zürcher Slawist German Ritz, der Loccumer Kulturwissenschaftler Hans-Peter Burmeister, die Pariser Schriftstellerin Catherine Clément und der Stuttgarter Kritiker Horst Koegler. Sie hatten ihre eigenen Ansichten über die russische Kultur und veranlassten mich, mit maximaler Schärfe auf die für meine Position neuen Gesichtspunkte zu reagieren. Ich tauchte tief in den lebendigen europäischen Kontext ein, knüpfte mir ein dichtes Netz aus philosophischen und tiefenpsychologischen (zu Freud und Jung) Assoziationen, spürte sinnlich-emotional das historische Umfeld auf und schuf mir so ein ganz persönliches Bild der russischen klassischen Oper.
Dieses Buch beendete ich im Jahr 1999. Bald darauf erschien auf der russischen Opernbühne der Regisseur und Bühnenbildner Dmitri Tscherniakow, mit dem mich Zusammenarbeit und Freundschaft verbindet. Zu wichtigen Meilensteinen für das Verständnis russischer Opern in neuer Interpretation wurden die Arbeiten der Dirigenten Waleri Gergijew, Wladimir Jurowski und Jewgeni Braschnik, der Regisseure Georgi Isaakjan und Dmitri Bertman. Seither hat sich unsere Sicht auf das innere Potenzial und bisher verborgene Aspekte in der russischen Opernklassik beträchtlich verändert. Doch darüber werden Sie in diesem Buch nichts finden. Einmal geschrieben, kann es heute, nach 15 Jahren, keine „Korrektur“ erfahren: Es ist ein Zeitdokument.
Inneres Anliegen dieses Buches ist es nicht, konkrete, auf bestimmte Aufführungen bezogene Interpretationen zu bieten, sondern das Spektrum an Problemen und ewig zu stellenden Fragen deutlich zu machen, die in russischen Opern auftauchen. Und ich glaube, ein solcher Blickwinkel mag gewährleisten, dass dieser Text seine Aktualität nicht verliert.
Ich würde mich freuen, wenn die deutsche Ausgabe meines Buches in Wien, einer Stadt, die ich sehr liebe, für den heutigen Leser von Interesse wäre.
Moskau, Januar 2016
KAPITEL I
OPFERUNGSGLOCKEN UND KRÖNUNGSGELÄUT: DER ZAR
Der Zar als Hauptfigur ist keine Seltenheit in der russischen klassischen Oper. Nehmen wir den Beginn und das Ende des langen Bogens von Michail Glinka bis Nikolai Rimski-Korsakow: Die erste Oper in dieser Kette trägt den Titel Schisn sa zarja (Ein Leben für den Zaren, 1836) (man beachte das Wort „Leben“!): Wenn der Zar in dieser Oper in Erscheinung tritt, dann nur als ein schweigender, unnahbarer, gleichsam mit einem Heiligenschein versehener Herrscher – ähnlich der aufgehenden Sonne im Morgenrot,1 – und auch dies erst in der finalen Apotheose; außerdem lässt das Werk offen, ob er tatsächlich auftritt oder hinter den Kulissen bleibt. Die letzte Oper in der genannten Zeitspanne, Solotoi petuschok (Der goldene Hahn, 1909), präsentiert den Zaren hingegen auf recht ungünstige Weise und endet mit dessen Tod, der absurd, ja lächerlich erscheint.2
Der wichtigste Zar der russischen Oper ist jedoch weder der schweigende, von Glinka glorifizierte Michail Romanow noch der geschwätzige, von Rimski-Korsakow karikierte Dodon. Es ist vielmehr Boris Godunow mit seiner nicht allzu umfangreichen Opernpartie, der in der russischen kulturellen Mythenbildung die Oberhand gewonnen und in der russischen Geschichte eine sonderbare, aber bemerkenswerte Rolle gespielt hat. Seit Fjodor Schaljapins triumphalem Auftritt in der Opéra national de Paris3 steht Boris Godunow im Westen und in der ganzen Welt stellvertretend für die russische Oper: Man denke an die begeisterten, ja ekstatischen Reaktionen der Pariser Zuschauer auf die Generalprobe und Premiere des Boris Godunow im Jahre 1908.4 Es war der große russische Sänger, der Modest Mussorgskis Meisterwerk seinen Rang unter den berühmtesten Opern der Welt sicherte. Heute gilt Boris Godunow in internationalen Opernkreisen nicht nur als wichtigste russische Oper, sondern wahrscheinlich als wichtigste Oper zum Thema Macht überhaupt. Allein die 1990er-Jahre brachten unzählige Aufführungen des BorisGodunow mit sich, vom imposanten Fresko von Herbert Wernicke/Claudio Abbado auf der gigantischen Bühne des Salzburger Festspielhauses bis hin zu der kammerspielartigen Inszenierung der Sankt Petersburger Oper im überschaubaren Eremitage-Theater.
Mussorgskis Boris ist zum paradigmatischen Herrscher avanciert. Selbst solche erstrangigen Opernfiguren wie Händels Julius Cäsar, Sarastro aus Mozarts Zauberflöte, König Ludwig aus Webers Euryanthe, die leidenden Monarchen Nabucco und Philipp von Verdi oder die gerechten Herrscher von Wagner – Hermann Landgraf von Thüringen, Heinrich der Vogler und König Marke – können den symbolträchtigen Glanz des glücklosen russischen Zaren nicht überstrahlen. Betrachten wir einige von ihnen genauer.
Julius Cäsar (Georg Friedrich Händel, Giulio Cesare in Egitto, 1724) erscheint – ganz im Sinne der Opera seria – als eine Summe sozialer Rollen, die sich durch unterschiedliche Affekte offenbaren: berechnender Machthaber, tapferer Heerführer, edler Römer, sinnierender Dichter und galanter Liebhaber – eine Summe ungleicher Komponenten, die sich erst durch die Mittel des modernen Theaters zu einem überzeugenden psychologischen Ganzen zusammenfügen lässt.5 Der Zauberherrscher Sarastro (Wolfgang Amadeus Mozart, Die Zauberflöte, 1791) setzt sich zusammen mit seiner freimaurerischen Umgebung ernsthaft mit dem Phänomen der Macht auseinander und versucht, ihre Wirkungsweisen zu perfektionieren. Der babylonische Despot Nebukadnezar (Giuseppe Verdi, Nabucco, 1842) lotet die Grenzen der irdischen Alleinherrschaft im Angesicht Gottes aus, während der absolute Monarch Philipp von Spanien (Giuseppe Verdi, Don Carlos, 1867) die königlichen Befugnisse vor dem Hintergrund der Menschenrechte einerseits und der Gebote der Inquisition andererseits prüft. Alle genannten Herrscher aus den Opern Richard Wagners (Tannhäuser, 1845; Lohengrin, 1850; Tristan und Isolde, 1865) verstehen sich eher als Prototypen von idealen, gewissenhaften, nahezu schemenhaften Königen, mit ausgewogenen Urteilen und klischierten Vorstellungen von den Normen und Grenzen der Macht. Wenn die Macht für einen von ihnen mit Leid verbunden ist, dann höchstens für den – knapp skizzierten – König Marke, der damit auf emotionaler Ebene dem Typus des königlichen Märtyrers näher rückt.
Die finstere, dekadent-apokalyptische Stimmung der dritten der überlieferten Opern des ‚divino Claudio‘ (Claudio Monteverdi, L’incoronazione di Poppea, 1642) legt den Grundstein für die Reflexionen über Macht in der Oper. Dieses Werk führt das Bild einer unheilvollen Unzeit ein und setzt sich beharrlich mit den paradigmatischen Beziehungen zwischen politischen Gegnern sowie zwischen weltlichem und geistlichem Machthaber auseinander: Der Schatten von Monteverdis Ottone und Seneca liegt unverkennbar über Mussorgskis Schuiski und Pimen. Wotan (Richard Wagner, Das Rheingold, 1869; Die Walküre, 1870; Siegfried, 1876) durchläuft den gesamten Weg eines Herrschers: Am Anfang hat er gerade erst den Thron bestiegen und begründet selbstbewusst seine Macht; am Ende ist er das Oberhaupt einer zusammenbrechenden Welt, das sich in der Hoffnung, wenigstens etwas retten zu können, als Vagabund verkleiden muss. In dem späten, vermächtnishaften Mysterienspiel des ‚Genies von Bayreuth‘ (Richard Wagner, Parsifal, 1882) wird die Gestalt des verwundeten Gralskönigs Amfortas, dessen irdisches Fortbestehen an die läuternden Rituale der Reinigung und der moralisch qualvollen Eucharistie geknüpft ist, zu einem Symbol der Krise der Macht, ob weltlich oder geistig. Die ‚Errettung‘ durch Parsifal, der den Leidenden von seiner Macht erlöst und dessen heller Tenor Amfortas’ dunkler Baritonstimme Linderung verschafft, korrespondiert mit dem heldenhaft-triumphalen Einzug des Usurpators und mit der hellen Klage des Gottesnarren in der Kromy-Szene des Boris Godunow.
Nero aus Monteverdis L’incoronazione di Poppea, in dessen jähzornigen und wollüstigen Ausbrüchen die Macht zu einem furchtbaren, tödlichen Spielzeug verkommt, Wotan aus dem Ring des Nibelungen, der viel über die Natur der Macht reflektiert und seinen Diskurs über die Weltherrschaft und die Wege zu dieser über alle drei Opern hinweg wortreich entfaltet, und Amfortas aus Parsifal, dessen körperliche Wunde die Verletzlichkeit der sakralen Macht symbolisiert: all diese Figuren hätten das Potenzial dazu, als paradigmatische Herrscher, Monarchen und Könige der Opernwelt Boris Godunow die Stirn zu bieten. Jedoch erscheint Monteverdis Nero zu unverhohlen brutal und zu historisch konkret, um zu einem vielschichtigen, polyvalenten Symbol aufzusteigen. Wotan ist wohl zu reflektiert6 und in Wort, Musik und Charakter zu detailliert gezeichnet: Für eine paradigmatische Herrschergestalt hat er nicht genug Geheimnisvolles, Rätselhaftes, Unausgesprochenes. Amfortas seinerseits ist als menschlicher Charakter viel zu abstrakt und eindimensional, als symbolische Gestalt nahezu schemenhaft.
Es scheint, als wäre Boris Godunow die einzige Figur, die historische Realität, mythische Symbolträchtigkeit und die Züge eines konkreten menschlichen Charakters umfassend in sich vereint. Wie auch immer er in modernen Inszenierungen erscheint, ob als barbarischer Attila inmitten der abstoßenden, schmutzigen Hinterlassenschaft Iwans des Schrecklichen, als altorientalische Herrschergottheit, die zu ihren sterblichen Untertanen nur über rituelle Teppiche hinabsteigt, oder als ein heutiges, postsowjetisches Staatsoberhaupt, unfähig, die etablierten Machtmechanismen zu verändern,7 – stets bewahrt ihm Mussorgskis musikalische Suggestivität die Aura einer vieldeutigen Symbolgestalt. Die ästhetische, nichtrationale Elementarkraft dieser Figur macht ihr Geheimnis aus – und erhebt Boris zum Zaren aller Opernzaren.
Wie ist dieses Rätsel zu erklären? Selbstverständlich ist das Libretto, ein Text von höchstem literarischem Wert, der auf einer Vorlage des großen Dichters Alexander Puschkin beruht, als solches bereits Grund genug für den besonderen Rang des Boris Godunow im Opernkanon.8 Im Folgenden sollen zwei autorisierte Fassungen des Boris Godunow behandelt werden: der introvertiert-abgerundete, in sich geschlossene siebenteilige Ur-Boris (1869)9 und die neungliedrige ‚definitive Fassung‘ mit ihrer etwas gar lockeren Struktur (1872).10
Auch die Qualität von Mussorgskis Musik mit ihrer grenzenlosen, an Vogelflug gemahnenden Freiheit, ihrem nahezu sinnlich wahrnehmbaren ‚Erdgeruch‘ und ihrer charakteristischen prophetischen Schärfe erklärt die beharrliche Konkurrenzfähigkeit des Boris Godunow unter den mächtigsten Rivalen. Die neuere, wegweisende Studie von E. A. Akulow deckt die musikalisch-dramaturgischen Wirkungsweisen des Boris scharfsichtig auf und liefert detaillierte Erklärungen für ihre besondere Bühnentauglichkeit.11 Alle Opern benötigen naturgemäß eine Bühne; jedoch büßt Boris Godunow, wenn nur in Ausschnitten oder als konzertante Aufführung gespielt, besonders stark an Suggestivkraft ein. Demgegenüber bringen Aufführungen oder Verfilmungen die Botschaft des Komponisten deutlich besser zum Ausdruck, unabhängig davon, ob sie das Original historisch getreu oder symbolisch verallgemeinert interpretieren.12 Es liegt daran, dass das Gefüge von Mussorgskis Musik von einem tiefliegenden Zusammenhalt all seiner Teile gekennzeichnet ist, von einer geheimnisvollen, unzertrennlichen, archetypischen Lebendigkeit, welche zur Bedingung hat, dass sich alle strukturellen Elemente im theatralischen oder sogar metatheatralischen Raum entfalten.13 Natürlich schreit jede konzertante Aufführung nach einer Überführung auf die Bühne, aber im Falle von Mussorgskis Meisterwerk wird diese Option zum Imperativ. Carl Dahlhaus brachte die musikalisch-dramaturgische Einzigartigkeit des Boris Godunow scharfsichtig mit der spezifischen Gattung der ‚Historie als Oper‘ in Verbindung, die sich konsequent und radikal von den Fesseln der europäischen ‚Grand Opéra‘ befreit hatte.14
Wir werden nun versuchen, die inneren Zusammenhänge des Boris Godunow mit Blick auf den allgemeinen Kontext der russischen Kultur und Mythenbildung zu ergründen. Möglicherweise liefert dies einen Schlüssel zu den Geheimnissen, die Mussorgski uns in seinem Meisterwerk vermacht hat.
Als Erstes wollen wir bestimmen, wofür der Zar (König, Herrscher allgemein) aus der Perspektive der Religion, der Mythologie, der Literaturgeschichte und der Kulturwissenschaft überhaupt steht.
Bei der Analyse der Darstellung eines Königs und einer Königin auf einem alchemistischen Stich formuliert C. G. Jung wie nebenbei: „Der König stellt die ausgezeichnete Persönlichkeit dar.“15 Der König bzw. der Zar erscheint hier als Archetyp des Menschen überhaupt, eine überlebensgroße Gestalt vor dem Hintergrund der sozialen und sakralen Geschichte, die, „weil sie aus der Beschränkung des Gewöhnlichen hinausgehoben ist, zur Trägerin des Mythos, d.h. der Aussage des kollektiven Unbewußten, wird“.16 Jung weist auf die Symbolträchtigkeit aller Attribute der königlichen Macht hin: Die Krone entspricht der leuchtenden Sonne, der mit Edelsteinen bestickte Umhang dem Sternenhimmel, der Reichsapfel der Erdkugel, der erhöhte Thron der hohen gesellschaftlichen Stellung, die Anrede „Majestät“ der Annäherung an das Göttliche.17
Der gottgesalbte Herrscher verfügt in jedem mythologischen System über besondere Macht;18 der geweihte – ‚göttliche‘ – Herrscher ist eine mythologische Gestalt par excellence, er nimmt den höchsten Rang in der politischen Hierarchie ein und besitzt auch ein politisches Bewusstsein.19 Hans Urs von Balthasar schreibt, dass „der König nicht nur Repräsentant Gottes vor dem Volk ist, sondern gleichzeitig den Individuen seines Volkes in sich Gestalt gibt und sie vor der Gottheit repräsentiert“.20 „Er ist es, der überhaupt erst dem Menschen seine Stellung in Staat und Gesellschaft verleiht.“ Und man kann „die Gestalt des altorientalischen Königs kaum bessser umschreiben als mit dem Bilde des Mittlers zwischen der Welt der Götter und der Welt der Menschen“.21 Der archaische Herrscher steht in den meisten Mythologien in direkter Verbindung mit dem Himmel kraft seiner unbedingten und unbestreitbaren Tugenden. Im religiösen Denken ist der Herrscher Fleisch gewordener Gott, innerhalb der kosmologischen Ordnung repräsentiert er nichts anderes als die Sonne – ob als assyrischer König Assurbanipal, die ‚Sonne aller Völker‘, als frühmittelalterlicher russischer Großfürst Wladimir Sonnenrot oder als französischer ‚Roi-Soleil‘ Ludwig XIV. In vielen alten Religionen fällt die Position des Herrschers mit der Funktion des Hohepriesters zusammen. Im christlichen Wertesystem wiederum bedeutet das königliche ‚Amt‘ an sich noch gar nichts. Gemäß der Legenda Aurea des Jacopo da Varazze, der wichtigsten Sammlung von Heiligenviten im mittelalterlichen Westeuropa, stammen die meisten vorchristlichen europäischen Herrscher von Verbrechern oder Huren ab.22 Die Gestalt des Kindermörders Herodes legte den Grundstein für das literarische Motiv der Tyrannei, während das biblische „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ das Verhältnis der frühen Christen zum (heidnischen) Herrschertum unmissverständlich zum Ausdruck bringt.23 Die spätere, kirchliche ‚Aufwertung‘ des christlichen Monarchen mit den Zügen eines Hohepriesters brachte dem Herrscher die sakrale Bedeutsamkeit zurück. Ihm wurde die Rolle eines Mittlers zwischen Gott und den Menschen übertragen, eines zweiten Messias, der sein Angesicht in Demut Gott zuwendet, den Menschen aber in hellem Glanz erstrahlt. In mittelalterlichen Darstellungen des Monarchen spiegelt sich die Parabel von der ewigen (kosmischen) Ordnung, der Civitas Dei, wider; als typologisches Urbild dient hier König David. Auch die weltliche Mythenbildung der europäischen Neuzeit, Russland mit eingeschlossen, greift bei ihren Attributen mit Vorliebe auf mythische Herrscherbilder zurück.
Im Russischen bezeichnet das Wort „Zar“ nicht nur die höchste Stellung in der sakralen und sozialen Rangordnung, sondern bedeutet insgesamt „der Stärkste, der Mächtigste, der Älteste, der Herrschende; der Beste und unter allen anderen Ausgezeichnete“.24
In der russischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts mit ihrer hitzigen Diskussion über die nationale Identität stehen stets zwei Gestalten Seite an Seite: Christus und der Zar, der Leidende und der Gnadenreiche. Die persönliche Involviertheit der Streitenden und der affektgeladene Ton der Diskussion zeugen davon, dass diese Gestalten noch immer einen zentralen Platz im russischen Denken einnehmen. Es scheint, als rufe das Wort „Zar“ bei jedem russischen Kulturträger, unabhängig von seiner politischen Gesinnung, eine starke emotionale Reaktion archetypischen Ursprungs hervor. In einer Zeit gewaltiger sozialer Umbrüche wurde die archetypische Schlüsselrolle des Begriffs „Zar“ vom Dichter Alexander Blok folgendermaßen formuliert:25 „Zarenpaläste tragen wir im Herzen, die Zaren selbst im Sinn. Die ewigen Formen, die sich uns offenbart haben, können uns nur abhanden kommen, wenn wir auch unser Herz und unseren Kopf verlieren.“26
Im Einklang mit archaischen Systemen stellt das russische Denken den Zaren über den Hohepriester. In dieses Denkmuster passen auch andere, verallgemeinerte Eigenschaften des mythischen Herrschers: An seiner Seite steht vorzugsweise eine reine Zarentochter oder ein weiser Berater (häufig in Gestalt des Zarewitsch, also des Sohnes). Erst recht gilt in diesem Rahmen die Annahme, dass die Verbrechen des Zaren Kummer und Elend über den ganzen Staat bringen – ein weitverbreitetes Motiv seit der Geschichte von Ödipus, dem König von Theben. Der russische Zar als solcher behält, gleich Ödipus, bei all seiner mythischen Aura eindeutig menschliche Züge und wird nicht müde, die ewig wiederauferstehende Sphinx mit Gegenrätseln herauszufordern.
Als Nächstes wenden wir uns den Gestalten russischer Zaren in der Kunst zu und zählen alle zentralen und repräsentativen Herrscher der russischen Oper auf. Ihr literarischer Ursprung ist in den meisten Fällen wohlbekannt und für unseren Zusammenhang nicht sehr wesentlich; wichtiger sind ihre mythologischen Rollen.
Bei Glinka, dem Vater der russischen Oper, finden sich zwei königliche Figuren. Eine davon, der eingangs erwähnte Michail Romanow, kann entweder als stumme Rolle oder als Figur ohne Auftritt interpretiert werden. Als Gipfel der staatsmythologischen Pyramide setzt er den finalen Akzent in der betont regimetreuen Apotheose von Ein Leben für den Zaren. Der Zar als mythische Größe bildet hier den Kern der symbolischen Botschaft: Er wird den Zuschauern als Statthalter Gottes auf Erden präsentiert, für dessen Wohl jeder Sterbliche selbstverständlich sein Leben zu lassen hat. Beim anderen Glinka-Zaren handelt es sich um Swetosar, Großfürst von Kiew in Ruslan i Ljudmila (Ruslan und Ljudmila, 1842), dessen Name bereits eine Assoziation mit der Sonne nahelegt.27 In einer idealisierten, höfisch-heidnischen Welt umgibt er sich mit einer reinen Zarewna (Ljudmila) und einem – nicht minder archetypischen – bösen Herrscher (Tschernomor) und erfüllt so seine mythenbildende Funktion in vorbildlicher Weise.
In Alexander Dargomyschskis Rusalka (1856) ist die Rolle des Herrschers dem leichtsinnigen Fürsten übertragen, der als Privatperson wirkt, ein verhängnisvoller Verführer aus der Reihe der russischen Valmonts. Sein Missbrauch der Herrscherprivilegien, oder, genauer, seines sozialen Standes lässt ihn am Ende selbst zum Opfer werden. Aber nicht einmal seine bittere Reue erhebt den Fürsten über den Status einer Privatperson, außerhalb des Diskurses von Macht und ihren mythologischen Implikationen.28
In den seinerzeit höchst populären Opern von Alexander Serow, Judif (Judith, 1863) und Rogneda (1865), begegnen uns zwei monumentale Herrscherfiguren par excellence: der assyrische Despot Holofernes, Lüstling und Vergewaltiger, Gegenbild des Herrschers aus christlicher Sicht, und der legendäre Fürst Wladimir Sonnenrot, der im Laufe der Handlung das heidnische Prinzip der Gewalt zugunsten eines christlichen Wertesystems aufgibt. Im ersten Fall ist die moralische Haltung der sakralisierten Heldin derjenigen des Herrschers entgegengesetzt; im zweiten Fall durchlebt der Fürst eine geistige Metamorphose, die über den Rahmen seiner persönlichen Beziehung mit der Heldin hinausgeht und fortan den geistigen Weg eines ganzen Volkes bestimmt, so wie es sich für einen archetypischen Monarchen gehört.
Die zwei Meisterwerke von Mussorgski, Boris Godunow und Chowanschtschina (1896), bieten Herrschergestalten im Überfluss. In Boris Godunow gibt es neben dem eigentlichen Protagonisten, der den Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung bildet, zusätzlich einen potenziellen Zaren, den lichten Prinzen und Berater Fjodor; einen zukünftigen Zaren, den raffinierten Intriganten Wassili Schuiski; und einen selbsternannten Zaren, den dunklen Usurpator. Außerhalb der eigentlichen Handlung stehen zudem zwei weitere Zaren: der ominöse Iwan der Schreckliche, der von mehreren Figuren in unterschiedlichem Kontext erwähnt wird, und dessen Sohn, der engelhafte Zarewitsch Dimitri, an dem das Sinngefüge der gesamten Oper ausgerichtet ist. Chowanschtschina wiederum präsentiert neben dem herrschenden Fürsten Golizyn, dem Anführer der Schützen Fürst Chowanski und dem Hohepriester und Gebieter der Altgläubigen Dossifej hinter den Kulissen auch noch Zarewna Sofja und Peter I., der – unabhängig davon, ob es für das Publikum sichtbar stattfindet – in den Moskauer Kreml einzieht: Dies ist an sich eine rituelle Handlung von höchstem Rang.
Alexander Borodins Knjas Igor (Fürst Igor, 1890) bietet seinerseits vier tatsächliche oder potenzielle Herrscherfiguren: auf der einen Seite den schuldbeladenen, reuigen, fast märtyrerhaft zur öffentlichen Schändung bereiten Protagonisten, den gewalttätigen Lüstling und ‚inneren Feind‘ Fürst Galitzki sowie den handlungsunfähigen, in Bezug auf Macht gleichgültigen Fürstensohn Wladimir; und auf der anderen Seite den Anti-Zaren Kontschak. Die Auseinandersetzung mit Letzteren, bei der es um kulturelle Grundlagen der Zivilisation geht, lässt den Titelhelden seine Mission erkennen und eine historische Weitsichtigkeit erlangen, wie sie einem paradigmatischen Herrscher gebührt.
Die Herrscherfiguren des lyrisch veranlagten, an sozialen und historischen Themen wenig interessierten Peter Iljitsch Tschaikowski präsentieren sich sehr unterschiedlich im Hinblick auf Status und Charakter. Über tatsächliche Macht verfügen nur zwei seiner Gestalten, die machthungrigen Antagonisten aus Masepa (Mazeppa, 1884): der Titelheld, ein regelrechter Anti-Zar, und der von christlicher Ethik ebenso wie vom ritterlichen Ehrenkodex unbehelligte Kotschubey. Der finstere Fürst aus Tscharodeika (Die Zauberin, 1887), seine Gemahlin und sein Sohn scheinen allesamt einem Schauerroman zu entstammen und wirken wie eine private Familie. Tschaikowskis französische Monarchen, der charakterlose Karl VII. aus Orleanskaja dewa (Die Jungfrau von Orléans, 1881) sowie der liebende Vater und provenzalische König René aus Jolanthe (1892), sind auf ihre lyrisch-symbolische Komponente reduziert und entbehren nahezu jeder sozialen oder historischen Charakterisierung. Dem Sujet gemäß steht es René immerhin frei, die strafende Funktion des Herrschers auszuüben, und Karl wird zum Subjekt einer Krönung. Der Akzent beider Werke liegt aber nicht auf diesen mythologischen Aspekten der königlichen Macht und lässt sie deshalb unwesentlich erscheinen. In Tscherewitschki (Die Pantöffelchen, 1887) und in Pikowaja dama (Pique Dame, 1890) lässt Tschaikowski jeweils Katharina die Große erscheinen und schweigend die Ehrerbietung der Untertanen empfangen: Als Symbol einer göttlichen Königin, leibhaftiges Idol des kollektiven Unbewussten und ominöse Gestalt steht sie beide Male außerhalb der Machtproblematik, dafür aber im Kontext der Wechselwirkung von männlicher Psyche und Anima.29
Demgegenüber sind viele Herrscher aus den Opern Rimski-Korsakows in einen Strudel von Regierungsproblemen involviert und sehen sich häufig vor die qualvolle Entscheidung zwischen Gewalt und christlicher Vergebung gestellt. Die Paare Saltan – Gwidon (Skaska o zare Saltane [Das Märchen vom Zaren Saltan, 1898]) und Fürst Juri – Prinz Wsewolod (Skasanije o nevidimom grade Kiteschei dewe Fewroniji [Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch und der Jungfrau Fewronija], 1907) entsprechen der mythischen Konstellation vom Zaren und Zarewitsch als seinem Freund und weisen Ratgeber, in ersterem Fall auf märchen-, in letzterem auf mysterienhafte Weise. Dieselbe Konstellation wird im Dreigestirn Dodon – Gwidon – Afron (Der goldene Hahn) im Sinne eines grotesken Gegenentwurfs parodiert. Der unsterbliche Kaschtschej aus der gleichnamigen Oper ist aufs Engste mit den Tatarenherrschern Bedjai und Burundai aus Kitesch verbunden: Sie alle verkörpern den Typus des bösen, verbrecherischen, höllischen Herrschers, dem die universelle Güte der ‚reinen Zarewna‘ gegenübersteht. Die Herrscher aus Snegurotschka (Schneeflöckchen, 1882) und Sadko (1897) – der despotische König Frost, der um das Wohl seiner Untertanen besorgte Zar Berendej und der furchteinflößende heidnische Meereskönig – befinden sich außerhalb der christlichen Welt:30 Ihre mythologischen Funktionen offenbaren sich in elementarer, archaischer Form, wobei der Archetyp des Zaren mit dem Archetyp des Greises verschmilzt.31
Der vage umrissene Fürst Mstiwoi aus Mlada (1892) ist ein entfernter ‚Verwandter‘ des König Frost; seine Macht ist unbestritten und kommt auf allen Ebenen zum Ausdruck – sowohl im Ritus als auch im Alltag. Eine statuenhafte Katharina die Große begegnet uns auch bei Rimski-Korsakow (Notsch pered Roschdestvom [Die Nacht vor Weihnachten, 1895]), ebenso wie bei Tschaikowski als symbolische Königin-Göttin, diesmal allerdings mit Recht auf Opernstimme.32
Der zentrale Herrscher der Opern von Rimski-Korsakow, den der unternehmerische Kunstkritiker und Herausgeber Sergei Pawlowitsch Djagilew zusammen mit Boris Godunow in den Westen ‚verkaufen‘ wollte, bleibt jedoch unbestritten sein widersprüchlicher Iwan der Schreckliche, den der Komponist in Pskowitjanka (Das Mädchen aus Pskow, 1873) sowie in der späteren Bojarynja Wera Scheloga (Die Bojarin Vera Šeloga, 1898), viel und abwechslungsreich singen lässt. In der mythologischen Struktur dieser Oper steht allerdings die ‚reine Zarewna‘ im Vordergrund – Olga, die Retterin von Pskow –, während der furchteinflößende Zar ihrer Reinheit und sakralen Macht lediglich als Folie dient.33 Demgegenüber tritt in Zarskaja newesta (Die Zarenbraut, 1898) die auf Macht gegründete Wesenheit des Zaren deutlicher hervor, als eine stumme, zeichenhafte Präsenz, die alle Figuren und ihre Beziehungen untereinander gleich einer unsichtbaren Spinne umwebt.34
Chronologisch und inhaltlich gelangt die Galerie der russischen Opernzaren mit dem grotesken Dodon aus dem Goldenen Hahn zum Abschluss. Mit seiner ganzen Art führt er die Figur des Zaren ad absurdum, weshalb dieser Archetyp anschließend für immer aus der russischen Oper verschwindet. Mit Dodon endet die russische klassische Oper. Sergei Prokofjews Kreuz-König, Napoleon und Alexander I. stehen in Dodons Nachfolge und sind auch nur groteske Einzelfälle. Als Erbe des archetypischen Zaren der russischen Oper, Boris Godunow, kann höchstens noch Igor Strawinskys – in jeglichem Sinne nicht allzu russischer – Ödipus gelten, der immerzu von den quälenden Fragen des qualvoll verendenden Zaren verfolgt wird, indem er sich mit seinem eigenen Gewissen, mit den schrecklichen Geheimnissen der Sphinx und mit dem unvorhersehbaren Schicksal auseinandersetzt. Es ist kein Zufall, dass Strawinskys Werke unter diesem Blickwinkel als eine eigene Spielart der russischen klassischen Oper erscheinen: Carl Dahlhaus wies mit scharfem Blick auf die besondere, wenngleich implizite, ‚epische‘ Qualität des russischen Musiktheaters gegenüber dem westeuropäischen hin,35 und in diesem Sinne lässt sich Strawinsky als Erbe und Fortführer einer viele Jahrzehnte alten Tradition begreifen.
Als Nächstes stellt sich auf dem Weg zu den Geheimnissen des Boris Godunow die Frage, welche Metamorphosen die Gestalt des Monarchen in der russischen Geschichte nach der Christianisierung erfuhr. Auf der Suche nach archetypischen Mustern wollen wir versuchen zu ergründen, wie sich das kollektive Unbewusste, das historisch-kulturelle Gedächtnis des russischen Volkes gebildet und entwickelt hatte, das unter anderem in der Oper Ausdruck fand.36
Zu diesem Zweck muss grundsätzlich zwischen dem sakralen Diskurs, der dem Menschen gewisse Verhaltensweisen diktiert, und weltlicher Geschichte, die von seinen Handlungen abhängt und durch diese beeinflusst wird, unterschieden werden. Der sakrale Diskurs hilft zu ergründen, in welcher Weise das kollektive Bewusstsein die sozialen Lebensformen, die jeweils geltende Ethik und die Psychologie prägt.
Alain Besançon stellt fest, dass die Zeit in Russland, unter den zwei genannten Blickwinkeln betrachtet, gleichzeitig schneller und langsamer fließe als in Europa. In Bezug auf weltliche Geschichte vergehe sie schneller: Fjodor Dostojewski beispielsweise sei im Laufe seines Lebens Zeuge von Ereignissen geworden, die in Frankreich die Zeitspanne von René Descartes bis zur Pariser Kommune von 1871 gefüllt hätten. Im Sinne des sakralen Diskurses fließe die Zeit langsamer: Die symbolische Ordnung der Dinge werde in Russland als eine tragische wahrgenommen, und das Tragische sträube sich grundsätzlich gegen Entwicklung oder Evolution.
Russische Herrscher füllten in den drei historischen Etappen seit der Christianisierung drei unterschiedliche sakrale Rollen aus. Entsprechend änderte sich der jeweils vorherrschende Heiligendiskurs.
Zu Zeiten des ‚heiligen Russlands‘, das von Dossifej in Chowanschtschina so leidenschaftlich heraufbeschworen wird, waren die Fürsten die ranghöchsten Heiligen. Ein Drittel aller in Russland kanonisierten Heiligen von der Einführung der christlichen Staatsreligion in den Jahren 988/989 bis hin zur mongolisch-tatarischen Invasion in den Jahren 1237–1240 waren Fürsten. Die ersten kanonisierten russischen Heiligen waren die unschuldig ermordeten Brüder Boris und Gleb; besonders wichtig ist dabei, dass sie zu Prototypen für Heiligkeit und für kaiserliche Würde gleichermaßen wurden. Die ersten Fürsten wurden in Russland also fast zeitgleich mit dem Aufkommen des Christentums heiliggesprochen. Charakteristischerweise tragen sie auf Ikonendarstellungen keine Märtyrerkränze, sondern Fürstenkappen. Von der sakralhistorischen Warte gesehen ist die Epoche der ‚heiligen Fürsten‘ eine glückliche: In dieser tugendhaften christlichen Welt herrscht allgemeine Harmonie, das Böse ist nicht Teil dieser Welt und manifestiert sich ausschließlich in Gestalt äußerer Feinde (benachbarter Stämme etc.).
Als dauerhaftes Leitprinzip des russischen Verständnisses von Heiligkeit kann die Nachahmung Christi in der Kenosis bezeichnet werden, das heißt in der Schlichtheit, Armut, Demut, im freiwilligen Opfertod. Entsprechend werden russische Heilige – wörtlich übersetzt – als ‚Ähnliche‘ oder ‚Erzähnliche‘ tituliert.37 Boris und Gleb werden zu den ersten Wundertätern und Fürsprechern des neu christianisierten Volkes vor Gott. Sie sind Märtyrer im eigentlichen Sinne, sogenannte ‚Dulder‘,38 die Leid ohne jegliche Gegenwehr ertragen, den Tod als Gottes Gabe empfinden und die Qual von Gethsemane freiwillig über sich ergehen lassen. „Was Boris’ Heiligkeit ausmacht, ist die Art, wie er sich vor dem Tod verhielt und warum er ihn nicht abzuwenden versuchte. […] Er akzeptierte den Tod, und diese Entscheidung war freiwillig. Er deutete den Tod nicht als ultimatives Leid, sondern als ein Opfer, also etwas, das spätere Belohnung verspricht. Zudem war dieses Opfer kein außenstehendes wie üblich, kein anderer wurde als Opfer dargebracht, sondern das eigene Leben, im Sinne eines Selbstopfers.“39 Ein Jahrhundert später lässt sich Fürst Andrei Bogoljubski, ein grausamer und lasterhafter Mann – im Bewusstsein der drohenden Gefahr – von seinen Bojaren ermorden; dadurch wird er seinerseits zu einem ‚Dulder‘. Zu Zeiten des ‚heiligen Russland‘ zentriert sich die Theologie der Zarenwürde um das ‚Duldertum‘ als solches: Der Fürst verkörpert damit Christus in seinem Aspekt als Schmerzensmann, als Lamm Gottes, das dem himmlischen Vater geopfert wird. Es darf jedoch nicht außer Acht bleiben, dass fürstliche Würde an sich bereits für eine Heiligsprechung auszureichen schien: Für die meisten kanonisierten Fürsten lässt sich kein ‚Duldertum‘ nachweisen.
Mit der Herausbildung des zentralisierten Staates um Moskau verkehren sich die Vorstellungen vom Verhältnis zwischen dem Zaren und dem Volk in ihr Gegenteil. Hier nimmt ein Prozess seinen Lauf, den Georgi Fedotow als „Tragödie der russischen Heiligkeit“ bezeichnete. Es beginnt eine von Leid und Kummer gekennzeichnete Epoche der russischen Geschichte: Der Herrscher übernimmt von nun an strafende Funktionen, die bis dahin Gott vorbehalten waren (Besançon). Seine frühere kenotische Funktion geht einerseits auf das Mönchtum über (um diese Zeit wird das Kloster zur höchsten Instanz der orthodoxen Heiligkeit; Mönche machen die Mehrheit der Kanonisierten aus), andererseits auf die Narren in Christo. Fürstliche Würde ist nicht mehr automatisch mit Heiligkeit assoziiert; um diese Verbindung aufrecht zu erhalten, ist der Zar gezwungen, sich als Mönch zu verkleiden und zu gebärden (Iwan der Schreckliche) oder einen Gottesnarren in seiner Nähe zu haben, welcher den Herrscher rituell anklagt, zugleich aber ein unzertrennliches sakrales Paar mit diesem bildet. Das Gottesnarrentum erreicht nicht zuletzt deshalb im 16. Jahrhundert seinen Höhepunkt, weil sich um diese Zeit, nach G. P. Fedotow, die josephitische Klosterordnung endgültig durchsetzt40 und das Einsiedlertum seine sakral-kenotischen Funktionen teilweise einbüßt. Der Zar gilt nicht mehr als Opferlamm und ‚Dulder‘ (ein solcher Diskurs setzt voraus, dass der Zar eine passive, untergeordnete Rolle gegenüber dem Volk einnimmt), sondern als Hohepriester, der Opfer fordert und diese selbst zum Altar bringt. Er steht zwar nach wie vor stellvertretend für Christus, diesmal aber für dessen Aspekt als strafender, unerbittlicher, Sühne fordernder Richter des Jüngsten Tages. Der Moskauer Zar hält nun das Schwert des Racheengels in der Hand, ein Instrument göttlicher Strafe, und steht somit über dem Volk. In ihren Selbstbezeichnungen verwenden die Herrscher aber nach wie vor kenotische – in diesem Zusammenhang erniedrigende – Epitheta: Sowohl Iwan der Schreckliche als auch Alexej Michailowitsch, der zweite der Romanow-Zaren, bezeichnen sich selbst als „Demütiger“, „Sklave“, „Unwürdiger“, „Sünder“ etc.
Der Zar gilt zwar immer noch als lebendiges Abbild Gottes, so wie sich das orthodoxe Reich als irdische Abbildung des himmlischen Reichs versteht. Das erschreckende Paradox besteht jedoch darin, dass dieser strafende Zar ein tragisches Geheimnis in sich trägt: Er ist elender als das unglücklichste seiner Opfer, weil er sowohl für ihre Sünden als auch für die Sünde ihrer Bestrafung vor Gott büßen muss. Da die Assoziation zwischen Zar und Christus, wie gesagt, weiterhin gewahrt bleibt, werden ihm ambivalente Emotionen entgegengebracht: Als ‚Dulder‘ löst er Angst aus, als Richter Mitleid, und diese zwei Gefühlszustände lassen sich kaum voneinander abgrenzen.
In dieser Epoche kommt dreimal eine Situation vor, in welcher sich der Zar zunächst weigert, seine Macht anzunehmen oder deren strafende Funktion auszuüben, sich dabei vor der Welt verschließt und sich lange nicht überreden lässt. So harrt Iwan der Schreckliche in der Siedlung Alexandrowo aus und spielt den Beleidigten, nur um sein freiwilliges Exil wenig später auf Schmeicheln und Bitten hin zu verlassen und die Opritschnina41 ins Leben zu rufen (man denke an die Episode der flehenden Volksversammlung in Sergei Eisensteins Film Iwan Grosnyj [Iwan der Schreckliche, 1945, 1958]). Später schließt sich Boris Godunow im Neujungfrauenkloster ein und weigert sich hartnäckig, die Krone anzunehmen, als ob er sein zukünftiges Unglück im Voraus ahnte. Zuletzt ist es der junge Michail Romanow, der mit seiner Mutter im Ipatjew-Kloster den Besuch der Bojaren erwartet; mit seiner Krönung endet alsdann die Geschichte der Angst der russischen Monarchen vor der Last des Herrschertums.42
Dass sich die Vertikale Volk – Zar – Gott mit der Zeit gewandelt hatte, wurde bereits angesprochen. Verständlicherweise führt die strafende Funktion des Zaren früher oder später zu einer Konfrontation mit dem Volk, und dies erklärt seinerseits die Entstehung des Mythos vom ‚heiligen Russland‘43 als einer weiblichen, schützenden, nährenden, ‚heiligen‘ Wesenheit im Sinne einer Reaktion auf den Mythos vom furchtgebietenden Vater mit seiner männlichen Herrschernatur.
Später sollte die Idee des Herrschers im kollektiven Unbewussten der russischen Kultur eine weitere Wandlung erfahren. Dies geschah, als die Moskauer Zaren durch die Petersburger Kaiser abgelöst wurden. Aus der Perspektive der sakralen Geschichte stehen die Reformen Peters des Großen nicht nur für Europäisierung, sondern vielmehr für die Säkularisierung der Staatsmacht und der Kirche.44 Paradoxerweise führt die Säkularisierung des Staates zur Vergöttlichung des Kaisers, indem sich die Idee von Gott aus dem ‚entweihten‘ Himmel auf die Erde verlagert. Der Kaiser ist nicht mehr Statthalter Christi, sondern avanciert selbst zur letzten Instanz, zur Theophanie (göttlichen Manifestation). Der Bischof und Schriftsteller Theophan Prokopowitsch stilisiert Peter I. in seiner Grabesschrift zum Weltenschöpfer, der Leben zu schenken und Tote aufzuerwecken vermag, und bezeichnet ihn schlichtweg als Christus (Gesalbten im weiteren Sinne). Im Zusammenhang damit verändert sich auch der Kanon der Herrscherdarstellung: Von den Ikonen der ‚heiligen Fürsten‘ und den frühen, ikonenartigen Porträts der Moskauer Zaren aus dem 17. Jahrhundert führt der Weg zu den kaiserlichen Statuen und Denkmälern. Hoch zu Pferd oder stehend, entsprechen sie auf jeden Fall nicht mehr dem byzantinischen, sakralen Darstellungstypus, sondern orientieren sich an der römischen Reichssymbolik.45 Aus der Sicht der Slawophilen46 erscheint das kaiserliche Russland als Kaserne, im Gegensatz zum ‚heiligen Russland‘, das als Kirche erschien. Trotz seiner offensichtlichen Tendenz ist dieser Diskurs nicht ganz unbegründet: Eine ausgeprägte Vorliebe für Paraden und militärische Symbolik war allen Nachfolgern Peters des Großen eigen, während Nikolaus I. häufig gar als „idealer Oberst“ bezeichnet wurde. Das Bild der Kaserne entspricht dem Modell einer idealen Gesellschaft, in der das religiöse Wertesystem in den Hintergrund getreten ist, die althergebrachten äußeren Formen jedoch relativ streng gewahrt bleiben.
Zum Abschluss dieses flüchtigen historischen Exkurses möchte ich festhalten, dass alle in diesem Buch analysierten Opern selbstverständlich in die dritte Periode der russischen Geschichte fallen und dass deswegen alle ‚heiligen Fürsten‘ oder ‚Moskauer Zaren‘, die in diesen Opern auftreten, auf die eine oder andere Weise mit dem Firnis des ‚sakralisierten Kaisers‘ übertüncht sind, der ihrer Entstehungszeit anhaftet.
Versuchen wir nun, die Herrscher der russischen Oper den umrissenen historischen Typen zuzuordnen.
Als muster- und ikonenhafte ‚heilige Fürsten‘, ideale Herrscherbilder oder deren würdige Abwandlungen präsentieren sich ziemlich viele Opernzaren. Glinkas Swetosar mit seiner väterlichen Liebe, seinen versöhnlichen Kantilenen und feierlich-ausschweifenden Ergüssen steht gleichsam stellvertretend für die glückselige Harmonie des alten Russland, die durch keinen inneren Widerstreit getrübt war. Ob er Christ oder Heide ist, spielt keine Rolle: Er verkörpert auf mustergültige Weise den Typus des ‚heiligen Fürsten‘, denn seine fürstliche Würde ist unbestritten. Manche modernen Inszenierungen47 versetzen Ruslan und Ljudmila aus einem Märchenland in Puschkins Epoche, was Swetosars archetypischen Charakter zusätzlich hervorhebt: Der weise, statuenhafte Greis, der einer Ikone oder einem Fresko des Moskauer Kremls zu entstammen scheint, wirkt unter den Menschen des 19. Jahrhunderts wie ein strenges Mahnmal der tugendhaften Vergangenheit – das heißt des ‚heiligen Russland‘ –, egal, welche Kleider er trägt und welche alltäglichen Funktionen ihm zugeschrieben sind.
Es bedarf keiner Beweise, auch Fürst Juri und seinen Sohn Wsewolod aus der Skasanije o newidimom grade Kitesche dem Typus des ‚heiligen Fürsten‘ zuzuordnen: Kitesch ist in einem seiner Aspekte schließlich nichts anderes als ein Symbol für das ‚heilige Russland‘.48 Der ältere Fürst ist ein wahrer ‚Dulder‘: Er ist es, der die Stadtbewohner im dritten Akt durch kummervolle Gesänge zum Martyrium verleitet und sich angesichts der bevorstehenden Qualen fast ekstatisch an der eigenen Rechtschaffenheit berauscht.
Der junge Fürstensohn ist von anderem Schlag, er strahlt von Anfang an jugendliche Dynamik aus und legt eine aktive Lebenshaltung an den Tag (Dialog mit Fewronija im ersten Akt). Er ist es aber auch, der Fewronija für ihre „bunten Träume“ schilt und dafür, dass sie nicht in die Kirche geht, der sich gegen ihr Verständnis des Lebens und des Gottesglaubens als unvergängliche Freude sträubt.49 Und so erscheint der Fürstensohn, dessen „jugendlicher Übermut“ ihn nach eigener Aussage daran hindert, sich in die Stille der Einsiedelei zurückzuziehen, nicht nur als militanter Herrscher und prototypischer Heimatretter, sondern auch als eifriger Hüter der spirituellen Ordnung des ‚heiligen Russland‘. Später, als er freiwillig in den sicheren Tod geht, machen ihn die „vierzig Wundlein am Leibe“ auch noch zu einem musterhaften ‚Dulder‘ und geistigen Erben von Boris und Gleb. Das „freiwillige Opfer“ ist das Schlüsselbild von Kitesch, und damit evoziert die Oper in ihrer gesamten Struktur den frühesten Heiligendiskurs des christlichen Russland.
Fürst Igor aus Alexander Borodins gleichnamiger Oper mit seinem Fehltritt und anschließender Reue scheint in seiner Gesamtheit unmittelbar einer Heiligenvita zu entstammen. Seine tugendhafte Seele entspricht der ‚lichten‘ Hälfte Tannhäusers, der für diese Opernfigur offensichtlich Pate gestanden ist.50 Es handelt sich um diejenige Hälfte, die der reinen Jungfrau Elisabeth treu ergeben ist oder, in unserem Fall, der Ehefrau Jaroslawna; die andere Hälfte, gebannt in Venus’ Grotte und unwillig, den Normen der christlichen Moral nachzukommen, verselbstständigte sich in Gestalt von Igors Sohn Wladimir mit seiner Leidenschaft für die üppige Kontschakowna. Igors musterhafte, nicht von Sinnlichkeit befleckte Vergeistigung wird sowohl durch die Behäbigkeit des äußeren Feindes Kontschak hervorgehoben als auch durch die Zügellosigkeit des inneren Feindes, Fürst Galitzki, dem auf sakraler Ebene die Funktion des Anti-Zaren – sprich: Antichrist – zufällt: Man denke an den archetypisch hinterlistigen Swjatopolk, den Mörder Boris’ und Glebs, und an die bösartigen Bojaren in der Legende von der Ermordung Andrei Bogoljubskis. Igors ‚Heiligkeit‘ ist der wichtigste Pfeiler im Gefüge von Borodins Oper.51 Die Tatsache, dass der Igor-Mythos der russischen Oper (und der gesamten russischen Kultur) auf dieser Prämisse aufbaut, war es wohl, die seinerzeit den Komponisten Boris Tischtschenko, den Choreografen Oleg Winogradow und den Regisseur Juri Ljubimow dazu bewogen hatte, Igors angebliche Heldenhaftigkeit kritisch unter die Lupe zu nehmen und unter veränderten soziokulturellen Umständen nach der historischen Wahrheit zu suchen.52
Zar Berendej und Fürst Mstiwoi aus Rimski-Korsakows Schneeflöckchen und Mlada gehören als heidnische Herrscher natürlich nicht in den Kontext von Heiligendiskursen, aber die Art des Verhältnisses, das sie mit den Gottheiten (Sonnengott Jarilo und insgesamt dem polytheistischen Pantheon) und mit dem eigenen Volk verbindet, entspricht dem aufsteigenden altrussischen Modell. Genauso steht es um Wladimir Sonnenrot aus Serows Rogneda – umso mehr, als er sich durch die Taufe dem Typus des ‚heiligen Fürsten‘ nähert. Demselben sakral-historischen Zeitraum sind aus typologischer Sicht auch Tschaikowskis westliche Monarchen zuzuordnen, Karl aus der Orleanskaja dewa (Jungfrau von Orléans, 1881), und René aus Iolanta (Jolanthe, 1892). Ihre latente königliche Würde ist unbestritten und kommt nicht auf säkularisiert-politische, sondern eher auf sakral-religiöse Weise zum Ausdruck: Man denke an Johannas Verständnis des Monarchen als Gottgewählten, das durch dessen Krönung bestärkt wird, oder an Renés Rolle als Hüter eines Geheimnisses und Wächter über die heilige Blindheit in der symbolischen Struktur von Jolanthe.53 Wie Parodien auf den Typus des ‚heiligen Fürsten‘ wirken die Zaren aus den späten Opern von Rimski-Korsakow: in märchenhaft-ironischer Brechung der großzügige, barmherzige, einfältige Saltan oder als scharfe Groteske der banale, eindimensionale und lächerliche Dodon. Die typologische Verzerrung, die diesen Verwandlungen zugrunde liegt, lässt sich etwa mit der Verzerrung der Motive und Stilmittel der Ikonenmalerei in populären Bilderbogen oder mit der Profanierung des spirituellen Gehalts kirchlicher Heiligendarstellungen auf billigen Papierabdrucken vergleichen.
Wie schon erwähnt, bezeichnet der sakrale Diskurs vom ‚heiligen Russland‘ einen Zustand vollkommenen Glücks und harmonischer Selbstgenügsamkeit. Bedroht wird dieser Zustand von äußeren Feinden (Gegnern des Christentums), die außerhalb der imaginären Grenzmauern der Kirche (als symbolisches Staatsbild) lauern. So gesehen sind die Feinde der russischen (oder auch universellen) Seligkeit, als da wären all die polnischen Könige, Tschernomor, Kontschak, Holofernes, Bedjai und Burundai,54 Mazeppa und die Königin von Schemacha, allesamt eine Art von Dämonen bzw. blutrünstige Christenfeinde, wie sie auf den mittelalterlichen Märtyrerdarstellungen zu sehen sind; ihre Herrscherrolle ist nicht als solche von Bedeutung, sondern nur als das böse ‚Andere‘, welches kontrastiv zur Bestimmung des guten ‚Eigenen‘ beiträgt.55 Die Gegenüberstellung des Eigenen und des Fremden, des Helden und des Feindes findet aber auch in der harten Fügung der Mythen vom ‚heiligen Russland‘ und von Petersburg (im Sinne eines Symbols des säkularisierten Russischen Reichs) einen Ausdruck. Darauf werden wir an anderer Stelle ausführlich eingehen.56
Die zweite Gruppe der Opernzaren ist durch ‚Kaiserstatuen‘ vertreten, d. h. durch die vergöttlichten Machthaber des säkularisierten Staates. Ohne die ihnen stillschweigend vorbehaltene Funktion eines Deus ex Machina zu erfüllen, erscheinen sie auf dem Höhepunkt der Handlung und beanspruchen für sich die Rolle eines Götzenbilds innerhalb des verweltlichten gesellschaftlichen Wertesystems. Zu dieser Gruppe zählen: Michail Romanow in der Schlussapotheose des Lebens für den Zaren,57 Peter I. im fünften Bild der Chowanschtschina58 und Katharina die Große in Tschaikowskis DiePantöffelchen (sowie in Rimski-Korsakows Die Nacht vor Weihnachten) und im dritten Akt seiner Pique Dame.59
Übrig bleiben alle Fürsten aus Chowanschtschina, der unglückselige, von Feinden umgebene Titelheld des Boris Godunow, die Fürsten aus Rusalka und Die Zauberin sowie Iwan der Schreckliche aus Das Mädchen aus Pskow und Die Zarenbraut. Diese Figuren gehören zum Paradigma des Moskauer Zarenreichs und sollen in diesem Kontext interpretiert werden. Bevor wir uns aber ihnen widmen, soll eine wichtige Gesetzmäßigkeit beziehungsweise ein grundlegender Nationalmythos der russischen Geschichte erläutert werden, der von Alain Besançon beschrieben und von Maria Pljuchanowa detailliert untersucht worden ist.
Bevor Besançon auf den russischen Nationalmythos zu sprechen kommt, macht er auf eine immer wiederkehrende Konstellation in der französischen Geschichte aufmerksam, die als französischer Nationalmythos aufgefasst werden kann. Es handelt sich um die Abfolge von drei Zuständen: Aufteilung des Landes – drohende Auflösung des Staates – Wiedervereinigung unter der Ägide eines heldenhaften Retters. Dieses Schema sei, so Besançon, mit der Vereinigung der fränkischen Gebiete durch Chlodwig I. etabliert worden und habe sich als solches zum ersten Mal in der Regierungszeit Karls des Großen realisiert, der das Erbe der Merowinger unter seiner Herrschaft konsolidiert hatte. Im weiteren Geschichtsverlauf habe sich diese Konstellation noch dreimal wiederholt, jedes Mal mit dem gleichen Tenor: Jeanne d’Arc, oder das gerettete Frankreich; Heinrich IV., oder das gerettete Frankreich; Napoleon, oder das gerettete Frankreich. Besançon weist ausdrücklich darauf hin, dass sich dieser Mythos jeweils um einen geopferten Helden (oder eine geopferte Heldin) zentriere.
Demgegenüber gründet der russische Mythos, laut Besançon, in der Tötung eines unschuldigen Zarewitsch durch den furchteinflößenden Zaren, also im immer wiederkehrenden Durchspielen des paradigmatischen Opfertodes von Boris und Gleb. Diese Schlüsselkonstellation begegnet in der russischen Geschichte mindestens dreimal, allesamt in zeitlicher Nähe der sogenannten Smuta (‚Zeit der Wirren‘). Pljuchanowa analysiert die Idee vom „Opfer im Fundament des Zarenreichs“ auf einer strengeren historischen bzw. populär-mythologischen Basis; für unseren Zusammenhang ist ihre Beobachtung, dass das Motiv der „Opferung des Herrschersohnes“ ausgerechnet im Moskauer Zarenreich zum ersten Mal verbalen Ausdruck erhält,60 am wichtigsten.
Die zentralen Ausprägungen dieses Musters in der russischen Geschichte sind folgende: November 1581: Zar Iwan der Schreckliche tötet seinen Sohn Iwan. Der mythische Zarewitsch, der dem Zaren als weiser Berater zur Seite stehen sollte, erweist sich als Verräter. Dieser Aspekt des Vater-Sohn-Verhältnisses ist es, der in den volkstümlichen Heldengedichten über Iwan den Schrecklichen besonders hervorgehoben wird. Bezeichnenderweise ist es gerade Iwan der Schreckliche, ein archetypischer russischer Zar, dem in dieser Abwandlung des Boris-und-Gleb-Mythos die Rolle des Mörders zufällt. Aufschlussreich ist auch die Tatsache, dass diese historische Episode ausgerechnet im 19. Jahrhundert, zur Blütezeit der russischen klassischen Oper, dank des Malers Ilja Jefimowitsch Repin und des Dramatikers Alexei Konstantinowitsch Tolstoi symbolischen Charakter erhält.
Mai 1591: In Uglitsch kommt es zu einem Ereignis, das in mythischer Umgestaltung dem Tod Boris’ und Glebs gleicht: Der jüngste Sohn Iwans des Schrecklichen, Dmitri (geboren 1582 im gleichen Jahr, als sein Vater den Prinzen Iwan Iwanowitsch tötete), stirbt infolge einer tragischen Koinzidenz von Erbkrankheit und Unfall,61 worauf die überlieferten Quellen schließen lassen.62 Dieser Unfall wird jedoch, gleich nach der Entdeckung der Leiche im Hof des Zarenpalastes und noch bevor das Trauergeläut verhallt ist, durch Gerüchte beharrlich und finster als Mord dargestellt und die Schuld an diesem vermeintlichen Mord dem Adeligen Boris Godunow, der das Land zur besagten Zeit de facto regiert, unterstellt. So wird diese paradigmatische Episode zum Nährboden für die gesamte Smuta: Sie setzt der Epoche des Moskauer Zarenreichs mit seiner sakralen Vision und der etablierten Ordnung, die Iwan der Schreckliche auf jede erdenkliche Weise zu erschüttern versuchte, ein Ende; und sie leitet das Chaos einer Umbruchszeit ein, in deren Verlauf die Gestalt des Zaren ihre sakrale Konnotation fast vollständig einbüßt. Boris Godunow, der vermeintlich Schuldtragende in dieser schicksalhaften Episode, fungiert dabei als Mittler, als lebendige Brücke zwischen den Epochen. Es ist bezeichnend, dass nicht-russische Autoren an der Smuta vor allem das Phänomen des Usurpators interessiert: Man denke etwa an Friedrich Schillers Dramenfragment Demetrius oder an Antonín Dvořáks Dimitrij (1882). Andererseits verwundert es nicht, wenn Puschkin, in höchstem Maße empfänglich für Fragen des nationalen Bewusstseins und der Mythenbildung (man bedenke seinen Anteil an der Schöpfung des Mythos um Peter den Großen63 oder die brillante Legendenkonstruktion um Mozart und Salieri), seinerseits Boris Godunow zur Titelfigur wählt und ihm im Handumdrehen paradigmatischen Rang verleiht.
Die Episode mit der Ermordung eines Zarewitsch sollte sich allerdings im Juni 1718 noch einmal wiederholen. Zu einer Zeit, als die Smuta längst vorbei und ihre anarchischen Wunden geheilt zu sein scheinen, zollt Zarewitsch Alexej der Vergangenheit Tribut, verschwört sich gegen seinen Vater und wird auf dem Altar der Staatsmythologie geopfert (gemäß der vorherrschenden These ließ ihn sein Vater Peter I. im Gefängnis umbringen). In diesem Fall gehört der Mord in den Rahmen einer säkularisierten Welt; mehr noch, er ist sogar selbst ein Element dieser Säkularisierung. Vergebung kann nur durch den Tod erlangt werden: Der Zar und Reformator wiederholt Abrahams Opfer, ohne dass ein Engel dazwischentritt. „Das künstliche Mythologem […] wurde zum Zeitpunkt der Gründung des neuen Reiches mit Zentrum in Petersburg wiederhergestellt. […] es besteht kein Zweifel, dass die Hinrichtung des Sohnes durch seinen Vater im Rahmen des christlichen Denkens […] nicht außerhalb jeglicher Traditionen reflektiert werden konnte.“64
Besançon verzeichnet den Tod des letzten ermordeten Zarewitsch, Iwans VI.,65 als „außermythologisch“, rechnet aber die Ermordung Peters III. durch seine Frau Katharina zu den rituellen Opfern des entsprechenden Typus. Demgegenüber bin ich der Meinung, dass diese „schöne, aber nicht zufällig wiederkehrende Reihe“66 im Juli 1918 mit der grausamen Ermordung des Zarewitsch Alexej in Jekaterinburg ihren Abschluss findet, kurz nach der Abdankung seines Vaters Nikolaus II. Gemeint ist nicht die herrschergeschichtliche, sondern die sakral-historische Bedeutung dieses Ereignisses: Der Zarewitsch wurde in einem rituellen Akt auf dem Altar des Staates geopfert, und nicht einmal die ohrenbetäubenden Glocken des bolschewistischen Triumphes konnten den mächtigen Nachhall seiner Ermordung übertönen. Um den neuen Staatsmythos nicht zu gefährden, wurde das Haus, in dessen Keller die Zarenfamilie erschossen worden war, während der Sowjetunion abgerissen, nur um nach der politischen Wende der 1990er-Jahre spirituelle Bedeutung zu erlangen: An seiner Stelle wurde eine Kapelle des Heiligen Blutes errichtet.67
Kommen wir aber auf die drei erstgenannten Episoden zurück, die im Kontext der russischen Oper relevant sind. Der Tod Iwans, des Sohnes Iwans des Schrecklichen, wurde vom Volk ohne Weiteres gebilligt; Dmitris Tod löste einen spontanen Aufstand aus; die Reaktion auf den Tod von Alexej Petrowitsch hatte ihrerseits etwas Absurdes: Das Volk hielt den Zarewitsch schon lange für ‚fremd‘, da er entweder als Ausgeburt des Antichrist oder als Sprössling eines selbsternannten Kaisers wahrgenommen wurde (mehr zu Peter I. folgt weiter unten im Zusammenhang mit den Strukturen der Chowanschtschina.)
Das Wichtigste an dieser Ereigniskette ist jedoch Folgendes: Es scheint, als stünde der Zar symbolisch für die russische sakrale Ordnung und die Opferung seines Sohnes für die politische Ordnung. Unter diesem Blickwinkel lässt sich leicht erklären, warum sich die aufrührerischen, gegen den Zaren aufbegehrenden Kräfte stets durch kategorischen Verzicht auf Opferung auszeichnen: Vollendeter Ausdruck dieses Verzichts ist das ‚Wiedererwecken‘ eines getöteten Zarewitsch. Es wird aber auch verständlich, warum auf die ‚Zeit der Wirren‘ kaum eine Herrschaftsperiode ohne einen selbsternannten Kaiser folgt.68 Zur Zeit Peters I. wird sogar der Zar selbst im sakralen Umfeld als Usurpator gedeutet (im Sinne von Widerstand gegenüber der offiziellen säkularen Verherrlichung).
Ausgehend von den obigen Überlegungen lässt sich die Zeitspanne, die mit Iwan dem Schrecklichen anfängt und mit Peter dem Großen endet, als Knotenpunkt der paradigmatischen Ausprägungen der russischen Herrschermacht in ihrem sakral-mythologischen Aspekt deuten. Der strafende, opferbringende Zar des Moskauer Russland blickt noch mit Sehnsucht – oder Hass – auf das Bild des ‚heiligen Fürsten‘, des Opferlamms, zurück und ebnet gleichzeitig den Weg für den entsakralisierten Kaiser in militärischer Uniform. Er ist nicht mehr der Mittler zwischen Gott und den Menschen, nicht mehr der freiwillig leidende Menschensohn, aber auch noch nicht der sozialisierte, den Vorschriften der Blutsverwandtschaft entfremdete Imperator; er ist noch der Vater-Zar, der aus grenzenloser väterlicher Liebe straft. Die Umbruchslinie der nationalen Geschichte, welche die ‚Zeit der Wirren‘ (einschließlich großer Zeitabschnitte vor und nach der eigentlichen Smuta) kennzeichnet, verläuft mitten durch sein Herz.
Aus diesem Grund habe ich die furchteinflößenden, von Zweifeln oder Widersprüchen zerrissenen Herrscher in der russischen Oper bis zum Schluss aufgespart: In den Leidenschaften, denen diese Figuren Ausdruck verleihen, spiegelt sich meiner Meinung nach die paradigmatische Zarenfigur wider, welche dem sakralen Umfeld der Smuta, einer verhängnisvollen Umbruchszeit, entstammt.
Fangen wir mit den einfacheren Beispielen an. Der „strahlende Fürst“ aus Dargomyschskis Rusalka weist alle Merkmale eines opferbringenden Zaren auf. Seine fürstliche Würde ist für seine Umgebung unbestritten und kommt auch in der Musik zum Ausdruck, welche ihn gleichsam über die anderen, alltäglichen Figuren erhebt. Es ist zwar kein Zarewitsch, den er auf dem Altar der Staatsordnung opfert, sondern eine ungeborene Tochter mitsamt Mutter: Das Motiv ist hier, wie gesagt, auf sentimental-romantische Ebene überführt. Der Mythos der Umbruchszeit versetzt den Fürsten in innere Unruhe: Immerzu meint er die Lieder der Geopferten zu hören, und sein schlechtes Gewissen sucht ihn in Gestalt des wahnsinnigen Müllers heim, der ihm den Tod prophezeit. Daraufhin legt er seine Herrscherfunktionen nieder und geht an der Rache der Hölle zugrunde (sein Opfer hat nämlich eine sakrale Wandlung erfahren und ihr traditionelles engelhaftes Wesen gegen ein diabolisches getauscht, wenngleich auf recht banale Weise).69 Indem der Opferbringer selbst zum Opfer wird, zollt er offensichtlich seinen Vorfahren, den ‚heiligen Fürsten‘, Tribut.
Obwohl, wie gesagt, auf den ersten Blick durch modernistische Brüche gekennzeichnet, gehört der Fürst aus Tschaikowskis Die Zauberin im Hinblick auf seine psychologische Struktur derselben schicksalhaften Epoche an wie Dargomyschskis Fürst – als einziges Beispiel im Œuvre des wichtigsten ‚Westlers‘ der russischen Oper. Auch diese Figur realisiert nämlich das Schema des strafenden Vaters und des ermordeten Zarewitsch, wenngleich in fast märchenhafter, pseudovolkstümlicher Verbrämung. Das unaufhaltsame Streben des Fürsten nach Verbotenem, nach einem Ausbruch aus jahrhundertealten Familientraditionen macht ihn zu einem Geistesverwandten Iwans des Schrecklichen. Den Widerstand des Zarewitsch deutet er – ganz der strafende Zar – eindeutig im Sinne des ‚Zarenmythos‘, demzufolge ein ungehorsamer, gegen das Gesetz aufbegehrender Zarewitsch zum Erzfeind verkommt. Und so wird Nastassja (ein Spiegelbild ihrer Namensvetterin aus Dostojewskis 20 Jahre früher entstandenem Roman Der Idiot, die genauso unbeabsichtigt schreckliche Kettenreaktionen in Gang setzt) für den Fürsten zum einzigen Strohhalm im unheilvollen Strudel der Smuta, zur reinen Zarewna, bei der er Schutz vor den Grausamkeiten und Abscheulichkeiten des Lebens sucht: Man denke an Rogoschins Verhältnis zu Nastassja Filippowna bei Dostojewski und an die Symbolik der Figur von Anastasia in Eisensteins Film Iwan der Schreckliche.
Rimski-Korsakows Iwan-Figuren gehören nicht nur durch ihre historische Verankerung, sondern auch durch ihre sakral-mythologische Rolle in dieselbe Gruppe.
Der wortlose Zar in der Zarenbraut erscheint gewichtiger als der fleißig singende Herrscher im Mädchen aus Pskow. Seine väterliche Allgegenwärtigkeit ist unumstößlich; die schwarzen Strahlen seines krankhaft geltungssüchtigen Herrschertums dringen in alle Facetten der zwischenmenschlichen Beziehungen, in die abgrundtiefe Schuld und Sühne des Opritschniks Grjasnoj, in die Gebete der büßenden Sünderin Ljubascha, in die spirituelle Gesundheit und seelische Krankheit der ‚reinen Zarewna‘ Marfa. Der musikalische Ausdruck der sakralen Gleichsetzung des Vater-Zaren mit einer unerschöpflichen Strahlenquelle, einer omnipräsenten Sonne im dritten, statischen, gleichsam kontemplativen Akt ist in meinen Augen eine Meisterleistung des Komponisten.70
In Das Mädchen aus Pskow entspricht Iwan der Schreckliche allen mythologischen Parametern: Er ist grausam, aber für den Mythos der ‚reinen Zarewna‘ nicht unempfänglich; er legt, dem lyrisch-genrehaften Wesen der Oper zum Trotz, historische Denkweisen an den Tag. Es gelang jedoch weder dem großen Fjodor Schaljapin,71 der nach Djagilews Plan den russischen Mythos in den Westen tragen sollte, noch dem brillanten Schauspieler Vladimir Ognowenko, der den finsteren Zaren vor nicht allzu langer Zeit auf der Bühne des Mariinski-Theaters verkörperte, die antimythologischen, narrativ-monotonen Strukturen des Mädchens aus Pskow zu durchbrechen. Diese Oper lässt den Charakter Iwans des Schrecklichen eindimensional erscheinen und trägt nichts Neues zum verallgemeinert-symbolischen Bild des russischen Zaren bei.
Demgegenüber haben Mussorgskis Opern als Schlüsselwerke innerhalb des Machtdiskurses der russischen Oper dieses Bild ungemein bereichert.
Beginnen wir mit den Fürsten der Chowanschtschina, die – jeder für sich genommen – der Figur des jungen, im Hinblick auf seine Machtfunktionen erst aufkeimenden, in der unheilvollen Moskauer Luft schattenhaft präsenten Peter I. gegenüberstehen. Gleichzeitig ist diese Luft, wie schon oft erwähnt, von der Säkularisierung der Herrschermacht erfüllt, welche den sakralen Aspekt des Zaren aufhebt und den Machtträger überdies zum Antichrist werden lässt. Die Ausgangslage der Chowanschtschina liest sich somit durch die Brille des mythologischen Bewusstseins eindeutig als eine apokalyptische. Initiator dieser Lage und ihre treibende Kraft ist der Bojar Schaklowity: Seine gemächlichen, gereimt-harmonischen, in musikalischer Hinsicht verführerisch schönen Reflexionen über Russlands Schicksal verdanken sich einer distanzierten, teuflisch gelassenen, intellektuellen Einsicht in die Unvermeidlichkeit des historischen Fortschritts. Die Apokalypse bzw. der Untergang des ‚heiligen Russland‘, dessen letzte Bruchstücke im Herrscherverständnis des Moskauer Zarenreichs überdauerten, ist unabwendbar, weil dem – vorerst rein intuitiv handelnden – Peter Mitstreiter wie Schaklowity zur Seite stehen: ideologisch gewandt, teuflisch scharfsinnig, geübt im Intrigieren.72
Die drei Fürsten der Chowanschtschina verkörpern auf symbolischer Ebene die drei Herrscherepochen Russlands und stellen aus dieser Perspektive ein unteilbares Ganzes dar. Dies zeigt sich am deutlichsten in ihrem paradigmatischen Disput, der durch zeitlose Aktualität besticht: Selbst die apokalyptische Lage kann den objektiven Widerstreit der durch sie repräsentierten Konzepte der Zarenmacht nicht auflösen.
Dossifej ist aus historischer Sicht zwar ein ‚heiliger Mönch‘, aus sakraler Sicht aber ein echter ‚heiliger Fürst‘. Sein Freitod, das repräsentative Einstehen für alle Altgläubigen, die versöhnliche Position im ewigen Streit zwischen Vater und Sohn Chowanski – all dies zeichnet ihn als Träger der fürstlich-heiligen Würde aus. Sein ständiger verbaler Rückgriff auf das ‚heilige Russland‘ („das suchen wir“) ist dabei weniger wichtig als seine musikalische Partie, die von orthodoxem Altertum durchdrungen zu sein scheint und nicht einmal in den genrehaften Episoden (Dialog mit Marfa nach Susannas Abgang) ihren spirituellen, liturgisch-mystischen Charakter einbüßt. Sein Tod ist zwar zu demonstrativ, zu rational für einen richtigen ‚heiligen Fürsten‘: Dossifej redet der ekstatischen Marfa ein, für die von ihr angedachte Selbstverbrennung sei es noch zu früh – und schreitet dann pünktlich zum abgemachten Zeitpunkt in einem symbolischen Akt der Selbstaufopferung auf den Scheiterhaufen. Jedoch bedarf die Darstellung einer apokalyptischen Situation sicherlich anderer theatralischer Mittel als das Ursprungsszenario einer (für den gegebenen Kulturkreis) neuen Religion, das in der spirituellen Heldentat Boris’ und Glebs gipfelte. Nichtsdestoweniger wäre die Gestalt des Dossifej ohne Weiteres auf einer frühmittelalterlichen russischen Ikone vorstellbar.
Der alte Fürst Chowanski entspricht mit seiner väterlichen Liebe, seiner Neigung zum schönen Geschlecht und zu Ausschweifungen in der Art Iwans des Schrecklichen, noch dazu in ständiger Begleitung des Fürsten Andrej, der mit der Rolle des ermordeten Zarewitsch zu liebäugeln scheint, dem Typus des Moskauer Zaren in leicht überzeichneter, komischer Brechung. In der Situation des nahenden Untergangs verzichtet er freiwillig auf die ihm zustehende strafende Funktion, indem er sich an die Strelizen, die Schützen, mit dem Aufruf wendet, sie sollen „nach ihren Häusern gehen“, und begibt sich anschließend feierlich in den Tod, als wäre es ein ritueller Opferungsakt. Diese Episode wäre auf einer hochmittelalterlichen Ikone der Moskauer Schule mit ihrer Vorliebe für Verzierungen und dekorative Details durchaus angebracht.
Etwas ganz anderes ist Fürst Golizyn, den man sich auf einer Ikone nicht vorstellen kann. Auch für ein Reiterdenkmal fehlt es ihm an Geltung; der richtige Ort für ihn wäre ein altes Porträt. An ihm ist nichts Sakrales, er steht vor der endgültigen Säkularisierung, zeichnet sich aber nicht durch das Genie Peters I. aus, sondern durch eine langatmige, halbherzige musikalische Gestalt, ein Liebäugeln mit dem ‚heiligen Russland‘ in seiner populistischen Verbrämung und durch ständige Angst.73 Nicht einmal seine geschärfte Wahrnehmung des nahenden Weltuntergangs kann diesem Charakter eine irgendwie spürbare Geistesgegenwärtigkeit verleihen. Dies ist die Vorstufe zu Peters Reformen, der psychologische Boden, auf dem die Samen des Abfalls vom Sakralen aufgehen werden, aber erst eine Vorstufe, erst der Boden.
Außerhalb dieser Dreierkonstellation, die in sich geschlossen ist, deren Tage aber bereits gezählt sind, stehen der Imperator Peter (in kunstgeschichtlichen Kategorien entspricht ihm ein Reiterdenkmal) und sein diabolischer Mitstreiter, der die Absichten des Kaisers im Voraus erahnt, der in einem Atemzug den Schritt von der Ikone zur (im alten Russland verbotenen) dreidimensionalen Statue vollzogen hat – der intellektuelle (oder intelligente?) Bojar Schaklowity.