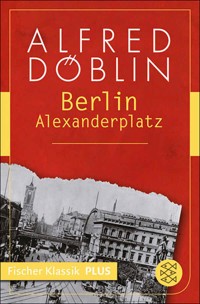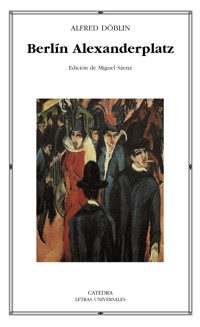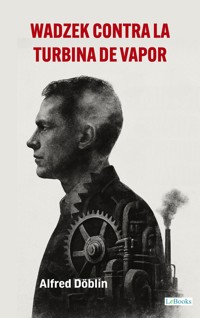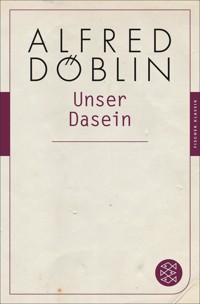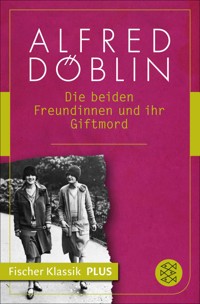9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alfred Döblin, Werke in zehn Bänden
- Sprache: Deutsch
Ein großer Familien- und Epochenroman aus der Zeit der Weimarer Republik Eine Witwe zieht nach Berlin und versucht sich dort mit ihren drei Kindern durchzuschlagen. Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch richtet sich ihr neu erwachter Ehrgeiz auf die Karriere des ältesten Sohnes. Und tatsächlich gelingt dem Sohn der gesellschaftliche Aufstieg. Dann aber stellt die Wirtschaftkrise alles in Frage … Mit einem Nachwort von Sabina Becker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Alfred Döblin
Pardon wird nicht gegeben
Roman
Roman
Fischer e-books
Entbehren sollst du, sollst entbehren
ERSTES BUCHARMUT
Abfahrt
In ihren schwarzen Kleidern warteten sie auf dem kleinen ungedeckten Bahnsteig, die Mutter unbeweglich in der heißen Sonne zwischen zwei Bauersfrauen, die sich ihre bunten Kopftücher in die Stirn zogen und nach den Fliegen schlugen, die um ihre nackten Unterschenkel schwirrten, sie spähten die Hand über den Augen nach dem Zug aus, aber er kam noch nicht, noch immer nicht, man war viel zu früh aufgebrochen, man war schon seit dem Morgen unterwegs, um endlich den Jammer und den Abschied hinter sich zu haben.
Die Mutter stand in ihrem dichten Witwenschleier, Blumen und Taschentuch preßte sie in der linken Hand, in der rechten trug sie die kleine Handtasche mit dem Geld und den Papieren. Das Töchterchen mit dem schwarzen Käppchen, sonntäglich aufgeputzt, hielt sich hinten an ihrem Rock fest und sah, den Daumen im Mund, den beiden Brüdern zu, dem großen und dem jüngern, die unermüdlich den Schienenstrang entlang patrouillierten, in ihren neuen billigen Jacken, den zu strammen langen Hosen, auf den Rundköpfen die ungewohnten Strohhüte mit dem Trauerband. Manchmal gönnten sie sich Ruhe, um hinter dem Rücken der Frauen über die Kisten zu diskutieren, die da zu einem kleinen Bollwerk aufgestapelt lagerten, hier war das Geschirr, hier noch Geschirr, hier Mutters Sachen, hier Mariechens, hier ist die alte Uhr.
Dann surrten die Schienen, die Mutter griff nach dem Kind, zwei einfache Männer mit Beamtenmützen zogen rauchend aus dem Stationshäuschen, der eine packte einen leeren Karren und schob ihn hinter die Kisten, die Burschen stürmten an, sie hatten hinten auf den Schienen den schwarzen anwachsenden Punkt entdeckt, polternd und rüttelnd kam er näher, die Lokomotive hob ihr schwarzes Eisenschild höher und höher, im Takt ihrer Stöße schmetterten die Gleise, dampfschleudernd rollte der Zug an, gewaltig, verlangsamte seinen Atem, schwer keuchend zwang er sich zur Ruhe, hielt knirschend.
Die beiden Bäuerinnen rieben sich die Waden, sie verzogen schmerzlich ihre alten verbrannten Gesichter. Ein Beamter rief den Namen der Station aus, winkte den Frauen, riß vorn am Zug eine Coupétür auf, die Kisten wurden nach hinten gefahren, die Bäuerinnen schleppten hinter der Frau einen schweren Reisekoffer her, der mit schwarzem Wachstuch bezogen war. Die Burschen kletterten zuerst rein, der jüngere kniete schon strahlend auf der Bank und sah zum Fenster hinaus. Die Mutter wanderte mit dem Kind langsam an. Man reichte ihr das Kind in den Wagen, alles hob und schob an dem Koffer, die Burschen lärmten nach den Kisten, aber die waren schon im Packwagen verstaut. Dann pfiff es, die Tür knallte, die beiden Bäuerinnen auf dem Bahnsteig traten zurück, die Zipfel ihrer Kopftücher zogen sie sich vor die Augen.
An ihnen vorbei schob sich das schwere Eisengehäuse und schnaufte hinaus. Sie sahen das selige Gesicht des kleinen Jungen und darüber das trübe verschlossene des älteren. Die Witwe saß auf der Mitte der Bank, stumm, das Töchterchen im Arm neben sich, Blumen und Taschentuch auf dem Schoß.
Dann lagen die blanken Schienen wieder frei. Die Bäuerinnen verließen den heißen Bahnsteig, zogen durch das mittagsstille Dorf, marschierten lange auf der gewundenen Chaussee, bis sie in die Felder einbogen. An einer kleinen Birkenschonung wanderten sie vorbei, an einer Wiese, einem Hof, dessen Tore weit offen standen. Enten schwammen in einem Tümpel daneben, aus dem Hof kam das Blöken von Rindern, Hämmern und Menschenstimmen. An der Flanke des Gutes, nach der Chaussee zu stand der zweistöckige Gasthof mit dem hohen roten Dach. Er war mit einem Gerüst verkleidet, leuchtete frisch weiß über die Schonung. Ein blaues Schild wurde grade über seinem Dach errichtet und trug zur Landstraße herüber strahlend die Goldbuchstaben: ›Zum Wiesengrund, Gasthof, Wirtschaft‹. Darunter bauschte sich ein Leinenstreifen: ›Neuer Bes zer‹.
Die, denen dieses Gut zuletzt gehört hatte, fuhren jetzt weit weg von hier, zwischen den endlosen hohen Getreidefeldern.
Im Grab auf dem Ortsfriedhof ließen sie zurück den Vater. Er streckte sich da so selig, wie er es Zeit seines Lebens zur Freude seiner Freunde, nicht immer seiner Familie getan hatte. Der Mann, von dem sie sich jetzt los rissen und dessen Lebensrechnung sie bezahlen mußten, war ein Unhold und ihrer aller Liebling gewesen. Er war ein korpulenter fröhlicher helläugiger Mensch, nur Pächter auf diesem Boden, aber eine Art Kavalier, ein unruhiger Geist, ein Gernegroß, ein Phantast. In zwei Tagen und zwei Nächten hatte er zuletzt sein Leben ausgelöscht, das diesen Inhalt hatte: ein kleines Pachtgut bewirtschaften, eine strenge wohlhabende Frau heiraten, drei Kinder erzeugen, einen unmäßig großen Hof kaufen und noch während der Neueinrichtung sterben. Er nahm seiner Frau das Geld ab unter der Drohung, sonst seines Weges zu gehen, hatte sich wenig um sein Stück Land gekümmert, nur mit unfruchtbarer Spielerei, Drechseln und Patentsachen beschäftigt. Von dem Geld der Frau kaufte er dann fröhlich und frei den verkommenen Herrenhof, ritt mit Freunden auf den Feldern herum, ließ Ställe abreißen, neue aufrichten, den zugehörigen Gasthof und die Wirtschaft renovieren, die Gerüste, die jetzt standen, hatte er mit aufstellen sehen. Er nahm Schulden über Schulden auf. Dann trug man den munteren Planer eines Morgens vom Feld herein, sein Nierenleiden hatte ihm den Streich gespielt, er lag im Kartoffelacker schräg unter dem Pferd, das Gesicht nach unten, einen Fuß im Steigbügel, das Pferd stand wiehernd da und drehte den Hals nach ihm. Zum Bewußtsein kam er erst am nächsten Morgen, da lächelte er die Frau in seiner herzlichen Weise an und fragte nach den Anstreichern. Er dämmerte noch zwei Tage und zwei Nächte hin und lag da mit einer aufmerksamen heiteren Miene, als ob er einer spaßigen Geschichte lauschte. Am zweiten Tage verstärkte sich dieser lustige pfiffige Ausdruck noch. So daß man, wenn man unvermutet ins Zimmer trat, den Eindruck hatte, der Mann spiele Theater, man brauchte nur etwas zu warten, dann wird er selber genug haben und loslachen. Aber ohne auch nur eine Bewegung zu machen, lag er genau so am dritten Morgen, jetzt aber starr und weiß, und hatte sogar das Atmen aufgegeben. Man konnte es nicht für möglich halten, daß man einen solchen Menschen gewissermaßen lebendig in den Sarg legte. Er war in seiner Art gestorben, ein Vogel, den man nicht fangen kann.
Im schüttelnden Eisenbahnwagen saß die Frau auf der Bank. Zwischen den gelben Getreidefeldern schnaubte der Zug, trug sie von dem Boden weg, auf dem sie geboren war und wo ihr ganzes Leben verlaufen war. Sie nahm mit die drei Kinder, ein gelähmtes Herz und die Armut. Sie hatte die erste Partie ihres Lebens verloren. Es war fraglich, ob noch eine zweite kam. Den Mann hatte sie geliebt, und die erste Zeit ihrer Ehe war wie in einer andern Welt. Dann zeigte sich sein Charakter. Er bürdete ihr die Wirtschaft auf, sie mußte es annehmen, sie wollte es ihm nicht schwer machen. Sie rang um ihn. Er sollte ihr die Freude geben, die sie nicht kannte. Aber es nützte nichts, sie lebte nur noch von den Brosamen, die er ihr zwischen seinen Spielereien und Vergnügungstouren zuwarf. Und zuletzt mußte sie ihm ihr Erbe, ihr Geld in die Hand drücken, geängstigt, er sollte es nur nehmen, wozu sei es denn da. Das Leben, was für sie Leben war, drohte endgültig an ihr vorbeizurauschen. Nach einigen herrlichen, fast taumligen Monaten mit Ausflügen in die Stadt, Fahrten auf Güter, Besichtigungen und Kalkulationen, nach der Abgabe der Pacht und dem Umzug – da lag er. So donnerte das Geschick. Nun war das Leben vorbeigerauscht. Als sie am Grabe stand, war ihr noch nicht alles klar. Sie dachte nur an ihr eigenes ersticktes Herz. Aber der Hof stand da, die schrecklichen Gerüste, die Fundamente der Ställe, die Maurer, Maler, neuen Maschinen. Es erschienen alle Menschen, die sie vor Monaten mit einladenden Mienen gesehen hatte, sie sprachen eine ungeduldige Minute lang ihr Beileid aus, dann nahmen sie die Maske ab und waren dürre Gläubiger, die Papiere aus der Tasche zogen. Die Schulden, die Schulden, die Schulden, jeder Klingelzug ein Gläubiger. Nachts lag sie schlaflos allein in dem großen Zimmer, klagte sich an, daß sie das Glück gewollt hatte, zerbiß sich die Finger, schämte sich, sie konnte es keinem sagen, sie war schuld an allem, jetzt mußte sie büßen. Hof und Wirtschaft gingen in andere Hände, eine kleine Summe hielt sie wie eine Wilde fest, aber der Kampf war noch nicht zu Ende. Sie wäre auch ohne den Hohn der Leute und die frechen Anschuldigungen gegen ihren Mann nicht hier geblieben. Sie wollte den Anblick dieses Ortes, diese Landschaft, diese Luft nicht mehr. Es war, sie gestand es nur sich, das Gesicht ihres Sündenfalles. Und der Zug nahm sie auf, sie floh, schwarz verhüllt, das Land, wo sie geboren war, Liebe und Glück gesucht hatte, und ging in die fremde Stadt, die Wüste.
Den Kopf am Fensterrahmen schlief in der Ecke der Ältere, Karl, den Strohhut auf dem Schoß. Er war so groß wie die Frau, über sechzehnjährig, rotbäckig, braunblond wie der Vater, mit dem gleichen runden weichen Gesicht, er atmete durch den Mund, sie sah seine Zahnlücke im Oberkiefer, da fehlten zwei Zähne, die hatte ihm der Vater ausgeschlagen, als er damals das Weite suchen wollte. Bei dem Streit hatte die Frau den Mann bei den Schultern angefaßt und ihn geschüttelt, damit er sich besinne, er hatte sie zurückgestoßen, da war mit einmal der Sohn, dieser junge Mensch, der nie etwas von den Streitigkeiten der Eltern bemerkt zu haben schien, todblaß und mit einem völlig irrsinnigen Ausdruck im Zimmer gewesen, hatte sich, ohne ein Wort hervorbringen zu können, vor dem Vater aufgepflanzt. Der sah verblüfft einen Augenblick in das fremde Gesicht, dann wischte er es mit einem Faustschlag bei Seite. Daß sie sich noch am selben Tag mit dem Vater versöhnte, hatte sie als Verrat an dem Sohn empfunden. Der sah es freilich anders, er war glücklich, daß die Mutter in seine Stube kam, ihm das Gesicht verband, ihn spülen ließ, ihn bedauerte, vor ihm weinte. Seit da war, ein Hoffnungsschimmer, ein Rückhalt, der Junge in ihren Gesichtskreis getreten. Es gab geheime Fäden zwischen ihm und ihr. Sein Kopf schaukelte jetzt am Fensterrahmen mit den Stößen des Wagens, ihr gemeinsamer Gegner war tot, aber wie merkwürdig, dieser Karl hatte am wildesten am Grab des Vaters geweint. In der anderen Ecke, dicht neben ihr, schlief der siebenjährige Erich. Auf der Bank ihr gegenüber, mit dem Mantel der Mutter bedeckt, die dreijährige Marie. Diese drei nahm sie aus dem Schiffbruch mit.
Ankunft
Es war Nacht, als sie in der großen Stadt ankam. Auf dem Bahnsteig empfing sie ein Angestellter ihres Bruders, ein grauer einsilbiger Mann, der bei dem Anblick der vier Personen, die sich aus dem Wagen entwickelten, stumm den runden steifen Hut hob, der Mann sah ziemlich schäbig aus, ein Gepäckträger griff zu, der graue Herr führte sie, ohne ein freundliches Wort oder eine Frage an die Kinder zu richten, gradeswegs zur Treppe und zu einer Droschke. Das schwere Gepäck, die Kisten, den großen Koffer würde er morgen abholen lassen. Die Kinder, aus dem Schlaf geweckt, entgeistert von der Weite des Bahnhofs, dem Lärm, der Menschenmenge, wollten nicht die Treppe herunter, er drehte sich um und pfiff, wie man Hunden pfeift. Sie ratterten durch helle und durch finstere Straßen, die Kinder hingen an den Scheiben, nur das Töchterchen weinte auf dem Schoß der Mutter. In einer breiten Straße, vor einem Haus, an dem eine rote Laterne brannte, hielten sie, der Mann schloß auf, sie stiegen vier enge Treppen hinauf, so hohe Treppen waren die Kinder noch nie gegangen, an dem Flur gab es viele schmale Türen mit Briefkästen, eine öffnete er, es war eine ganz kleine finstere und wüste Wohnung, die Küche gleich am Eingang, dann eine Stube. Der Angestellte, der den Hut aufbehalten hatte, steckte eine Kerze auf dem Küchentisch an, fand, daß es muffig roch und öffnete das Fenster, dann legte er die Schlüssel auf den Tisch, lüftete ohne ein Wort den Hut und ging. Die beiden Jungen, überwach, wollten noch im Finstern auf der Treppe spionieren, wieviel Stock das Haus hatte, die Mutter jagte sie in die Stube, sie mußten sich im Finstern ausziehen und auf die Matratzen am Boden legen. Gleich wie aber die Mutter mit dem Kind in der Küche verschwunden war, standen sie in Hemden wieder auf und quetschten ihre erregten Gesichter an das Fenster. Die schwarze Masse der Häuser mit den vielen stummen Fenstern, mit verschlossenen Läden zog sich wie eine einzige Mauer hin. Es war eine Riesenburg. Wenige Laternen brannten auf der Straße, in keinem Haus war mehr Licht, aber alle diese Häuser mußten voller Menschen stecken. Das war die Straße, oh welche große geheimnisvolle Stadt.
In der Küche hatte die Mutter das Kind neben sich gebettet. Als es schlief und sie seine Händchen von sich löste, setzte sie sich still am Boden auf. Sie saß lange. Langsam wurden die Konturen des Herdes vor ihr sichtbar, die Stuhlbeine neben ihr, das Handtuch quer vor das Fenster gespannt. Was auf dem Herd eine Rundung zeigte, war der Handkoffer mit dem Bügel. Morgen sollte sie hier für die Kinder kochen. Wie die Trümmer eines Schiffbruchs betrachtete sie alles, ohne Empfindung. Sie hatte vieles erwartet, dies betäubte sie.
Nach acht Tagen war die kleine Wohnung eingerichtet, die Betten aufgestellt, Gardinen gezogen, Stühle und Tisch standen mit einem Schein von Freundlichkeit in der Stube beieinander, eine Gaslampe hing von der Decke und streckte zwei Arme aus, nur in der Küche stapelten noch ungeöffnete Kisten. Da kam spät abends die Mutter wieder. Erich, der Jüngere, der schon in der Volksschule untergebracht war, lag im Bett in der Stube, die Mutter kam im Hut noch zu ihm herein, löschte das Licht aus und ging mit dem Älteren, Karl, in die Küche. Er fragte gleich: »Wo ist Mariechen?« Die Frau blickte sich in der Küche um, ja, da waren die Kisten, die das Kleine beklopft hatte, die aus dem Dorf mitgekommen waren, aus dem ›Wiesengrund‹, sie mußte sich setzen. Sie hob Hut und Schleier ab, legte sie vor sich auf den Tisch, saß, beide Arme aufgestützt, die kräftige Frau mit dem gescheitelten dunkelbraunen Haar, am Küchentisch, auf dem der Rest einer Kerze in einer Bierflasche flackerte. Der Junge sah sie ängstlich an. Ihr schwarzer Schatten stieg gebrochen über der Wand mit der Wasserleitung an die Decke. Da an der Decke hockte über dem Raum die finstere Erscheinung, sie lauschte, gebot dem Gespräch.
»Mariechen habe ich zur Tante gebracht. Sie haben ja kein Kind, Mariechen hat ihnen gefallen.«
Sie sah ruhig in die Kerze. Der Junge verstand nicht gleich, dann legte er das Kinn auf die Brust, sein Gesicht zog sich zusammen, er setzte sich stumm hin, der Mutter gegenüber, weinte in seine verschränkten Arme.
»Sie ist gern dageblieben. Was sie da gleich alles kriegt: so viel hat sie zu Haus nie gehabt. Und hier schon garnicht. Was sollen wir auch mit ihr. Wir haben ja alle keine Zeit. Ist ganz blaß geworden von dem vielen Rumschleppen auf der Straße, das Kleine.«
Der Junge hob den Kopf nicht. Die Frau redete weiter: »Hat keinen Zweck zu heulen, Karl. Damit kommen wir nicht weiter. Hier schon garnicht. Das wirst du noch lernen. Geschenkt wird einem nichts, du kannst froh sein, wenn du hier sitzt und sie dich leben lassen.«
Sie stieß über den Tisch seinen Ellbogen weg: »Nicht weinen, hörst du doch, Karl. Fang bloß damit nicht an, tust ihnen bloß einen Gefallen. Wenn du weinst, dann bist du schon reif für sie. Mußt dir ein Beispiel an mir nehmen. Ich weine nicht. Nein, ich nicht, bestimmt nicht. Räume den Tisch ab, fix, stell alles auf den Herd.«
Er arbeitete, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, das Gesicht glührot. Er wollte immer losplärren. Sie benutzte die Zeit, um angestrengt und kalt die braune Bierflasche zu studieren: »Marie ist weg und jetzt kommst du ran, Junge. Bleibt nichts weiter übrig, ihr müßt verdienen. Wir haben keine Zeit mehr. Was ich in der Tasche habe, kannst du nachzählen. Es reicht für ein halbes Jahr, aber sie haben es schon gerochen, ein halbes Jahr ist ihnen zu viel, die sind jetzt drauf und dran, uns das auch wegzunehmen. Keinen Pfennig sollen wir behalten, bloß betteln und weinen. Wenn es ihnen paßt, werden sie dann so gut sein. Die geben keinen Pardon. Die rechnen, bis ihre Sache stimmt. Kuck dich hier um, Karl, geht’s uns nicht schlecht genug, haben wir schon in solchen Löchern gesessen? In so einem Haus, ohne Licht, der Fabrikrauch weht einem ins Fenster, das wissen sie, ich sag’s ihnen jeden Tag, tut uns leid, liebe Frau, ja, liebe Frau sagen sie, die lieben Herren, aber Ordnung muß sein, wir müssen auch sehen, wo wir bleiben, und ziehen ihre Schulden ein, ziehen dir das Fell ab und verfluchen dich, weil du ein Betrüger bist, weil du nicht mehr hast. Da hab ich heut in einem Büro gesessen und hab alles gesagt und gezeigt, und habe geweint und geheult, bis sie mich rausgeschmissen haben, und sie verlangen Abzahlung, und nächstes Mal holen sie die Polizei.« »Wer ist es denn, Mutter?« »Für die bist du ein Knochen. Und einer beißt nach dem andern.«
Er räumte am Herd. Sie wartete, stierte in die Kerze. Es dauerte lange, bis sie wieder den Mund aufmachte: »Ich hab jetzt keinen andern, Karl, setz dich mal, du bist ja groß, du verstehst schon alles, ich muß mich mit einem aussprechen, du hast ja auch zu Hause alles gesehen, mit Vatern und mit der Versteigerung [mit dem hab ich auch kein Wort sprechen können, aber es ist nicht mehr auszuhalten, und wenn es die Wand ist, ich schreie]. Es muß mir einer helfen, es geht nicht so weiter« [sie blickte auf ihre geballte Hand, er hat mich im Stich gelassen, er hat mich ausgebeutet, nie war er für mich da, nie, nie, nun hat er mir das auch aufgehalst].
Und was der Schmerz nicht fertig gebracht hatte, tat die Wut, und sie brach, ohne die Haltung zu ändern, in ein störrisches Schluchzen aus. Der Junge kam herüber und faßte sie am Arm, sie wunderte sich nicht, sie duldete es. Zum ersten Mal ließ sie ihren Zorn los. »Hat alles keinen Zweck«, stammelte sie in ihr Schluchzen hinein, »nimmt einem doch keiner was ab [der Schuft, so läßt er mich sitzen mit allen Kindern, wenn es eine Hölle gibt, müßte er büßen], Menschen sind Verbrecher, das mußt du wissen, Karl. Was der Pfarrer dir in der Kirche sagt, kein Wort ist davon wahr, der redet das, weil er dafür bezahlt wird, das kommt aus seinem geschmierten Maul heraus, davon kannst du dir keine Semmeln backen, aber er hat seinen fetten Tisch, da setzt er sich dann hin, wenn du weg bist, und macht die Tür zu. Und dann geben sie dir Zettel, Ratschläge, immer einer an den andern, und jeder sagt ein schönes Wort oder ist nicht zu Hause, und dann kannst du rennen in der Hitze und sie sagen, Frauchen, wie sehen Sie aus, Sie müssen sich pflegen. Menschenschinder, Fellabzieher. Und lügen, und lügen, pfui.«
Ahnungsvoll, geängstigt stand der Junge mit einem Handtuch neben ihr und spannte die Ohren. »Wann komme ich in die Lehre, Mutter?« »Geld, Geld, Junge, nichts als Geld. Er hat mir meins durchgebracht. Sie pfänden uns alles weg.« »Wo soll ich denn hin?« »Geld, Geld. Die Stadt ist groß. Brauchst dich nicht zu genieren. Zugreifen. Ich weiß auch nicht.«
Sie bewegte den Kopf und sah den schweren schwarzen Schatten, gebrochen über Wand und Decke.
Er breitete ihre Matratze in der Küche aus. Dann wanderte er unsicher hin und her und legte, was er nie getan hatte, seinen Arm um den Hals der Mutter: »Kommen wir ins Gefängnis, Mutter?« Er sah ihr gehetztes Gesicht, es war schlimmer, als wenn sie den betrunkenen Vater zu Bett brachte. »Ich denke, Mutter, es wird schon gehen. Wenn sie uns nicht ins Gefängnis bringen, find ich schon Arbeit, ich nehm alles an. Onkel wird doch ein bißchen geben?« »Nichts vom Onkel. Geld, Geld.« Sie sah den großen Burschen an aus ihren irren Augen, eine Ertrinkende, dann schluchzte sie, und dann war ihr Gesicht wieder ganz starr. Er hatte Angst, wie sie so leer vor sich hinblickte.
Die Großstadt
Morgens brachte er den Kleinen zur Schule. Die Mutter hatte, wie er in die Küche kam, vergrämt am Gasherd gesessen, die Matratze stand schon an der Wand. So grau und elend war das Gesicht der Mutter, so still ihre Bewegungen, daß er, wie er den Jungen in der Schule abgegeben hatte, wieder nach Hause lief, zitternd die vier Treppen hinauf, was wollte er denn sagen, ach, er hätte kein Taschentuch, er hätte seinen Hut vergessen.
Sie war nicht in der Küche, sie lag in der Stube, auf dem ungemachten Bett des Kleinen. Sie raffte, als Karl aufklinkte, das Kissen beiseite und flüsterte: »Was ist denn?« »Ich hatte bloß meinen Hut vergessen.«
Der Hut lag auf einem Stuhl, Karl nahm ihn nicht. »Was stehst du rum?« »Steh doch auf, Mutter.« »Du sollst gehen, sag ich dir.« Er leise, ohne sie anzusehen: »Nein, ich geh nicht, du sollst aufstehen.« Sie fuhr hoch, hatte ihren strengen Ausdruck. »Ich geh nicht runter, Mutter, wenn du nicht aufstehst.«
Sie ließ ihre Beine herunter, faßte ihn um die Schultern, nahm im Gehen den Hut vom Stuhl und führte den Jungen umschlungen durch die Küche zur Tür. Die öffnete sie, schob ihn hinaus, stülpte ihm draußen den Hut fest auf den Kopf, gab ihm die Hand. Er sah sie bettelnd an. Wie sie ihn mühsam anlächelte, bezwang er sich und ging.
Draußen war es noch so heiß wie vorige Woche, als sie abfuhren. Das Mähen hatte er noch mitgemacht, jetzt wird wohl schon das Einfahren begonnen haben, das schöne große Gut, wir haben nichts mehr. Er stand vor der Haustür, was soll ich machen, Mutter weiß sich keinen Rat, sie hat den Kopf verloren, an wen soll ich mich wenden. Er setzte sich in Bewegung, marschierte los. Irgendwohin lief er. Die Menschen sah er an, bei jedem die Frage, wovon lebt der, wovon der, woher haben die’s. Woher hatte es der Vater. Wenn ich jetzt auf dem Land wäre, würde ich mich vermieten, jetzt ist viel Arbeit, warum ist die Mutter nur hierher gekommen.
Nach einiger Zeit hatte er die enge ärmliche Gegend seiner Straße hinter sich, ein anderer Menschenschlag ging hier herum, die Straßen waren oft mit Bäumen besetzt, es waren Alleen mit richtigen Bäumen, dann Plätze mit Kindern und Steinfiguren. Er sah sich um, blickte dahin, dorthin, dachte immer: ich muß zugreifen, ich muß was finden, wie machen sie’s nur. Aber wie war hier alles so bequem! Alles war da. Das Brot lag fertig in den Geschäften, grobes Brot, feines Brot, Kuchen, Semmeln, das hatte den ganzen schweren Weg hinter sich, da war schon alle Arbeit getan, das Jäten, Pflügen, die Aussaat, das Mähen, Einbringen und das Dreschen und die Mühle und der Handel mit der Genossenschaft und die Mehlsäcke und das Schleppen. Sie hatten nur damit zu tun, zu bakken, es süß und fein zu machen, zu bestreuen und in die Fenster zu legen. Manche Bäckereien hatten Marmortische und Stühle hingestellt, und da saßen schmucke Leute und vor die schoben Mädchen mit weißen Schürzen Kuchen und die fertige Sahne, das hatte viele Muskeln und Schweiß gekostet, die feine Sahne zu machen, das Warten der Kühe, das Futterfahren, das Melken, Kübelschleppen, das Dungabfahren und dann die Plage mit der Molkerei. Davon merkten sie hier nichts, die Leute bekamen hier alles vorgesetzt, sie saßen in den schattigen Läden, nippten an den blanken Löffeln, und nachher zogen sie das Portemonnaie und zahlten.
Lange stand der Bursche vor einer Konditorei. Zu Hause hatte ihr Bäcker auch einen kleinen Verkauf gehabt, aber das war eine Art Handwerker, der ihnen ein Stück Arbeit abnahm. Eine kleine mit Bäumen bestandene Grünfläche war in der Nähe, der Bursche setzte sich auf eine Bank, behielt die Konditorei im Auge. Da quälte man sich auf dem Land und hatte noch die Trockenheit und den Hagel und das Unkraut, das kümmerte sie hier alles nicht. Sie wußten vielleicht nicht mal, welche Arbeit es auf dem Land gab. Was sollte er hier mit seinen Muskeln? Zugreifen? Was denn? Über dem kleinen Platz an den Sitzbänken vorbei fuhr ein Mann einen zweirädrigen Wagen und rief Eis aus. Der und jener ließ sich die kleine Biscuittüte geben, Karl hatte keinen Appetit danach, er sah nur, wie alles reif vor die Leute geschoben wurde. Über ihm wölbte eine mächtige Buche ihr Laubwerk, ihre Blätter waren vom Straßenstaub bepudert, so zieht unsere Chaussee von der Bahn zu den Feldern, wir schinden uns und die haben’s gut und zu Hause liegt Mutter auf dem Bett und ich soll Geld verdienen.
Und die Ängstlichkeit setzte ihn wieder in Bewegung. Er ging. Woher haben sie’s nur. Aber da öffnete sich plötzlich die Straße wie ein Fluß, der ein Gebirgstal durchflossen hat. Die Straße nahm eine doppelte Breite an und war rechts und links besetzt von großen Geschäftshäusern, zwischen ihnen gab es Restaurants, die mit Wimpeln geschmückt waren, weiter hinten erhob sich weiß ein Denkmal mit vielen Figuren auf einem zurückgeschobenen Platz, das breite säulenverzierte Gebäude hinter dem Denkmal war ein Theater. Aber was Karl vor allem verblüffte, waren an der Ecke die beiden Kaufhäuser. Sie waren die ersten in der Stadt, ihr Erscheinen hatte die gesamte Kaufmannswelt in der Stadt heftig erregt.
Wie wuchtige Schildwachen in blitzender Uniform postierten sie schon an der Ecke. Die Magazine hatten eine riesige Breite, prunkvoll waren sie ausgestattet mit Fahnen, Girlanden und goldener Verzierung wie zu einem Jahrmarkt, Musik blies aus einigen Fenstern. Karl wollte noch darüber nachdenken, wie die Menschen in der Stadt zu Geld kämen, aber da war er in das verwirrende Abenteuer dieser Magazine gezogen und staunte und sah und ging herum. Die Riesenströmung nahm ihn auf. Es wurde ausgerufen, musiziert, gekauft. Tausend Dinge waren ausgebreitet von den Dächern bis zum Boden, und über den Boden quoll es bis zu den Bordschwellen vor.
Als der Bauernbursche, den Strohhut mit dem Trauerband in der Hand, die Stirn rot und schweißig, das zweite Warenhaus verließ, war schon Mittag vorbei. Er kam an einer engen wagenverstopften Hinterstraße heraus. Mühsam schlängelte er sich zwischen den Fuhrwerken hindurch. Durch die Hauptstraße fuhr die neue Straßenbahn, sie war elektrisch, Wagen fuhren auf Schienen unter langen Drähten, es war ganz unwahrscheinlich, wie sich das ohne Pferd bewegte, der Kutscher stand vorn an einer Kurbel, er stand gewissermaßen in der leeren Luft und drehte, es sah gradezu komisch aus, aber der Wagen bewegte sich doch. Hier in der Seitenstraße aber trabten noch die lieben alten Tiere, die Pferde, die braunen und schwarzen, die guten mit ihren stillen Augen. Im Herüberschlüpfen strich er einem über die Schnauze, du bist auch hier.
Und der junge Mensch, der Tag aus, Tag ein zehn Stunden mit allen Muskeln gearbeitet hatte, lehnte neben einem Zeitungsausrufer an der Häuserwand und fühlte sich müde, schlaff, verlangte Augen und Ohren zu schließen und sich auf den Boden niederzulassen. Weil das Schreien neben ihm ihn quälte, schleppte er sich noch ein paar Straßen weiter, der Lärm der großen Alleen und Warenhäuser schlug hier wie von einer fernen Schlacht herüber. Obwohl es übel roch, war es hier angenehm schattig, er war verwirrt, sein Gehirn beladen wie die Straße, wo die zwanzig Wagen sich ineinander verfahren hatten. Er putzte seinen Strohhut, setzte ihn sich auf, er hatte das mahnende schwarze Band gesehen, und ungeheuer weit lag irgendwo in dieser Stadt seine Mutter in einer Stube, den kleinen Bruder hatte er heute in die Schule gebracht, er war ausgegangen, um Geld, Geld zu verdienen.
Dieser Bursche, der jetzt den Bordrand entlang pendelte, den Blick zu Boden, hatte schon die hängenden müden Schultern vieler, die hier standen und gingen, sein Blick war glanzlos wie vieler, die hier suchten. Ein Eisenbrunnen stand an der Straßenecke, er trank das laue Wasser aus der hohlen Hand auf Vorrat. Dann merkte er, daß er Hunger hatte, sein Brot in der Tasche war dumpf geworden, er aß es im Gehen, keiner sah ihn an, keiner beachtete hier ja den andern, seine Schultern hoben sich wieder, seine Füße wanderten wieder dahin, von wo das dumpfe Tosen kam.
Noch einmal nahm er die prächtige Parade ab, sie war schwächer in diesen frühen Nachmittagsstunden, dann lief er über eine Stunde, bis er die schwärzlichen leeren Mauern, die ärmliche Straße fand, wo er wohnte. Hier war er also jetzt zu Hause, in einer Stadt mit Elektrizität und Kaufhäusern. Seine Augen blickten vertrauter auf die kleinen Lebensmittel- und Kohlengeschäfte hier. Ja, sie waren alle arm, sie waren aus derselben Familie. Er stieß die Tür zu dem dumpfen und dunklen Flur seines Hauses auf. Sein erster Gang in die Stadt war zu Ende.
Lächelnd schwatzten oben die Flurnachbarn mit ihm, von denen er den Schlüssel holte, die Mutter war nicht da, Erich war eingeschlossen.
In der frühen Dämmerung trat sie dann in ihrem schwarzen Kleid über die Schwelle, das Gesicht verhängt wie immer, und zog die Tür hinter sich zu. Er hatte erzählen wollen, wie er dem Kleinen erzählt hatte, der hatte den Mund aufgesperrt und gebettelt, ihn bald mitzunehmen. Aber die Mutter, furchtbar stumm, mit bleigrauem Gesicht, räumte, kaum daß sie Hut und Schleier abgelegt hatte, in der Stube auf, der Junge sprang hinzu, um zu helfen, sie wies ihn eisig in die Küche zu dem Kleinen. Als sie nachher hereinkam, stand sie mit dem Rücken zu ihnen am Herd. Da fürchteten sie beide zu gleicher Zeit, sie würde sie weggeben, wie sie Marie weggegeben hatte, und erst fing Erich am Tisch über seinem Schreibheft krampfhaft zu schluchzen an, dann zitterten auch Karl die Backen. Die Frau drehte das Gas ab, legte den Löffel hin und wandte sich zu ihnen. Sie schob das Heft beiseite, wischte dem Kleinen mit ihrem Taschentuch die Tränen, nahm ihn, als er nicht aufhörte, auf den Schoß, fragte ihn nach der Schule aus. Er beruhigte sich. Und als es dunkel geworden war, erlebte der Kleine sogar etwas, was ihm ganz neu war. Die Mutter legte ihm sorgfältig die Kissen zurecht und blieb bei ihm neben dem Bett sitzen, erzählte von Marie, die sie bald besuchen würde, und von ihren vielen neuen Spielsachen und in zwei Wochen würde Mariechen mit Onkel und Tante ans Meer fahren und da bekäme sie einen bunten Strandanzug und ihnen bringe sie auch was mit. Der Kleine erzählte wieder, was er von Karl gehört hatte, er gähnte, die Mutter blieb bei ihm, wie sie immer bei dem Töchterchen hatte bleiben müssen. Dann schlich sie in die Küche.
Karl hatte schon aufgeräumt, auch ihre Matratze ausgelegt, aus der langen Geschichte, die er ihr erzählen wollte, wurde nichts als: »Morgen geh ich wieder runter.« Sie am Tisch stützte den Kopf auf und gab keine Antwort.
Was Karl aber am nächsten Morgen erlebte, nach einer herrlich durchträumten Nacht, übertraf noch den vorigen Tag. Heute hatte er nur im Beginn, als er die Treppe herunterstieg, die Ängstlichkeit: ich soll Geld verdienen, ich muß mich beeilen, ich muß mich umsehen. Heute, nachdem er den Bruder in der Schule abgesetzt hatte, ging er auf die Wanderschaft, erst noch einmal in die Gegend der großen Magazine, dann irgendwohin. Es würde sich schon etwas finden. Er war in einem Durcheinander von Angst und Neugier.
Die Stadt versetzte ihn in Entzücken. Gott, ist das schön, daß wir hergekommen sind. Wenn ich mal hier unterkommen könnte, und wenn’s als Kohlenträger wäre! Er wurde heute noch tiefer in das Zentrum der Großstadt hineingetrieben, ein gewaltiges Geschrei lockte ihn vor ein breites niedriges Gebäude, auf dessen Steintreppen Menschenscharen brüllten, gestikulierten, und einige schrieben und plauderten, am First trug das Haus das Wort ›Börse‹. Nicht weit davon arbeiteten Scharen von Straßenkehrern; folgte man ihnen, kam man an einen Komplex dunkler Hallen, ihre Umgebung strotzte von Obst- und Gemüseresten und Zeitungspapier; Händler beluden ihre Wagen mit den leeren Körben und Kisten. Durch die weit offenen Tore sah Karl in diese abenteuerlichen Riesengewölbe, die nach vielen Dingen rochen. Dies sollten die Markthallen sein. Nachher lief er über eine Stunde, bis er auf breite stille Straßen kam mit vornehmen geschlossenen Wohnhäusern, es war, als ob hier noch alles schlief, nur Lieferanten und Dienstboten sah man, hinter den Gittern der Häuser lagen zierliche Gärten mit Kieswegen.
Und dann öffnete sich der Bezirk der Schlösser, Museen, Denkmäler. Nicht einmal nach den Bildern hatte er solche Herrlichkeit vermutet. In diesen starken Schlössern, vor denen Schildwachen auf und ab gingen, wohnte der König, die Königin, die Prinzen. Hier schlossen sich an die grauen einfacheren Gebäude, in denen – die Eingrabung über den Torbogen zeigte es an – Minister und Generäle ihre Arbeit für das Land taten. Die Generäle, die Staatsmänner, das waren die, die der König ernennt, die ihm dienen, ihr Leben weihen, die die Siege erringen und ihr Auge auf allen Dingen haben, und wenn sie tot sind, stellt man sie in Stein oder Bronze hin und in der Schule lernt man von ihnen. Eine ungeheuer weite, mit herrlichen Ulmen bepflanzte Allee zog sich mitten durch diesen Bezirk, den sich der Staat ausgesucht hatte. Wenn man von der Stadt durch eine der Hauptstraßen auf diese Allee stieß, hatte man eine breite Marmorbrücke, einen Platz und dann einen gewaltigen Triumphbogen zu passieren, auf dem die Siege des letzten Krieges mit Namen und Figuren eingegraben waren. Vor dem Triumphbogen ruhte ein mächtiger Steinlöwe, er war weit in den Platz vorgerückt und blickte von seinem Sockel einsam und gefährlich nach der Stadt herüber.
Lange stand Karl, während Schülergruppen, von Lehrern geführt, an ihm vorbeizogen, vor der Siegeshalle, bis er Mut faßte und auch hineinging. Ein weites Eingangsgewölbe mit Kanonen, Fahnen, dann rechts und links, von einer Marmorbalustrade eingefaßt, eine hohe Treppe, mit einem Purpurläufer belegt. Sie führte zu einem prunkenden Bildersaal hinauf. Da herrschte tiefes Schweigen. Ein alter Mann, ein Invalide in Uniform mit Krückstock, führte die Aufsicht. Erwachsene und Kinder drängten sich ehrfürchtig vor den Riesenbildern von den Schlachten und Triumphen.
Karl steht vor einem Schlachtenbild und ist überwältigt von den prunkenden Farben und dem, was da vorgeht. Er sieht einen König mit langem Bart auf einem edlen weißen Roß, er ist umgeben von Generälen und Fürsten, die alle bestaubt sind. Sie halten auf einem Hügel, eine Königsfahne weht hinter ihnen. Den Hügel aber geht ein einzelner Mann hinauf, den Kopf bloß, man kennt sein trauriges Gesicht, es ist auch ein König, in blanken kleinen Schuhen geht er, die hinten silberne Sporen tragen. Es ist der Besiegte. Was von ihm übrig geblieben ist, sieht man, die umgeworfenen Kanonen zur Seite, die brennenden Häuser hinten. Das war sein, das und das geschlagene Heer, das man nicht sieht, hat er eingesetzt. Er will seinen Degen dem Sieger auf dem weißen Roß übergeben.
Maßlos breit bedeckt das Bild die Längswand, die Menschen stehen stumm davor, sie atmen kaum, das Bild springt sie an. Sie kriechen mit dem einsamen Besiegten den Hügel hinauf, demütig.
Als Karl sich abwendet, sieht er in der Mitte der Halle einen schmalen Marmorsockel und darauf erhebt eine Steinfigur mit einem stolzen Marschallstab die Hand. Das ist wieder der große König, der Sieger, er ist überall, alles lebt in seinem Reich, es geht von Meer zu Meer, er hat sich alles untertan gemacht.
Scheu geht Karl um den Sockel herum. Er lugt noch einen Augenblick in den angrenzenden Saal, wo in einem Glasschrank das weiße Lieblingspferd des Königs ausgestopft steht. Er hat jetzt nicht seinen Bauernblick für das Pferd. Dies Pferd ist ein gewaltiges Wesen, das zu den Generälen und Fürsten gehört und mit keinem Gaul zu vergleichen ist.
Erschüttert und geheiligt verließ unser Wanderer dieses weite Quartier der Schlösser, das wie eine Insel und eine Festung in der Mitte der Stadt lag, reiche Parkanlagen schlossen sich nach der an dern Seite an. Das weltliche Treiben um die Geschäftshäuser berührte ihn heute wenig. Und wie er am Spätnachmittag nach Hause kam, war die Mutter zu Hause geblieben und machte mit dem Kleinen Schularbeiten. Sie setzte ihm zu essen vor und sah ihm mit einem merkwürdigen Lächeln zu, das ihn beunruhigte. »Und wo bist du gewesen, Junge?« Obwohl ihm das Wort in der Kehle stecken blieb – er dachte, ich komme drüber weg –, fing er an von den Schlössern zu sprechen, die es in der Stadt gab, Erich spitzte gleich die Ohren, die Mutter lächelte, er solle nur weiter erzählen. Aber es ging schlecht. Wenn er mit Erich allein wäre, hätte er alles sagen können. Da fing die Mutter an, immer mit dem peinlichen Blick, ihn stückweise nach den Schlössern auszufragen, sie hätte noch keine Zeit gehabt hinzugehen, und da sprach er von dem Triumphbogen mit dem Wagen darauf, und von der Siegeshalle und der großen Treppe. Aber nichts stimmte recht. Kopfnickend und nun deutlich höhnisch fragte sie nach den Bildern. »Hat’s keinen Eintritt gekostet?« Er verneinte. Sie lachte auf: »Das glaub ich dir! Da lassen sie dich rein. Damit du sie bewunderst. Wenn wir lange hier sind, werden wir auch Steuer dafür bezahlen dürfen.« Er legte den Löffel hin. »ISS nur ruhig auf, Karl, von mir kriegst du Suppe, von ihnen kriegst du nichts, nur schöne Worte, oder Bilder, das kenne ich. Na, hast du etwa heute ein Stück Brot gekriegt?« »Aber das sind doch die Schlösser.« »Versuch mal da von ihnen ein Stück Brot zu kriegen, da werden sie dir kommen.« »Da sind auch keine Bettler, Mutter.« »Glaub ich. Die kommen garnicht erst rein. Na, hast du etwa was geschafft?« Ihm stiegen die Tränen in die Augen. »Ich weiß doch nicht, wie ich’s machen soll.« »Geht mir ja grade so, Junge. Wir sind hier ganz überflüssig. Die brauchen uns nicht. Die wirtschaften, und was ein armer Mensch ist, soll seiner Wege gehen.« Er hielt sie bei der Hand fest. »Ich verdiene doch bald was, Mutter.« »Mit Bilderankukken.« Er bekam Mut: »Komm doch mit, Mutter.«
Eine schlimme Nacht
Es gelang ihm wirklich, die Mutter zu einem Spaziergang in die Stadt zu bewegen. Sie war schon, als er sich zur Begleitung des kleinen Erich zurechtmachte, angezogen, sprach nicht, räumte den Tisch ab, war im Begriff, den schwarzen Hut und Schleier aus dem Schrank zu holen, als er sich umdrehte, Erich an der Hand, und die Mutter fragte, ob sie nicht heute mit ihnen kommen wolle. »Erst bringen wir Erich zur Schule, dann gehen wir in die Stadt.« »Wozu«, fragte sie und zog sich den Schleier vor ihr hartes Gesicht. In keinen Spiegel sah das Gesicht, seit der Mann tot war. Alt und leblos war es geworden, eine lebende Gruft war sie hinter ihrem Schleier geworden. Er war kühner, seit sie ihn eingeweiht hatte: »Uns begleiten, Mutter, dann spazieren wir in die Stadt, und ich zeige dir was.« Sie stand. Drückte fest seine Hand. Die Mutter stopfte Papiere in ihre Tasche: »Geht doch schon.« Karl ließ den Kleinen los, stellte sich neben sie: »Komm mit, Mutter. Einen Tag kannst du dir gönnen.« Da wurden ihre Hände plötzlich still, ließen die Tasche los, die Rechnungen fielen auf den Tisch, sie sagte tonlos, ihr Gesicht war nicht zu sehen: »Einen Tag? Alle Tage. Ich lauf ja auch heute wieder umsonst.« Sie sank auf einen Stuhl. Er zog an ihr: »Komm, es ist Zeit für Erich.« »Geht.« »Komm.« Er streichelte ihre Hand, packte entschlossen die Papiere in die Tasche, dann faßte er – was war in ihn gekommen – die Frau um die Schultern – wann hatte sie einer so um die Schultern gefaßt, wie lange war das her, mit Staunen nahm sie’s wahr – und suchte sie hochzuheben. Und als es nicht gelang, rief er Erich: »Komm, du hilfst, Mutter kommt mit.« Und so von beiden Seiten gehoben und geschoben, von einem festen Arm um die Schulter, der den starren Schleier zerknautschte, und zwei Kinderhänden, die an ihre Hüfte stießen, mußte sie sich bequemen, halb fallend, sich aufzurichten und schließlich aufzustehen. »Ach Gott«, sagte sie und wehrte den Kleinen ab, der noch weiter stieß, »wie richtet ihr einen her.« Da hatte sich Karl ihre Tasche unter die Achsel geklemmt, nahm sie beim Arm, der Kleine hängte sich vergnügt an der andern Seite an, und so wurde das schwere Schiff durch die enge Tür bugsiert. Sie wollte noch einmal zurück, um Wasser zu den Kartoffeln zu gießen. Aber sie hatte keinen Willen mehr und stand auf der Treppe. Karl schloß ab. Ihre Gedanken, aber es kam zu keinen deutlichen Gedanken, waren: Da steh ich, warum auch nicht, gut, daß einen einer zieht und stößt.
Sie gingen durch die morgendlich hellen Straßen. Die Stadt war ein merkwürdiges Uhrwerk; auf ein bestimmtes Signal, zu einer bestimmten Zeit surrte eine Partie nach der andern los und setzte sich in Trab. Die Straßenreiniger begannen, dann räumten die Arbeiter an den Schienen der Elektrischen die Strecke, dann fuhren Gemüsewagen, die Bettler auf den Schwellen und in den Torbögen drehten sich um und sahen, es war wieder Tag, sie würden weggescheucht werden.
Jetzt klingelten die Elektrischen, waren voller Leute, die zur Arbeit wollten. Aber sie drei wollten nur spazieren. Und als Erich in der Schule abgegeben war, nahm die Frau Karl ihre Handtasche ab, sie ging nicht zu den Leuten, heute würde es nicht Betteln und Barmen geben, sie spazierten, ja spazierten. Und als ob das noch zu unterstreichen wäre, blickte sie an einer Haltestelle ein Herr an, so daß sie zurückfuhr, es war ein Angestellter einer Baufirma, der sie etwas schuldete, er erkannte sie, grüßte: »Wenn Sie etwa heute zu uns kommen wollten, mir fällt ein, wir haben Sie irrtümlich bestellt, der Chef hat eine Reise vor.« Sie stand – Karl beobachtete sie bestürzt – mit stockendem Atem, rote Flecken stiegen an ihrem Hals hoch, ihre Backen bekamen rote Flecken, sie stammelte etwas, bat um Entschuldigung. Aber es war doch nichts zu bitten! Karl nahm rasch die Mutter beim Arm und ging mit ihr, wie war sie zerstört, wie fiel sie vor diesen Leuten hin, war es denn so schlimm, aber es konnte doch nicht so schlimm sein, denn der Mann hatte sehr höflich gesprochen, und sie benahm sich wie ein Verbrecher, ein Angeklagter. Er war bedrückt, rasch weg führte er die Mutter von der Stelle, sie sollte die lustigen lauten Straßen sehen.
Wir kennen diese Straßen und Magazine. Die Frau hatte schon oft durch diese Gegend gemußt. Um Gotteswillen, was sollte sie hier, warum zeigte er ihr das? War das ein Bösewicht, ein Niederträchtiger, der sie noch verspotten wollte? Sie fühlte ihre Schritte nicht unter sich, sie sah aus den Wolken dies alles, die hastigen fröhlichen Menschen, die glitzernden Auslagen. Alles in eins. Das Reich der Erde und ihre Herrlichkeiten. In dieses Glück-Unglück war sie vor Jahren mit ihm gefahren, der jetzt tot lag, aus ihrem Leben durch einen eisigen Spruch weggerissen, hier war auch er mit ihr gegangen, der Junge, der sie am Arm führte, blickte genau so fröhlich hell, strahlte genau so offen vor sich. Sie horchte auf ihn, sie zwang sich, ihn so zu hören, wie sie wollte, in seiner Stimme klangen Töne von dem Andern. Sie krampfte sich fest an seinen Arm, er hielt es für einen innigen Gruß und streichelte ihre Hand, sagte leise: »Mutter.« Ach ja, Mutter, es hat sich bald ausgemuttert, ich hab nichts mehr zu suchen auf eurer Welt, ihr werdet es ohne mich besser haben. Ich werde nicht mehr betteln gehen.
Und wie er sie durch die fröhlichen Straßen führte – er wollte sie doch zerstreuen –, wurde ihr klarer, als wie sie zu Hause saß: Ich kann nicht mehr! Ich kann den Schlag, der auf mich gefallen ist, nicht aushalten! Es ist Wahnsinn, daß ich mich hier noch bewege. Ich will das alles nicht mehr leiden.
Ich will – das alles nicht mehr.
Es ist stärker als ich. Ich habe die langen Monate ausgehalten, ich habe die langen Jahre ausgehalten mit dem Mann, an mir ist nichts mehr heil, ach, ich darf doch ausweichen.
Da ließ der Krampf nach, der Entschluß tat ihr wohl, sie lüftete den Schleier vor ihren Augen, fühlte wieder ihre Schritte. Und da ging plaudernd Karl, den Strohhut auf dem Kopf, neben ihr, und sie sah ihn an, kalt und fremd prüfend, wie sie ihren Mann angesehen hatte, den Strolch, wenn er von einer Lumperei heimkam. Dieser Karl, ja, er war aus seinem Blut, ein Kindskopf, ein Schwärmer, wen wird er einmal unglücklich machen, welche Frau, welche Kinder.
Sie machte sich von seinem Arm los, trat mit ihm an ein Schaufenster, sie mußte hart und scharf mit ihm sein, sie müßte ihn fühlen lassen, wer er war. »Wo ist also das Schöne an diesen Knabenanzügen da? Wie gefallen sie dir, he? Ich will dir sagen, an denen ist nichts. Nichts ... Das ist teuer. Das ist schlechte Ware wie alles hier. Die Leute fallen darauf rein. Hier ist alles Betrug, für die Augen, sie machen den Leuten was vor, Gimpelfang. Verstehst du?« Er verstand nicht, die Mutter war ärgerlich. Sie zogen noch stumm eine Weile durch das Gedränge. Es war ein Lärm. Sie nickte: »Hörst du, wie die Leute schreien müssen, um zu ein paar Pfennigen zu kommen?« Er sah sie hilflos an, was wollte die Mutter von ihm, er wollte sie doch zerstreuen. Er wollte sie aus dem Gedränge heraussteuern, aber mit einer inbrünstigen Gehässigkeit blieb sie grade hier, sie atmete stärker. Bis sie an einen weiten Platz kamen, wo die großen Geschäfte aufhörten, da stand eine mächtige altersgraue Kirche mit einem ungeheuren Turm. Die Kirche läutete grade aus irgend welchem Grund, die Tore standen offen, einige Menschen gingen hinein. »Willst du nicht hineingehen, Karl?« »Warum?« »Mußt ihm doch danken für unser Leben. Er hat alles gemacht, wie es ist, und es ist gut, du sagst es doch.« Er murmelte, ein Windstoß wollte ihm seinen Hut abwehen: »Mutter.« Er dachte an den Vater, und wie hilflos er war, was sollte er mit der Mutter tun. Sie wanderten auf Seitenstraßen zurück. »Sei nicht böse«, flüsterte einmal die Mutter und legte wieder ihren Arm in seinen. Er führte sie nach Hause, sie kam, von einer Müdigkeit befallen, zuletzt nicht von der Stelle. »Ich schlafe fast ein«, lächelte sie den Jungen an.
Und in dieser wattedichten Müdigkeit, die sie den Tag über nicht losließ, verabschiedete sie sich am Abend von den Kindern, die sie freundlich behandelt hatte, und zog sich gähnend in ihre Küche zurück. Da saß sie freundlich vor der weißen neuen Kerze, gähnte viel, war wie narkotisiert. Schließlich holte sie, immer wie träumend, von dem Geschirrahmen einen Bleistift und das Notizbuch herunter und schrieb am Tisch gähnend und in einem ungewohnten Wohlbefinden:
»Lieber Oskar [das war ihr Bruder], wo ich nun nicht mehr bin, wirst du dich wohl der beiden Jungen annehmen. Ich dank dir und Lippchen, daß ihr so gut zu Marie seid. Deine dankbare Schwester.«
Das Blatt riß sie heraus, kniffte es sorgfältig, liebevoll und schrieb außen die Adresse des Bruders auf. Und dann löschte sie das Licht, rutschte mit ihrem Stuhl zum Herd, zog den Gasschlauch vom Rohr und drehte das Gas auf. Das Gas wehte gegen ihr Gesicht, es roch häßlich, sie ließ es sich in den Mund strömen, schluckte, ihr wurde übel, ihre Ohren klangen, ihr Kopf wurde groß, immer größer, unheimlich groß, sie wollte würgend den Schlauch bei Seite schieben mit ihren Händen, die plötzlich riesengroß und weich geworden waren.
In der zweiten Hälfte der Nacht [der Tag war heiß gewesen, es dämmerte] gab es ein Gewitter. Die Jungen flüsterten von Bett zu Bett miteinander. Der Kleine, dem man auf dem Land Angst vor Gewittern eingeprägt hatte, fing an zu weinen. Der Größere stand auf, suchte ihn zu trösten, der Kleine wollte zur Mutter. Karl flüsterte, es sei noch so früh, man könne sie nicht wecken. Der weinte unverändert weiter. Da zog sich der Große Hosen und Strümpfe über, wartete noch etwas, ob sich der Kleine beruhigte oder der Sturm nachließ, dann schlich er in den langen Korridor und horchte an der Küchentür, ob die Mutter nicht auch aufgewacht war von dem Donner, vielleicht hatte sie den Erich auch schon selber gehört. Er ließ die Tür zum Zimmer offen, damit sie das Schluchzen des Jungen hörte. Aber, er hatte es am Anfang nicht beachtet, was war das nur, es roch so eigentümlich, er schnüffelte Gas. Er lief in die Stube zurück, bei ihnen war es nicht, er riß, obwohl der Kleine stärker brüllte, in der Stube die Fenster auf, der Sturm blies die Vorhänge hinein. Er rannte erregt in den Korridor zurück, schloß leise die Wohnungstür auf, schnüffelte auf dem Korridor, auf der Treppe, die im Morgendämmer schon ihre Stufen zeigte: nichts, von hier kam es nicht. Wieder in den Korridor zurück, die Wohnungstür offen gelassen. Sein Grauen: der Geruch kam aus der Küche! Die Mutter hatte das Gas aufgelassen! Die Mutter meldete sich nicht!
Er klopfte gegen die Tür: »Mutter!« Er klopfte im Augenblick mit beiden Fäusten, er schrie: »Mutter, wach auf.« Der Kleine im Zimmer wurde still vor Angst. Karl schlug gegen die Tür, er brüllte: »Aufmachen, Mutter, es ist Gas, Mutter.« Draußen auf der Treppe gingen Türen, man klopfte gegen die Wand. Wie ein Besessener, weinend, schreiend, tobend arbeitete der Junge gegen die Tür, lief auf den Flur: »Hilfe, kommen Sie, die Tür geht nicht auf, Mutter hat das Gas aufgelassen.« Die Nachbarfrau, in Hemd und Unterrock, erst mürrisch, holte ihren Mann, vom fünften Stock kam ein Mann mit einer brennenden Kerze herunter, die Hosen hatte er an, die Hosenträger, nur hinten befestigt, hielt er mit der Hand nach hinten fest, schimpfte im Heruntersteigen, torkelnd: »Also das ist eine Schweinerei, das soll Sie aber eine Stange Geld kosten, die Leute vergiften einen«, und wollte, benommen wie er war, erzählen, wie es ihm in der Nacht gegangen war, daß er zweimal gebrochen hatte, aber er hatte überhaupt nicht gebrochen, ihm war nur übel gewesen, und seit gestern abend Schlag neun Uhr hatte er den Geruch gemerkt, obwohl er die Fenster sperrangelweit aufgerissen hatte, die Dielen in diesem alten Haus sind natürlich undicht, da war er aber, statt von seinem Kummer zu erzählen, in einen großen andern hineingerissen worden. Man blies ihm unten gleich das Licht aus, wie kann man so leichtsinnig sein, da können wir alle in die Luft fliegen, das merken Sie doch, daß hier Gas ausströmt. Zu dritt, zu fünft drängten sie sich in dem engen kurzen Korridor, die Treppenfenster rissen unten welche auf, neben dem Flüstern und Reden hörte man das Türschlagen und schluchzende Schreien des Jungen, dem sich jetzt auch das Klagen des Kleinen in der Stube beigesellte. Dann drängte sich ein älterer großer Mann, ein Arbeiter in der Mütze, der schon fertig angezogen war und seinen Fabrikgang antreten wollte, zwischen die Leute, er hatte ein Küchenbeil in der Hand, den Jungen schob er bei Seite, versuchte erst mit seinem Rücken die Tür aufzustoßen, dann sagte er: »Alle weg aus dem Gang«, nahm das Beil und schlug Füllung auf Füllung heraus, preßte mit dem Knie und einem Fußstoß unter Krachen das Mittelkreuz durch und stieg in die Küche, während alles auf dem Gang zurückwich unter dem Anhauch des Gases.
Es war ganz still drin. Man hörte den Mann durch den Raum laufen, Fenster aufreißen, dann bewegte er sich, kam aber nicht heraus. Dann hörte man ihn sprechen und fragen: »Na, na?« Aber es war nur seine Stimme ohne Antwort. Die Nachbarsfrau hielt Karl zurück, der, beide Fäuste vor dem Mund, wimmerte und stöhnte. »Du bleibst hier, Junge, ist nichts für dich.« Der Arbeiter rief aus der Küche: »Ein Mann rein, anfassen helfen.« Derselbe, der vorhin geschimpft hatte und noch immer die Hosenträger in der Hand hielt, knöpfte sie sich an, drängte sich durch den Korridor, na, wer steht denn hier alles, sie arbeiteten drin langsam, schleiften etwas über den Boden, dann lief die Wasserleitung, der alte Arbeiter rief: »Einer muß zur Feuerwehr oder Rettungswache, aber fix.« Mehrere setzten sich auf der Treppe in Bewegung. Dann wurde endlich Licht in der Küche, sie hatten die Kerze angesteckt, die beiden Männer erschienen im Türrahmen und der ältere sagte: »Der Gashahn war losgegangen, aber das Fenster war offen oben.« Karl hob die Hände zur Brust des alten Mannes: »Was macht meine Mutter, was macht –?« »Ich bin kein Doktor, Junge. Sagen kann sie jedenfalls nichts. Na, wenn man stundenlang in der Luft liegt. Der Herr hier hat schon Kopfschmerzen, wo er ein Stock höher wohnt.« Karl bettelte: »Ist nichts passiert?« »Junger Mann, Sie haben einen festen Schlaf, daß Sie das nicht riechen.«
Das Gaslicht auf der Treppe brannte, schreckliche Minuten verliefen, dann rasselte ein Wagen vor, zwei Männer kamen die Treppe heraufgerannt, Feuerwehrleute drangen in die Stube, einer rannte bald wieder zurück, die schwarze Sauerstoffbombe wurde angeschleppt, die Wohnungstür blieb offen, die Treppe war von Menschen belagert, die sich flüsternd unterhielten. Nach einer halben Stunde erschien ein Doktor, er war ein paar Minuten in der Küche, dann hörte man das gelle Schreien der Frau, erst nur »Ah, ah«, dann »ich will nicht, ich will nicht.« Das Schreien gellte durch das ganze Haus, die Kinder auf der Treppe sahen zitternd die Großen an. »Ich will nicht, ich will nicht mehr, laßt mich zufrieden.« Die Frauen wischten sich die Augen und nickten trübe.
Man machte den beiden Feuerwehrleuten Platz, sie kamen mit einer Tragbahre wieder, die Nachbarn zogen Karl zu sich in die Wohnung hinein, man trug die Frau herunter. Sie lag bis über den Kopf zugedeckt und stöhnte unter der Decke: »Ich will nicht, ich will nicht mehr«, immer dasselbe. Die Menschen, an die Türen gedrängt, hörten es mit Furcht. »Sie muß nicht richtig sein, es ist das Gas, paß auf, sie tragen sie in eine Anstalt.«
Inzwischen hatten die Nachbarn den kleinen Erich zu sich genommen. Karl rannte am Morgen mit dem Zettel der Mutter zu dem Onkel. Der hatte seine Wohnung nicht weit von ihnen, in einem der Hinterhöfe war seine Möbelfabrik, er wohnte in dem gewaltigen Vorderhaus im zweiten Stock. Als Karl auf dem blanken Messingschild draußen seinen Namen sah, den Mädchennamen seiner Mutter, brach er in Tränen aus, schluchzend fragte er nach dem Onkel, das Mädchen ließ ihn auf der Treppe stehen, dann blickte jemand durch das Guckloch, die Kette war vorgeschoben, eine dicke Frau mit unordentlichem Haar im geblümten Morgenkleid sah durch den Türspalt und fragte, was er wolle. Weil er nicht sprechen konnte, schob er das Blatt Papier hinein. Die Tür wurde darauf zugemacht. Die Frau entfernte sich.
Plötzlich wurde drin eine Tür aufgerissen, jemand schimpfte, brüllte, humpelnd im Galopp näherte er sich, schleuderte die Kette ab, riß die Tür auf, ein kleiner Mann mit einem kurzen Bein in Hemdsärmeln stand vor Karl, er hatte ein viereckiges blaurotes Gesicht, die grauen Schnurrbarthaare sträubten sich, er packte mit der linken Hand Karls Arm: »Wer hat dir den Zettel gegeben?« Karl gluckste: »Ich bin ja Karl. Auf dem Tisch.« Mit einem Ruck zog der Mann den Burschen in den Korridor, auf dem nebeneinander die dicke Frau und das Mädchen standen. Die Tür krachte. »Wo ist Mutter? Was ist mit ihr?« Der schiefe Mann glotzte Karl an, er hatte eine merkwürdige Gebärde, die linke Hand hochgehoben, als wenn er auf Karls Hals zustoßen wollte. Den braunen Kopf auf die Brust gesenkt, weinte Karl bitter und ließ die Tränen über sein Gesicht fließen: »Im Krankenhaus.« »Sie lebt?« Karl schluchzte und nickte. Der Mann nahm die Hand herunter: »Na also. Na also. Ein Schreckschuß. Ich bin noch ganz erschrocken.« Die Frau an der Tür sagte: »Gottlob. Gottlob. Ich bin auch ganz erschrocken.« Das Dienstmädchen weinte in ihre Schürze hinein. »Na, nu mal rein«, damit humpelte der Onkel, dessen Hinterkopf eine fette Glatze bedeckte, den langen Läufer des Korridors entlang. Scheu sah das Dienstmädchen Karl an sich vorbeigehen. In dem schmalen, dick von unförmigen Möbeln vollgestopften Eßzimmer unter einer Gaslampe setzten sie sich hin, für zwei Personen war gedeckt, das Mädchen brachte eine Tasse für Karl. Und da saß er, wischte sich das Gesicht, und das war der Morgen nach der Gewitternacht und nachdem die Mutter das gemacht hatte. Er mußte Kaffee trinken, sie sprachen ihm zu, lobten den Kaffee, die Frau ließ sich Brotscheiben rösten. »Es geht jetzt fix mit dem Rösten, das Mädchen versteht sich jetzt endlich darauf«, meinte sie zu dem Mann, und dem Burschen erklärte sie: »Ich muß nämlich immer Brot rösten, wir vertragen beide das frische Brot nicht. Woher kommt das eigentlich, daß hier das Brot einen so auftreibt? Du bist doch halber Bauer.« Der Mann kaute: »Laß ihn zufrieden, das kann er dir ein andermal erzählen.« Darauf aßen und tranken sie schweigend, sehr langsam, sehr aufmerksam, ermunterten häufig Karl, lobten die Marmelade. Die Frau blickte Karl an: »Wie einen sowas trifft. Ich kann mich noch immer nicht erholen.« Auch der Mann nickte. Die Frau wischte sich den Mund. »Hast du gesehen, Oskar, die Anna hat geweint, sie ist ein gutes Mädchen.«
Karl trank. Wann würde er aufstehen können. Plötzlich äußerte der Mann nach andachtsvollem Kauen: »Man könnte eigentlich mal bei dem Krankenhaus anfragen, wie es ihr geht.« Die Frau fuhr hoch: »Ich denke, es geht ihr gut?« »Na ja, man muß sich aber erkundigen.« Darauf hinkte er, den Mund noch voll, aus dem Eßzimmer, Karl und die Frau, allein gelassen, saßen sich gegenüber hinter ihren Tassen, warteten und sagten kein Wort. Vom Korridor her hörten sie dann bald das Stampfen des Mannes und sein beruhigendes »Also, also.« Er trat ein: »Also, also. Alles halb so schlimm. Der Doktor ist nicht da. Die Schwester meint: wir sollten uns nicht Sorge machen, bloß keine Sorge, es ist eine leichte Leuchtgasvergiftung – Leuchtgasvergiftung sagt sie –, das gibt sich schon.« Er hatte aber keinen freundlichen Ausdruck, er blieb hinter dem Stuhl der Frau stehen, flüsterte mit der Frau, Karl schnappte einiges auf: »Einer soll hinkommen, nähere Angaben machen, die Polizei will auch wissen –« Er wandte sich verstimmt an Karl: »Wo ist denn der Andere, ihr seid doch zwei?« »Nein, wir sind drei. Die Marie hat doch Mutter weggegeben.« Er hatte wahrhaftig nicht gedacht, daß die kleine Schwester hier im Haus lebte. »Das wissen wir. Soll aber noch einer da sein, ein Junge.« »Der ist bei den Nachbarn.« »So. Also, ich habe den Vormittag zu tun. Dann gehst du ins Krankenhaus, Lippchen, der Karl kann dich begleiten.« Er war wütend, setzte sich gedankenlos an seine Brotschnitte. Lippchen bat: »ISS langsam, Oskar, schling nicht, es bekommt dir nicht.« Sie sah vorwurfsvoll Karl an. Die große Standuhr schlug volltönig metallisch acht Uhr, Karl fiel ein, heute bringt keiner den Kleinen zur Schule, er hat ja auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Der Mann stand auf, wischte sich mit der Serviette den Mund, dachte nach: »Also schreib mir mal genau eure Adresse auf, und mit der Polizei, das mache ich schon. Haben die denn meine Adresse gelesen auf dem Brief?« Der Junge war auch aufgestanden, nur die Frau trank noch und schenkte sich frisch ein. Karl schüttelte den Kopf: »War kein Schutzmann da, nur die Feuerwehr.« »So, so.« Und finster humpelte er hinaus, ließ Karl und die Frau zurück, die trank und vorwurfsvoll, ja anklagend Karl anblickte. Wie sie das Türwerfen des Alten hinter sich hatten, sagte die Frau: »Aufregungen am frühen Morgen verträgt der Onkel schon gar nicht. Das schlägt gleich auf seinen Magen, und gar die Polizei.«
Darauf erschien Anna, um abzudecken, und bei ihrem Anblick stieß die Frau Karl an: »Na, nun erzähl uns noch mal, wie’s gewesen war. Nachher gehen wir ins Krankenhaus, wir nehmen auch ein paar Blumen mit.« Das Wasser trat ihm in die Augen, die Frau erklärte dem Mädchen: »Sie sind alle zusammen vom Land, seine Mutter ist die Schwester vom Herrn, wenn Leute vom Land in die Stadt kommen und es ist kein Mann dabei, dann geht das eben nicht einfach.« »Ach, was hab ich mich verlaufen die erste Zeit«, bestätigte Anna mitleidig. Darauf nötigte Anna wieder den Burschen, sich zu setzen, es wird ja doch noch dauern, bis Madame sich fertig gemacht hat.
Und da saß Karl allein in dem fremden Haus, auf dem hohen Stuhl an einem jetzt sauber mit Plüsch bedeckten Tisch, und wartete. Er hörte ein kleines Stimmchen, das ist unser Mariechen, sie ziehen sie jetzt an, wenn sie sie reinbringen, ach Gott, fang ich wieder an zu weinen. Aber sie brachten sie nicht; auf eine Frage Annas kräuselte Madame geringschätzig die Lippen und schüttelte einfach den Kopf.