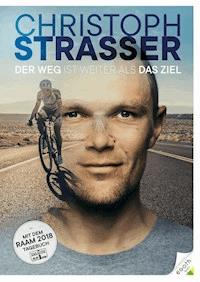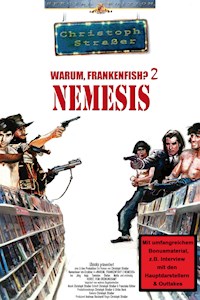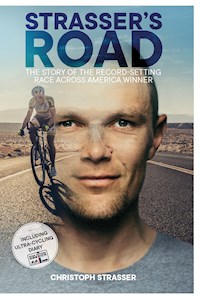Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsichtbar Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paria, der Außenseiter oder Ausgestoßener. Durch die bewusste Entscheidung, sein Leben außerhalb der Gesellschaft zu verbringen, erhält er durch die Distanz bessere Einblicke in diese. Er ist charmant, witzig, gutaussehend und finanziell unabhängig. Die Frauen lieben ihn, und er weiß diesen Umstand zu genießen. Er führt das perfekte Leben eines Großstadt-Casanovas, bis er eines Tages einen folgenschweren Entschluss fasst: Er will sein Leben ändern, um der Oberflächlichkeit seiner eigenen Existenz zu entrinnen. Allem guten Zureden seiner besten und einzigen Freundin Ida zum Trotz beschließt er, sich ein bürgerliches Leben aufzubauen, und so geht er eine ernsthafte Beziehung mit der jungen Conny ein. Anfangs noch ein Fremdkörper in einer Gesellschaft, der er sich nie zugehörig fühlte, beginnt er immer mehr wie ein Gift zu wirken. Und wo ein Gift ist, ist der Tod nicht weit, und mit ihm kommt die Erkenntnis, dass manche Entscheidungen einfach nicht getroffen werden sollten. Lakonisch, bitterböse und melancholisch. Die Geschichte eines Außenseiters, der auch immer einer sein sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
1. Auflage 2019
©opyright 2019 by Autor
Cover: D-ligo
Coverbild: Shutterstock 679462525
Lektorat: Christoph Straßer
Satz: Denise Bretz
ISBN: 978-3-95791-103-2
eISBN: 978-3-95791-104-9
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.
Hat dir das Buch gefallen? Schreib uns Deine Meinung unter: [email protected]
Mehr Infos jederzeit im Web unter: www.unsichtbarverlag.de
Unsichtbar Verlag | Dieselstr. 1 | 86420 Diedorf
Christoph Straßer
Paria oder von der Kunst, nicht lieben zu müssen
Casanova ist ein Hampelmann, der dieWelt mit steinernen Augen betrachtet:Kurz und gut, Casanova ist Pinocchio,aber ein Pinocchio, der niemals Mensch wird.
(Federico Fellini)
Inhalt
Julia Erstes Kapitel
Carina Zweites Kapitel
Berlin Drittes Kapitel
Conny Fünftes Kapitel
Nicole Sechstes Kapitel
Schlampe Siebtes Kapitel
Neukatzenelnbogen Achtes Kapitel
Entscheidung Neuntes Kapitel
Die erste Verabredung Zehntes Kapitel
Junges Glück Zwölftes Kapitel
Liebe Dreizehntes Kapitel
Kontrollen Vierzehntes Kapitel
Die Seele Fünfzehntes Kapitel
Diagnosen Sechzentes Kapitel
Fledermäuse Siebzehntes Kapitel
Eine Brücke von Stein Achtzehntes Kapitel
Julia
Erstes Kapitel
Julia schläft bereits seit einer ganzen Weile. Ich betrachte ihren Körper, der nackt neben mir im Bett liegt. Mein Blick wandert einige Sekunden lang über ihren Körper, der jetzt, wo nur das schwache Licht des wolkenverhangenen Mondes in den Raum fällt, beinahe makellos wirkt. Ich lächle und erinnere mich, wie sie mir sagte, dass ich bisher der einzige Mann sei, neben dem sie nackt einschlafen könne. Nicht aus Scham oder ähnlichen Dingen. Woran es genau läge, dass sie sich immer unter eine Decke legen müsse, um wirklich einschlafen zu können, wisse sie selbst nicht. Sie habe sich bisher auch nie tiefergehende Gedanken dazu gemacht. Ihr sei dies erst klargeworden, als ihr neben mir liegend die Augen schon beinahe zugefallen waren.
„Du bist der erste Mann, bei dem ich das kann. Kannst dich geehrt fühlen.“
„Das tu’ ich in der Tat“, hatte ich geflüstert und ihr den letzten Kuss dieses Tages gegeben, bevor sie endgültig eingeschlafen war.
Ihr Gesicht wirkte entspannt, so ruhig und ausgeglichen, wie man es am Tag nur sehr selten sah.
„Schlaf schön“, sage ich leise und streichle über ihren Rücken, was Julia mit einem kurzen Schmatzen quittiert.
Ich schließe die Augen und fahre mit einer Hand ihren Körper entlang. Ich fühle jede kleine Narbe, jedes Muttermal, jede Unebenheit ihrer Haut. Ich fühle nichts, was mich überrascht. Nichts, was mir nicht bekannt vorkommt. Alles, was ich spüre, ist die Haut einer jungen, schönen Frau, die ich seit einer Woche kenne. Und genau jetzt, in diesem Moment, gibt es nichts, was mich noch mehr langweilen könnte. Es heißt, dass die Liebe zu drei Vierteln aus Neugier bestehe. Bedauerlicherweise ist das tatsächlich so. Die Liebe ist weg, fühle ich. Meine Art der Liebe. Die Liebe, die zu spüren ich imstande bin. Intensiv und aufrichtig, aber nicht mit großer Langlebigkeit gesegnet. Ich öffne wieder die Augen und blicke lächelnd Julias wundervollen Körper an, der sich langsam und fast unmerklich im Mondlicht bewegt. Leise wende ich mich auf die Seite und stütze meinen Kopf auf einem Arm ab.
Wie wunderschön sie ist, denke ich.
Ihr langes, dunkles Haar fällt weich über ihren schlanken Hals, der in zerbrechlich wirkende Schultern übergeht. Ihr Hintern ist rund und fest, ihre Beine lang und wohlgeformt. Sogar ihre Füße, die sich nun im Schlaf unter die Bettdecke zu graben versuchen, sind traumhaft. Klein und mit so weicher Haut gesegnet, als hätten sie ihr Leben lang noch keinen Schritt gehen müssen.
Kaum ein Mann, der sich an diesem Anblick sattsehen könnte. Eine Frau wie aus Porzellan.
Mir gibt dieser Anblick nichts mehr. Ich könnte ebenso gut das Foto einer mir völlig Fremden betrachten. Schön, aber in keiner Beziehung zu mir stehend. Und es liegt nicht an ihr, es liegt auch nicht an mir. Es ist einfach so. Das menschliche Bestreben nach Zweisamkeit ist so beklagenswert. Man lernt sich kennen, flirtet und der ganze Raum um einen herum ist voller Magie. Aber bereits eine Sekunde später schiebt man gelangweilt einen Einkaufswagen vor sich her und plappert Halbwissen über Laktose-Intoleranz vor sich her in dem Wissen, dass einem der einst geliebte Mensch, den man seit Jahren gelangweilt als „Schatz“ bezeichnet, sowieso nicht zuhört. Beinahe empfinde ich Traurigkeit bei diesem Gedanken. Denn obwohl ich selbst keineswegs auf der Suche nach einer Gefährtin fürs Leben bin, bedaure ich in Momenten wie diesen, dass ich nicht in der Lage bin, mich auf diese Suche zu begeben. Denn wenn ich es könnte, hätte ich mein Ziel bereits oft erreicht. Im Laufe meines Lebens bin ich dazu übergegangen, es als eine Laune des Schicksals zu betrachten, dass ich wieder und wieder fortwerfe, wonach andere ihr Leben lang oft erfolglos streben. Ich bin ein Idiot, der unentwegt Diamanten in den Müll wirft, weil man damit im Supermarkt nicht bezahlen kann.
Schon bald werden sich Julias und meine Wege trennen. Höchstwahrscheinlich schon morgen, auch wenn ihr dies erst später bewusstwerden wird. Ein Schlussmachen wird es nicht geben, schließlich sind wir kein Paar, wir führen keine Beziehung. Wir verbrachten bisher nur viel Zeit miteinander, weil sie mir vertrauen kann und sie sich bei mir wohl und geborgen fühlt. Und weil ich sie verstehe. Ihre Macken und Eigenarten akzeptiere und ihr niemals vorwerfe, die zu sein, die sie ist. Weil sie glaubt, ich wäre der, nach dem sie vielleicht immer schon gesucht hat. Aber der bin ich nicht. Vielleicht könnte ich es sein, aber das hieße, mich zu verstellen. Die Langeweile zu unterdrücken, die jeden Tag aufs Neue in mir aufstiege. Das würde bedeuten, nur noch zu funktionieren. Und zwangsläufig würden sich meine größten Stärken in meine untolerierbarsten Schwächen verwandeln. Ich würde in ihren Augen zu dem emotionslosen Roboter werden, der ich doch eigentlich schon immer war. Der Unterschied wäre, dass sie sehen könnte, was ihr gefallen hat. Und sie würde es hassen. Mich hassen. Ich gebe Julia einen Kuss auf die Schulter und lege mich neben sie auf den Rücken.
„Gute Nacht, meine Süße“, flüstere ich.
Morgen früh werden wir gemeinsam Kaffee trinken und auf dem Sofa kuscheln, bis ich mich verabschiede. Und Julia wird sich freuen, mich schon bald wieder zu sehen.
Aber das wird nicht passieren.
Carina
Zweites Kapitel
Ich will Platz nehmen und versinke sogleich in den Polstern des Sofas.
„Lustige Möbel“, sage ich zu Ida, die mich in diesen wunderlichen Club geführt hat.
„Ist doch cool. Schön retro. Zum Chillen optimal.“
„Zum Chillen?“, frage ich und spüre, wie meine Augenbrauen nach oben springen. „Wie alt warst du doch gleich?“
Ida winkt müde ab.
„Und wie alt warst du, als du das erste Mal ‚geil’ gesagt hast? Und wie alt bist du heute?“
„Verstehe“, sage ich. „Du siehst dich als Trendsetter.“
„Nein, ich sehe mich als gar nichts. Ich gebe mich dem natürlichen Wandel der Sprache hin.“
„Fett“, lache ich.
„Übelst fett“, lacht auch meine Begleiterin nun, lehnt sich weit zurück und lauscht der Musik.
Kylie Minogues Confide in me dröhnt durch den riesigen Raum, der mit einem angenehmen Maß an Menschen gefüllt ist. Nicht so viele, dass man sich nirgendwo mehr frei bewegen könnte, aber dennoch genug, um das Gefühl zu haben, sich an einem Ort zu befinden, an dem etwas los ist und man sich nicht im Minutentakt zurück vor den Fernseher wünscht.
„War früher mal ne ganz üble Kokshöhle“, beginnt Ida unvermittelt, als ich gerade nach einer Kellnerin Ausschau halte. „Haben hier auf den Tischen die Lines gezogen, als wär’s das Normalste auf der Welt.“
„Warum hat man damit aufgehört?“, frage ich halb interessiert zurück.
Ida zuckt mit den Schultern.
„Keine Ahnung. Das Übliche wahrscheinlich. Polizist in Zivil kommt rein, fragt nach Kokain, bekommt es, macht die Bude dicht. So wird’s gewesen sein.“
„Aber sicher bist du dir nicht.“
„Nein, wie auch? War ja nicht dabei.“
„Also keine Pointe?“
„Was für eine Pointe denn?“
„Ich dachte, die Information, dass es sich bei dem Matrix früher einmal um eine ganz üble Kokshöhle gehandelt habe, leite die dramatische Geschichte ein, wieso dies heute nicht mehr so ist.“
„Nein, tut es nicht. Ich wollte nur mein Wissen mit dir teilen.“
„Gerüchte, die man dir zugetragen hat, bezeichnest du als Wissen?“
„Wir hocken auf dem Sofa in einer … Bar, Disco …, was auch immer das hier ist, und werden uns gleich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit betrinken. Ich wette, wenn ich dir den gleichen Satz, dass es sich beim Matrix früher mal um ne ganz üble Kokshöhle gehandelt hat, in ein paar Stunden noch einmal präsentiere, wirst du mich mit riesigen, gierigen Augen anblicken und sagen: ‚Ist nicht wahr? Ehrlich? Erzähl mal!’“
„Hm“, mache ich und überlege. „Ja, da könntest du recht haben. Einigen wir uns auf ‚mieses Timing’?“
„Ja, ich hab’ sehr früh angefangen mit diesen Themen, oder?“
„Was ich dir niemals vorwerfen würde. Ich weiß, du meinst es gut.“
„Später dann also?“
„Sehr gerne. Dann kannst du mir auch noch einmal die Geschichte erzählen, wie du damals dieses Eichhörnchen im Baum entdeckt und erst nach fünf Minuten festgestellt hast, dass es lediglich ein Vogelnest war.“
„Das war ein irrer Tag“, lacht Ida nickend, und ich lache automatisch mit.
Wir bekommen eine Kellnerin zu fassen und ordern Getränke.
Ich lächle still in mich hinein und höre der Musik zu. Abende wie diesen, gemeinsam mit Ida, genieße ich sehr. Wir beide kennen uns schon seit gut zehn Jahren und sind auch beinahe seit der gleichen Zeitspanne eng befreundet. Obwohl ich selbst nur die groben Fakten ihres Lebens kenne, ist sie der Mensch, der wohl am meisten über mich weiß. Angefangen bei meiner Kindheit bis hin zu meiner aktuellen Situation: Es dürfte kaum ein Thema geben, über das wir mich betreffend noch nicht gesprochen haben. Dabei hat sich mich nie ausgefragt oder versucht, mich in irgendeiner Weise zu therapieren. Sie stellt mir Fragen, die ich beantworte, wenn ich es will. Und diese Antworten hört sie sich interessiert an und gibt ihre Meinung dazu nur preis, wenn ich sie danach frage. Ida gehört zu der äußerst seltenen Art Mensch, die andere Menschen einfach in Ruhe lassen und nicht versuchen, ihnen ihre Wert- oder Moralvorstellung aufzudrücken, und sei es nur unterschwellig. Und das liegt wahrlich nicht daran, dass ihr das den Frauen gottgegebene Talent fehlen würde, mit dem Zucken einer Augenbraue oder einem kurzen Blick das über Jahre aufgebaute Weltbild eines Mannes wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen lassen zu können. Nein, sie lässt mich einfach ich selbst sein, so wie ich sie auch sie sein lasse. Es hilft unserer Beziehung sicher auch, dass Ida aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nie mit mir im Bett war. Auch wenn ich das ihr gegenüber niemals zugeben würde.
„Knackiger, kleiner Hintern“, sagt Ida und blickt der Kellnerin nach.
Nun ja, es schmerzt dennoch, für sie nie interessant gewesen zu sein. Aber mein Ego hat damit zu leben gelernt.
Ida wendet sich wieder mir zu.
„Und was liegt bei dir an in nächster Zeit? In Berlin steigt eine richtig nette Party. Eine Freundin von mir eröffnet nächste Woche ihre Galerie und feiert das anständig. Lust?“
„Eine Galerie?“, frage ich erstaunt.
Ida winkt ab.
„Ist ein altes Ladenlokal, das sie umgebaut hat. Klingt spektakulärer als es ist. Aber sie hat dort ein paar interessante Kontakte geknüpft und wohl auch schon einige ihrer Bilder verkauft.“
„Vielleicht sollte ich dann auch ein Bild kaufen. Als Wertanlage.“
„Wenn du meinst. Aber sie malt im Moment ausschließlich großformatig. Vier mal vier Meter ist so das Standardformat.“
„Hm“, mache ich. „Dann muss ich vorher umziehen. Oder sie malt mir direkt auf die Fußböden.“
„Und wenn du Geld brauchst, reißt du einfach deinen Fußboden raus und verkaufst ihn?“
„Wieso nicht? Die Nachbarn unter mir freuen sich sicher über sieben Meter hohe Decken.“
„Schwer zu heizen.“
„Ach, die haben’s doch. Er ist den ganzen Tag zu Hause und kann sich dennoch eine Alkoholikerin-Ehefrau und drei Hunde leisten. Ich schätze, er ist Privatier.“
Ida schließt die Augen und grinst.
„Dein seelenzerfetzender Sarkasmus würde mir unter all dem Künstlergetue fehlen. Also?“
Ich überlege.
Einer der Vorteile, die mein Job mit sich bringt, ist der, dass ich mir meine Zeit recht frei einteilen kann. Und wenn nicht irgendetwas völlig Unvorhergesehenes passiert, und das ist praktisch nie der Fall, spricht nichts gegen einen kleinen Berlin-Trip.
„Ja, warum eigentlich nicht“, sage ich schließlich. „Wenn’s mir nicht gefällt, lass’ ich dich einfach stehen und mache was Lustiges.“
„Was könnte denn lustiger sein, als mit mir eine Vernissage zu besuchen?“, fragt Ida und tut beleidigt.
„Mir fällt da auch absolut nichts ein“, lache ich und werfe die Hände in die Luft. „Aber man weiß ja nie.“
„Schön gerettet“, zwinkert mir Ida zu, als auch schon unsere Cocktails an den Tisch gebracht werden.
Ich nicke freundlich und nehme mein Getränk entgegen.
„Vielen Dank“, schnurrt Ida in ungewohnt tiefer Stimmlage.
„Immer wieder gerne“, säuselt die Kellnerin und blickt sonderbar auf Ida herunter, bevor sie sich wieder mit eleganten Schritten zurückzieht.
„Hast du das gesehen?“, grinst Ida nun mich an.
„Aber du lässt sie noch ein wenig arbeiten, bevor du sie in dein ruchloses Schlafzimmer zerrst, oder?“
„Das sagt der Richtige“, sagt Ida und nippt an ihrem Mojito.
„Interessante Musikauswahl für eine Bar“, wechsle ich das eventuell aufkommende Thema und höre dem Anfang von Nothing else matters zu.
Im Augenwinkel sehe ich, wie Idas Finger zu zucken beginnen.
„Nein, sag’ es nicht“, grinse ich. „Tu’s nicht.“
„Was denn?“, fragt sie.
„Ach, was soll’s“, seufze ich und lasse den Kopf hängen. „Bring’s hinter dich.“
„Was?“
„Sag’, was du sagen wolltest.“
„Okay: Ich kann Nothing Else Matters auf der Gitarre spielen, …“
„… aber nur den Anfang“, beenden Ida und ich synchron den Satz.
„Du bist’n Arsch“, sagt Ida, steht auf, gibt mir einen Kuss auf die Stirn und verschwindet Richtung Toiletten.
Ich nicke und lasse meinen Blick umherwandern. Auf der kleinen Tanzfläche fällt mir eine junge Frau auf, die allein zu der Musik tanzt. Ich lehne mich ein Stück aus dem Polster vor und kann erkennen, wie sie Anscheinend völlig in das Lied versunken ihre Lippen bewegt und offensichtlich still für sich mitsingt.
Traumhaft, denke ich und erhebe mich mit meinem Glas in der Hand aus dem Sofa.
In einem Bogen gehe ich zu der Tanzfläche und lehne mich in unmittelbarer Nähe des Mädchens an eine Wand. Es wäre ungerecht und vermessen, zu behaupten, dass sie ohne nennenswertes Aussehen wäre, allerdings fällt die Frau weit mehr durch andere Dinge auf als durch ihre bloße Erscheinung. Sie trägt eine enganliegende Jeans, dazu ein dunkles, trägerloses Oberteil, sodass ihr Haar weich auf ihre nackten Schultern fällt. Eine kleine Tätowierung blitzt gelegentlich zwischen ihren Schulterblättern hervor, wenn sich der Saum ihres Tops kurz senkt. Wie hypnotisiert beobachte ich die Frau, deren wahre Schönheit sich erst beim Tanzen offenbart. Mit geschlossenen Augen singt sie Zeile für Zeile des Titels und lässt so, ganz für sich allein in dieser Bar, für wenige Minuten ihre innere Schönheit sichtbar werden für jeden, der bereit ist, mehr in ihr zu erkennen als die bloße Beute.
Die Musik verklingt, und die Frau öffnet langsam wieder ihre Augen. Ich stehe bereits vor ihr und halte ihr meinen Cocktail entgegen. Wie selbstverständlich nimmt sie ihn, trinkt einen Schluck und reicht ihn mir wieder.
„Carina“, sagt das Mädchen und wischt sich kurz mit einem Finger über die Lippen.
„Du bist wunderschön, wenn du alleine bist“, sage ich.
„Aber ich bin ja nicht alleine“, sagt sie und legt ihren Kopf auf die Seite.
„Für etwa sechs Minuten warst du es“, lächle ich.
„Was du nicht sagst … Und was bedeutet das jetzt?“
Carina nimmt mir mein Glas aus der Hand und trinkt erneut einen Schluck.
Ich lächle und lege meine Handfläche auf ihren Bauch. Carina sieht mich irritiert an, lässt die Geste aber zu.
„Hier“, sage ich. „Genau an dieser Stelle wird es hohl sein und schmerzen. Genau dort wird sich das leere Elend breit einnisten, wenn ich heute Abend alleine in meinem Bett liege. Ich werde mir wie ein Versager vorkommen, wie jemand, der erneut gescheitert ist. Der etwas hätte haben können, aber im richtigen Moment einfach nicht schlau genug war. Und dieses Gefühl der Unzulänglichkeit wird sich tagelang dort befinden, bevor es sich endlich auflöst.“
Carina schaut mich ernst an. Anscheinend überlegt sie, ob sie es gerade mit einem Romantiker oder einem Irren zu tun bekommen hat.
Meine Hand liegt noch immer auf ihrem Bauch, dessen Muskeln ich straff unter ihrem Shirt fühle.
„Willst du mich vögeln?“, fragt sie schließlich.
Ich ziehe langsam meine Hand zurück und schüttle den Kopf.
„Nein, aber ich würde unglaublich gern mit dir schlafen.“
Carina lacht, trinkt einen weiteren Schluck und sieht mich an.
„Hat diese Tour jemals funktioniert?“, fragt sie dann.
„Tut mir leid, wenn du das so siehst“, sage ich. „Hat mich wirklich gefreut, dich kennenzulernen, Carina.“
Ich gehe zurück zum Sofa und finde dort auf dem kleinen Tisch eine Serviette, auf der etwas geschrieben steht:
Wir telefonieren morgen, du egozentrischer Penner.
Ich bin jetzt an der Bar.
Kuss, Ida
Darunter hat sie einen zwinkernden Smiley gezeichnet.
Anscheinend hat sie eine alternative Beschäftigung gefunden, denke ich und habe beinahe etwas wie ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Freundin einfach habe sitzen lassen.
Zum Glück weiß sie aber, mit wem sie unterwegs ist, und wird mir mein Verhalten nicht nachtragen, solange ich den Bogen nicht zu sehr und zu häufig überspanne.
„Hey, Casanova“, höre ich eine Stimme hinter mir.
„Nenn mich nicht so“, sage ich und drehe mich lächelnd herum.
Bereits im Taxi knutschen Carina und ich wie zwei verliebte Teenager, die es kaum mehr abwarten können, bis der Wagen sein Ziel erreicht hat.
Der Fahrer scheint sich an derlei Szenen bereits gewöhnt zu haben; mit stoischer Gelassenheit lenkt er den Wagen durch die Straßen, bis wir schließlich bei mir zuhause angekommen sind. Mit Carina in einem Arm halte ich ihm zwischen die Vordersitze hindurch das Geld hin.
„Ist in Ordnung so“, sage ich, und wir steigen aus.
Obwohl es bei mir im Haus einen Aufzug gibt, eilen wir beide die Treppen hinauf in die zweite Etage. Da sie den Weg naturgemäß nicht kennt, ziehe ich Carina an einer Hand hinter mir her bis in das Schlafzimmer. Wir werfen uns auf mein Bett, zerren uns in gegenseitiger Gier die Kleidung von den Körpern, sodass ich schließlich ihren kleinen nackten Körper in der Dunkelheit unter mir spüre. Augenblicklich durchströmt eine irrsinnige Hitze meinen Körper. Mein Atem geht schwer und wenn ich könnte, ich würde sofort in Carinas Körper versinken. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass es einem Heroinabhängigen, der sich gerade sein Gift in die Venen gespritzt hat, besser geht als mir. Jetzt, in diesem Augenblick, spüre ich mein Herz. Nicht die organische Blutpumpe unter meinen Rippen, sondern mein richtiges Herz. Das diffuse Gefühl in der Brust, das mir einredet, dass ich zu lieben fähig bin. Mein Leben, dieses Mädchen hier, die ganze Welt. Alles um mich herum löst sich in einem Nirvana auf, ich bestehe nur aus Gefühl, es existiert kein Gleich, nur ein Jetzt. So muss es sich anfühlen, glücklich zu sein.
Ich küsse Carina und mit ihr zu schlafen, fühlt sich exakt so großartig an, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich weiß bereits jetzt, dass ich diese Frau mein Leben lang lieben werde. Dafür, dass sie mir vertraut hat. Dafür, dass sie heute Abend mich erwählt hat. Dafür, dass sie mir ihren wunderbaren Körper zur Verfügung stellt.
Als ich wach werde, ist es bereits hell. Ich liege auf dem Rücken, und Carina ist heute Nacht etwas heruntergerutscht und auf meinem Bauch liegend eingeschlafen. Ich streichle ihr sanft über den Kopf und ziehe die Bettdecke ein wenig zur Seite, sodass sie etwas mehr Luft bekommt. Mir ist es überhaupt ein Rätsel, wie sie in dieser Position die Nacht verbringen konnte. Ich lege den Kopf zur Seite und betrachte das kleine, gerahmte Bild auf der Kommode. Die Fotografie zeigt meine Eltern, die eng umschlungen auf einer Wiese liegen und breit in die Kamera lachen. Meine Mutter sieht glücklich aus, meinen Vater umgibt ein ungeheurer Stolz, eine solche Frau zu seiner Ehefrau gemacht haben zu können. Laut meiner Tante, bei der ich nach dem Tod meiner Eltern aufgewachsen bin, ist das Bild etwa ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit entstanden. Bei einem Picknick im Park, ungefähr ein Jahr vor meiner Geburt. Auf der Beerdigung meiner Eltern spürte ich zum ersten Mal, dass ich anders war als die Menschen um mich herum. Freunde und Verwandte, alle standen um das große Loch herum, in das man die Körper meiner Eltern gleich herabsinken lassen würde, und weinten. Sie heulten Rotz und Wasser. Nur ich selbst weinte nicht. Ich unterdrückte meine Trauer nicht, ich war nur nicht in der Lage, ihr in irgendeiner Form Ausdruck zu verleihen, außer durch mein Schweigen.
„Heute ist ein trauriger Tag, selbst die Engel weinen“, hatte der Pfarrer zu mir gesagt, war in die Knie gegangen und hatte mich umarmt. „Du darfst ruhig auch weinen. Das ist überhaupt keine Schande.“
Rückblickend betrachtet muss dieser junge Kerl mit Vollbart unglaublich verzweifelt und verwirrt gewesen sein. Ein Neunjähriger, der am Grab seiner Eltern nicht weint. Und er dachte, es läge an meinem Stolz. Daran hatte es nicht gelegen. Daran liegt es nicht. Es liegt nicht an meinem Stolz, dass ich nicht fliegen kann, es liegt nicht an meinem Stolz, dass ich mich nicht unsichtbar machen kann, und es liegt auch nicht an meinem Stolz, dass ich keine Trauer fühlen kann. Keine Trauer, keine Liebe, keine Reue. Ich habe weder ein Gewissen noch fühle ich mich irgendjemandem gegenüber verpflichtet. Ich mag es, wenn man mich mag, aber es ist mir völlig gleichgültig, wenn man mich nicht mag. Es existiert nur eine Sache, die in mir etwas auslöst, das zu kontrollieren ich nicht in der Lage bin, und somit einer wahrhaften Emotion am nächsten kommt: Wenn ich nicht bekomme, was ich will. Wenn ich etwas habe und wieder verliere, empfinde ich keinen Verlust. Da gibt es bei Dingen und bei Menschen keinen nennenswerten Unterschied. Zerbricht ein vielleicht wertvoller Gegenstand: C’est la vie. Ich habe auch nie unter Liebeskummer gelitten. Menschen kommen und gehen, das ist einfach so. Nur musste ich mich mit dieser Tatsache nie erst abfinden, für mich stand sie einfach fest. Wenn ich jedoch etwas wirklich will, es aber für mich unerreichbar bleibt, dann bricht etwas in mir los, was ich bis heute nicht verstehe. Ich bin vor einigen Jahren dazu übergegangen, es als Verzweiflung zu bezeichnen. Das Bild meiner Eltern ist für mich mehr als reine Nostalgie. Es hat für mich auch einen beinahe religiösen Charakter angenommen, scheinen die beiden dort abgebildeten Menschen doch miteinander einen Zustand erlangt zu haben, der mir unerreichbar vorkommt: glücklich sein.
Giacomo Casanova sagte einmal: „Nur der Gedanke an Liebe widerstrebt mir, denn ich könnte nicht lieben, wenn ich nicht gewiss wäre, allein geliebt zu werden.“
So wie für ihn, so ist die Liebe auch für mich: unerreichbar. Ein Ideal, eine Idee, ein Konzept, mehr nicht. Das Misstrauen und die Skepsis sind uns beiden zu Eigen wie ein Körperteil, den abzuschneiden wir nicht imstande sind, ganz gleich, wie sehr er uns auch behindert auf unserer Suche nach dem Wahrhaften. Beides ist Teil unseres Wesens. Aber wie Casanova leide auch ich nicht über Gebühr unter diesem Umstand. Und wie ihn, so machen auch all meine vorhandenen und nicht vorhandenen Eigenschaften mich nicht zu einem schlechten Menschen. Das weiß ich zum Glück sicher.
„Guten Morgen“, reißt mich Carina aus meinen Gedanken.
Ihr Kopf taucht unter der Bettdecke hervor, und sie sieht mich schlaftrunken an.
„Hi“, lächle ich.
Carina setzt sich aufrecht ins Bett und sieht sich im Schlafzimmer um.
„Was machst du eigentlich beruflich?“
Ich lache laut los.
„Was?“, fragt Carina und legt sich wieder hin.
„Was ich beruflich mache? Das ist deine erste Frage, obwohl du noch nicht einmal meinen Namen kennst?“
Carina zuckt mit den Schultern.
„Mir gefällt halt dein Schlafzimmer. Ein paar der Möbel sehen teuer aus, da dachte ich, ich frag’ mal.“
„Okay“, sage ich. „Nicht viel. Ich illustriere Bücher und Magazine. Ich sitz’ also hauptsächlich am Rechner. Und wenn ich hauptsächlich sage, dann meine ich damit, dass ich fast nie am Rechner sitze, weil ich die ganze Sache eher als eine Art Hobby betreibe.“
Carina sieht mich an, als hätte ich ihr gerade gesagt, dass ich Bibeln verkaufe.
„Und so bezahlst du deine Rechnungen?“, fragt sie ungläubig.
„Ja, absolut. In guten Monaten mache ich mit den Illustrationen beinahe zweihundert Euro.“
„Du verarschst mich. Zweihundert Euro. Das ist doch noch nicht einmal ein Fünftel der Miete hier.“
„Die Wohnung gehört mir“, sage ich.
„Trotzdem.“
„Und was machst du?“, frage ich dann.
„Ich bin Astronautin.“
„Cool“, sage ich. „Ist das wahr, dass ihr bald auf dem Mars landet?“
Carina schlägt sich die Hände vors Gesicht und schüttelt den Kopf.
„Du hast recht. Ich nehm’ einen Kaffee. Sonst fällt’s mir schwer, mich veralbern zu lassen.“
„Okay“, sage ich. „Meine Eltern waren Hippies und haben ihr Geld in Windkraftwerke gesteckt. Ich hab’ die Anteile geerbt und kann von dem Geld ganz gut leben. Streng genommen lebe ich sogar sehr gut davon, da ja regelmäßig ein Kernkraftwerk in die Luft fliegt. Abgesehen davon gehören mir zwei Häuser, die ich vermiete. Das Zeichnen bezahlt meine Rechnungen, weil ich üblicherweise nicht viele Rechnungen bekomme. Das meiste von dem, was ich brauche, gehört mir.“
Carina nimmt die Hände vom Gesicht und lächelt.
„Das klingt plausibler.“
„Dass ich vom Wind lebe, klingt für dich plausibler als dass ich vom Zeichnen lebe?“
„Sozusagen.“
„Ich mag deine Einstellung.“
„Ich mag Kaffee.“
„Milch und Zucker?“
„Schwarz.“
„Kommt sofort“, sage ich, steige aus dem Bett und werfe mir meinen Morgenmantel über.
„Und was soll ich machen?“, fragt mich Carina aus ihrem Kissen heraus.
Ich überlege kurz, komme aber zu keinem Ergebnis.
„Ich weiß nicht“, sage ich. „Folge mir in die Küche, warte im Wohnzimmer, bleib im Bett liegen … Ganz wie du magst. Wir sind erst seit ein paar Minuten wach, jetzt ist noch nicht die Zeit für ausufernde Überlegungen.“
Carina sieht mich eigenartig an.
„Klänge deine Stimme nur einen Hauch weniger gelangweilt, würde ich mich über deine Gastfreundschaft freuen.“
„Aha …“, sage ich und lehne mich an die Tür.
Ein Jammer, denke ich.
Dieser kleine, für jeden anderen vielleicht unbedeutende Moment der Disharmonie zertrümmert in mir augenblicklich jegliches Interesse an einem gemeinsam verbrachten Tag.
„Aber wenn ich’s mir schon aussuchen darf“, fährt Carina fort, „dann lass’ uns den Kaffee doch hier im Bett trinken. Okay?“
„Natürlich, gerne“, sage ich und mache mich auf den Weg in die Küche.
Ich mag Carinas Art irgendwie nicht mehr, aber gehen lasse ich sie noch nicht.
Nachdem ich in der Küche den Kaffee zubereitet habe, gehe ich mit zwei Tassen in den Händen zurück ins Schlafzimmer. Carina liegt auf der Seite, den Kopf auf eine Hand gestützt, und spielt an ihrem Smartphone herum. Als sie mich bemerkt, legt sie das Gerät auf den Teppich.
„Danke“, sagt Carina und nimmt ihre Tasse entgegen.
Ich stelle meine auf dem Nachttisch ab, ziehe mich wieder aus und lege mich zu ihr unter die Decke.
Carina ist wunderbar warm und weich, und sie riecht nach Schlaf, Parfum und mir.
Unwillkürlich rutsche ich näher an sie heran. Sie lächelt, nimmt meinen Kopf zwischen ihre Hände und zieht mich sanft auf sich. Obwohl ich mich auf meinen Ellbogen abstütze, um nicht zu schwer auf ihr zu liegen, entspanne ich mich, lege meinen Kopf auf ihre Brust und schließe die Augen. Ich könnte den ganzen Tag so liegen bleiben. Hier, mit diesem wunderschönen Frauenkörper bei mir.
„Ich muss heute Nachmittag zur Arbeit, aber vielleicht hast du ja Lust, heute Abend was mit mir zu unternehmen“, flüstert Carina.
„Sehr gern sogar“, lüge ich und atme sie noch einmal tief ein.
Berlin
Drittes Kapitel
Ich sitze im Flugzeug und sehe aus dem Fenster. Unter mir befindet sich Deutschland, was sonst. Beinahe lautlos gleite ich über Äcker und Felder, die wie ein einziger, gewaltiger Flickenteppich aussehen und dementsprechend überhaupt nicht beeindruckend sind.
„Teppiche sind mit Abstand das Langweiligste, was es gibt“, sage ich zu Ida, die neben mir sitzt und sich gerade ihr Klatschmagazin vornimmt, das sie im Terminal erstanden hat.
Auf dem Titel sind Calista Flockhart und Harrison Ford abgebildet, darüber prangt in riesigen Lettern: „Darum lasse ich mich von Harrison scheiden!“
Ida ignoriert meine Feststellung, fährt sich kurz durch ihr kupferfarbenes Haar und beginnt, in dem Heft zu blättern. Ich sehe zu der Sitzreihe neben uns. Dort blättert eine Frau interessiert ein anderes Promi-Magazin durch. Vorne drauf erkenne ich Calista Flockhart und Harrison Ford. Über ihrem Foto steht: „Darum ist Harrison mein Seelenverwandter!“
„Ich hab’ AIDS“, sage ich und schaue traurig aus dem Fenster.
„Hast du nicht“, sagt Ida. „Dir ist nur langweilig. Aber wir landen ja in fünf Minuten.“
„Ich bin eben nicht so leicht ablenkbar“, grinse ich und deute auf das Heft in Idas Händen.
Sie wirft mir einen abschätzigen Blick zu und lässt das Magazin auf ihren Schoß sinken.
„Wärst du begeisterter von mir, wenn das eine Architekturzeitschrift wäre?“
„Nein, ich finde Architektur langweilig.“
„Weil du nichts davon verstehst?“
„Ganz genau.“
„Warum zwingst du mir dann jetzt so eine Diskussion auf?“
„Ich wollte nur erforschen, warum Lügen okay sind, wenn es sich um unterhaltsame Lügen handelt.“
„Lügen sind total in Ordnung, wenn sie unterhaltsam sind.“
„Das sagst du nur, damit ich ruhig bin.“
„Ganz genau.“
„Ich verstehe nicht, warum ihr Mädels euch den Krempel reinzieht, wenn ihr doch wisst, dass er höchstwahrscheinlich unwahr ist.“
„Darf ich dich daran erinnern, dass du letzten Monat tagelang vor dem Computer gesessen und als Hexe kleine Spielfiguren durch Fantasiewälder gescheucht hast?“
„Erstens“, sage ich und hebe mahnend den Zeigefinger, „war ich keine Hexe, sondern ein mächtiger Magier. Und zweitens hat das nichts mit deiner Vorliebe für Hochglanz-heftchen zu tun.“
„Okay, du Magier. Dann zaubere dir mal deine männliche Überheblichkeit samt der Annahme, dass Frauen diese Hefte für mehr als bloßen Zeitvertreib halten, aus deinem Chauvi-Gehirn, bevor ich zur Hexe werde und dir meinen Besen in den Hintern ramme.“
Ida setzt ein strahlendes Siegerlächeln auf und greift wieder nach ihrem Magazin. Ich schaue wieder gelangweilt aus dem Fenster auf den Flickenteppich.
„Dann kriegt dein Besen eben auch AIDS“, maule ich Sekunden später und ziehe den Gurt unter meinem Bauch fest. Nachdem wir in dem kleinen Hotel eingecheckt haben, verabschieden Ida und ich uns in der Lobby voneinander. Da dies erst ihr dritter Aufenthalt in der Hauptstadt ist, möchte sie ein wenig Sightseeing betreiben, um ihr Fotoalbum zu komplettieren, wie sie sagte. Ich selbst war zwar nur unbedeutend öfter in der Stadt, aber mich hat Berlin auch nie interessiert. Nicht, dass ich etwas gegen die Stadt hätte, aber Häuser, Straßen und all die anderen Dinge, die zu einer Stadt gehörten, waren denen anderer Städte einfach zu ähnlich, um mich ernsthaft auf Erkundungstour locken zu können. Trotzdem habe ich keine Lust, in meinem Zimmer zu hocken und auf den Abend zu warten, weswegen ich beschließe, ein wenig spazieren zu gehen. Da es hier keine Kioske gibt, besorge ich mir in einem Supermarkt eine Schachtel Zigaretten, die ich in meiner Manteltasche verstaue. Ich setze mich auf eine Parkbank, zünde mir eine Zigarette an und beobachte die Passanten, deren Äußeres mir ins Auge fällt. Es fasziniert mich, wie unterschiedlich sich die Leute von Stadt zu Stadt kleiden. Menschen in Kleinstädten kleiden sich oft eher zweckmäßig, und gibt ein spezieller Anlass Grund zu besserer Kleidung, so fällt die Kleiderwahl oft etwas linkisch und unbeholfen aus. In München oder Düsseldorf, so unbedeutend und provinziell diese Städte auch sind, legt man Wert auf den großen Auftritt. Selbst Menschen, die sich ihre Kleidung in Discountern kaufen, haben ein gut geschultes Gespür dafür, mit welchen Kleidungsstücken man sich auf die Straße trauen kann und mit welchen nicht. Als gebe es dort „Mode“ als Schulfach, in dem man lernt, dass wenn man nur noch zehn Euro übrighat, diese doch mindestens in ein Dolce & Gabbana T-Shirt aus dem Outlet zu investieren seien. Hier in Berlin scheint es dagegen mehr von Bedeutung zu sein, flippig und ausgefallen auszusehen. Man kombiniert Sneakers so selbstbewusst mit Anzügen, als wäre dieser Trend nicht schon seit 2002 bekannt. Dazu trägt man quietschbunte, selbst gestrickte Wollmützen, deren Aussehen an Pokémon oder ähnliche japanische Trickfilmmonster angelehnt ist. Hauptsache progressiv, Hauptsache auffällig. Und auch die ekelhaften Hipster-Bärte sind hier noch in großer Zahl zu bewundern.
Mich hat das Thema Mode nie sonderlich betroffen. Seit ich selbst für meine Kleidung verantwortlich bin, achte ich darauf, dass die Sachen sauber sind und dem Anlass Rechnung tragen. Mehr nicht, aber auch niemals weniger. Ein kleiner Junge mit ausgebeulter und verschlissener Jeans läuft an mir vorbei. Die Hose macht nicht den Eindruck, als könnten oder wollten sich seine Eltern nichts Besseres für ihren Sohn leisten, vielmehr wirkt sie, als habe der Kleine dem Stoff heute bei irgendeiner Beschäftigung schlicht zu viel zugemutet.
Unwillkürlich erinnere ich mich an die Zeit, als ich in seinem Alter gewesen bin. Der Bruder meines Vaters war im Todesfall meiner Eltern als mein Vormund vorgesehen. Und da dieser Fall überraschend eingetreten war, hatten er und seine Frau mich aufgenommen, was für mich einen Ortswechsel zur Folge hatte. Ich hatte vorher keinen sehr intensiven Kontakt zu meinem Onkel und meiner Tante gehabt, aber im Gegensatz zu meinem Onkel war sie mir gleich sympathisch. Eine ruhige Frau, warmherzig und voller Mitgefühl meiner Situation gegenüber. Mein Onkel war das Gegenteil von ihr. Zu sagen, dass die Tatsache, dass ich nun zur Familie gehörte, ihn gestört hätte, wäre sicher übertrieben, aber vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl, ihm wäre lieber gewesen, ich wäre in ein Heim, eine Pflegefamilie oder sonst wohin gekommen. Irgendwie nervte ich ihn, und das, obwohl ich weder laut war oder mich sonst in irgendeiner Weise auffällig benahm. Selbst in meiner Pubertät war ich nicht rebellisch oder begehrte gegen ihn oder seine Frau auf. Das Zurückziehen in mein Zimmer, um dort meine Metal-Platten zu hören, fiel vollständig aus. Ich mochte diese Musik nicht; zu laut, zu unstrukturiert und zu unmelodisch war sie mir, und das gilt bis zum heutigen Tag. Mich interessierten mehr das Zeichnen und in etwas geringerem Maße das Malen, ein Hobby, das ich mit meiner Tante teilte. Oft, meinem Onkel nach viel zu oft, saßen wir beisammen im Wohnzimmer und malten, sie an einer kleinen Staffelei, ich neben ihr auf dem Fußboden vor einem Zeichenblock sitzend. Mein Onkel fürchtete gelegentlich, meine Tante würde eine kleine Schwuchtel aus mir machen mit ihrem ständigen Gepinsel, wie er sich ausdrückte. Später, ich war bereits beinahe erwachsen, machte ich mir einen Spaß daraus, ihn über meine sexuelle Orientierung im Unklaren zu lassen.
Ich liebte es, schweigend bei meiner Tante sitzend die Stunden zu verbringen. Hin und wieder beugte sie sich zu mir herüber und lobte, was ich oft nur halbherzig zustande gebracht hatte.
Und wie ich die gemeinsam mit ihr verbrachte Zeit liebte, so liebte ich auch schon bald sie. Sie war zu meiner neuen Mutter geworden, und genau diese Gefühle brachte ich ihr so gut es ging entgegen. Was ich hingegen für meinen Onkel empfand, konnte ich lange nicht sagen. Ich mochte es, wenn er ging, und fand es bedauerlich, wenn er nach Hause kam. Die Gemütslage meiner Tante änderte sich merklich, wenn er die Wohnung betrat. Ich sollte erst später erfahren, woran das gelegen hatte. Mir selbst jedoch lag seine Anwesenheit nie besonders am Herzen. Er war für mich wie ein Handwerker: okay, ihn im Haus zu haben, aber man will ihn eigentlich doch recht schnell wieder loswerden. Meine neuen Eltern waren nicht unbedingt reich, das merkte ich ziemlich am Anfang meines Aufenthalts. Strom und Heizung wurden gelegentlich abgestellt, weil das Geld für die Rechnungen fehlte. Ich erinnere mich, wie meine Tante alle Sofakissen unter den Wohnzimmertisch gelegt und eine Wolldecke über die Tischplatte geworfen hatte. Das war dann unsere Räuberhöhle, wenn es wieder kalt und dunkel in der Wohnung war. Von meinem Onkel hätte ich mir ähnliche Reaktionen gewünscht, leider beschränkte er sich meist nur auf lautstarke Hinweise darauf, dass er sich den Arsch abrackere und man ihm trotzdem nur Knüppel zwischen die Beine werfe. Zum Glück für uns verließ er aber in solchen Momenten oft die Wohnung, um sich in einer Kneipe mit Freunden zu treffen, sodass wir uns ungestört Gruselgeschichten erzählen konnten. Einige Monate nach meinem unfreiwilligen Umzug bekam ich dann die Gelegenheit, mir über die Gefühle im Klaren zu werden, die ich meinem Onkel entgegenbringen konnte und wollte.
Er hatte seinen Job verloren, und er nutzte jede Gelegenheit, um lang und breit zu erläutern, dass dies nicht seine Schuld gewesen sei, auch wenn ich mich nicht daran erinnere, dass ihn jemals irgendwer von uns danach gefragt hätte. Viel interessanter als den Verlust seines Arbeitsplatzes fand ich dagegen die Wandlung, die er in der nachfolgenden Zeit vollzog. Er stand morgens nicht mehr auf, sondern blieb im Bett liegen, was mich weder irritierte noch störte, immerhin musste er ja nirgendwo hin. Wenn ich jedoch von der Schule nach Hause kam, dann lag er nur mit T-Shirt und Unterhose bekleidet auf dem Sofa und sah fern. Dazu kam, dass er sich um seine persönliche Hygiene nicht mehr besonders zu bemühen schien, wenn mich meine Augen und meine Nase nicht täuschten. Man kann sagen, dass er vor meinen Augen verwahrloste, und das nur binnen weniger Wochen und ohne die Messlatte während seiner guten Zeiten besonders hoch gelegt zu haben. Und mit der Zeit kam in mir ein Gefühl hoch, dass ich erkannte und benennen konnte: Abscheu.
Ich war nicht wütend auf ihn oder gar enttäuscht, aber mich widerte an, wie schnell und wie konsequent er sich aufgab. Er erwartete überhaupt nichts mehr vom Leben, abgesehen davon, als Familienoberhaupt respektiert zu werden. Mit welchem Recht er diese Rolle einforderte, erschloss sich mir nicht. Meine Tante kümmerte sich um Behördengänge, machte den Haushalt, überwies die Rechnungen so gut es ging und kümmerte sich in der verbleibenden Zeit um mich. Und mein Onkel sah fern. Ich begann, meinen Onkel so anzusehen, wie man den Familienhund ansehen würde, wenn er forderte, von nun an als Ernährer und Herr des Hauses anerkannt zu werden. Tatsächlich überkam mich hin und wieder der Drang, eine Zeitung in der Hand zusammenzurollen und meinen Onkel damit vom Sofa zu prügeln wie einen verwanzten Köter, der sich wieder einmal zu viel herausgenommen hatte. Was ich natürlich nicht tat. Ich beobachtete ihn einfach weiter und hoffte, niemals so zu enden. Auch wenn er einige Monate später wieder Arbeit fand und es uns so zumindest finanziell wieder ein wenig besser ging, hat sich mein Blick auf ihn nie wieder verändert. Dass wir während seiner Arbeitslosigkeit noch viel weniger Geld hatten als zuvor, war natürlich auch schnell an meiner Kleidung zu erkennen gewesen. Ich war es gewohnt, dass meine Eltern mich hin und wieder in ein Kaufhaus mitnahmen, wo ich dann einen neuen Pullover, eine Hose oder Schuhe bekam. Je nachdem, woran es mir gerade fehlte – ihrer Meinung nach. Mir als Kind war Bekleidung immer recht egal gewesen. Was bequem war und nicht vom Körper fiel, war in Ordnung. Meine Eltern hatten dies natürlich anders gesehen und Wert darauf gelegt, dass ich nicht wie ein Strolch durch die Gegend lief. Jetzt hingegen bestanden die Einkaufstouren aus Besuchen in Kleiderkammern gemeinnütziger Organisationen, was ich selbst als ungemein vorteilhaft empfand. Die Sachen waren bereits getragen, liefen also nach dem Waschen nicht mehr ein oder verloren die Farbe, was bei den Sachen aus dem Kaufhaus leider gelegentlich vorkam. Außerdem sah die Kleidung nicht neu aus, sodass mich in der Schule niemand aufzog mit der Tatsache, dass man mich zum Einkaufen genötigt hatte.
An meinem ersten Tag auf dem neuen Gymnasium jedoch hatte ich eine etwas unglückliche Wahl getroffen. Wie sich herausstellte, hatte den Pullover, den ich trug, die Mutter einer meiner Klassenkameraden beim Roten Kreuz abgegeben. Und der Junge erkannte seinen ehemaligen Lieblingspulli natürlich sofort wieder, kaum dass ich die Klasse betreten hatte.
Mit hochrotem Kopf und stotternd hatte ich darauf bestanden, den Pullover mit meiner Tante in einem Geschäft gekauft zu haben, als mich ein Mädchen in Schutz nahm, indem sie den Vorbesitzer des Pullovers kurzerhand vor der ganzen Klasse als Lügner und hässliches Schwein bezeichnete. Ich gab ihr Recht, was den zweiten Teil ihrer Aussage betraf, und durfte neben meiner neuen Freundin Platz nehmen, die in der Klasse recht beliebt war. Und so genoss ich in der ersten Zeit auf meiner neuen Schule einen gewissen Schutz durch sie und ihre Freundinnen, später dann wurde ich dann sogar in ihren Freundeskreis aufgenommen, und das als einziger Junge, was mich damals unglaublich stolz machte.
Ich trete meine Zigarette aus und sehe dem Jungen in der kaputten Jeans nach, der sein Smartphone aus der Tasche nimmt und mit dem Zeigefinger auf dem Display herumwischt.
Ich nehme mein Telefon aus der Manteltasche und wähle Idas Nummer.
„Wo bist du?“, frage ich, als sie sich meldet.
„Am Brandenburger Tor. Das Ding ist viel kleiner als ich gedacht hab’. Sehr enttäuschend. Und du?“
„Keine Ahnung. Ich sitze in einem Park und beobachte ein Kind.“
„Das hab’ ich jetzt einfach überhört. Und ich hoffe, die Leute in deiner Umgebung auch.“
Ich muss lachen.
„Aber ich krieg’ langsam Hunger“, sagt Ida weiter. „Wenn du magst, können wir uns gleich zum Mittagessen treffen. Ich frag’ mal Darth Vader, ob es hier in der Gegend ein Restaurant gibt, das was taugt.“
„Ein Pantomime?“, frage ich.
„Dafür quatscht er zu viel. Aber er bedroht mich schon seit einer Weile mit seinem Lichtschwert. Und wenn er jetzt keine Antwort parat hat, schieb’ ich ihm das in den Hintern.“
„Ida, wir müssen uns mal über deinen Drang unterhalten, Leuten was in den Hintern schieben zu wollen, wenn sie dein Missfallen erregen.“
„Sagt der Mann, der auf Spielplätzen herumgammelt.“
„Ich sitze in einem Park. Der Junge läuft nur zufällig hier herum.“
„Aber wenn ich gleich da hinkomme, steht da kein kleines Holzkreuz mit Teddybären darunter und einem handgemalten Schild, auf dem ‚Warum?’ steht, oder?“
„Möglich ist es. Der Kleine hat ein geiles Handy.“
„Ich komm’ mal lieber rüber. Wo sitzt du?“
„Straße des 17. Juni.“
„Das ist doch direkt um die Ecke, du Vogel. Ich bin gleich da.“
„Ich weiß“, sage ich und lache. „Ich warte dann hier auf dich.“
„Bis gleich“, lacht auch Ida und legt auf.
Ich schiebe mein Telefon zurück in die Tasche.
Ich beschließe, meine Überlegungen zu den verschiedenen Kleidungsgepflogenheiten im Hinterkopf zu behalten. Möglicherweise kann ich damit ja heute Abend noch Künstler beeindrucken.
Ich zupfe meine Krawatte zurecht und gehe hinunter in die Lobby, wo Ida bereits auf mich wartet.
„Ein Anzug?“, fragt sie und sieht erstaunt an mir herunter.
„Wieso nicht?“, frage ich zurück. „Immerhin gehen wir auf eine Vernissage.“
„Too much“, sagt Ida und macht einen Schritt auf mich zu.
Sie lockert den Knoten meiner Krawatte, streift sie über meinen Kopf ab und klemmt sie sich unter den Arm. Die oberen beiden Knöpfe meines Hemds öffnet sie geschickt mit einer Hand.
„Besser“, sagt sie schließlich und steckt die Krawatte in ihre Handtasche. „Wie Jean Dujardin. Elegant, sexy und mit einem Hauch Verwegenheit.“
„Wer ist Jean Dujardin?“, frage ich.
„Du siehst jetzt so aus. Mehr musst du nicht wissen.“
„Er ist aber nicht missgebildet?“
„Nein.“
„Dann ist gut“, sage ich und gehe voran in Richtung Ausgang.
Ich halte Ida die Tür auf und sie steigt in das Taxi. Während ich mich neben sie setze, gibt sie dem Fahrer die Adresse. Jetzt, im Dunkel der Nacht, verliere ich vollständig die Orientierung und habe erst recht den Eindruck, dass Berlin wie jede andere Stadt auch aussieht. Ich ermahne mich, meine Meinung heute Abend nicht weiter kundzutun, da der Berliner an sich trotz allen Gemaules sehr stolz auf seine Stadt ist.
„Das wurmt dich jetzt, dass du nicht weißt, wer Jean Dujardin ist, hab’ ich recht?“, fragt Ida und grinst mich an.
„Den Elefantenmenschen hat John Hurt gespielt, mehr muss ich über mein Aussehen nicht wissen“, gebe ich zurück.