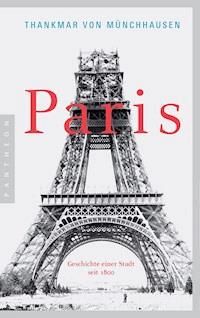
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das hinreißende Portrait der »Hauptstadt Europas«
Der Frankreichkenner und Paris-Liebhaber Thankmar von Münchhausen führt durch über 200 Jahre Geschichte der Stadt an der Seine: von Napoleons Selbstkrönung in Notre-Dame bis heute. Paris stand aber nicht nur stets im Zentrum großer politischer Umwälzungen. Es galt als Inbegriff der Lebensfreude, als »Hauptstadt des 19. Jahrhunderts«, war Gastgeber für sechs Weltausstellungen und Arbeitsfeld des Präfekten Haussmann. Paris ist die Stadt Victor Hugos, Baudelaires und der Impressionisten. Hier entwarf Coco Chanel Haute Couture für Frauen in aller Welt, hier schuf Picasso den Kubismus, und hier formulierte Sartre den Existenzialismus: Paris wirkte in die ganze Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
THANKMAR VON MÜNCHHAUSEN
Paris
Geschichte einer Stadtseit 1800
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Erste Auflage Pantheon-Ausgabe März 2017
Copyright © 2007 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, unter Verwendung einer Vorlage von independent Medien-Design Umschlagabbildung: © AKG-Images Karte Vorsatz: Nouveau Plan de Paris Monumental, Paris 1900 Karte Nachsatz: Paris heute, © Peter Palm, Berlin Typografie und Satz: DVA/Brigitte Müller
eISBN 978-3-641-21430-2V001
www.pantheon-verlag.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
»Ouvrons-nous Paris comme la fenêtre de notre grenier de souvenirs …« LÉON-PAUL FARGUE
Vorwort
Zahllose Bücher sind über Paris geschrieben worden, und jedes Jahr kommen neue dazu. Denn überall in der Welt gibt es Freunde und Bewunderer dieser einzigartigen Stadt. Am Anfang eines neuen Jahrhunderts wollen wir das Leben in Paris in seinen mannigfachen Erscheinungsformen beschreiben: während des Zeitraums von zweihundert Jahren, in dem sich die Stadtgestalt, wie sie uns heute vor Augen steht, entwickelt hat. Die eindringlichen Stimmen der Zeitgenossen erscheinen dabei aufschlußreicher als der Schulstreit der Nachgeborenen, auch wenn man – und wer wüßte das besser als der Chronist, der das politische Geschehen in der französischen Hauptstadt fast ein Vierteljahrhundert lang beobachtet hat – im Nachhinein meist klüger ist als im Augenblick der Ereignisse. Die Bibliographie der einzelnen Kapitel gibt Auskunft über die Quellen der Zitate.
Eine Stadtgeschichte sollte keine Nationalgeschichte sein. Im Fall von Paris ist das leichter gesagt als getan: Die meisten wichtigen Ereignisse in der Geschichte Frankreichs seit der Französischen Revolution hatten Paris zum Schauplatz, und manche von ihnen wären ohne die Mitwirkung des Volkes von Paris anders verlaufen. Seit Paris vor mehr als tausend Jahren die Hauptstadt Frankreichs wurde, nahm die Staatsführung immer wieder bestimmenden Einfluß auf ihre Geschicke. Der Erste Konsul Bonaparte gab der Hauptstadt im Jahr 1800 eine Verwaltungsspitze, die sie von allen anderen Gemeinden Frankreichs unterschied, erst seit 1977 darf Paris, dank einer Reform des Präsidenten Giscard d’Estaing, seinen Bürgermeister wählen. Die Modernisierung der jahrhundertealten Bausubstanz, die die »Ville lumière« in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur einzigen Weltstadt neben London werden ließ, war der Weitsicht Napoleons III. und der Tatkraft seines Präfekten Haussmann zu verdanken. Doch können die Eingriffe »von oben« die Ausstrahlung dieser Stadt nicht vollständig erklären. Die besondere Wirkung von Paris beruhte auf dem Nebeneinander von Altem und Neuem, auf der Schönheit der Stadtlandschaft und der historischen Bauwerke, auf der Vielfalt und Lebendigkeit seiner Gesellschaft, die immer neue Kräfte anzog, auf dem Schaffen von Künstlern, Literaten und Gelehrten, auf den Freiheitserwartungen, die sich mit dem Ort des Bastille-Sturms verbanden, auf den Leistungen des Kunsthandwerks und der Industrie, auf einer Lebenskunst und Lebensfreude, denen der Reichtum, den ein besitzbewußtes Großbürgertum und ein sparsames Kleinbürgertum über Generationen angesammelt hatten, die solide Grundlage bot. Der Paris-Mythos, eine Nostalgie eigener Art, vereinte die hellen und die dunklen Seiten urbanen Daseins: das hoffnungsfrohe »À nous deux, Paris!« wie den »Spleen«, die Einsamkeit in der Großstadt.
Man hat Paris im Rückblick die »Hauptstadt des 19. Jahrhunderts« genannt. Diese Benennung trifft zweifellos das Wesentliche, birgt aber die Gefahr einer Mumifizierung oder Musealisierung. Doch das Leben in Paris ging auch im 20. Jahrhundert weiter, wenn auch nicht mit der gleichen exemplarischen Bedeutung. Paris erlebte Höhepunkte wie die Weltausstellung 1937 oder die Bautätigkeit der Präsidenten Pompidou und Mitterrand und dunkle Jahre wie die Zeit der deutschen Okkupation oder des Algerienkriegs und sogar noch, im Mai 1968, eine verspätete »Revolution«. Es ist wenig ins allgemeine Bewußtsein gedrungen, daß die Stadtgestalt – glücklicherweise unter Schonung des historischen Kerns – in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nicht weniger großflächig verändert worden ist als zur Zeit des Präfekten Haussmann. Als Großraum gehört Paris zu den wichtigsten Wirtschaftsmetropolen der Welt. Das zweitausendjährige Paris darf auf eine glanzvolle Vergangenheit und in eine erfolgversprechende Zukunft blicken.
ERSTES BUCH
KAISERLICHE PLÄNE
Der Weg in die Tuilerien
Wer im Sommer des Jahres 1800 einen Blick über Paris tun wollte, hatte es nicht nötig, die Türme von Notre-Dame zu ersteigen. Es genügte, das Panorama zu besuchen, das der amerikanische Ingenieur Robert Fulton im Garten des einstigen Klosters der Kapuzinerinnen eingerichtet hatte, nicht weit von der Place Vendôme, die zu dieser Zeit noch die revolutionäre Bezeichnung »Platz der Piken« trug. Die neue Erfindung hatte einige Jahre früher jenseits des Kanals, in Edinburgh und London, Aufsehen erregt. Fulton, ein nicht übermäßig talentierter Maler und einfallsreicher Erfinder, brachte sie nach Paris. Wie die Ladenpassagen, die Gußeisenarchitektur und die Weltausstellungen gehört das Panorama zu den bezeichnenden Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Der gemalte Rundblick erschloß jedem Neugierigen, der in die hölzerne Rotunde eintrat und die zwanzig Stufen zu einer Plattform hinaufstieg, die Stadt. Da lag Paris in seinem Umfang von fünfeinhalb Meilen, optisch konzentriert. Der Blickpunkt entsprach dem von der Zentralkuppel des Tuilerien-Palastes, hätte der Beschauer dort hinaufsteigen dürfen. Doch davon konnte keine Rede sein. In dem einstigen Königsschloß residierte seit einigen Monaten ein neuer Herrscher: der Erste Konsul Napoleon Bonaparte.
Man blickt nach Westen, sieht die Kieswege, Rabatten und Springbrunnen des Tuilerien-Gartens. Dahinter die Place de la Concorde, die unter dem Ancien Régime den Namen Ludwigs XV. trug und zwischen 1792 und 1795 »Platz der Revolution« hieß. In der Verlängerung, sacht ansteigend, im Schmuck der Alleen auf beiden Seiten, die Champs-Élysées, die an der »Barrière de l’Étoile« enden. Zur Linken, nach Süden, glänzt die Seine. Die Kuppel des Invaliden-Doms grüßt herüber. Der Glockenturm von Saint-Germain-des-Prés, von dessen Höhe Heinrich IV. das belagerte Paris beobachtete. Die Doppeltürme von Saint-Sulpice. Auf der Montagne Sainte-Geneviève schimmert das Panthéon, als Kirche der heiligen Genoveva, der Schutzpatronin von Paris, gestiftet, 1791 zur Grab- und Gedenkstätte der »großen Männer der Epoche der Freiheit« bestimmt. Rundum drängen sich die Dächer des Quartier Latin, des Faubourg Saint-Jacques und des Faubourg Saint-Marcel. Wendet man sich 180 Grad nach Osten erblickt man die Türme der Kathedrale Notre-Dame, das Wahrzeichen von Paris, der gedachte Mittelpunkt Frankreichs. Ein Blick noch über den Palais-Royal hinweg nach Norden: zum Montmartre, dem »Berg des Merkur« der Römer, dem »Berg der Märtyrer« der ersten Christen.
In dieser Stadt war in den vergangenen Jahren viel geschehen, mehr als je zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum: der Sturm auf die Bastille, die Erklärung der Menschenrechte, das Wüten der Sansculotten und der Terror der Jakobiner, der Tod Ludwigs XVI. unter der Guillotine, der Sturz Robespierres und seiner Helfer, die Bemühungen des Direktoriums, sich an der Macht zu halten. Seit 1789 war Paris nicht zur Ruhe gekommen: erregt durch tönende Reden, erschreckt durch blutige Taten, im allgemeinen Elend erschöpft. Nun überließ sich die Hauptstadt wie das ganze Land dem neuen Machthaber mit der Hoffnung, er werde der Revolution ein Ende setzen.
Das Verhältnis Bonapartes zu Paris war durch frühe Eindrücke geprägt. Im Oktober 1784 war der Zögling der Kadettenanstalt Brienne in der Champagne nach Paris gekommen. Ein Jahr später verließ er als Artillerieleutnant die Militärschule, um in ein Regiment in Valence einzutreten. Fünfzehn Jahre zählte Bonaparte, als er zum erstenmal die Türme von Notre-Dame erblickte. Fünfzehn Jahre später machte er sich zum Herren der Stadt und des ganzen Landes.
Im Herbst 1787 kam Leutnant Bonaparte für ein Vierteljahr zum zweitenmal nach Paris. Er wohnte in einem billigen Hotel in der Rue du Faubourg Saint-Honoré, aß für sechs Sous in schlechten Speiselokalen und hatte sein erstes Abenteuer mit einer Prostituierten, die er im Palais-Royal ansprach. Bei seinem dritten Pariser Aufenthalt im Sommer 1792 erlebte Bonaparte den Sturz der Monarchie. Am 20. Juni wurde er Zeuge, wie eine Volksmenge in das Königsschloß eindrang. Eine rote Jakobinermütze auf dem Kopf, zeigte sich der König am Fenster. Dieser Vorfall war die Generalprobe für den blutigen Sturm auf die Tuilerien und die Gefangennahme der Königsfamilie am 10. August 1792. Bonaparte beobachtete den Kampf aus einem der Häuser, die damals noch die Place du Carrousel umgaben und einen guten Blick auf das Hauptportal des Palastes boten. Der Anblick der verstümmelten Leichen der ermordeten Schweizer Gardisten erschütterte den künftigen Schlachtenlenker, der noch kein Schlachtfeld gesehen hatte.
Die Erfahrung, daß bei Aufständen hart durchgegriffen werden mußte, prägte sich dem Soldaten ein. Die Notwendigkeit dazu ergab sich drei Jahre später, als sich der Nationalkonvent, der im Nordflügel der Tuilerien tagte, im Oktober 1795 durch die Gegenrevolution bedroht sah. Der Vorsitzende Barras, der sich im Vorjahr bei der Beendigung der Schreckensherrschaft Robespierres umsichtig und energisch gezeigt hatte, übernahm den Oberbefehl über die Truppen in Paris und ernannte General Bonaparte zu seinem militärischen Stellvertreter. Am Nachmittag des 6. Oktober entbrannte der Kampf an der Place du Carrousel. Auf den Stufen der Kirche Saint-Roch in der Rue Saint-Honoré wurden die letzten Königstreuen von Geschützen niedergestreckt, die der Reiteroffizier Murat auf Bonapartes Befehl rechtzeitig herangeschafft hatte. »Nach mehreren Schüssen war Saint-Roch genommen. Um sechs Uhr war alles zu Ende. Der größte Teil der Getöteten oder Verwundeten fand sich an den Türen von Saint-Roch« berichtete der Sieger. Die Kirchenfassade zeigt noch die Spuren des Kampfes.
Durch sein entschlossenes Eingreifen machte sich Bonaparte zum Mithandelnden im großen Machtspiel. Barras verhalf ihm zunächst zum Oberbefehl über die Armee des Innern. Mit dem Hungerdasein war es vorbei. Dem Divisionsgeneral stand eine Dienstwohnung an der Place Vendôme zur Verfügung, wo sich fünfzehn Jahre später die Siegessäule mit dem Standbild des Kaisers Napoleon erhob. Der neue Befehlshaber beschränkte sich nicht auf das Militärische. Er kümmerte sich um die Nationalgarde, die Verwaltung, die Versorgung der Bevölkerung, ermunterte die Arbeiter in den Vorstädten, zeigte sich überall. Im März 1796 erhielt der General den Oberbefehl über die Armee, die in Italien gegen die Österreicher kämpfte. Auf der Bürgermeisterei des Bezirks schloß er den Ehebund mit der lebenslustigen Witwe Joséphine de Beauharnais, die bis vor kurzem die Geliebte seines Gönners Barras gewesen war. Joséphines Haus in der Rue Chantereine, ein geselliger Mittelpunkt der Pariser Gesellschaft, wurde der gemeinsame Wohnsitz. Nach den ersten Siegen Bonapartes in Italien erhielt die Straße (im heutigen 9. Arrondissement) den Namen Rue de la Victoire, der ihr geblieben ist. Aber die Feldzüge in Italien und in Ägypten ließen dem Ehrgeizigen wenig Zeit für Häuslichkeit und Eheglück.
Im Oktober 1799 kehrte General Bonaparte überraschend aus Ägypten zurück. »Nichts kommt der Freude gleich, die die Rückkehr Bonapartes verbreitet … In den Schenken trinkt man auf diese Rückkehr; auf der Straße singt man Lieder darüber«, hieß es in einem Zeitungsbericht. Angesichts dieser Stimmung konnte es das Direktorium nicht wagen, den Heerführer, der seine Soldaten in aussichtsloser Lage in Afrika zurückgelassen hatte, zur Rechenschaft zu ziehen. Die Regierung hatte durch Mißwirtschaft und Korruption wie durch militärische Rückschläge das Vertrauen der Bevölkerung verloren. Drei Wochen genügten Bonaparte und seinen Helfern, um den Staatsstreich vom 18. und 19. Brumaire (9. und 10. November) in die Wege zu leiten.
Wie so oft in der Geschichte Frankreichs wurde auch diesmal in Paris über den Besitz der Macht entschieden. Paris war die Bühne. Die einzelnen Szenen spielten in Joséphines Haus, im Palais du Luxembourg, der Residenz des Direktoriums, in den Tuilerien und im Palais-Bourbon, wo der »Rat der Alten« und der »Rat der Fünfhundert« ihren Sitz hatten. Aber auch in den Offizierskasinos und den Häusern einflußreicher Bankiers. Bei einem Festessen, das der Rat der Alten drei Tage vor dem Staatsstreich für Bonaparte gab, saßen die Teilnehmer in der zum »Tempel des Sieges« erklärten Kirche Saint-Sulpice fröstelnd nebeneinander. Keiner traute dem anderen. Der letzte Akt spielte im Schloß von Saint-Cloud, einem prachtvollen Bau aus der Zeit Ludwigs XIV. Dorthin waren die Volksvertreter zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengerufen worden, dort wurden die Widerstrebenden am Spätnachmittag von Grenadieren mit dem Bajonett auseinandergetrieben, während die Willigen das fünfköpfige Direktorium durch ein dreiköpfiges Konsulat ersetzten, dessen Leitung Bonaparte übernahm. Am nächsten Abend war die Stadt festlich beleuchtet. Von Soldaten und Musikkapellen begleitet, verlasen Beamte auf Straßen und Plätzen das Gesetz über die Einführung des Konsulats. Die konstitutionelle Fassade, auf die Bonaparte Wert legte, täuschte über den wahren Charakter des Regimes nicht lange hinweg. Doch das Volk war mit der Veränderung einverstanden. Es erhoffte von dem neuen Machthaber: Ruhe, Wohlstand und Frieden.
Der neue Hof
Der Erste Konsul bezog zunächst das Petit-Luxembourg, ein Nebengebäude des Palais du Luxembourg, vormals die Residenz des späteren Ludwig XVIII., der 1791 ins Exil gegangen war. Ein Vierteljahr später, am 19. Februar 1800, zog General Bonaparte mit militärischem Gepränge in den Tuilerien-Palast ein, den die Königinmutter Katharina Medici in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts westlich des Louvre hatte erbauen lassen. Die über vierhundert Meter lange Große Galerie oder Ufer-Galerie, ein Auftrag Heinrichs IV., stellte die Verbindung zwischen den Tuilerien und dem Louvre her. Von dem dreihundert Meter langen Palast, der 1871 der Zerstörungswut der Pariser Kommune zum Opfer fiel, zeugen nur noch der Pavillon de Marsan und der Pavillon de Flore, die seinen nördlichen und südlichen Abschluß bildeten. Kurz vor dem Einzug ließ Bonaparte die »Freiheitsbäume« im Schloßhof fällen und eine revolutionäre Parole übermalen. Auch die sitzende Freiheitsgöttin auf der Place de la Concorde verschwand wie von Zauberhand. Der neue Hausherr bezog im ersten Stockwerk das Appartement des letzten Königs und traf Anordnungen für die Verwendung der Räume: das Arbeitszimmer, daneben der Kartenraum, das Schlafzimmer. Joséphine richtete sich in dem Appartement im Erdgeschoß ein, das vor ihr die Königin Marie Antoinette bewohnt hatte.
»Es genügt nicht, in die Tuilerien zu kommen. Man muß auch dort bleiben«, bemerkte Napoleon am Abend nach dem Einzug in das einstige Königsschloß zu seinem Sekretär Louis de Bourrienne, einem früheren Kameraden aus der Kadettenanstalt. Der Tagesablauf des Ersten Konsuls war streng geregelt. Um sieben Uhr morgens, nach dem Wecken, ließ sich Napoleon aus den Zeitungen vorlesen und prüfte die Polizeiberichte. Nach acht Uhr diktierte er im Arbeitskabinett Briefe. Der Befehlsausgabe an die diensthabenden Offiziere um neun Uhr folgte die Audienz der Würdenträger und hervorragend Begünstigter (»les grandes entrées«). Napoleon liebte es, sich beim anschließenden Déjeuner um zehn Uhr mit Gelehrten, Künstlern und Architekten zu unterhalten. Die Zeit bis zum späten Nachmittag füllten Unterredungen mit Ministern und hohen Beamten und das Diktieren von Anweisungen, wenn nicht die wöchentlichen Sitzungen des Ministerrates und des Staatsrates anberaumt waren. Seine erstaunliche Arbeitsleistung erklärte Napoleon selbst mit dem systematischen Wechsel von einem Fachbereich zum anderen. Am Abendessen, das um sieben Uhr begann, nahm der Hausherr selten länger als eine Viertelstunde teil. Konzerte und Ballet, Theateraufführungen und Bälle sorgten für Zerstreuung. Napoleon widmete sich solchen Vergnügungen mit dem gleichen Pflichtgefühl wie der Jagd, dem Sport der Könige. Das prachtvolle Kartenwerk der königlichen Jagdreviere um Paris, der »Chasses du Roi«, das unter Ludwig XV. begonnen worden war, wurde vierzig Jahre später unter Napoleon vollendet. Im Schloß von Saint-Cloud und auf dem Landsitz Malmaison westlich von Paris, den Joséphine 1799 erworben hatte, ging es intimer zu. Doch auch dort behielt die selbstgesetzte Ordnung ihre Gültigkeit.
Als Erster Konsul begnügte sich Napoleon anfangs mit einem »gewissen Dekorum«. Seine persönlichen Bedürfnisse waren einfach. Aber, wie er Bourrienne auseinandersetzte: »Das Direktorium war zu schlicht, deshalb genoß es kein Ansehen. In der Armee ist Einfachheit angebracht. In einer großen Stadt, in einem Palast, muß der Regierungschef die Blicke mit allen Mitteln auf sich ziehen. Aber man muß dabei vorsichtig zu Werke gehen.« Als sich Napoleons Absichten zur Wiederherstellung der erblichen Monarchie deutlicher abzeichneten, fand die höfische Etikette wieder Eingang in die Tuilerien. Die Anrede »Citoyen« und das kameradschaftliche Du waren nun seltener zu hören. Nach dem Frieden von Amiens 1802 unterschied sich die Hoftracht mit Kniehosen, Zierdegen und unter dem Arm zu tragendem Hut für die Herren, Schleppenkleidern für die Damen, Livreen für die Dienerschaft, kaum von der des Ancien Régime. Der ehemalige Tanzlehrer Königin Marie Antoinettes brachte den ungeübten Damen den Hofknicks bei. Bei der Sonntagsmesse in der Schloßkirche nahm Napoleon auf erhöhtem Sitz gegenüber dem Hochaltar seinen Platz ein – wie einst der König.
Den Höhepunkt der Selbstdarstellung bildete die Kaiserkrönung am 2. Dezember 1804. Vorangegangen war die Entscheidung des Senats, den Ersten Konsul als Napoleon I. zum »Kaiser der Franzosen« zu proklamieren. Aber damit kam die Erste Kammer nur dem Verlangen des Betroffenen nach. In einem Referendum durften die Wahlberechtigten der Einführung der Erbmonarchie zustimmen. In Paris gab es gegenüber 122711 Ja-Stimmen nicht mehr als 81 Nein-Stimmen, kein Wunder, da die Abstimmung durch namentliche Eintragung in die amtlichen Listen erfolgte. Als Ort der feierlichen Handlung schlug der Staatsrat das Champ-de-Mars auf dem linken Seine-Ufer vor, Napoleon bestimmte die Kathedrale Notre-Dame. Für den Eroberer Italiens bedeutete die Teilnahme des Papstes einen besonderen Triumph. Pius VII. mußte in der winterlich kalten Kirche am Hochaltar auf die Ankunft des Krönungszuges warten. In der mehrstündigen Zeremonie, die sich bis in den späten Nachmittag hinzog, sprach Pius die überkommenen Gebete mit einigen diplomatischen Abwandlungen, segnete die von dem Goldschmied Martin-Guillaume Biennais eigens für diese Gelegenheit angefertigte neue »Krone Karls des Großen« und die übrigen Herrschaftsinsignien und salbte Stirn und Hände des Kaisers. Dem Papst den Rücken zuwendend, krönte Napoleon zuerst sich selbst, dann die Gemahlin. Der Hofmaler David verewigte den feierlichen Augenblick auf einem Riesengemälde (im Louvre) für die Nachwelt.
Beibeginnender Dunkelheit bewegte sich der Krönungszug der acht- und sechsspännigen goldschimmernden Karossen, angeführt von fünfhundert Fackelträgern und begleitet von Kürassieren und Mamelucken, über die Großen Boulevards und die Place de la Concorde zurück zu den Tuilerien. Wie nach dem Staatsstreich zogen am folgenden Tag Musikkapellen auf Festwagen durch die Stadt. Von der Place de la Concorde stiegen fünf trophäengeschmückte Fesselballons auf: das Vorspiel für das Feuerwerk, das eine leuchtende Krone an den Nachthimmel zauberte. In den folgenden Tagen verlieh der Herrscher den Regimentern auf dem Champ-de-Mars die neuen Feldzeichen und empfing im Antiken-Saal des Louvre die Abordnungen der Armee. Das Kaiserpaar wurde feierlich im Rathaus begrüßt und wohnte in der Oper der ersten Pariser Aufführung von Mozarts »Requiem« bei. So konnten die Pariser, unter die sich Abordnungen und Neugierige aus dem ganzen Land mischten, mehrmals an dem großen Ereignis teilhaben und ihre Freude darüber bekunden. Die Krönung war auch eine Probe für die Volkstümlichkeit des Kaisers der Franzosen. Napoleon konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Mit dem Kaisertum kamen auch die alten Hofämter vom Großmarschall des Palastes bis zum Pagen wieder zur Geltung. Die Aufzählung der Hofhaltungen des Kaisers, der Kaiserin und der Mitglieder der kaiserlichen Familie im »Almanach imperial« füllt dreißig Seiten. Der Zugang zu Hofe, die »Hoffähigkeit«, unterlag freilich anderen Regeln als früher: nicht das Vorrecht adliger Geburt gab den Ausschlag, sondern geleistete oder zu erwartende Dienste. Und noch etwas hatte sich geändert. Im Unterschied zum Hof von Versailles führte der Hof der Tuilerien sein Dasein mitten in der lebhaften Hauptstadt und in gesellschaftlichem Wettbewerb mit ihr. »An den früheren Höfen war die wirkliche Macht konzentriert«, stellte Napoleon nach seinem Sturz fest. »Man sagte: der Hof [von Versailles] und die Stadt [Paris]. Jetzt müßte man richtiger sagen: die Stadt und der Hof.«
Hinter dem Gepränge stand der Wille, die neue Dynastie auf feste Grundlagen zu stellen und die zerrissene Nation zu einen. Napoleon begnügte sich nicht damit, seine Brüder und Verwandten zu Herrschern eroberter Länder zu machen. Er schuf mit Fürsten-, Herzogs-, Grafen- und Baronstiteln einen neuen Adel, um den Ehrgeiz seiner Gefolgschaft zu befriedigen, allen voran die Marschälle, die Garanten seines Kriegsglücks. »Ich wollte durch sie große Familien begründen, wirkliche Stützpunkte und Bannerträger in nationalen Krisen«, rechtfertigte er sich. Der kaiserliche Adel stammte zu einem guten Fünftel aus dem alten Adel, zur guten Hälfte aus dem Bürgertum, zu einem knappen Fünftel aus dem Volk. 1802 hatte der Erste Konsul den Orden der Ehrenlegion gegründet, eine Elite der Nation. Der Sitz der Ordenskanzlei befand sich im Hotel de Salm in der Rue de Lille, einem hübschen klassizistischen Palais, mit dessen Bau sich gegen Ende des Ancien Régime der Rheingraf Friedrich von Salm-Kyrburg verausgabt hatte. Der Bauherr konnte sein Haus nur als Mieter bewohnen, bis er als eines der letzten Opfer unter der Guillotine starb.
»Napoleon liebte einen glänzenden Hof, alle Hofchargen erhielten ein hohes Gehalt, und er erwartete von den Inhabern erhebliche Aufwendungen. Um ihm zu gefallen, mußte man ein großes Haus führen, elegante Equipagen halten, große Feste geben und viele Gäste empfangen«, erinnerte sich die Gattin des General Durand. Geldgeschenke von einer halben Million Franc und mehr setzten die Begünstigten in die Lage, Häuser in Paris und Schlösser in der Umgebung zu erwerben. So sollte der neue Adel mit der Hauptstadt wie mit der Provinz verbunden werden, wie es die Häupter des alten Adels waren. Die neuen Machthaber traten lieber als Käufer denn Bauherren in Erscheinung, vielleicht, weil sie dem Glück nicht trauten, sicher jedoch, weil das Angebot groß war. Im Faubourg Saint-Germain und im Faubourg Saint-Honoré standen viele Häuser von Emigranten leer.
Der Außenminister Talleyrand kaufte von einer italienischen Tänzerin das größte Palais des Faubourg Saint-Germain, das Hotel de Matignon in der Rue de Varenne und verkaufte es fünf Jahre später an den Staat. In der Folgezeit wechselte das Palais mehrmals den Eigentümer, bis es 1935 der Amtssitz des Ministerpräsidenten wurde. Napoleons Stiefsohn Eugène de Beauharnais erwarb 1803 für fast 200 000 Franc ein Stadtpalais in der Rue de Lille. Die Verkäufer waren zwei Spekulanten, die das Anwesen aus dem beginnenden 18. Jahrhundert von den Erbinnen des letzten vorrevolutionären Eigentümers, des Herzogs von Villeroy, billig erworben hatten. Eugène de Beauharnais überließ das Haus seiner Mutter, die mit großem Aufwand die Instandsetzung betrieb. »Man überreicht mir eine Kostenrechnung von 1 500 000 Franc für Ihr Haus. Diese Summe ist enorm … Der Architekt hat sich genommen, soviel er wollte, und nun sind immense Summen in den Fluß geworfen«, tadelte der Kaiser den Stiefsohn in einem Schreiben. Im Jahr 1818 kaufte Friedrich Wilhelm III., der König von Preußen, das Palais samt Mobiliar für 575 000 Franc. Das Hotel de Beauharnais, eines der elegantesten Beispiele des Empire-Stils, diente seither als preußische Gesandtschaft und deutsche Botschaft und erfreut als schönste Botschafterresidenz der Bundesrepublik Deutschland jeden Besucher.
Mit einem Wunsch konnte sich der Herrscher nicht durchsetzen: mit der Versöhnung des alten und des neuen Adels. Die Voraussetzung dafür bot der Erlaß über die Rückkehr der Emigranten vom 20. Oktober 1800: ein Schritt zur Überwindung des beiderseitigen Hasses. Die Behörden verhielten sich gegenüber den Zurückgekehrten mißtrauisch und machten ihnen Schwierigkeiten, wo es ging. Napoleon ließ nichts unversucht, die Aristokraten für sich zu gewinnen. Hofämter besetzte er gern mit Trägern großer Namen. An der hochmütigen Zurückhaltung der Älteren stießen sich die Karrierehoffnungen der Jüngeren, die ihre Begeisterung für das Genie Napoleons in ihren Kreisen nicht zeigen durften. »Die Deserteure wurden bei uns nicht schlechter empfangen, vorausgesetzt, sie vertauschten ihre Kammerherren-Uniform gegen den üblichen Frack, bevor sie unsere Salons betraten und redeten von dem Herrn und Meister, den sie eben noch beweihräuchert hatten, alles Schlechte«, schrieb der Baron de Frénilly, ein eingefleischter Royalist. Ein Staatsverbrechen wie die Entführung und Erschießung des Herzogs von Enghien 1804 steigerte die Verbitterung. Doch die Eheschließung Napoleons mit der österreichischen Kaisertochter Marie Louise im Jahr 1810 beschwichtigte manche Vorbehalte. Durch die Spitzelberichte des Polizeiministers Fouché war Napoleon über die politisch folgenlose Stimmung des Faubourg Saint-Germain genau unterrichtet. Auch die Großen des Kaiserreiches blieben entgegen dem ausdrücklichen Wunsch Napoleons lieber unter sich. Beim gesellschaftlichen Verkehr zeigten sich die Grenzen des despotischen Willens.
Im Zentrum der Macht
Das Verhältnis Napoleons zu Paris und seinen Einwohnern war und blieb zwiespältig. Der Herrscher war sich bewußt, daß diese Ansammlung einer halben Million unruhiger Menschen auf engem Raum ständige Aufmerksamkeit erforderte. Die Ausschreitungen der jüngsten Vergangenheit waren noch in frischer Erinnerung. Der Erste Konsul ließ sich Unterlagen über die Ereignisse in Paris während der Revolution vorlegen und gelangte zu dem überraschenden Ergebnis: »Ich muß zur Entlastung des Volkes dieser Stadt im Hinblick auf die anderen Nationen und im Hinblick auf die Zukunft erklären, daß die Anzahl der schlechten Bürger immer äußerst klein gewesen ist. Von vierhundert waren mehr als zwei Drittel Fremde, wie ich mich überzeugt habe; nur sechzig bis achtzig von ihnen haben die Revolution überlebt.« Aber das Mißtrauen gegen die »Canaille« blieb. Vor der Kaiserkrönung äußerte Napoleon im Staatsrat Zweifel, ob Paris der geeignete Ort für die Zeremonie sei: »Diese Stadt war immer Frankreichs Unglück! Ihre Einwohner sind undankbar und leichtsinnig … Ich würde mich ohne eine starke Garnison in Paris nicht sicher fühlen; aber ich habe zweihunderttausend Mann unter meinem Befehl, und fünfzehnhundert würden genügen, um die Pariser zur Räson zu bringen.« Als Hauptstadt wollte Napoleon unter Umständen der Wirtschaftsmetropole Lyon den Vorzug geben, das auch dem eroberten Italien näher lag als die Stadt an der Seine. Es darf bezweifelt werden, daß solche Erwägungen mehr waren als innenpolitische Drohungen. Paris – mehr noch die Stadt der Zukunft, die Napoleon plant als die Stadt der Gegenwart – war als Kapitale des Kaiserreiches unersetzlich.
Aber Napoleon wünschte eine ruhige, eine unterwürfige Hauptstadt. Konnte er sicher sein, daß der Vulkan der Revolution erloschen war? Der Staatsstreich des 19. Brumaire war nach Saint-Cloud verlegt worden, weil der Urheber Reaktionen der Pariser Bevölkerung befürchtete. Die Sanierung der Umgebung des Louvre und der Tuilerien mit der Anlage der Rue de Rivoli diente der Sicherheit des Staatschefs. Der Palast des Thronfolgers auf der Anhöhe von Chaillot, den der Kaiser plante, war zugleich eine Zitadelle, von der aus Paris beherrscht werden konnte. Wie der Erste Konsul achtete der Kaiser auf die Stimmung in Paris. Die Polizeiberichte informierten ihn täglich über alles, was in der Hauptstadt vorging. Mit dem Instrument der Presse- und Theaterzensur dämpfte er eventuelle Mißstimmung. Dabei war sich Napoleon der Unbeständigkeit der Volksgunst stets bewußt. »Man behält in Paris nichts im Gedächtnis«, bemerkte der Erste Konsul gegenüber Bourrienne. »Wenn ich längere Zeit nichts unternehme, bin ich verloren. In diesem großen Babylon löst ein Ruhm den anderen ab. Wenn man mich dreimal nicht im Theater gesehen hat, beachtet man mich nicht mehr.« Solche Sorgen waren auch dem Kaiser nicht fremd.
Der Versorgung der Bevölkerung und der Beschaffung von Arbeit maß Napoleon größte Wichtigkeit bei. Hatten nicht Mißernten, Teuerung und Hungerrevolten den Sturz des Königtums eingeleitet? Den Brotpreis beobachtete der Herrscher mit der gleichen Aufmerksamkeit wie den Kurs der Staatsanleihen. Die Prachtentfaltung des Hofes sollte auch dem Geschäftsleben, dem Kunsthandwerk und den Manufakturen zugute kommen. Lästige Tadler wurden mit der Verbannung aus Paris bestraft, wo kritische Äußerungen den größten Widerhall fanden. Solche Ungnade erfuhr 1803 die Schriftstellerin Germaine de Staël, deren Salon ein Treffpunkt der liberalen Opposition war. Das Erscheinen ihres – umgehend verbotenen und eingestampften – Buches »De l’Allemagne« im Jahr 1810 zeigte dem Kaiser, daß es ihm nicht gelungen war, die geistreiche Widersacherin mundtot zu machen. Ihre Freundin Madame Récamier traf 1811 ähnliche Rache.
Bis zur Revolution war Paris »nur« die größte Stadt Frankreichs, der Mittelpunkt des geistigen und wirtschaftlichen Lebens. Paris als Sitz der Zentralverwaltung war eine revolutionäre Neuerung. Unter dem Ancien Regime arbeiteten die Ministerien, das Justizministerium an der Place Vendôme ausgenommen, in Versailles, in der Nähe des Königs. Der vom Pöbel erzwungenen Übersiedlung Ludwig XVI. in die Tuilerien im Oktober 1789 folgte die Verlegung des Regierungsapparats nach Paris. Eine kluge Entscheidung des Wohlfahrtsausschusses bestimmte, daß die zwölf Ministerien gehalten waren, die enteigneten Stadtpalais der Emigranten zu nutzen und damit »den herrlichen Gebäuden, die die Nation besitzt, Wert zu geben«. Die meisten Ministerien ließen sich im Faubourg Saint-Germain nieder. Nur das Finanzministerium richtete sich auf dem rechten Ufer ein, dem Zentrum des Wirtschaftslebens. Napoleon perfektionierte den Zentralismus der Jakobiner. Die Präfekten, die Vertreter des Staates in den Départements, waren dem Innenminister verantwortlich und in letzter Instanz dem Kaiser. Zu ihren Aufgaben gehörte es, die Zentrale über die Vorgänge im Lande und die Stimmung der Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten.
Nicht die Bourgeoisie, sondern die Staatsbeamten bildeten die »neue Klasse« des Kaiserreichs. Unter dem Ancien Regime begnügten sich die Minister mit einem kleinen Stab von Mitarbeitern. Jetzt waren 25 000 Beamte in der Hauptstadt beschäftigt, mehr als die Hälfte der insgesamt 40 000 Staatsdiener. Die Bezüge in der Hauptstadt waren höher als in der Provinz. Nie davor oder danach genossen die Beamten so großes Ansehen. Die Uniform und die blau-weiß-rote Amtsschärpe gaben ihnen den Anschein, an der Macht des Kaisers teilzuhaben. »Wer nicht einen Säbel oder eine Dienstuniform trug, galt nichts«, spottete der zum Theaterschriftsteller mutierte Straßenbauingenieur Alexandre Duval. Der Kaiser verstand es, den Eifer seiner Beamten anzuspornen. Alle Minister waren mit Arbeit überlastet.
Mit der Macht der staatlichen Entscheidungsträger konnte sich der Einfluß der Legislative nicht messen. Die »Gesetzgebende Körperschaft«, die den »Rat der Fünfhundert« ablöste, behielt ihren Sitz im Palais-Bourbon am linken Seine-Ufer. Der Name des Gebäudes erinnerte an Louis von Bourbon, Prinz von Condé, den Bauherren. Die antikisierende Tempelfassade erhielt der langgestreckte Bau auf Befehl Napoleons. Spötter nannten die Gesetzgebende Körperschaft die »dreihundert Stummen«. Der Kaiser fand es einfacher, mit Verordnungen und Senatsbeschlüssen zu regieren. Der Senat, der 1811 zur Pairs-Kammer wurde, zog aus den Tuilerien in das Palais du Luxembourg, das Maria Medici, die Witwe Heinrichs IV., nach dem Vorbild des Palazzo Pitti gebaut hatte und das bis vor kurzem als Sitz des Direktoriums gedient hatte. Die beiden beratenden Körperschaften behinderten sich gegenseitig und überließen der Staatsspitze um so mehr Befugnisse.
Neben den militärischen Erfolgen hing die Machtstellung des Kaisers vor allem vom Besitz der Hauptstadt ab. Trotzdem brach Napoleon immer wieder zu Feldzügen auf, die ihn bis Wien und Berlin, bis Madrid und Moskau führten. Dabei ließ er Paris in den Händen von Helfern zurück, auf die nicht unbedingt Verlaß war. Es wirkt erstaunlich, daß der Kaiser darauf verzichtete, Paris durch eine starke Truppe zu sichern. Er sah die Armee, mit deren Hilfe er an die Macht gekommen war, lieber im Feld als in der Hauptstadt. Die Pariser Garnison unter dem Befehl des Militärgouverneurs zählte achttausend Mann. Die kaiserliche Garde bezog die leerstehende Militärschule als Kaserne. Dem unmittelbaren Schutz des Herrschers diente eine Abteilung Grenadiere im neuen Westflügel des Louvre. Von den neun Jahren auf dem Thron verbrachte der Eroberer keine neunhundert Tage in seiner Hauptstadt. Im Dezember 1812 jagte er in Eilfahrten aus Rußland nach Paris zurück, wo ihn Verschwörer schon für tot erklärt hatten. In den Zeiten der Gefahr 1813/14 zeigte sich der Kaiser in schlichter Uniform in den Vorstädten, sprach mit den Arbeitern, verteilte Geld. Aber die »levée en masse« zur Vertreibung der Feinde, wie im Revolutionsjahr 1792, ließ er sich ausreden. Dabei hielt das einfache Volk bis zuletzt zum Kaiser, während das Bürgertum nur noch auf Frieden hoffte und der Adel die Rückkehr der Bourbonen ersehnte.
Paris war nicht nur die Hauptstadt Frankreichs, sondern die Hauptstadt des »Grand Empire«, das auf dem Höhepunkt seiner Macht die Hälfte Europas umfaßte: 130 Départements, von denen die letzten durch die Aneignung des Kirchenstaates, des Königreichs Holland, der Fürstentümer Hannover und Oldenburg, der Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck mit ihrem Hinterland entstanden waren. Darum gruppierten sich die Rheinbund-Staaten, die Schweiz und die Königreiche Italien und Neapel. Für seinen Sohn und Erben sah der Kaiser, schon vor dessen Geburt, einen europäischen Bundesstaat unter Frankreichs Führung voraus, mit Paris als Mittelpunkt: »Ich brauche ein europäisches Gesetzbuch, ein europäisches Oberstes Gericht, gleiche Währung, gleiche Maße und Gewichte. Ich muß aus allen Völkern Europas ein Volk machen und aus Paris die Hauptstadt der Welt.« Die wichtigsten der siebenundzwanzig Reichsstraßen griffen weit über die Grenzen hinaus: über Brüssel und Antwerpen nach Amsterdam (Nr. 2); über Soissons und Lüttich nach Bremen und Hamburg (Nr. 3); über den Simplon-Paß nach Rom und bis Neapel (Nr. 6); über Bayonne nach Spanien (Nr.11). Jeden Tag gingen Postkutschen nach Mailand und Amsterdam. Der Kurierdienst sorgte für schnellstmögliche Befehlsübermittlung. Die optischen Telegrafen, die auf dem Dach der Telegrafen-Verwaltung in der Rue de l’Université, auf den Türmen von Saint-Sulpice, auf dem Marine-Ministerium an der Place de la Concorde und auf der Höhe von Montmartre die hölzernen Arme bewegten, übermittelten militärische und amtliche Nachrichten nach Lille, Calais, Brest, Straßburg oder Lyon und weiter nach Italien. Doch die Geschäftswelt profitierte nicht von dieser Neuerung.
Das Geld und die Arbeit
Das große Geld, die eigentliche Macht des 19. Jahrhunderts, trat während des Kaiserreichs noch wenig in Erscheinung. Aber es war schon da. Heereslieferanten verdienten am Krieg, Spekulanten an Assignaten und Kolonialwaren, Bankiers an den Krediten, die sie dem Staat einräumen mußten. Ihre Vorgänger waren die Steuerpächter gewesen, die unter dem Ancien Regime das Kapital verkörperten. Der Faubourg Saint-Honoré und die Chaussee d’Antin, das spätere Quartier de l’Opera, waren die bevorzugten Wohnviertel der Reichen, wie der Faubourg Saint-Germain das des Adels. Das Direktorium verhalf ihnen zu raschen Gewinnen, die in schamloser Offenheit genossen wurden. Aber auch die geordneten Verhältnisse, in denen man nun lebte, hatten ihre Vorteile. Die Kurse der Staatsanleihen stiegen zwischen 1800 und 1810 von 20 Franc auf 80 Franc. Am Steigen und Fallen der Kurse ließ sich das Vertrauen der Geschäftswelt zum Kaiser ablesen. Bei alledem fühlte sich die Bourgeoisie zurückgesetzt.
Die Gründung der Bank von Frankreich am 6. Januar 1800 sollte dem Pariser Geldmarkt größere Sicherheit geben. Einige Bankiers hatten das staatlich geförderte Privatunternehmen vorbereitet, das die Form einer Aktiengesellschaft mit 30 000 Anteilen zu 1000 Franc annahm, an der sich auch die Familie Bonaparte beteiligte. Drei Jahre später erhielt die neue Bank das Privileg der Ausgabe von Banknoten. Ein Aufsichtsrat von fünfzehn »Regenten« leitete die Geschäfte. Die zweihundert größten Aktionäre vertraten die Gesamtheit der Teilhaber. Seither sprach man in Frankreich von der Herrschaft der »zweihundert Familien«. Seit 1806 übte der Staat durch den von ihm ernannten Gouverneur und zwei Untergouverneure die Kontrolle aus. Die Zentralbank diente in erster Linie der Regierung und erreichte niemals die Unabhängigkeit der Bank von England. Der Sitz befindet sich an der Place des Victoires, im Hôtel de Toulouse, das ein Sohn Ludwigs XIV. und der Madame de Montespan gebaut hatte und das für eine dem Schloß von Versailles nachempfundene Galerie berühmt ist.
Eine Börse gab es in Paris seit 1724. Ihr Standort war bis 1793 die Galerie Vivienne, ein Flügel des Palais Mazarin, der späteren Nationalbibliothek. Danach war sie in den Räumen des Louvre, in der Kirche Notre-Dame-des-Victoires und von 1809 bis 1818 im Palais-Royal untergebracht. Die Wankelmütigkeit der Börse erfuhr der Kriegsherr 1805 und 1809. Erst die Siege von Austerlitz und Wagram hielten in den beiden Jahren den Kurssturz auf. Napoleon mißtraute den »agioteurs«, den Börsenspekulanten, zutiefst und beschränkte ihre Zahl auf achtzig. Andererseits wollte er Paris zu einem wichtigen Börsenplatz machen: »Ich habe die Absicht, eine Börse bauen zu lassen, die der Bedeutung der Hauptstadt und dem Umfang der künftigen Geschäfte entspricht.« Als Baugrundstück wurde das ehemalige Kloster Sankt Thomas der Dominikanerinnen ausgesucht, im Geschäftszentrum günstig gelegen. 1814 unterbrach der Krieg die Bauarbeiten. Die Börse in Gestalt eines antiken Tempels wurde erst gegen Ende der Restaurationszeit vollendet. »Die Börse ist das Denkmal der modernen Gesellschaft par excellence«, schrieb eine Generation später der Sozialist Proudhon in seinem »Handbuch des Börsenspekulanten« (1853).
Die gegen England und seinen Handel gerichtete Kontinentalsperre fügte der Hauptstadt weniger Schaden zu als den französischen Hafenstädten. »Seit fünf Jahren hat sich die Anzahl der Ladengeschäfte sehr vergrößert; es gibt Stadtteile, wo es bisher nicht eines gab und jetzt viele. Paris gleicht einem immerwährenden Jahrmarkt; nie zuvor hat man so glänzende Läden gesehen«, beobachtete der Stadtschilderer Louis Prudhomme. Allen ausländischen Besuchern fiel die Eleganz der mit Spiegeln verkleideten, von Lüstern erleuchteten Geschäfte auf. Die Schaufensterauslagen übertrafen an Werbewirkung die alten Ladenschilder. Die Straßen Vivienne, Saint-Honoré, du Roule, Saint-Denis und die Galerie des Palais-Royal waren Beispiele für diese Entwicklung. Bäcker und Fleischer eingerechnet, gab es in Paris zu Anfang des 19. Jahrhunderts mehr als dreißigtausend Ladengeschäfte, vom Juwelier bis zur Holzhandlung.
Daß im Großraum Paris die meisten Industrieunternehmen Frankreichs konzentriert waren, mehr als in Lyon, Marseille, Lille oder Rouen, fiel den Betrachtern weniger auf. Das lag wohl daran, daß diese Betriebe mehr Werkstätten und Manufakturen als Fabriken waren – Textil, Porzellan und Fayence und die Anfänge der chemischen und metallverarbeitenden Industrie ausgenommen. Die wichtigsten Pariser Erzeugnisse waren dem Luxushandwerk zuzurechnen. Der Präfekt Frochot vertrat die Ansicht, daß das Departement Seine für die Industrialisierung nicht geeignet sei, nicht zuletzt wegen der relativ hohen Löhne. Dahinter stand eine andere Sorge: »Entspricht es einer guten Politik und einer weisen Verwaltung, hier die Industriebetriebe vermehren zu wollen und auf diese Weise in einer Stadt, die ohnehin schon von Unruhekeimen erfüllt ist, eine große Anzahl Arbeiter zusammenzuziehen, die immer leicht aufgewiegelt werden können und deren Vereinigung den Übelwollenden und Intriganten die Möglichkeit gibt, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu stören?« Die gleichen Besorgnisse äußerte Frochots Amtskollege, der Polizeipräfekt Dubois, angesichts des Zustroms von Wanderarbeitern.
Aber die Entwicklung ließ sich nicht aufhalten. Im Jahr 1801 wurden im Département Seine 937 Produktionsbetriebe mit 60 000 Arbeitern gezählt, davon 890 Betriebe in Paris (davon 159 Textilfabriken; 102 chemische Fabriken; 103 lederverarbeitende Werkstätten; zehn Pulverfabriken; zwei Waffenfabriken; sechs Gießereien). Nur zwei Dutzend Unternehmen beschäftigten mehr als hundert Arbeiter. Die Kontinentalsperre gegen England und die Handelsvorteile im unterworfenen Europa begünstigten die französische Industrie. 1811 gründete der Bankierssohn Jules Delessert im Vorort Passy die erste Rübenzuckerfabrik Frankreichs, zehn Jahre nach der ersten deutschen in Niederschlesien. Die Textilindustrie brachte den Großbetrieb nach Paris. François Richard-Lenoir (1765–1839), ein Textilhändler aus der Champagne, richtete im Faubourg Saint-Antoine eine Baumwollspinnerei und -weberei ein, um Ersatz für die geächteten englischen Stoffe zu schaffen. Das Anfangskapital hatte er mit erfolgreichen Spekulationen in Assignaten und Grundstücken zusammengebracht. Die Baumwolle zog er auf eigenen Pflanzungen in Süditalien. 1814 beschäftigte Richard-Lenoir in Paris 750 Arbeiter und in der Normandie, wo die Löhne niedriger waren, zwanzigmal so viele. Nach dem Ende des Kaiserreichs richtete die englische Konkurrenz den Unternehmer zugrunde. Eine Subskription, an der sich König Louis-Philippe beteiligte, bewahrte einen der ersten Industriellen Frankreichs am Ende seines Lebens vor nackter Not.
Ein Produktionsfaktor, der nicht so leicht abzuschätzen ist, wie die Höhe der Arbeitslöhne, war der Erfindungsgeist, der in dieser Weltstadt herrschte. Drei von vier Erfindungen, so behauptete man, wurden damals in Paris gemacht. Auch Ausländer waren daran beteiligt. Ein Schotte konnte mit Unterstützung des Staates auf einer Seine-Insel eine Maschinenfabrik einrichten. Aber nicht immer war den Pionieren Anerkennung beschieden. Der Amerikaner Robert Fulton, der Betreiber des ersten Panoramas auf dem Kontinent, ließ in einer Gießerei in Chaillot die Dampfmaschine bauen, die 1803 auf der Seine das erste Dampfschiff antrieb. Der Erste Konsul zeigte sich an der Erfindung interessiert, aber eine Gelehrtenkommission riet davon ab, die Sache weiterzuverfolgen. Fultons weltumspannende Erfindung setzte sich schließlich auf dem heimatlichen Hudson durch.
Noch ehe die Industrialisierung richtig begonnen hatte, gab es in Paris schon ein Museum der Technik. 1798 wurde in dem aufgelösten Kloster Saint-Martin-des-Champs, nicht weit vom heutigen Platz der Republik, das »Conservatoire national des Arts et Metiers« eingerichtet. Die einstige Klosterkirche nahm Hunderte von Werkzeugen, Maschinen, Instrumenten und Plänen auf, in Originalgröße oder als Modell. Die Grundlage bildeten die enteigneten Sammlungen des Herzogs von Orléans und des Herzogs von Aiguillon, des Günstlings der Madame Dubarry, erweitert durch Beutegut aus Holland, Deutschland und Italien. Zwischen 1798 und 1806 fanden auf dem Champ-de-Mars, im Louvre und auf der Esplanade des Invalides vier Industrieausstellungen statt, Vorboten der Weltausstellungen. Dabei überwogen die Erzeugnisse der Luxusindustrie. Die Zahl der Aussteller wuchs von zweihundert auf über 1400. Napoleon frohlockte: »Der Augenblick des Wohlstandes ist gekommen. Wer wollte ihm Grenzen ziehen?«
Die Arbeiter und ihre Familien hatten an diesem Wohlstand geringen Anteil. Ein Bericht der Polizeiverwaltung aus dem Jahr 1807 zählte für Paris rund 91 000 Arbeiter, Lohnabhängige, zu denen auch die Handwerksgesellen gerechnet wurden. Die wichtigste Branche war das Baugewerbe mit 24 000 Beschäftigten. Zusammen mit den Familienmitgliedern zählte die Arbeiterbevölkerung 350 000 Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Herkömmliche Arbeiterviertel waren der Faubourg Saint-Antoine, die »ruhmreiche Vorstadt« der Revolution und die Faubourgs Saint-Jacques und Saint-Marcel am Abhang der Montagne Sainte-Geneviève. Der Tageslohn, höher als in der Provinz, lag für die Männer zwischen zwei und vier Franc. Die sieben Franc, die ein geschickter Schlosser erwarten konnte, gehörten zu den Ausnahmen. Zwischen 1800 und 1810 stiegen die Löhne um fast ein Drittel. Die Arbeitszeit betrug zwölf Stunden, davon zwei Stunden für die Mittagspause am Arbeitsplatz. Aber die Beschäftigten, besonders im Baugewerbe, konnten nicht während des ganzen Jahres auf Arbeit rechnen. Wenn die Arbeitslosigkeit, die mit fünf- oder sechstausend Unbeschäftigten als normal galt, zwanzigtausend und mehr erreichte, erwarteten die Betroffenen das Eingreifen des Staates, ein Zustand, an den sie sich seit der Revolution gewöhnt hatten. Die Arbeiter legten in der Regel kein Geld zurück. »Diese Klasse ist nicht vorausschauend und kann es nicht sein; sie spart nichts, auch wenn das Brot billig ist«, heißt es in einem Bericht des Polizeipräfekten vom September 1804.
Der Arzt Jean Menuret de Chambaud gab 1804 ein Bild von der Ernährung des »niederen Volkes«: Das wichtigste Getränk, nicht nur für Frauen und Kinder, sondern auch für die Männer, war Wasser, zu dem gelegentlich Bier und Apfelmost kam und seltener ein schlechter, meist versetzter Wein. Im Gegensatz dazu war das Brot gut und gesund, »die ausgedehnte Grundlage ihrer Ernährung«. Mit Fleisch und Zutaten sah es schlechter aus: »Tier- und Essensreste, dicke Rüben, mehliges Gemüse«. Die drei oder vier »sehr mäßigen Mahlzeiten« der Handwerksmeister nahmen sich dagegen anders aus: »gute Suppe, saftiges Fleisch, ungekünstelt zubereitet, Grünzeug, Gemüse, Milcherzeugnisse, Obst. Wein für den täglichen Gebrauch in geringer Menge.« Das Schlimmste aber waren die Wohnverhältnisse. Auch darüber gab der Arzt mit dem von den Hygienevorstellungen der Aufklärung geschärften Blick Auskunft: »Die übermäßige Zusammendrängung von Menschen in bestimmten Stadtteilen«, »die große Zahl lebender Tiere, ihre Ausdünstungen und Exkremente«, »der Gestank verwesender Kadaver und verfaulender Gemüseabfälle« schufen eine »atmosphärische Kloake«, in der das Atmen schwer fiel: »Es bildet sich ein sichtbarer Dunst, der gewöhnlich über Paris liegt und der sich in manchen Stadtteilen verdichtet.« Gemeint waren die dichtbewohnten Gassen hinter dem Rathaus und um den Markt.
Gleichzeitig mit den Vorrechten des Adels, hatte die Revolution die Handwerkszünfte beseitigt. Ein Gesetz vom 14. Juni 1791 verbot auch Zusammenschlüsse von Arbeitern und Streiks. Die Arbeitsverträge sollten einzeln ausgehandelt werden, nicht gemeinschaftlich. Dieser liberalistische Grundsatz begünstigte den Arbeitgeber gegenüber den einzelnen Arbeitnehmern. Das Konsulat führte auch das Arbeitsbuch wieder ein, eine polizeiliche Maßnahme aus dem Jahr 1781, die während der Revolution abgeschafft worden war. Jeder Arbeiter mußte dem »Patron« bei Antritt des Arbeitsverhältnisses das Heft abliefern und erhielt es beim Abschied zurück. Ein Arbeiter ohne Arbeitsbuch wurde von der Polizei als Vagabund behandelt. In Paris, wo die Aufsicht schärfer gehandhabt wurde als in der Provinz, gab es sechzehn polizeilich kontrollierte Arbeitsämter (»Bureaux de stationnement«). Die Gesellenvereinigungen, die bis zu den Bauhütten der Kathedralen zurückreichten, stellten sich aber trotz des Verbots wieder her. Der Polizeipräfekt Dubois sah die »Compagnonnage« mit einem gewissen Wohlwollen. Was war dagegen einzuwenden, wenn die Handwerksgesellen in Notfällen einander beistanden? Wenn die Polizei einen von ihnen suchte, fand sie ihn bei der Herbergsmutter am schnellsten. Trotzdem beobachtete die Obrigkeit die Arbeiter mit Mißtrauen. Die Schlosser wurden als streitsüchtig und schwer lenkbar eingeschätzt. »Aber man sieht auch Schlossergesellen, die technisches Zeichnen, Architektur und Metallbearbeitung lernen. Ihr Verhalten steht zu der Grobheit der anderen in auffallendem Gegensatz.« Bei Streitigkeiten zwischen Meistern und Arbeitern hielten sich die Behörden nach Möglichkeit zurück. Lohn und Arbeitsbedingungen mochten die Betroffenen miteinander ausmachen. Da tüchtige Handwerker zuweilen schwer zu finden waren und die Unternehmer, durch keinen Zunftzwang gehemmt, einander Arbeitskräfte abwarben, war die Stellung der Arbeiter nicht durchweg ungünstig, besonders, wenn Aufträge unter Termindruck standen.
Aber nicht solcherart begrenzte Arbeitskonflikte machten Napoleon Sorge, sondern soziale Unruhen als Folge von Arbeitslosigkeit oder Teuerung. »Ich fürchte diese Aufstände aus Mangel an Brot mehr als eine Schlacht gegen zweihunderttausend Mann«, erläuterte der Erste Konsul im Herbst 1802 dem Innenminister Chaptal. Gleichzeitig wies er den Minister unter dem schicksalhaften Datum des 19. Brumaire schriftlich an: »Der Winter wird sehr hart, das Fleisch sehr teuer sein. Paris muß Arbeit haben.« Es folgten konkrete Vorschläge: die Arbeiten am Ourcq-Kanal; der Bau von zwei Seine-Quais; der Abriß von Häusern; Straßenpflasterung. Solche Maßnahmen, verbunden mit Lieferungen für den Hof und die Armee, die das Handwerk in Brot setzten, ergriff Napoleon auch später. In Notzeiten schoß er aus seiner Privatschatulle große Beträge für die Speisung von Bedürftigen zu. Vom österreichischen Kriegsschauplatz mahnte der Kaiser 1809 den Polizeiminister Fouché, in seiner Abwesenheit keine Neuerungen einzuführen, damit sich die Arbeiter nicht ungerecht behandelt fühlten, denn: »Man muß ihnen ihre Gewohnheiten lassen.« Die Arbeiter dankten dem Kaiser seine Fürsorge. Sie blieben bis zum Ende des Kaiserreiches und darüber hinaus bonapartistisch gesinnt, während die Oberschicht Napoleon als »Kaiser der Vorstädte« verhöhnte.
In dem Jahrzehnt der Revolution hatte Paris hunderttausend Einwohner verloren. Die Bevölkerung war von 650 000 (1790) auf 550 000 Menschen (1801) zurückgegangen. Denn nicht nur der Adel und die reichen Bürger waren geflüchtet, auch die Dienerschaft der großen Haushalte, die ihre Anstellung, Arbeiter und Handwerker, die ihre Arbeit verloren hatten, zogen fort. In den fünfzehn Jahren der Herrschaft Napoleons nahm die Bevölkerung von Paris stetig zu und betrug schließlich 700 000 Einwohner, nur von London mit 800 000 Einwohnern übertroffen. Die Bevölkerungsverdichtung vollzog sich vor allem in den ohnehin dicht bebauten Vierteln der Innenstadt und entlang einiger Ausfallstraßen. In den Gassen um die Markthallen drängten sich über hunderttausend Menschen auf dem Quadratkilometer, in der Gegend der Champs-Élysées waren es weniger als dreitausend. Zwischen den Großen Boulevards und der Stadtgrenze gab es noch einstige Dörfer, die manches von ihrem ländlichen Aussehen bewahrt hatten. Die Hauptstadt bot auf ihrer Fläche von über 30 Quadratkilometern innerhalb der Zollgrenze noch viel freien Raum.
Weniger als die Hälfte der Einwohner waren gebürtige Pariser. Der größere Teil stammte aus der Provinz, die Vorhut der großen Zuwanderung während der Industrialisierung. Aus Flandern und der Picardie kamen Weber, aus der Normandie Steinmetze, aus dem Zentralmassiv Maurer und Wasserträger, aus Savoyen Schornsteinfeger. Schlepperbanden nutzten die Wanderungsbewegung aus. »In der Auvergne besteht eine Bande, die Jahr für Jahr die ärmsten und einsamsten Gemeinden durchkämmt und eine kleine Heerschar von Kindern zusammenbringt, die nach Paris geleitet werden, wo man sie als Schornsteinfeger oder Bettler abrichtet«, schrieb der Präfekt des Départements Cantal. Andere Zuwanderer kamen von noch weiter her, und die Eroberungen des Kaisers schufen die Voraussetzung dafür. Ein Polizeibericht von 1806 führte Klage über die große Anzahl deutscher Juden: »Es vergeht kein Tag, an dem nicht aus der Tiefe Polens, Mecklenburgs oder Westfalens irgendein Jude in Paris eintrifft, ohne Mittel und ohne Kenntnisse, um sich hier niederzulassen und einen Trödelhandel zu beginnen.« Der ungeregelte Zustrom von Wanderarbeitern machte den Behörden Sorge. Der Polizeipräfekt bezifferte im Mai 1809 die monatliche Zuwanderung mit 2100 Arbeitern, die Gesamtzahl der Wanderarbeiter in Paris mit mehr als 120 000: »Nicht alle finden Arbeit; …von den unbeschäftigten Arbeitern ist alles zu befürchten.« Die sozialen Spannungen, die der hohe Beamte voraussah, entluden sich ein, zwei Generationen später in den Barrikadenkämpfen von 1830 und 1848.
Der Aderlaß durch die Kriege des Kaisers hemmte die Bevölkerungszunahme in Paris nicht. Jahr für Jahr wurden in der Hauptstadt drei- bis viertausend junge Männer ausgehoben, die meisten von ihnen Handwerksgesellen. Dazu kamen vierhundert Freiwillige, die den Militärdienst der Arbeitslosigkeit vorzogen. Mit insgesamt 52 000 Wehrpflichtigen, von denen nur jeder dritte (16 500) bei der Auslosung eine »schlechte Nummer« zog, also Militärdienst leisten mußte, stellte die Hauptstadt während des Konsulats und des Kaiserreiches drei von hundert französischen Soldaten. Von einer Million französischer Kriegstoten entfielen auf Paris sechstausend Gefallene und Vermißte. Die Chance, die Feldzüge des Kaisers zu überleben, stand zwei zu eins. »Eine Liebesnacht [der zurückgekehrten Armee] in Paris wird dieses Gemetzel ausgleichen«, soll Napoleon angesichts der zwanzigtausend Toten und Verwundeten nach der Schlacht von Preußisch-Eylau 1807 zynisch bemerkt haben. Viele Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehrten und den Ruhm des Kaisers verbreiteten, waren für das bürgerliche Leben verloren.
Der Nutzen der Religion
Die Aussöhnung zwischen Staat und Kirche gehörte zu den vordringlichen Aufgaben des neuen Machthabers. Nur die Religion, davon war Napoleon überzeugt, konnte die Menschen mit der sozialen Ungleichheit, mit dem Gegensatz von Armut und Reichtum versöhnen. Am 28. Dezember 1799 gab der Erste Konsul den Gläubigen die Benutzung der Kirchen und den Sonntagsgottesdienst zurück, womit er einem Verlangen entsprach, das sich immer deutlicher äußerte. Nach einem Polizeibericht vom Jahresanfang 1800 erregte der Beschluß »größte Sensation« in Paris: »Der Zustrom an den Kirchentüren war in diesen Tagen beträchtlich. Viele Kirchen, die geschlossen waren, sind geöffnet, und eine Menge von Personen beiderlei Geschlechts bezeigte ihre Befriedigung auf die lebhafteste Weise.« Offensichtlich hatten die Verfolgungen während der Revolution dem Glauben weniger Schaden getan als die vorangegangene Propaganda der Aufklärung.
Wie es um die Frömmigkeit in Paris bestellt war, das ließ sich nicht ohne weiteres sagen. Auffallend war, daß die Minderheit der Geistlichen, die den Eid auf die Verfassung verweigert hatten, beliebter und einflußreicher waren, als diejenigen, die sich angepaßt hatten. Das einfache Volk, besonders die Frauen, ging eifriger zur Kirche als das Bürgertum. Chateaubriands »Geist des Christentums« (1802) kündigte eine verinnerlichte Frömmigkeit an. Der erleichterten Zustimmung der alten Aristokratie zu der neuen Kirchenpolitik entsprach die höhnische oder mißtrauische Ablehnung der Verwaltung, des Militärs und der Intellektuellen. Auf die »Theophilanthropen«, die seit 1796 als offizieller Kultus anerkannt waren, brauchte der Erste Konsul keine Rücksicht zu nehmen. Diese »Freunde Gottes und der Menschen« durften ihre Zusammenkünfte in einigen Pariser Kirchen, darunter Notre-Dame, abhalten. Bonaparte stellte die staatlichen Zuwendungen ein und entzog ihnen das Recht, öffentliche Gebäude zu benutzen, was das Ende der Sekte bedeutete.
Nach zähen Verhandlungen schloß der Erste Konsul 1801 ein Konkordat mit dem Papst, das am 8. April 1802 Gesetzesform erhielt: Die Bischöfe der Kirche Frankreichs wurden vom Staat ernannt und vom Papst eingesetzt, um in einem halben Hundert Diözesen zu walten, wie die Präfekten in den Départements. Zehn Tage später, am Ostersonntag, feierte Paris mit einem Hochamt in der Kathedrale Notre-Dame die Aussöhnung zwischen Kirche und Staat. Die Hauptkirche, ihres Figurenschmuckes und des Turmes über der Vierung beraubt, war 1793 mit knapper Not dem Abbruch entgangen, sie hatte als Magazin, als »Tempel der Vernunft« und als »Tempel des höchsten Wesens« gedient. Nach Jahren erzwungener Stille durften die Glocken wieder läuten. Bonaparte zeigte sich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal vor der Öffentlichkeit mit höfischem Gepränge, bei dem auch die Waffengefährten widerwillig eine Statistenrolle übernehmen mußten.
Die Krönungsfeier im Dezember 1804 bedeutete den Höhepunkt in den Beziehungen zwischen Kaiser und Papst. Bis zum März des folgenden Jahres weilte Pius VII. in der französischen Hauptstadt. Als Wohnung wurde ihm der Pavillon de Flore, der südliche Abschluß der Tuilerien, zugewiesen. Der Papst hielt Gottesdienste in Notre-Dame und in jeder der zwölf Pfarrkirchen. Er empfing in der Großen Galerie des Louvre Würdenträger und Volksvertreter, Gelehrte und Künstler. Er besichtigte das Hôtel des Invalides, das Krankenhaus Hôtel-Dieu, die Staatsdruckerei und den Jardin des Plantes. Die Pariser begegneten dem bescheiden wirkenden älteren Herrn mit einer Ehrerbietung, die dieser nicht erwartet hatte. Die Kirche fühlte sich gestärkt.
Das sollte sich ändern, als 1809 der Kirchenstaat dem Kaiserreich einverleibt wurde. Der Papst antwortete mit der Exkommunizierung Napoleons, was in Frankreich nicht zur Kenntnis genommen werden durfte. Pius VII. wurde zunächst in Savona und von Juni 1812 bis Januar 1814 in Fontainebleau als Gefangener gehalten. Die französischen Bischöfe wünschten ein gutes Verhältnis zum Staat, aber sie wollten keine Entscheidungen ohne die Zustimmung des Papstes treffen. Napoleons Vorstellung, den Vatikan nach Paris zu versetzen und die höchste weltliche und geistliche Autorität an der Seine zu vereinen, blieb ein imperialer Wunschtraum. Der Kaiser hatte den Gegenspieler unterschätzt. Auch die Absicht, die Kirchenpolitik zu einem Mittel der nationalen Versöhnung zu machen, schlug dadurch fehl. Für die Kirche in Paris und in Frankreich brachte diese Zeit neue Bedrückungen, die sich besonders gegen die geistlichen Orden richteten. Im Untergrund wuchs der Widerstand. Der konservative Geheimbund der »Glaubensritter« machte es sich zur Aufgabe, trotz Polizei und Zensur die päpstlichen Schreiben zu verbreiten. Am Ende begrüßten viele Gläubige den Sturz Napoleons und die Rückkehr der Bourbonen als Befreiung.
Wissenschaft und Kunst
Schon unter dem Ancien Régime war Paris das Zentrum der Wissenschaften. Die Revolution, vorbereitet durch die Aufklärung, tat viel, die vorhandenen wissenschaftlichen Einrichtungen zu öffnen und neue ins Leben zu rufen. Auf keinem anderen Feld wurde sie ihrem Anspruch, zum Wohle der Menschen zu wirken, besser gerecht. Was damals gesät worden war, konnte Napoleon ernten. Das »Institut de France« setzte seit 1795 die Tätigkeit der königlichen Akademien fort, mit der Aufgabe, »die wissenschaftlichen Entdeckungen zu sammeln und die Künste und Wissenschaften zu vervollkommnen«. Als Sitz des Instituts bestimmte Napoleon 1805 das »Kollegium der vier Nationen«, eine Gründung des Kardinals Mazarin, auf dem linken Ufer gegenüber dem Louvre. Die Sitzungen fanden in der einstigen Kirche des Kollegiums statt, in der das Grabmal des Kardinals durch das Standbild des Kaisers ersetzt wurde. Zwei Jahre früher hatte der Erste Konsul das Institut in vier Klassen eingeteilt: Physik und Mathematik; Französische Sprache und Literatur; Alte Geschichte und Literatur; Bildende Kunst. Die Abteilung für Moral- und Staatswissenschaften, die Zuflucht der verabscheuten »Ideologen«, wurde bei dieser Gelegenheit abgeschafft. Napoleon wachte über die Auswahl der 150 Mitglieder dieses Generalstabs der Wissenschaften, zu denen er seit 1797 selbst gehörte. Unter der Restauration erhielten die »Klassen« wieder die vertraute Bezeichnung »Akademie«.
Das Staatsarchiv fand nach mehrfachem Umzug seinen endgültigen Standort im Hotel de Soubise im Marais. »Dieses Archiv wurde durch die Archive der von Napoleon besiegten Mächte beträchtlich erweitert; ein Schatz, der bald wieder zurückgegeben werden mußte, als uns der Sieg nicht mehr günstig war«, merkte der Stadthistoriker Dulaure bedauernd an. Die Nationalbibliothek, die einstige Königliche Bibliothek in der Nähe des Palais-Royal, stand Besuchern nicht wie früher nur zwei Stunden in der Woche offen, sondern täglich vier Stunden. Dem deutschen Schriftsteller Seume fiel das auf: »In Paris sind die öffentlichen vortrefflichen Büchersammlungen für jedermann, und es gehört sogar zum guten Tone, wenigstens zuweilen eine Promenade durch die Säle zu machen, die Fächer zu besehen und einige Kupferstiche zu beschauen. Wer sie besuchen will, findet in allen Zweigen Reichtümer, und alles wird mit Gefälligkeit gereicht.«
Die Universität von Paris, die älteste nördlich der Alpen, sollte als staatliche Einrichtung über die Erziehung der Jugend im ganzen Land wachen. Es entsprach ganz und gar nicht den Absichten des Kaisers, daß der Großmeister der Universität, Louis de Fontanes, den Geistlichen großen Einfluß im Erziehungswesen einräumte. Ebenso wichtig oder wichtiger waren die neuen Fachhochschulen für Medizin, für Technik (École Polytechnique), für Öffentliche Arbeiten (Ponts et Chaussées), für die Ausbildung der Gymnasiallehrer (École Normale Supérieure), für die künftigen Diplomaten (École diplomatique oder École des Archives), für Orientalische Sprachen, für Recht, für Geographie und die Militärschule Saint-Cyr bei Versailles. Diese Eliteschulen verschafften der Hauptstadt eine Monopolstellung, die sie bis in die Gegenwart behaupten konnte. Die Vorstufe bildeten die Gymnasien (lycées), und auch in dieser Beziehung war Paris führend: mit den Lycées imperial (früher und später: Louis-le-Grand), Charlemagne, Bonaparte (später: Condorcet) und Napoléon (später Henri IV), in denen sich eintausendachthundert Zöglinge in strenger Internatszucht Wissen aneigneten. Das Bürgertum zog die geistlichen Lehranstalten den staatlichen Schulen vor. Im besiegten Preußen wurden zur gleichen Zeit andere Wege beschritten, deren Ziel nicht die Erziehung der Jugend für den Staat, sondern die Bildung des einzelnen im Zeichen der Freiheit von Forschung und Lehre war.
Der Vernichtung von Kunstwerken im revolutionären Überschwang hatte die Nationalversammlung vorsichtig entgegenzuwirken versucht: »In Anbetracht der gebotenen Zerstörung von Denkmälern, die geeignet sind, die Erinnerung an den Despotismus zu wecken, ist es wichtig, die Meisterwerke der Kunst zu bewahren, die so würdig sind, die Muße auszufüllen und das Staatsgebiet eines freien Volkes zu verschönen«, hieß es 1792 in einer Verordnung. Zwei Jahre später erstattete der Abbé Grégoire drei »Berichte über die Zerstörungen durch den Vandalismus und über die Möglichkeiten, ihn zu unterbinden«. Ein neuer Begriff war in Umlauf gesetzt: »Vandalismus«, die mutwillige Beschädigung oder Zerstörung von Kunstwerken, und in enger Verbindung damit, als schützendes Tabu: »historische Denkmäler«. Denn aus dem Raub des Eigentums der Kirche, des Adels und der Krone, stolz »Nationalisierung« genannt, folgte, wie manchem dämmerte, die Pflicht zur Bewahrung des nationalen Kulturerbes.





























