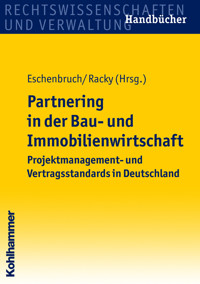
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Managementansatz Partnering gewinnt in der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Er stellt die Kooperation der Projektbeteiligten in den Vordergrund. Dadurch sollen Bauprojekte wesentlich effizienter und konfliktärmer ablaufen. Dieses Handbuch verschafft einen praxisorientierten und wissenschaftlich fundierten Überblick über die interdisziplinäre Materie und den aktuellen Stand der Praxis in Deutschland. Es beschreibt Methoden und Vorgehensweisen zur Umsetzung des Partnering-Ansatzes in der Bau- und Immobilienwirtschaft aus den Blickwinkeln der verschiedenen Marktteilnehmer. Zahlreiche Empfehlungen für das Projektmanagement und Formulierungsvorschläge für vertragliche Regelungen dienen als wertvolle Orientierungshilfe für die am Baugeschehen Beteiligten. Die Autoren dieses Handbuchs sind alle namhafte Experten in ihrem jeweiligen Bereich und haben sich mit Partnering in zahlreichen Bauprojekten, wissenschaftlichen Publikationen und beratender Tätigkeit intensiv befasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Managementansatz Partnering gewinnt in der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Er stellt die Kooperation der Projektbeteiligten in den Vordergrund. Dadurch sollen Bauprojekte wesentlich effizienter und konfliktärmer ablaufen. Dieses Handbuch verschafft einen praxisorientierten und wissenschaftlich fundierten Überblick über die interdisziplinäre Materie und den aktuellen Stand der Praxis in Deutschland. Es beschreibt Methoden und Vorgehensweisen zur Umsetzung des Partnering-Ansatzes in der Bau- und Immobilienwirtschaft aus den Blickwinkeln der verschiedenen Marktteilnehmer. Zahlreiche Empfehlungen für das Projektmanagement und Formulierungsvorschläge für vertragliche Regelungen dienen als wertvolle Orientierungshilfe für die am Baugeschehen Beteiligten. Die Autoren dieses Handbuchs sind alle namhafte Experten in ihrem jeweiligen Bereich und haben sich mit Partnering in zahlreichen Bauprojekten, wissenschaftlichen Publikationen und beratender Tätigkeit intensiv befasst.
Rechtsanwalt Dr. Klaus Eschenbruch, Kapellmann und Partner; Professor Dr. Peter Racky, Universität Kassel.
Partnering in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Projektmanagement- und Vertragsstandards in Deutschland
Herausgegeben von
Dr. Klaus Eschenbruch Rechtsanwalt, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte, Düsseldorf
und
Prof. Dr. Peter Racky Universität Kassel, Fachgebiet Baubetriebswirtschaft
Dr. Andreas Eitelhuber Architekt, Audi AG, Ingolstadt
Dr. Klaus Eschenbruch Rechtsanwalt, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte, Düsseldorf
Christian Gorris Stv. Abteilungsleiter der Bauabteilung der Commerz Real AG, Düsseldorf
Prof. Dr. Mike Gralla Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl Baubetrieb und Bauprozessmanagement
Axel-Björn Hüper Vorsitzender der Geschäftsführung der DB ProjektBau GmbH, Berlin
Prof. Dr. Wolfdietrich Kalusche Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl Planungs- und Bauökonomie
Prof. Dr. Bernd Kochendörfer Technische Universität Berlin, Fachgebiet Bauwirtschaft und Baubetrieb
Bearbeitet von
Manfred Körtgen Bereichsleiter Planung und Bau BBI der Berliner Flughäfen
Dr. Peter Leicht Rechtsanwalt, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte, Hamburg
Dr. Norbert Preuß Geschäftsführender Gesellschafter der Preuss Projektmanagement GmbH, München
Prof. Dr. Peter Racky Universität Kassel, Fachgebiet Baubetriebswirtschaft
Burkhard Schmidt Mitglied des Vorstands der Ed. Züblin AG, Stuttgart
Prof. Dr. Konrad Spang Universität Kassel, Fachgebiet Projektmanagement
Dr. Carsten von Damm Contract Management, Ed. Züblin AG, Stuttgart
Wolfram Wiesböck Leiter Bautechnik, Audi AG, Ingolstadt
Verlag W. Kohlhammer
Alle Rechte vorbehalten © 2008 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-019861-6
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028272-8
mobi:
978-3-17-028273-5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Geleitwort Prof. Dr. Kniffka
Geleitwort Knipper
Geleitwort Prof. Dr.-Ing. Schofer
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Kapitel: Der Partnering-Ansatz
I. Partnering als Managementansatz – Definition und begriffliche Einordnung (Racky)
II. Entstehung und Verbreitung des Partnering-Ansatzes (Eschenbruch)
1. Sozioökonomischer Kontext der Entstehung der Partnering-Modelle
2. Verbreitung des Partnering-Ansatzes
a) Entstehung des Partnering-Gedankens in den USA
b) Aufnahme des Gedankens in England
c) Verbreitung über Europa nach Asien
d) Die Entwicklung in Deutschland
III. Erfordernis des Partnering angesichts der deutschen Marktverhältnisse (Kochendörfer)
1. Ausgangslage
2. Folgen konfrontativ geprägter Strategien
3. Anforderungen an Vertragsmodelle für komplexe Projekte
4. Partnering als Erfolg versprechende Alternative?
IV. Der Partnering-Ansatz in den Wettbewerbsmodellen (Gralla)
1. Grundsätzliches
a) Einführung
b) Begriffsdefinitionen
2. Bestandteile und Merkmale von Wettbewerbsmodellen
a) Projektorganisationsformen
b) Vertragsmodelle
c) Konfliktlösungsmechanismen
d) Kooperationsmechanismen
aa) Kooperationsprinzip im Bauvertragsrecht
bb) Partnering
cc) Zielorientierte Prozesskoordination und -integration der Projektbeteiligten
dd) Gemeinschaftliche Bausoll-Definition
3. Klassifizierung der verschiedenen Wettbewerbsmodelle.
a) Traditionelle Projektorganisationsformen.
aa) Ausführungsleistungen.
(1) Einzelunternehmer
(2) Generalunternehmer und -übernehmer
bb) Planungsleistungen
cc) Beratungsleistungen
dd) Übergreifende Leistungsformen
(1) Planender Generalunternehmer und -übernehmer
(2) Totalunternehmer und -übernehmer
b) Innovative Projektorganisationsformen.
aa) Construction Management
bb) Abwicklungsvarianten
(1) Zwei-Phasen-Modelle
(2) Ein-Phasen-Modell
c) Traditionelle Vertragsmodelle.
aa) Einheitspreisvertrag
bb) Detail-Pauschalvertrag
cc) Einfacher Global-Pauschalvertrag
dd) Komplexer Global-Pauschalvertrag
d) GMP als innovatives Vertragsmodell
aa) Typologisierung des GMP-Vertrags
bb) Vertragsregelungen
cc) Anreizmechanismen
4. Zusammenfassende Bewertung des Partnering-Ansatzes in den Wettbewerbsmodellen
V. Partnering-relevante Ingenieur- und Management-Methoden (Racky)
1. Zielkostenrechnung
2. Simultaneous Engineering
3. Value Engineering
4. Projektmanagement unter Partnering-Prämissen
a) Kostencontrolling
b) Termincontrolling
c) Leistungsänderungs-Management
d) Regelung weiterer erfolgskritischer Teilprozesse
e) Kommunikation und Information
5. Fazit
VI. Erforderliche Kompetenzfelder für Partnering und Rahmenbedingungen für Kooperation (Racky)
1. Kooperationsfördernde Rahmenbedingungen auf Projektebene
2. Erforderliche Anpassungen auf (Bau-)Unternehmensebene
VII. Rechtliche Rahmenbedingungen und Methoden (Eschenbruch)
1. Partnering als interdisziplinäres Managementkonzept
2. Die Aufgabenstellung Recht bei Partnering-Modellen.
a) Recht und Partnering-Modelle – Ein Widerspruch?
b) Strukturen der rechtlichen Umsetzung.
aa) Die unverbindliche Deklaration – non-binding-partnering-charter
bb) Die rechtlich bindende, ergänzende Partnering-Vereinbarung
cc) Einheitliche Partnering-Verträge (Einheitsvertragskonzept)
c) Alliance- und gesellschaftsrechtliche Konzepte
3. Typologien.
a) Die Vertragsbeteiligten
aa) Investoren und Projektentwickler
bb) Private und öffentliche Bauauftraggeber und Auftragnehmer (Bauunternehmen)
cc) Bauauftragnehmer und Nachunternehmer
dd) Bauauftraggeber und Auftragnehmer, Planer und Projektmanager
b) Die Projekttypen
aa) Komplexe Hochbauprojekte
bb) Industrie- und Anlagenbauprojekte
cc) Infrastrukturprojekte
c) Die Vertragstypen
aa) Zweiphasige Vertragstypen: Begleitung des Planungsprozesses und dann Errichtung
bb) Insbesondere: Construction-Management-Verträge (at risk)
cc) PPP-Verträge
d) Ein-Projekt-Partnering und Mehrprojekt-Partnering (Strategic-Partnering)
e) System-Partnering (Partnering unter Einbeziehung der Nutzerphase)
f) Anwendungssysteme
4. Die Vertragsgestaltung bei Partnering-Modellen.
a) Allgemeine Grundsätze der Vertragsgestaltung
aa) Formale Strukturen der Vertragsgestaltung
bb) Schlanke Vertragsgestaltung
cc) Vertragsgerechtigkeit und angemessene Risikoallokation
dd) Lebenszyklusgedanken
ee) Projektmanagement und -controlling
b) Zur Vertragsgestaltung im Detail.
aa) Partnering-Charter
bb) Partnering-Kernteam
cc) Planungsverantwortung
dd) Regelungen zur Ausführung
ee) Vertragsklauseln zur Vergütung
ff) Ausgestaltung der Kernprozesse Planung und Vergabe
gg) Änderungsmanagement
hh) Vertragsstrafe
ii) „Gläserne Taschen“
jj) Übertragung von Risiken/angemessene Risikoallokation
kk) Nachunternehmer
ll) Projektmanagement
c) Problemstellungen bei Allianz-Vereinbarungen
5. Außergerichtliche Konfliktschlichtung.
a) Außergerichtliche Konfliktschlichtungsstrategien
b) Empfehlungen für eine projektspezifische, Partnering-orientierte Konfliktschlichtung
c) Besonderheiten bei öffentlichen Auftraggebern
d) Rechtliche Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Schieds- und Schlichtungsvereinbarungen
e) Die jeweils sachangemessene Konfliktlösungsstrategie
6. Vergaberechtliche Implikationen
a) Kumulativleistungsträgervergaben
b) Vergaberecht und Vergütungsformen
c) Verfahrensrecht
d) Kompetenzwettbewerb durch sachgerechte Definition der Eignungskriterien und der Zuschlagskriterien
e) Die vergaberechtliche Berücksichtigung des Lebenszyklusansatzes
f) Die Einbeziehung der Projektfinanzierung
g) Nachprüfbarkeit und Rechnungsprüfung
7. Schlussbemerkungen
VIII. Ausblick: Die Zukunft des Partnering (Eschenbruch)
1. Zur Bedeutung des Partnering-Gedankens in der Zukunft
2. Pflicht und Kür: Anforderungen an die Ausgestaltung leistungsfähiger Partnering-Modelle
2. Kapitel: Partnering-Modelle der einzelnen Marktteilnehmer/in einzelnen Marktbereichen
I. Zur Umsetzung von Partnering-Modellen durch Auftraggeber – ein Praxisbericht (Körtgen)
1. Der sachkundige Auftraggeber/die Projektleitung
2. Projektleitung und Projektsteuerung
3. Projektkommunikation
4. Partnering und die Auswahl der Auftragnehmer
5. Konfliktbewältigung
6. Partnering und Zahlungsverhalten
7. Einzelheiten zur Umsetzung des Partnering-Modells beim Projekt BBI
a) Verschwiegenheitsverpflichtung als Grundlage für vertrauensvolles Zusammenwirken
b) Integritätsvertrag/Projektkultur
aa) Verpflichtungen des Auftraggebers
bb) Verpflichtungen des Bieters bzw. Auftragnehmers
cc) Der unabhängige Beobachter
c) Partnering-Vereinbarung
II. Partnering-Modelle der Bauunternehmen im Hochbau (Schmidt/von Damm)
1. Einleitung
2. Defizite der konventionellen Bauvertragsabwicklung
3. Partnerschaftsmodelle bei Bauprojekten.
a) Beteiligte Partner und ihre Aufgaben
b) Erfolgsfaktoren der Partnerschaftsmodelle bei der Projektabwicklung
aa) Einbindung von Ausführungskompetenz in die Planungsphase
bb) Eindeutiges Bausoll
cc) Risikominimierung
dd) Kostentransparenz
ee) Gemeinsames Projektcontrolling
ff) Konfliktlösungsmodelle
c) Ablauf der Partnerschaftsmodelle.
aa) Grundsätzlicher Ablauf in zwei Phasen zur Absicherung des Bauherrn
bb) Auswahl des Partners im Kompetenzwettbewerb
cc) 1. Vertragsphase: Gemeinsame Planungs- und Optimierungsphase
dd) 2. Vertragsphase: Bauausführung
4. Vorteile von Partnerschaftsmodellen
a) Höhere Kosten- und Terminsicherheit
b) Minimierung der Projektdauer
c) Verringertes Konfliktpotenzial
d) Optimierung des Planungsprozesses
e) Bau- und Betriebskostenoptimierung
5. Erfolgsvoraussetzungen für Partnerschaftsmodelle.
a) Projektspezifische Eignung von Partnerschaftsmodellen
b) Einstellung und Schulung der Mitarbeiter
6. Zusammenfassung
III. Partnering-Modelle im Industriebau (Wiesböck/Eitelhuber)
1. Zielsetzung und Anforderungen für den Einsatz von Partnering im Industriebau
2. Eingesetzte Partnering-Prozesse/-Methoden.
a) Partnering-Modell
aa) Planungsphase
bb) Optimierungsphase
cc) Realisierungsphase
b) Projektorganisation
c) Eingesetzte Partnering-Prozesse
aa) Kostentransparenz
(1) Angebots- und Kostenstruktur der direkt durch den AG beauftragten Leistungen
(2) Nachunternehmervergaben
bb) Integration eines Construction Managers
cc) Partnerschaftlicher Prozess
3. Eingesetzte Vertragslösungen
a) Präambel
b) Kostengliederung
c) Kooperationsverpflichtung
d) Nachunternehmer und Nachunternehmervergaben
e) Leistungsmehrungen und Leistungsminderungen
f) Baubegleitende Schlichtungsregelung
4. Was hat sich bewährt, was muss weiter verbessert werden?
5. Ausblick
IV. Partnering aus Sicht des Architekten (Kalusche)
1. Einleitung
2. Die Rolle des Architekten bei Bauprojekten
3. Wie findet der Bauherr seinen Architekten?
4. Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt
5. Zusammenarbeit zwischen Architekten und Fachingenieuren
6. Zusammenarbeit zwischen Architekt und ausführenden Firmen
7. Zusammenarbeit zwischen Bauherr und ausführender Firma
a) Frühzeitige Einbindung des Auftragnehmers in die Planung
b) Festlegung des Bausolls vor Vertragsabschluss
c) Ausgewogene Vertragsgestaltung und Risikominimierung für AG und AN
d) Transparente Zusammensetzung der pauschalierten Vergütung
e) Gemeinsame Festlegung der Projektablaufstrukturen und gemeinsames Projektcontrolling
f) Vereinbarung außergerichtlicher Konfliktlösungsmodelle
8. Fazit
V. Partnering aus Sicht des Projektmanagers (Preuß)
1. Einleitung
2. Die Realität in (einigen) GU-Projekten aus Sicht des Bauherrn
a) Planungskoordination
b) Änderungsmanagement
c) Entscheidungsmanagement
d) Qualitäten
e) Projektmanagementpersonal
f) Zusammenfassung
3. Die Realität in (einigen) GU-Projekten aus Sicht der Bauindustrie
a) Ausschreibungsverfahren
b) Projektorganisation
c) Ausführungsplanung
d) Ausführung
e) Zusammenfassung
4. Die Leistungsplattform des Projektmanagements bei Partnering-Projekten
a) Handlungsbereich Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
b) Handlungsbereich Qualitäten/Quantitäten
c) Handlungsbereich Kosten
d) Handlungsbereich Termine/Kapazitäten
5. Fazit
VI. Immobilienleasinggesellschaften und Construction Management (Gorris)
1. Immobilienleasing bei Neubauprojekten.
a) Einführung
b) Construction Management durch Immobilienleasinggesellschaften
2. Strukturierung der Phasen.
a) Grundlagen
b) Preconstruction-Phase
aa) Vertragliche Bindung während der Preconstruction-Phase
bb) Vorentwurfs- und Entwurfsplanung (Preconstruction-Phase)
cc) Kostenfortschreibung während der Preconstruction-Phase
dd) Genehmigungsplanung (Preconstruction-Phase)
ee) Behördliche Prüfung/Bauvorbereitungsphase (Preconstruction-Phase)
c) Construction-Phase
aa) Vertragliche Bindung während der Construction-Phase
bb) Abstimmung der Ausschreibung, der Subunternehmer und der Vergabe
dd) Budgetbildung
ee) Abschluss des GMP-Verfahrens
ff) Erkenntnisse aufgrund durchgeführter GMP-Modelle
3. Partnering-Konzepte für die Zukunft
VII. Partnering-Konzepte für öffentliche Auftraggeber, insbesondere bei Infrastrukturprojekten (Spang/Hüper)
1. Partnering und Infrastrukturprojekte.
a) Besonderheiten bei Infrastrukturprojekten
b) Notwendigkeit von Partnering bei Infrastrukturprojekten
2. Aktueller Stand des Partnering bei Infrastrukturprojekten.
a) Abwicklungsmodelle für Infrastrukturprojekte in Deutschland
aa) Standardmodell
bb) Erstellermodell
cc) PPP-Modell
b) Derzeitige Möglichkeiten und Grenzen bei der Projektabwicklung
c) Erfahrungen mit Partnering bei Infrastrukturprojekten am Beispiel Großbritanniens und Vergleich mit Deutschland.
aa) Situation Anfang der 1990er Jahre
bb) Erkenntnis der Notwendigkeit einer Veränderung
cc) Das britische Vertragsmodell für Infrastrukturprojekte: NEC3
dd) Beispiele der Abwicklung von Infrastrukturprojekten in UK
ee) Vergleich der Projektabwicklung in Großbritannien mit Deutschland
d) Neue Vergabewege und Wettbewerbsmodelle für Planungs- und Bauleistungen der Deutschen Bahn.
aa) Allgemeines
bb) Virtuelle Plattform
cc) Wettbewerbsmodell GMP-Vertrag
3. Partnering-Konzeption für deutsche Infrastrukturprojekte.
a) Zielstellung und Randbedingungen
b) Elemente des Partnering für Infrastrukturprojekte
aa) Partnerschaftsgedanke
bb) Klares Bausoll
cc) Risikoidentifikation und Risikoverteilung
dd) Abweichungen vom Bausoll
ee) Nutzung von Projektdaten
ff) Entscheidung und Verantwortlichkeit
gg) Konflikte
hh) Anreizsysteme
4. Ausblick
3. Kapitel: Konfliktschlichtung im Projekt (Leicht)
I. Einleitung
II. Konfliktpotenziale des Bauwerkvertrags in der Praxis
1. Allgemeine Konfliktanfälligkeit des Werkvertrags
2. Dynamik des Bauvertrags
3. Unsachgerechte Vertragsgestaltung
4. Komplexität von Bauwerkverträgen
5. Zusammenfassung Konfliktpotenzial
III. Praktizierte Konfliktlösung
1. BGB-Werkvertrag
2. VOB/B
a) Nachträge
b) Behinderungen
c) Kooperationsurteile des Bundesgerichtshofs
3. Vertragliche Regelungen
a) Nachträge
b) Behinderungen
4. Zusammenfassung
IV. Grundsätze effizienter Konfliktlösungsansätze
1. Vorsorge statt Behandlung
2. Autonom statt fremdbestimmt
3. Rationale und lösungsorientierte Betrachtung
4. Regelungsebenen
5. Hierarchien
6. Zeitpunkt der Regelung oder Entscheidung
7. Verbindlichkeit von externen Entscheidungen
8. Praktikabilität des Verfahrens
9. Materielle und formale Regelungsansätze
V. Partnering und Konfliktlösung
1. Managementansatz Partnering
2. Partnering aus Sicht der Vertragsparteien
3. Kooperation statt Konfrontation
4. Grundvoraussetzungen des Partnering
a) Verpflichtung und Überzeugung zum Partnering
b) Gegenseitiges Vertrauen
c) Offene Kommunikation
d) Gemeinsame Verantwortung
e) Gemeinsame Ziele
5. Verrechtlichung des Partnering
6. Partnering Issue Resolution
7. Partnering Issue Resolution Tools
a) Team-based Issue Resolution.
aa) Workshop
bb) Core Group
cc) Action Plans
b) Issue Resolution Ladder
c) Dispute Resolution
VI. Alternative Dispute Resolution – ADR
1. Rationale Verhandlung.
a) Intuitives Verhandeln
b) Verhandeln nach dem Harvard-Konzept
2. Concilation
3. Mediation
4. Mini-Trial
5. Hybride Verfahren.
a) ADR und Arbitration
aa) Last-Offer-Arbitration
bb) High-Low-Arbitration
b) Factfinding/Early Neutral Evaluation
6. Dispute Avoidance Procedures – DRA, DRB und DAB
7. Zusammenfassung
VII. Partnering und ADR
VIII. Regelungsvorschläge
1. Informationspflichten
2. Darlegungspflichten
3. Prüfungs-, Reaktions- und Stellungnahmefristen
4. Ausschlussfristen, Präklusionsregelungen und Obliegenheiten
5. Verhandlungspflichten
6. Zusammenfassung
Anhang 1: Partnering-Vereinbarung
Anhang 2: Praxisbeispiel: Construction-Management-Vertrag mit GMP
Anhang 3: Leitfaden für die Durchführung eines Kompetenzwettbewerbs bei Partnerschaftsmodellen
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Neue Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Realisierung von Bau- und Immobilienprojekten lassen Projektabwicklungsformen, welche in den letzten Jahrzehnten durch Ausrichtung auf Eigeninteressen und vielfältige Eskalationen während des Projektgeschehens geprägt waren, überholt erscheinen. Kein Marktteilnehmer, weder Auftraggeber noch Auftragnehmer, kann sich in einer Zeit ehrgeiziger Terminvorgaben, fester Kostenbudgets und von vornherein durchfinanzierter Projektrahmenbedingungen störende Auseinandersetzungen leisten. Alle Projektbeteiligten sind vielmehr auf einen störungsfreien Ablauf der Projektprozesse und eine optimale Projektperformance angewiesen. Das hat den Blick der Projektbeteiligten auf neue Wege der Projektabwicklung im Sinne eines mehr kooperativen und partnerschaftlichen Projektansatzes ausgerichtet. Entsprechende Erfahrungen über im Ausland erprobte Geschäftsmodelle durchdringen derzeit auch die deutsche Bau- und Immobilienbranche.
Die durch diese Entwicklungstendenzen notwendige Neuorientierung der Projektbeteiligten gab den Anlass für Konzeption und Herausgabe dieses Buches. Die Zielstellung des Buches ist es, sowohl die Grundlagen wie auch das methodische Handwerkszeug für die Projektabwicklung unter partnerschaftlichen Rahmenbedingungen darzustellen. Die Marktteilnehmer sollen über die neuen Anforderungen, Chancen und Risiken umfassend informiert werden. Insoweit ist es gelungen, namhafte Autoren aus allen Bereichen der Immobilien- und Bauwirtschaft zu gewinnen, welche die neuen partnerschaftlichen Projektansätze unter jeweils maßgeblichen Blickwinkeln beleuchten und damit eine branchenweite Bewertung ermöglichen.
Das Buch stellt sowohl inzwischen ausformulierte Partnering-Ansätze der deutschen Bauindustrie wie auch Strategien und Perspektiven unterschiedlicher Auftraggeber, Architekten, Projektmanager und Projektfinanzierer dar. Praxis und Wissenschaft sind ausgewogen vertreten. Der Mehrwert dieses Buches besteht daher in der umfassenden, interdisziplinären Ausleuchtung aller relevanten Aspekte von Partnering-Konzepten.
Dieses Werk ist für alle diejenigen gedacht, die sich als Vertreter in Auftraggeber- und Auftragnehmerorganisationen, als Projektmanager, Architekten oder Juristen mit der Entwicklung und Abwicklung von Bauprojekten sowie der Bewirtschaftung von Immobilien befassen und „am Puls der Zeit“ ihre Leistungen auf die neuen Anforderungen abstimmen wollen/müssen.
Unser besonderer Dank gilt den einzelnen Autoren, die mit Ihren Beiträgen engagiert zum Entstehen dieses Handbuches beigetragen haben, sowie den Verfassern der Geleitworte. Wir danken auch dem betreuenden Lektor, Herrn Jens Roth, für die sehr gute Zusammenarbeit. Bei Frau Nadine Sonntag und Frau Melanie Schleicher bedanken wir uns für die tatkräftige Unterstützung bei der redaktionellen Bearbeitung.
Unser Wunsch ist, dass dieses Werk einen Beitrag zur Neuorientierung der Bau- und Immobilienwirtschaft in Richtung Partnering leisten wird und dabei eine konkrete Hilfe bei der praktischen Umsetzung entsprechender Ansätze darstellt. Anregungen, Kritik und Empfehlungen zum Inhalt sind willkommen.
Düsseldorf/Kassel, im September 2007
Die Herausgeber
Dr. Klaus Eschenbruch und Prof. Dr. Peter Racky
Geleitwort
Dieses Buch verhält sich über Partnering in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Partnering ist mehr als nur partnerschaftliches Verhalten. Es ist ein Managementansatz und damit eine Methode für erfolgreiche Bau- und Immobilienprojekte.
Der Erfolg eines Projekts definiert sich über viele Umstände. Störend wirken sich Konflikte über Qualitäten, Termine, Kosten und sonstige Faktoren aus. Je häufiger diese Konflikte auftreten und je länger sie dauern, umso mehr ist der Erfolg eines Bauprojektes für alle Baubeteiligten gefährdet. Es gilt, Strategien zu entwickeln, solche Konflikte soweit wie möglich zu vermeiden und sie im Falle ihres Auftretens sachgerecht und möglichst schnell zu bewältigen. Konfrontationsstrategien, wie sie lange Alltag in der Abwicklung von Bauprojekten waren und teilweise auch noch sind, sind nicht geeignet, den Erfolg eines Bauprojektes sicherzustellen; ganz im Gegenteil: Sie treiben die Beteiligten in langwierige, risikobehaftete, kostenträchtige und häufig unbefriedigend endende Auseinandersetzungen. Hinterher gibt es nur noch Verlierer.
Der Wunsch nach den allseitigen Erfolg sicherstellenden Strategien ist allgegenwärtig. Der erfolgversprechendste Ansatz ist das Partnering, also das Management eines Bauprojektes, das auf der Grundlage partnerschaftlichen Verhaltens Konflikte verhindern soll oder gewährleistet, dass diese Konflikte auf einer partnerschaftlichen Ebene schnell und zufriedenstellend gelöst werden. Das Buch liefert dazu einen interdisziplinären Gesamtüberblick. Namhafte Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen behandeln das Thema unter ihrem Blickwinkel. Die Perspektiven der deutschen Bauindustrie mit ausformulierten Modellen, Konzepte der Projektmanager, Architekten und Finanzierer werden ebenso dargestellt wie partnerschaftlich orientierte Auftraggeberstrategien. Auch die Möglichkeiten rechtlicher Absicherung des Partnering werden beleuchtet.
Das Werk ist ein weiterer wichtiger Schritt zu einer veränderten Bauabwicklung. Es füllt den Wunsch nach Kooperation und Partnerschaft mit Leben. Das höchste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof, hat bereits im Jahre 1999 für die Vertragspartner eines Bauvertrages eine Kooperationspflicht entwickelt. Diese rechtliche Dimension partnerschaftlichen Verhaltens muss sinnvoll umgesetzt werden. Dazu bedarf es vieler Kurskorrekturen. Das fängt an mit einer im Detail ausgefüllten vertraglichen Verpflichtung zu partnerschaftlichem Verhalten und einer entsprechenden Ausbildung der am Projekt beteiligten Menschen. Partnerschaft muss gelebt werden und dazu gehört eine bejahende Einstellung der Vertragspartner. Es geht weiter mit der Vermeidung unkooperativer und teilweise unseriöser Vertragsformen, die durch undurchsichtige und risikoverlagernde Gestaltungen verhindern, dass das notwendige Vertrauen in die Vertragspartner gebildet wird. Zu fordern sind klar strukturierte, ehrliche Verträge, die Risiken offenlegen und Leistungen sowie Preise transparent erkennen lassen. Dazu gehören auch die Bereitschaft zur Teamarbeit aller Baubeteiligten ein- schließlich des Auftraggebers zur Verwirklichung eines als gemeinsame Leistung empfundenen Bauprojekts, eine in geeigneten Fällen frühzeitige Einbindung des Bauunternehmers und Spezialisten in die Planungsphase, ein dem angepasstes Vergabeverfahren, eine engere Einbindung der Nachunternehmer in die Entscheidungsprozesse, eine deutlich verbesserte Kostentransparenz und ein gemeinsames Nachtragsmanagement, das nicht auf Konfrontation, sondern auf Kooperation ausgelegt ist. Einzubeziehen in die Überlegungen sind außergerichtliche Verfahren, die basierend auf der Eigenverantwortung der Beteiligten die Konflikte erledigen, ein Thema, dem sich auch der Deutsche Baugerichtstag intensiv in einem Arbeitskreis angenommen hat.
Damit sind einige Punkte angesprochen, mit denen sich die Autoren beschäftigen. Alle verfolgen dasselbe Ziel. Sie zeigen Wege, wie Bauprojekte nicht in der gegenwärtigen Frustration enden, sondern in einer Win-win-Situation für alle Beteiligten. Diese Perspektive macht viel Mut und verhilft hoffentlich dazu, dass Bauprojekte nicht mehr nahezu zwangsläufig in rechtlichen Auseinandersetzungen enden und die Gerichtsbarkeit mit nahezu 25 Prozent aller vor staatlichen Gerichten geführten Zivilprozesse belasten.
Prof. Dr. Rolf Kniffka
Richter am Bundesgerichtshof
Geleitwort
Die Stimmung in der deutschen Bauwirtschaft hat sich gedreht. Nach langen Jahren herrscht nun wieder Optimismus – zu Recht! Zwar gibt es nach wie vor regionale und spartenmäßige Unterschiede. Jedoch zeigen die Umsatz- und Auftragseingangszahlen nach oben. Die Trendwende am Bau ist nach zehnjähriger Krise eingetreten.
Diese Wende zum Positiven gilt es zu nutzen – um die Verhältnisse am deutschen Baumarkt nachhaltig zu verbessern. Hierzu zählt auch, die Beziehungen aller am Bau Beteiligten auf eine neue, konstruktive Basis zu stellen. Eine Abkehr von den bislang oft konfrontativen Verhältnissen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern am Bau ist längst überfällig. „Weg von der Konfrontation – hin zur Kooperation“, das ist das Gebot der Stunde.
Wir wollen das Verhältnis zwischen Bauherren, Planern, Bauunternehmern wie auch Nachunternehmern auf eine neue, partnerschaftliche Grundlage stellen. Notwendig sind dazu innovative Organisations- und Vertragsformen, die zu einer kooperativen und lösungsorientierten Projektabwicklung führen sowie einen Mehrwert für das Bauvorhaben und die Projektbeteiligten schaffen. Mit der Entwicklung von Partnerschaftsmodellen ist den Unternehmen der deutschen Bauindustrie der Einstieg in diesen Prozess gelungen. Diese Modelle bauen auf den Grundsätzen des Managementansatzes Partnering auf. Wir sind davon überzeugt, dass sich auf Basis von frühzeitiger Kooperation, gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Zielen Projekte kostengünstiger, schneller, qualitativ besser und folglich für alle Beteiligten zufriedenstellender abwickeln lassen.
Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie begleitet die Umsetzung des Partnering-Ansatzes aktiv mit. Der im Rahmen unserer Initiative „Partnering bei Bauprojekten“ veröffentlichte Leitfaden für die Durchführung eines Kompetenzwettbewerbs bei Partnerschaftsmodellen ist in der Praxis auf großes Interesse gestoßen.
Das vorliegende Handbuch beleuchtet Partnering aus dem jeweiligen Blickwinkel namhafter Vertreter der verschiedenen Gruppen von Projektbeteiligten. Es ist sehr erfreulich, dass nicht nur die Bauindustrie, sondern auch Bauherren, Architekten, Projektmanager, Juristen und Investoren dem Partnering-Ansatz positiv gegenüber stehen. Auf dieser Erkenntnis kann ein erfolgreicher Wandel am Bau aufbauen.
Mit diesem Handbuch erhalten die am Baugeschehen Beteiligten sowohl einen umfassenden Überblick als auch konkrete Methoden und Vorgehensweisen zur praktischen Umsetzung aufgezeigt. Es bündelt die interdisziplinäre Materie und den aktuellen Stand der Praxis in Deutschland erstmals in einem Werk. Neben der ausgewogenen Auseinandersetzung der Autoren mit dem Themenkomplex ist hervorzuheben, dass der Praxisbezug stets auf wissenschaftlich fundierten Grundlagen beruht. Ich wünsche dem Handbuch eine möglichst weite Verbreitung und dem Partnering-Ansatz eine weiter zunehmende Bedeutung in der deutschen Bauwirtschaft.
RA Michael Knipper
Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e.V.
Geleitwort
Der Wunsch nach einer kooperativen Projektabwicklung besteht gleichermaßen in der gesamten Bau- und Immobilienwirtschaft wie auch bei den beteiligten Architekten, Fachingenieuren und Gutachtern sowie öffentlichen Auftraggebern. Die tatsächliche Entwicklung ist mit zunehmender Größe und Komplexität unserer Bauvorhaben und häufig „baubegleitender“ Planung mit hohem Änderungspotenzial eher gegenläufig: Es wird mehr denn je gestritten und prozessiert mit der Folge, dass wertvolle Planungs- und Managementkapazitäten bei den Projektbeteiligten für die Bearbeitung streitiger Sachverhalte in Form von Schriftsätzen, Stellungnahmen, umfangreichen Dokumentationen und zeitraubenden Verhandlungsrunden ohne echten Nutzen für das Projekt eingesetzt werden. Auch Rechtsberater und Gutachter profitieren nur vermeintlich von dieser allgegenwärtigen Situation, da auch deren Tätigkeit – in gleichem Umfang frühzeitig und proaktiv zur Gestaltung kooperativer Projektabwicklungsformen eingesetzt – zielführender im Sinne des Projekterfolges wäre.
Es bedarf daher einer umfassenden Initiative, das Wissen und die bisherige Erfahrung aus der Anwendung partnerschaftlicher und kooperativer Vertrags- bzw. Projektabwicklung aus den Interessenlagen der jeweiligen Projektbeteiligten heraus darzustellen und nachvollziehbar zu vermitteln. Auftraggeber, Bauunternehmen, Architekten, Projektmanager, aber auch Projektentwickler und Infrastrukturbetreiber, denen wertvolle Erfahrungen aus bereits durchgeführten Partnering-Verträgen vorliegen und diese kritisch bewerten können, sind prädestiniert dafür, diesen Erfahrungsschatz in aufbereiteter Form weiterzugeben.
Mit dem vorliegenden Buch „Partnering in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ erfüllen namhafte Autoren genau diese Aufgabe auf der Grundlage aktueller Projekte, indem Partnering-Modelle aus einzelnen Marktbereichen bzw. einzelner Marktteilnehmer vorgestellt werden. Dies ermöglicht dem Nutzer, eine Zuordnung aus seiner eigenen Interessenlage bzw. Projektart heraus vorzunehmen.
Die besondere Bedeutung dieses Buches ergibt sich jedoch aus der Kombination von Beiträgen Projektbeteiligter mit der systematischen Gesamtdarstellung des „Partnering“: als Managementansatz, die bisherige Entwicklung, Erfordernisse des Marktes, Wettbewerb, Kompetenzen, Rahmenbedingungen und das speziell darauf ausgerichtete Projektmanagement. Die Behandlung des Themas „Konfliktschlichtung“ in einem weiteren Kapitel rundet die gesamtheitliche Behandlung der mit dem „Partnering“ zusammenhängenden Themen ab und bietet dem Anwender ein umfassendes und aktuelles Handbuch als Grundlage für seine Entscheidungsfindung.
Aus der Sicht des DVP (Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.) gilt den Herausgebern besonderer Dank dafür, dass mit dieser umfassenden Abhandlung zum Thema „Partnering“ ein aktuell erkennbarer Bedarf zu einem Zeitpunkt befriedigt wird, zu dem sich mehr oder weniger zwangsläufig im Interesse aller Beteiligten partnerschaftliche Projektabwicklung parallel zu konventionellen Vertragsformen etablieren wird.
Prof. Dr.-Ing. Rainer Schofer
Vorstandsvorsitzender des DVP
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























