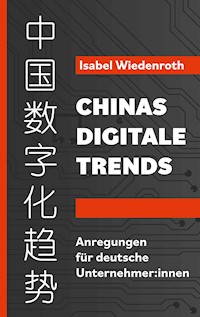Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In einer Welt, die von rasanten technologischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Umbrüchen geprägt ist, sind strategische Partnerschaften zwischen deutschen Unternehmen und asiatischen Innovatoren nicht mehr nur eine Option, sie sind eine Notwendigkeit. Während Deutschland für Präzision, Ingenieurskunst und nachhaltige Innovation steht, sind es die asiatischen Unternehmen, die mit agiler Entwicklung, disruptiven Ideen und Skalierungsfähigkeit die Zukunft vorantreiben. Gemeinsam können sie etwas schaffen, das weit über die Fähigkeiten eines einzelnen Akteurs hinausgeht. Doch nicht jede Partnerschaft ist ein Selbstläufer. Manche Allianzen scheitern, weil Visionen nicht übereinstimmen, Kulturen aufeinanderprallen oder Märkte sich schneller verändern, als es die Unternehmen erwarten. Dieses Buch zeigt auf, wie deutsch-asiatische Kooperationen zu Innovation, Wachstum und Erfolg führen können. Anhand konkreter Fallstudien, insbesondere aus der Automobilindustrie und dem Bereich hochwertiger Premiumprodukten werden sowohl erfolgreiche als auch gescheiterte Partner-schaften analysiert. Was macht eine Kooperation zum Gamechanger? Welche Kriterien führen zum Erfolg und welche zum Scheitern. Und vor allem: Was können wir daraus lernen? Ziel dieser Publikation ist es, den Blick für die großen Potenziale einer Partnerschaft mit Asiens Innovatoren zu öffnen. Es will inspirieren, bestehende Denkmuster zu hinterfragen, neue Wege zu beschreiten und Partnerschaften zu schaffen, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und einer gemeinsamen Vision beruhen. Denn die Zukunft gehört denjenigen, die den Mut haben, Grenzen zu überwinden und gemeinsam die Welt von morgen zu gestalten. Gerade deshalb wurden zum Schluss konkrete Projektideen für die Zukunft ausgerufen: als Einladung zum Mitdenken und Mitgestalten. Sie stehen exemplarisch für das, was möglich ist, wenn wir das Prinzip der Partnerschaft ernst nehmen, nicht als Absichtserklärung, sondern als gemeinsamen Gestaltungsprozess. Diese Ideen sollen Denkanstöße geben, Diskussionen anstoßen und mutige Akteure zusammenbringen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die Transformation aktiv voranzutreiben. Denn echte Veränderung beginnt dort, wo Visionen greifbar werden, in Unterneh-mungen, die zeigen, wie Partnerschaft konkret gestaltet werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Wiedenroth, 1965 in Taipei geboren, aufgewachsen in Wuppertal. Sie studierte Ostasienwissenschaft an der Universität zu Köln und International Management an der FernUniversität in Hagen.
Als deutsche Unternehmerin mit Wurzeln in Taipei und Shanghai ist es ihr ein besonderes Anliegen, Brücken zwischen Märkten und Kulturen zu schlagen. In über dreißig Jahren beruflicher Tätigkeit für deutsche Unternehmen in Asien hat sie ein tiefes Verständnis für die wirtschaftlichen und kulturellen Besonderheiten dieser beiden Welten entwickelt.
Als Chairwoman von SGT (SinoGermanTrade.com) ist sie eine Verfechterin von grenzüberschreitender, innovativer Zusammenarbeit. Sie hat einen einzigartigen Blick auf die Herausforderungen und Chancen, die sich aus strategischer Partnerschaft zwischen deutschen Unternehmen und asiatischen Innovatoren ergeben. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, erfolgreiche Partnerschaften zu gestalten und damit den Austausch von technologischem Wissen, innovativen Lösungen und Knowhow zwischen Deutschland und Asien zu fördern. Mit ihrer Expertise versteht sie es, sowohl kulturelle als auch strategische Unterschiede zu überwinden, um langfristige und nachhaltige Partnerschaften zu schaffen.
www.isabelwiedenroth.de
Für meine Mutter, die nie aufgehört hat, an mich zu glauben.
„Wer auf lange Sicht Erfolg haben will, der muss erkennen, dass wahre Größe nicht im Alleingang entsteht, sondern durch die Fähigkeit, sich mit anderen zu verbinden, Vertrauen aufzubauen und gemeinsam neue Wege zu gehen. Eine starke Partnerschaft ist wie Bambus: biegsam, aber unzerbrechlich.“ - Chinesisches Sprichwort
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapital 1: Einleitung
1.1 Bedeutung strategischer Partnerschaft
1.2 Warum Deutschland und Asien?
1.3 Asiatisches Mindset zur Partnerschaft
1.4 Ambivalenz der China-Partnerschaft
Kapital 2: Erfolgreiche Partnerschaften
2.1 Fallstudie: BMW und Brilliance
2.2 Fallstudie: Adidas - Lifestyle in China
Kapital 3: Gescheiterte Partnerschaften
3.1 Fallstudie: Volkswagen und Suzuki
3.2 Fallstudie: Bauknecht - Rückzug aus China
Kapital 4: Schlussfolgerung
4.1 Partnerschaft statt Deal
4.2 Erfolg mit asiatischen Innovatoren
4.3 Projektideen für die Zukunft
Literaturverzeichnis
Vorwort
In einer Welt, die von rasanten technologischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Umbrüchen geprägt ist, sind strategische Partnerschaften zwischen deutschen Unternehmen und asiatischen Innovatoren nicht mehr nur eine Option – sie sind eine Notwendigkeit. Während Deutschland für Präzision, Ingenieurskunst und nachhaltige Innovation steht, sind es die asiatischen Unternehmen, die mit agiler Entwicklung, disruptiven Ideen und Skalierungsfähigkeit die Zukunft vorantreiben. Gemeinsam können sie etwas schaffen, das weit über die Fähigkeiten eines einzelnen Akteurs hinausgeht. Doch nicht jede Partnerschaft ist ein Selbstläufer. Manche Allianzen scheitern, weil Visionen nicht übereinstimmen, Kulturen aufeinanderprallen oder Märkte sich schneller verändern, als es die Unternehmen erwarten.
Dieses Buch zeigt auf, wie deutsch-asiatische Kooperationen zu Innovation, Wachstum und Erfolg führen können. Anhand konkreter Fallstudien, insbesondere aus der Automobilindustrie und dem Bereich hochwertiger Premiumprodukten werden sowohl erfolgreiche als auch gescheiterte Partnerschaften analysiert. Was macht eine Kooperation zum Gamechanger? Welche Kriterien führen zum Erfolg und welche zum Scheitern. Und vor allem: Was können wir daraus lernen?
Dieses Buch versteht sich als Einladung, Neuland zu betreten. Es wurde bewusst in einem narrativen Stil verfasst, um den Geist von Partnerschaft, Innovation und gemeinsamer Wertschöpfung spürbar zu machen. Auf Fußnoten habe ich verzichtet, um die Gedanken frei fließen zu lassen – hin zu einer Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können. Die dargestellten Erkenntnisse basieren auf fundierten wissenschaftlichen Studien, die im Literaturverzeichnis aufgeführt sind, sowie auf persönlichen Erfahrungen, die ich in mehr als drei Jahrzehnten in der Begleitung und Umsetzung internationaler Projekte und deutsch-asiatischer Kooperationen sammeln durfte.
Ziel dieser Publikation ist es, den Blick für die großen Potenziale einer Partnerschaft mit Asiens Innovatoren zu öffnen. Es will inspirieren, bestehende Denkmuster zu hinterfragen, neue Wege zu beschreiten und Partnerschaften zu schaffen, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und einer gemeinsamen Vision beruhen. Denn die Zukunft gehört denjenigen, die den Mut haben, Grenzen zu überwinden und gemeinsam die Welt von morgen zu gestalten.
Gerade deshalb wurden hier konkrete Projektideen für die Zukunft ausgerufen: als Einladung zum Mitdenken und Mitgestalten. Sie stehen exemplarisch für das, was möglich ist, wenn wir das Prinzip der Partnerschaft ernst nehmen – nicht als Absichtserklärung, sondern als gemeinsamen Gestaltungsprozess. Diese Ideen sollen Denkanstöße geben, Diskussionen anstoßen und mutige Akteure zusammenbringen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die Transformation aktiv voranzutreiben. Denn echte Veränderung beginnt dort, wo Visionen greifbar werden – in Unternehmungen, die zeigen, wie Partnerschaft konkret gestaltet werden kann.
Der Lesefluss geht vor – deshalb verzichte ich auf gendergerechte Sprache. Als Unternehmerin, die sich täglich in einer männlich geprägten Geschäftswelt behauptet, habe ich gelernt: Gleichberechtigung wird nicht geschrieben, sondern gelebt.
Hallenberg, März 2025
Isabel Wiedenroth
Kapitel 1: Einleitung
S stellen wir uns eine Welt vor, in der kein Unternehmen allein überleben kann. Eine Welt, in der Märkte sich in atemberaubendem Tempo verändern, Technologien sich in immer kürzeren Zyklen erneuern und Kundenbedürfnisse sich so schnell wandeln, dass selbst die innovativsten Unternehmen kaum Schritt halten können. Doch das ist keine ferne Zukunft – es ist die Gegenwart, in der wir längst angekommen sind.
In einer solchen Umgebung sind strategische Partnerschaften nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Die Zeit der einsamen Marktführer, die in isolierten Zentralen operieren, ist längst vorbei. Heute zählt die Fähigkeit, sich mit den richtigen Partnern zu verbinden, Wissen zu teilen, Ressourcen zu bündeln und gemeinsam neue Wege zu beschreiten.
1.1 Bedeutung strategischer Partnerschaft
Der österreichische Ökonom Karl Aiginger betrachtet strategische Partnerschaften aus einer makroökonomischen Perspektive. In seinen Arbeiten zur europäischen Wirtschaftspolitik argumentiert er, dass Kooperationen nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen Regionen entscheidend für langfristige Wettbewerbsfähigkeit sind. Er betont, dass Partnerschaften über reinen Kostenwettbewerb hinausgehen – sie sind ein Instrument, um Innovationen voranzutreiben und nachhaltige wirtschaftliche Modelle zu entwickeln. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sind strategische Allianzen ein Weg, um Stabilität und Wachstum zu sichern.
Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Zustand ständiger Veränderung – unvorhersehbar, komplex und oft verwirrend. Man spricht auch von der VUCA-Welt. Der Begriff stammt aus dem militärischen Bereich, wurde aber in den letzten Jahren von der Wirtschaft und dem Management übernommen. VUCA steht für Volatility (Volatilität), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit) – vier Faktoren, die heute jede unternehmerische Entscheidung beeinflussen.
In einer volatilen Welt sind Marktbedingungen alles andere als stabil. Preise für Rohstoffe schwanken innerhalb weniger Wochen drastisch, Technologien veralten in rasantem Tempo, politische Entscheidungen können über Nacht neue Rahmenbedingungen schaffen. Ein Beispiel dafür ist der Energiemarkt: Während Ölpreise noch vor wenigen Jahren den globalen Energiemarkt dominierten, haben erneuerbare Energien mittlerweile ganze Industrien umgekrempelt. Unternehmen müssen flexibel bleiben, um nicht von plötzlichen Veränderungen überrollt zu werden.
Unsicherheit bedeutet, dass selbst mit den besten Daten und Analysen nicht eindeutig vorhergesagt werden kann, wie sich Märkte, Technologien oder geopolitische Entwicklungen verändern werden. Ein aktuelles Beispiel ist die Digitalisierung: Während einige Unternehmen frühzeitig in Künstliche Intelligenz und Automatisierung investierten, blieben andere zögerlich – oft, weil niemand genau sagen konnte, wie schnell sich diese Technologien durchsetzen würden. Unternehmen, die langfristige Strategien entwickeln, müssen akzeptieren, dass sie nie mit absoluter Sicherheit wissen können, ob sie die richtige Entscheidung treffen.
Die moderne Wirtschaft ist ein hochkomplexes, global verflochtenes System – vergleichbar mit einem weit verzweigten Netz, in dem jede Bewegung an einem Ende spürbare Auswirkungen an vielen anderen Stellen haben kann. Ein Beispiel ist die globale Lieferkettenkrise: Ein Engpass bei Halbleitern in Asien führte zu Produktionsstopps in der deutschen Automobilindustrie, was wiederum Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Investitionen hatte. Die wirtschaftlichen Abhängigkeiten sind so komplex geworden, dass keine einfache Ursache-Wirkungs-Beziehung mehr existiert – jedes Unternehmen muss ein tiefes Verständnis für seine gesamte Wertschöpfungskette entwickeln.
In einer VUCA-Welt gibt es oft kein Schwarz oder Weiß, sondern nur Grautöne. Unternehmen stehen vor Entscheidungen, deren Konsequenzen nicht eindeutig absehbar sind. Ein Beispiel ist der Umgang mit neuen Märkten: Soll ein Unternehmen frühzeitig in eine aufstrebende Region investieren oder lieber abwarten, bis sich der Markt stabilisiert? Während ein schnelles Handeln Chancen eröffnen kann, birgt es gleichzeitig Risiken. Doch zu lange zu warten, bedeutet oft, von agileren Wettbewerbern überholt zu werden.