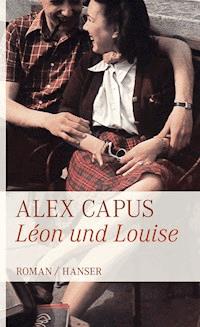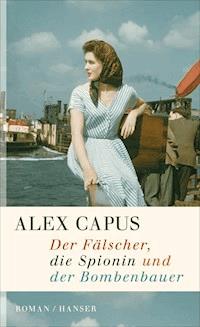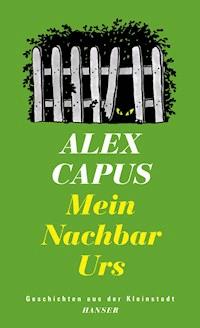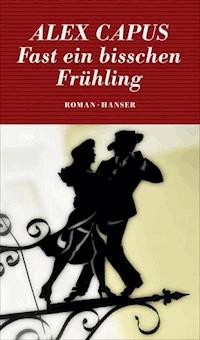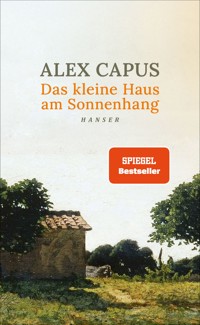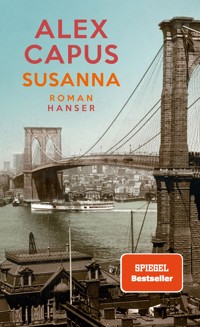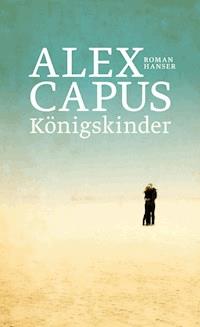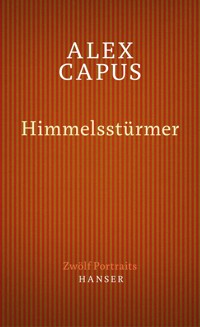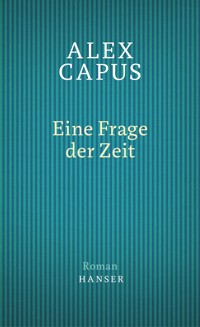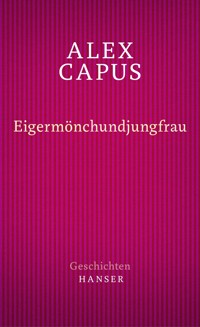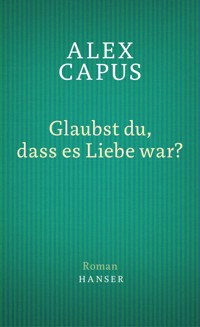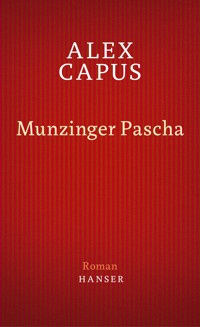
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dies ist die wahre Geschichte von Werner Munzinger, der 1852 auszieht, um die Sklaverei in Afrika abzuschaffen, während sein Vater im heimatlichen Olten vom bürgerlichen Revolutionär zum Finanzminister avanciert. Als Händler und Forschungsreisender zieht Werner Munzinger nach Kairo und ans Rote Meer, macht sich auf in die Gebirge Abessiniens, den sagenumwobenen Nilquellen entgegen. Er heiratet, wird Bauer, verwickelt sich in Kriege und Intrigen, und gegen seinen Willen steigt er auf zu Reichtum, Macht und Ehre. Dies ist aber auch die Geschichte des Reporters Max Mohn aus Olten, der, unzufrieden mit seinem Leben, 150 Jahre später aufbricht, um die Spuren des Werner Munzinger Pascha im Wüstensand aufzuspüren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Dies ist die wahre Geschichte von Werner Munzinger, der 1852 auszieht, um die Sklaverei in Afrika abzuschaffen, während sein Vater im heimatlichen Olten vom bürgerlichen Revolutionär zum Finanzminister avanciert. Als Händler und Forschungsreisender zieht Werner Munzinger nach Kairo und ans Rote Meer, macht sich auf in die unwegsamen Gebirge Abessiniens, den sagenumwobenen Nilquellen entgegen. Er heiratet und wird Bauer, verwickelt sich in Kriege und Intrigen, und gegen seinen Willen steigt er auf zu Reichtum, Macht und Ehre.
Dies ist aber auch die Geschichte des Reporters Max Mohn aus Olten, der, unzufrieden mit seinem Leben in der Provinz, 150 Jahre später aufbricht, um die Spuren des Werner Munzinger Pascha im Wüstensand aufzuspüren.
Alex Capus
Munzinger Pascha
Roman
Carl Hanser Verlag
Für Nadja
»Meistens verändern sich die Dinge zum Besseren.«
John Wayne 1969 in ›Chisum‹
Illustration von Bettina Wunderli
Copyright © 1997 Diogenes Verlag AG Zürich
1
An jenem Wintermorgen hing der Himmel voller Gleitschirmflieger und Ballonfahrer. Wie neonfarbene Geier kreisten sie über der Stadt, während unten im Morgenverkehr ein Bus sich über die City-Kreuzung quälte. Auf der hintersten Plattform stand ein schlaksiger junger Mann und warf gallige Blicke hinauf zu den vergnügungssüchtigen Himmelsstürmern. ›Die Idioten lernen fliegen‹, dachte er. ›Bald fliegen alle Idioten am Himmel herum. Dann sehen wir die Sonne nie mehr.‹ Der neidische junge Mann war ich.
»Ah, unser Max Mohn!« hatte mich der Chef zehn Minuten zuvor angebrüllt, als ich in die Redaktion der ›Oltner Nachrichten‹ kam. »Tut mir leid, daß ich deine Arbeitskraft zu solch früher Morgenstunde in Anspruch nehmen muß, hehe!«
Ich murmelte einen Morgengruß.
»… sozusagen mitten in der Nacht, hehe, dazu noch an einem Montag! Du mußt auf die Piste. Jetzt gleich, sofort. Portrait schreiben. Du bist angemeldet.«
»Bei wem?«
»Dieter Zingg.«
»Dem Kunstmaler? Der war doch erst letzte Woche im Blatt!«
»Schon. Aber jetzt will er in die Politik, kandidiert für den Ständerat. Da müssen wir ein Portrait bringen. Hundertachtzig Zeilen, ja? Sei so gut, bitte.«
Während der Bus stadtauswärts ruckelte, öffnete ich die Archivmappe, die mir der Chef mitgegeben hatte. Sie enthielt Zeitungsartikel über den Kunstmaler Dieter Zingg: fünfundvierzig Jahre alt, Bezirksschullehrer im Hauptberuf, Förder- und Anerkennungspreise hier und da und dort, wurde Anfang der achtziger Jahre den Jungen Wilden zugerechnet und als eine der vielversprechendsten schöpferischen Kräfte im Land gehandelt. Wurde — Donnerwetter! — zu Gruppenausstellungen in Tokio und London eingeladen. Durfte drei Monate im Atelier einer Kulturstiftung in New York arbeiten. Donnerwetter, Donnerwetter.
Meine Haltestelle hieß Mühlebach, obwohl es hier längst keine Mühle und keinen Bach mehr gab. Ein paar hundert Meter abseits der Hauptstraße begann das Einfamilienhausquartier, in dem Zinggs Haus stand. Er wohnte, wo alle Lehrer wohnen: in einem Einfamilienhaus am Jurasüdfuß. Nicht ganz hoch oben, wo's richtig teuer wird (ab 700 m ü. M.), aber auch nicht unten, wo die billigeren Häuschen stehen (530 m ü. M.), und schon gar nicht zuunterst in der Ebene an der Bahnlinie Zürich — Genf (420 m ü. M.), wo die Türken und Jugoslawen in speckigen Wohnblocks leben. Mit meinem in langen Jahren als Lokalreporter erworbenen Sozial-Höhenmesser hatte ich Zinggs Domizil rasch geortet: Es lag auf 613 Metern und war bis zum hintersten Kellerfenster dreifachverglast. Davor stand links ein Schneemann mit Karottennase, Kohleaugen, Wollmütze und Reisigbesen. Rechts lag tief eingeschneit und zugefroren ein Weiher, an dessen Ufer ein wohldosiertes Bündel Schilf aus dem Schnee ragte. Zweifellos quakten dort im Sommer die Frösche und blühten allerlei lehrreiche Pflanzen.
Ich öffnete das schmiedeeiserne Gartentor und ließ es hinter mir sachte ins Schloß fallen. Ein makellos schneefreier Plattenweg führte zu einer Buchenholztür. Daneben hing eine rostige Kette mit rustikalem Holzgriff. Als ich daran zog, ertönte drinnen das Bimmeln eines Ziegenglöckleins. Die Tür ging auf, und vor mir stand eine alterslose Frau mit im Nacken zusammengebundenen Haaren und wäßrigen Augen.
»Guten Tag, mein Name ist Mohn. Max Mohn, von den ›Oltner Nachrichten‹. Ich bin mit Herrn Zingg verabredet.«
Die Frau wischte ihre mehlbestäubten Hände an der Küchenschürze ab. »Bitte kommen Sie herein.«
Ich machte zwei Schritte ins Hausinnere, dann sagte die Frau: »Würden Sie bitte die Schuhe ausziehen? Wir halten das hier so. Der Schmutz und der Schnee, verstehen Sie?«
Ich stellte meine Schuhe neben eine Reihe von kleinen und noch kleineren Gummistiefeln mit aufgedruckten Mickymausfiguren, stieg vorsichtig über eine Spielzeuglokomotive aus Naturholz und folgte der Frau in die Wohnküche. Dort gab eine Glasfront den Blick frei auf den Weiher und den Schneemann. An schönen Tagen mußte die Küche sonnendurchflutet sein. Es duftete nach selbstgebackenem Brot. Überall stand und hing blitzsauberes Bauerngeschirr. An einem alten Eichentisch in der Mitte des Raums thronte Dieter Zingg und las die ›Oltner Nachrichten‹. Er trug ein blaues Bauernhemd mit aufgestickten Enzianen, einen gepflegten Kranzbart und eine runde Nickelbrille. Links und rechts von ihm saßen drei rotbackige Mädchen, das blonde Haar zu Zöpfen geflochten, etwa acht bis zwölf Jahre alt. Das also war der Junge Wilde und Ständeratskandidat Dieter Zingg.
»Guten Morgen, Herr Mohn! Setzen Sie sich, wir beginnen gerade mit dem Frühstück. In den Ferien immer etwas später als gewöhnlich, hehe!«
Ich setzte mich, verknotete die unbeschuhten Füße unter dem Stuhl und versuchte mich zu erinnern, wann ich zuletzt die Socken gewechselt hatte. Dieses Lachen. Hehe. Hatte ich das heute nicht schon einmal gehört?
»Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit«, eröffnete Zingg das Gespräch. »Ihren Chefredakteur kenne ich ja schon ewig. Wir haben zusammen das Lehrerseminar abgesessen. Und dann waren wir beide bei den Kommunisten, hehe! Das war vor — warten Sie — vor bald dreißig Jahren. Sie müssen das ja nicht unbedingt schreiben in Ihrem Bericht, hehe!«
Wie auf ein geheimes Zeichen falteten die drei Mädchen die Hände und schlossen die Augen. Zingg und seine Frau taten es ihnen nach, und dann bat das jüngste den Herrgott, daß Er segnen möge, was Er uns bescheret hat, und daß es dem kranken Nachbarn besser gehen möge. Ich hielt mich mit beiden Händen an der Tischplatte fest und war froh, daß die ganze Familie die Augen geschlossen hatte. Ob Zingg auch Tischgebete sprechen ließ, wenn er mit seinen Kumpels von der New Yorker Avantgarde Kokain schnupfte?
Als es vorbei war, sagte Zingg: »Das hast du schön gemacht, Myriam. Reichst du mir bitte die Butter, Rachel? Und du den Brotkorb, Rebekka?«
Myriam, Rachel, Rebekka. Mir schwindelte. Die drei Mädchen lächelten ihren Vater an und reichten ihm das Gewünschte, während die Mutter aufstand und am Herd mit Kaffee und Milch hantierte. Zingg schaute mich erwartungsvoll an. Ich zermarterte mir das Gehirn nach einer geistreichen Frage. Wie sollte ich etwas über den Mann schreiben, wenn mir nicht mal eine Frage einfiel? Die drei Mädchen mit den biblischen Namen musterten mich sittsam aus runden, wasserblauen Augen. Ich nahm einen Schluck Milchkaffee aus der riesigen Tasse, die mir die Frau hingestellt hatte. Jetzt mußte ich etwas sagen.
»Haben Sie dieses Haus selbst gebaut?«
Zingg riß begeistert die Augen auf. Er legte das Buttermesser auf den Teller und begann zu erzählen: von Sonnenkollektoren auf dem Dach und Wärmerückführung, Dreifachverglasung, natürlichen Baumaterialien und Holzschnitzelheizung. Ich beobachtete, wie die Mädchen sparsam Butter auf das Brot schmierten und noch sparsamer Honig auftrugen. Sie reichten einander den Honigtopf so behutsam weiter, als ob er Nitroglyzerin enthielt. Ich war mir sicher, daß Zingg den Honig selbst gewonnen hatte. Gleich hinter dem Haus stand mit größter Wahrscheinlichkeit das familieneigene Bienenhaus. Und bestimmt hatte Zingg seinen Töchtern schon tausendmal erklärt, wie hart ein Bienchen arbeiten muß für eine Messerspitze Honig.
Der Milchkaffee wärmte mir wohlig den Bauch. Die drei artigen Mädchen und ihre geschäftige Mutter wattierten den Raum mit sanfter Weiblichkeit, und jetzt drang doch tatsächlich ein zaghafter Sonnenstrahl durch den Nebel in unsere Bauernküche. Ich fühlte mich plötzlich sehr wohl. Eine dösige Müdigkeit breitete sich in mir aus. Weit weg waren New York, Tokio, der Ständerat und meine Schreibmaschine. Avantgarde und Politik hatten keine Chance gegen die Gemütlichkeit unserer Frühstücksrunde. Ich nahm mich zusammen und versuchte Zinggs bautechnischen Ausführungen zu folgen. Ab und zu streute ich einen schläfrigen Ausdruck der Verblüffung ein und tunkte selbstgebackenes Vollkornbrot in den Milchkaffee. Die Frau brachte mir Lammfellpantoffeln. Mein Glück war vollkommen. Ich wollte nie mehr von hier weggehen. Bis an mein Lebensende würde ich bei diesen braven und gottesfürchtigen Bauersleuten bleiben; morgens würde ich die Kühe melken, nachmittags Schnaps brennen und abends mich zeitig im Stall zur Ruhe legen in der dampfenden Wärme des Viehs. Nach zehn Jahren treuer Pflichterfüllung würde mir der Bauer Zingg eine seiner Töchter zur Frau geben — die mittlere vielleicht, die mit den Sommersprossen —, und eines fernen Tages würde ich den Hof übernehmen.
Aber dann sagte Zingg: »So, genug geplaudert. Jetzt muß ich Ihnen erklären, wieso Politik Kunst ist und Kunst Politik. Gehen wir ins Atelier.«
Benebelt stieg ich hinter Zingg die Treppe hoch. Ich wollte nicht ins Atelier. Ich wollte in der Bauernküche bleiben bei den blondbezopften Mädchen, der mehlbestäubten Frau und dem Milchkaffee. Aber Zingg wollte ins Atelier und in die Politik. Warum nur?
Das Atelier lag unter dem Dach. Da war nichts von bäuerlicher Gemütlichkeit, nur ein leerer weißer Raum mit großen Dachfenstern und einer Staffelei in der Mitte. An den Wänden standen ungerahmte Bilder, jedes so groß wie das staubige Rechteck unter dem Ehebett meiner Großeltern. Zingg deutete auf eine blaue menschliche Silhouette auf weißem Grund, die mit einem gewaltigen Satz durch einen gelbroten Feuerreif sprang. »Dieses habe ich als letztes gemalt.«
Ich versuchte mich auf das Bild zu konzentrieren, während ein Hauch kalten Milchkaffees von Zingg zu mir herüberwehte. Um nichts sagen zu müssen, wandte ich mich dem nächsten Bild zu. Es zeigte eine rote Silhouette, die durch einen blauen Feuerreif sprang. Schweigend machte ich die Runde: violette Silhouette durch gelben Feuerreif, gelbe Silhouette durch blauen Feuerreif, grün durch violett und so weiter. Schließlich kam ich wieder bei Zingg an, der bei seinem jüngsten Werk stehengeblieben war. Ich war ratlos. Was um alles in der Welt machte Zingg da?
Er schaute mich ernst und prüfend an. »Verstehen Sie nun, daß ich in die Politik muß?«
Jetzt mußte ich wirklich etwas sagen. Irgend etwas. »Ich … fühle in Ihrem Werk eine tiefe Betroffenheit …«
Zingg rieß erneut die Augen auf und begann zu erzählen: vom schlechten Zustand der Tropenwälder, vom Ozonloch, den Menschenrechten, fairem Welthandel, natürlichen Baumaterialien und Holzschnitzelheizung. Er redete über qualitatives Wachstum, nachhaltige Entwicklung und die Besteuerung fossiler Energieträger, dann auch über Kinderkrippen, Radwege, das Aussetzen von Feuersalamandern in städtischen Naherholungsgebieten und die Bekämpfung des Hundebandwurms. Ich fühlte mich plötzlich sehr unwohl. Weit weg waren die Bauernküche, die mehlbestäubte Frau mit ihren blondbezopften Töchtern, der Bienenstock und der Milchkaffee. Ich nahm mich zusammen und versuchte Zinggs Ausführungen zu folgen, machte auch einige Bemerkungen und Notizen. Aber eigentlich dachte ich immer nur über die eine große Frage nach: wie ich möglichst schnell und elegant von hier verschwinden könnte.
2
Am frühen Nachmittag saß ich in der Redaktion der ›Oltner Nachrichten‹ vor meinem Bildschirm und spielte mit der Tastatur. Hundertachtzig Zeilen, hatte der Chef gesagt; das war in zwei Stunden bequem zu schaffen. Wenn nichts dazwischenkam, würde ich noch bei Tageslicht die Aare entlangspazieren und nachsehen, wie es den Schwänen am zufrierenden Flußufer erging. Ich hatte gerade meine dreieinhalb Schreibfinger in Stellung gebracht, als eine fette, blauschwarze Fliege auftauchte. Eine Fliege mitten im Winter — fasziniert ließ ich die Hände in den Schoß sinken. Sie torkelte brummend durch mein Büro wie ein chilenisches Postflugzeug, das verzweifelt seinen Weg durch die regenverhangenen Anden sucht. Das Postflugzeug quälte sich über den Gipfel des Gummibaums hinweg, verschwand für einen Augenblick in einer schwarzen Gewitterwolke und schaffte kurz vor dem Zerschellen am nächsten Gebirgszug eine Notlandung auf meinem Büchergestell. Dort stand der Flieger still und ließ die heißgelaufenen Propellermotoren auskühlen. Sachte rollte ich auf dem Bürostuhl zum Regal. Der Brummer mußte weg; solange der im Büro umherkurvte, würde ich keine Zeile schreiben können. Als ich auf Armeslänge herangekommen war, hob ich die Hand, fixierte den Gegner, schlug blitzschnell zu — und die Fliege war nur mehr ein Fleck, gleichmäßig verteilt auf meinem Handteller und einem grünen Buchrücken. Ich wischte meine Hand ab und betrachtete das Buch. Dick, in Leinen gebunden, goldene Prägeschrift: Geographisches Lexikon der Schweiz, erschienen 1905. Noch nie gesehen. Dabei saßen wir nun schon drei Jahre ganz nah beisammen, Rücken an Rücken sozusagen. Als pflichtbewußter Lokalreporter schlug ich unter O wie Olten nach.
OLTEN (Kt. Solothurn, Amtei Olten-Gösgen). 400 m ü. M., Stadtgemeinde, 67 km nördlich von Bern, auf beiden Seiten der Aare und zwischen den beiden südlichsten Juraketten, 47 21’ n. Br. und 8 03‹ ö. L. von Greenwich. Olten verdankt seine Bedeutung der Eigenschaft als Hauptzentralpunkt der Bahnlinien Genf-Zürich-Bodensee via Bern und via Neuenburg und Basel-Luzern-Chiasso sowie der Straßenzüge …
Olten war also ein Hauptzentralpunkt. Das hatte ich doch schon immer vermutet. Und was sonst? 8200 Einwohner in 850 Häusern (1904), neues Schulhaus, neues Theater, neues Spital, allerlei neue Fabriken, ein eigenes Elektrizitätswerk, Stadtbibliothek mit 15.000 Büchern, prächtiger Bahnhof, prächtige Naturlandschaft ringsum, prächtige Geschichte, zurückzuverfolgen bis in die Römerzeit … und so weiter. Ich wunderte mich nicht mehr, daß wir so lange schweigend Rücken an Rücken gesessen hatten, das Lexikon und ich. Wir hatten einander nichts zu sagen. Ich wollte es eben zuklappen und zurück ins Regal stellen, als mir im letzten Moment eine irritierende Buchstabenfolge ins Auge stach. Ich zoomte die Druckbuchstaben heran. Hier stand eine Schulklasse voller kreuzbraver lateinischer Buchstaben, zu nichts anderem nutze als zum Auffüllen der leeren Seiten in einem geographischen Lexikon. Weshalb also irritierten mich die kleinen Langweiler? Ich ging sie nochmals durch, und dann sah ich es: Das hier war kein gewöhnliches Klassenfoto, die lateinischen Langweiler paßten nicht zueinander.
Aus Olten sind viele bekannte und verdiente Persönlichkeiten hervorgegangen: (…) WERNER MUNZINGER PASCHA (1832 —1875), Generalgouverneur der ägyptischen Provinzen am Roten Meer und des östl. Sudans, Afrikareisender und Sprachforscher.
Olten war also nicht nur ein Hauptzentralpunkt, sondern auch Geburtsort eines großen Abenteurers. In denselben engen Gassen wie der Ständeratskandidat Zingg und ich hatte der berühmte Werner Munzinger Pascha seine ersten Schritte getan. Wie wurde man Generalgouverneur der ägyptischen Provinzen am Roten Meer und des östlichen Sudans? Und ich? Warum hatte ich bis heute nichts gewußt von diesem Munzinger Pascha? Warum sagte mir keiner was? Mir, dem Lokalreporter? Ich stand auf und ging mit dem Lexikon hinüber ins Büro des Chefredakteurs.
Auf dem Mahagonipult drehte eine grüne Lokomotive des Typs Ae 3/6 einsam und gemächlich ihre Runden. Ich folgte dem Lauf der Schienen; der Chef hatte wieder einmal eine raffinierte Linienführung gefunden. Sein Ehrgeiz bestand jeweils darin, beim Streckenbau nichts zu verrücken: Die Schreibmaschine mußte am gewohnten Ort stehenbleiben, das Bild der Ehefrau auch, der Rosenquarz, die Aktenstöße, die zwei Telefonapparate ebenfalls. Wirklich gelungen, die Linienführung, besonders die kleine Brücke über die Computer-Tastatur hinweg. Aber wo war der Chef?
»Wo ist denn nur … verdammt … ich hab sie doch …« Hohl drang Trümpys Stimme aus einem Aktenschrank hinter der Tür.
»Chef?«
»Wo zum Teufel ist die Ae 4/7?« Er tauchte aus der Tiefe des Schranks auf und sah mich drohend an. Ich erinnerte ihn daran, daß wir die Lok nach dem letzten Redaktionsapéro in die Reparatur hatten schicken müssen; sie war in einer Linkskurve entgleist und gegen den Heizkörper geknallt, als der Chef einen neuen Geschwindigkeitsrekord versuchte.
»Ach ja!« Er ging zurück zu seinem Pult und drehte am Transformator, worauf die Ae 3/6 doppelt so schnell zwischen Rosenquarz, Ehefrau und Aktenstößen herumkurvte. »Kommst du voran mit deinem Portrait?«
»Es geht. Sagt dir der Name Werner Munzinger Pascha etwas?«
»Der Afrikaforscher? Natürlich. War der Sohn des Bundespräsidenten Josef Munzinger, des Gründervaters von 1848. Ist nach Ägypten abgehauen, als sein Vater in die Regierung kam. Wollte wohl Pharao werden, um den Alten zu übertrumpfen, hehe!«
3
17. November 1848, kurz vor Mittag. Dicke Nebelschwaden ziehen über die Aare. Das ist nichts Ungewöhnliches für die Jahreszeit, aber die Möwen mögen den Nebel nicht; beleidigt bleiben sie auf dem Dachfirst der Holzbrücke sitzen, die vom Zollhaus ins Städtchen führt. Ein Hauptzentralpunkt ist Olten damals noch nicht, denn es gibt keine Eisenbahn weit und breit. Olten ist in jenem Herbst ein muffiges Kaff mit tausendfünfhundert Einwohnern, die sich ängstlich hinter dicken, mittelalterlichen Stadtmauern verbergen. Und wo später Spitäler und Fabriken stehen werden, dampfen Kuhweiden und frisch gepflügte Kartoffeläcker in der fahlen Morgensonne.
Ein paar hundert Meter flußaufwärts sitzt ein schmächtiger Jüngling von sechzehn Jahren auf einem Fels und wirft Steinchen ins Wasser. Da und dort ragen verrottete, algenbedeckte Holzbalken aus dem Fluß. Die Goldsucher! Wenn nur die Goldsucher noch hier wären! Der Jüngling streicht sich eine blonde Locke aus dem bleichen Gesicht. Der Vater hat oft von ihnen erzählt: Über sechzig Mann haben hier Gold gewaschen von Mai bis September 1820. Grimmige Kerle waren das, ausgediente Soldaten, landlose Bauern, heimatlose Handwerksgesellen. Sie arbeiteten für den Oltner Posthalter Frei, der die Rechte an der unteren Aare für zehn Jahre gekauft hatte. Einen Sommer lang standen die Kerle zehn Stunden täglich bis zu den Hüften im Wasser, schaufelten goldhaltigen Sand aus dem Flußbett und siebten hauchdünne Goldplättchen heraus. Im Herbst wog Posthalter Frei die Ausbeute und beschloß, daß es zu wenig sei. Die sechzig Männer mußten gehen, nach Kalifornien oder sonstwohin. In Olten jedenfalls gab es für sie keinen Platz, und in der Aare verrotten seither die hölzernen Schleusen und Waschtische. Olten ist halt nicht Kalifornien! sagt der Vater.
Werner Munzinger wirft Steinchen nach einem Holzbalken, der nicht allzu weit weg im Wasser steht. Er trifft nicht. Sein Bruder Walther trifft immer. Walther ist Soldat. Dabei ist er nur zwei Jahre älter als Werner. Vor einem Jahr hat er sogar ernsthaft geschossen, als er gegen die katholischen Kantone in den Sonderbundskrieg zog, und einen Säbel hat Walther erbeutet in offener Schlacht. Hoch zu Roß ist er in Luzern eingeritten, mitten im Generalstab an der Spitze der siegreichen Armee. Soldat kann ich nicht werden, denkt Werner. Erstens ist das der Bruder schon, zweitens treffe ich nicht so gut. Aber was dann? Nächstes Jahr ist Werner mit dem Gymnasium fertig, dann muß er nach Bern an die Universität und ein Studium anfangen. Theologie wäre schön; aber wenn er diese verstaubten Pfaffen nur schon sieht … Der Vater will, daß er Arzt wird. Werner hat Hunger. Hoffentlich ist bald Mittag. Großmutter macht die besten Pfannkuchen der Welt. Je näher Werner dem oberen Stadttor kommt, desto mehr Menschen begegnet er.
»Sei gegrüßt, Werner! Gratulation dem Herrn Vater!«
Was haben die Leute nur? Warum schauen sie ihn alle an?
»Herzlichen Glückwunsch!«
Dort zieht sogar einer den Hut! Noch nie hat einer den Hut gezogen vor ihm. Und die Frau da will gar nicht mehr aufhören zu lächeln. »Allen Segen aus der Vaterstadt für den Herrn Papa!«
Ach ja, der Vater. Gestern ist er in Bern zum Bundesrat gewählt worden. Erwartungsgemäß. Vater ist ein berühmter Mann. Schon vor dreißig Jahren war er freisinniger Revolutionär, mußte nach Italien ins Exil, kam zurück und jagte in Solothurn 1830 die Adligen zum Teufel. Die Geschichte hat Werner schon oft gehört. Auch jene vom reaktionären Tambourmajor, der aus Rache in ihr Haus eindrang und die Köchin zwang, Vaters liebsten Kanarienvogel zu braten. Politiker will Werner nicht werden. Das ist der Vater schon. Etwas Neues will er machen, etwas Schönes, Großes — aber was? Im Frühling muß er nach Bern an die Universität. Er weiß nicht, was er studieren soll. Alles ist schon besetzt. Alles ist verbraucht und abgenutzt und langweilig.
Auf der Brücke zum Oberen Tor schlägt Werner der Gestank des Stadtgrabens entgegen. Tief unten fließt ein dünner Bach die Stadtmauer entlang. Im Gebüsch links und rechts des Rinnsals verwesen Küchenabfälle und die Eingeweide geschlachteter Tiere; unter der Brücke liegt seit Wochen ein totes Pferd, dessen Rippen zwischen dem zerfetzten braunen Fell hervorgrinsen. Werner läuft durch die Hauptgasse zum Munzinger-Haus, als vor ihm eine Bürgerin ihren Nachttopf aufs moosbewachsene Pflaster schüttet. Schon immer hat es gestunken in den dämmerigen Gassen dieses Untertanenstädtchens. Seit elf Generationen lebt Familie Munzinger in diesen Mauern. Seit vierhundert Jahren. Das genügt. Werner will nicht, sein Bruder Walther auch nicht. Natürlich hat Vater recht: Die Familie ist reich geworden im Schutz der Stadtmauern. Vierhundert Jahre haben die Munzingers hier gearbeitet in Frieden, Fleiß und Freudlosigkeit als Leinenweber, Drahtschmiede und Handelsleute. Eine ehrbare, angesehene Familie. Aber Werner will nicht. Das ist ihm zu langweilig. Wenn die Goldsucher hier keinen Platz haben, will auch er nicht bleiben.
4
Draußen war es schon dunkel, und ich saß immer noch im Büro und hatte keine einzige Zeile über Dieter Zingg zustande gebracht. Zum x-ten Mal schrieb ich drei Wörter auf den leeren Bildschirm und löschte sie gleich wieder. Ich stand auf und holte Kaffee, schrieb fünf Wörter, sortierte die Büroklammern in meinem Pult der Größe nach, fügte zwei Wörter hinzu und löschte alles, staubte die Blätter des Gummibaums ab und rauchte meine fünfzehnte Zigarette.
»Max, alter Träumer!« brüllte der Chef, der sich wie immer lautlos von hinten angeschlichen hatte. »Kommst du voran? Morgen früh bringst du mir den Artikel, ja? Ich möchte ihn durchsehen, bevor er ins Blatt kommt. Den alten Zingg kenne ich schon ewig. Wir haben zusammen das Lehrerseminar abgesessen. Und dann waren wir beide bei den Kommunisten, hehe! Das war vor — wart einmal — bald dreißig Jahren. Das mußt du ja nicht unbedingt schreiben, hehe!«
Er war schon fast wieder draußen, als ich ihn zurückrief. »Chef! Es geht nicht.«
»Was soll das heißen?«
»Es geht nicht. Mir fällt nichts ein.«
»Zum alten Zingg fällt dir nichts ein? Aber hör mal: der Bart. Die Kunst. Das Häuschen. Der Weiher. Die Frau. New York. Die drei Töchter. Tokio. Und jetzt auch noch die Politik. Da fällt dir nichts ein?«
»Wie soll ich sagen: Der Mann ist … er ist …«
»Ja?« Der Chef schaute mich an wie ein geduldiger Primarlehrer.
»Nun, er ist …«
»Sag's doch!«
»Er ist ein …«
»Ein Arschloch, ein verlogenes?«
»Ja. Ganz genau.« Der Chef hatte mit zwei Wörtern das Portrait des Ständeratskandidaten Dieter Zingg gezeichnet. Der Artikel war geschrieben, die Arbeit erledigt. Ich konnte nach Hause gehen.
»Du meinst, der alte Zingg ist ein wehleidiger Wohlstandskrüppel?«
»Ja.«
»Ein scheinheiliger Kriegsgewinnler? Ein kleinkarierter Kulturspießer?«
»Exakt.«
»Ein kleinmütiger Humanitätsheuchler? Ein wurstiger Pinselschwinger? Ein spießiger Gartenzwerg?«
»Genau.«
»Mein lieber Max, hör mir zu: Erstens müssen wir das Portrait einfach bringen, weil wir von jedem Ständeratskandidaten ein Portrait machen. Zweitens sind genau solche Sachen dein Job. Und drittens: Was glaubst du, welche Ausdrücke ein sechzehnjähriger Gymnasiast wählen würde, wenn er einen dreißigjährigen konvertierten Hippie wie dich mit zwei Wörtern portraitieren müßte?«
Natürlich hatte der Chef recht. Das ärgerte mich jedesmal furchtbar, wenn er recht hatte. Sobald ich mit dem Portrait fertig wäre, würde ich wieder einmal in die Kneipe gehen und mich betrinken. Sachte, aber gründlich, zur Entspannung.
Kaum war der Chef weg, klingelte das Telefon.
»Oltner-nachrichten-lokalredaktion-mohn-guten-tag?«
»Max, bist du das?«
Ingrid. Oh, Ingrid.
»Hallo Ingrid, wie geht's?«
»Danke. Bestens. Großartig. Und dir?«
»Genauso. Bestens. Ganz großartig.«
»Hör zu: Kannst du heute abend außer Programm den Kleinen übernehmen? Ich habe eine wichtige Sitzung. Sagen wir — in einer halben Stunde? Paßt dir das?«
»Natürlich.«
Es paßte mir überhaupt nicht. Heute abend wollte ich mich betrinken. Macht nichts. Mein Sohn ist wichtiger. Betrinke ich mich halt morgen. Und das Portrait kann ich auch zu Hause schreiben, wenn der Kleine schläft.
Ingrid, o Ingrid.
Wie lange ist das nun her, daß wir uns trennen mußten? Erst vier Monate? Es kommt mir vor wie sieben Jahre.
An jenem Abend hatte ich mich mit zwei großen Plastiktaschen voller Einkäufe das Treppenhaus hochgekämpft und sie neben Ingrid auf den Küchentisch gestellt. Sie saß vor einem Glas Rotwein in betonter Gelassenheit, eine Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand. Das war ein schlechtes Zeichen. Ingrid hatte das Rauchen zu Beginn der Schwangerschaft aufgegeben und war nur drei Mal rückfällig geworden — das erste Mal, als ich ihren roten Triumph Spider zu Schrott fuhr; das zweite Mal, als ihre Werbeagentur Konkurs ging; und das dritte Mal, als ihre Mutter an Lungenkrebs starb.
»Was ist los?« fragte ich.
»Nichts« sagte Ingrid und schaute ihren Rauchkringeln hinterher.
»Wo ist der Kleine?«
»Schläft.«
»Schon?«
»Noch. Er schläft noch. Seit zwei Stunden. Gleich wird er wieder aufwachen.«
»Dann schläft er wieder die halbe Nacht nicht.«
»Ja, Max!«
»Ich sage ja nichts.«
»Er ist mir mitten im Flur eingeschlafen, wenn du es genau wissen willst. Über seinem Feuerwehrauto.«
»Ja.«