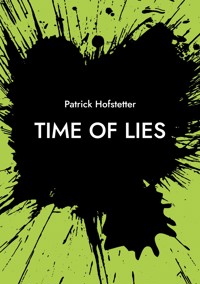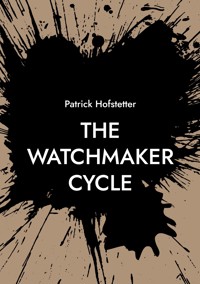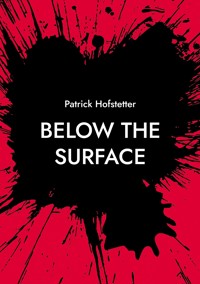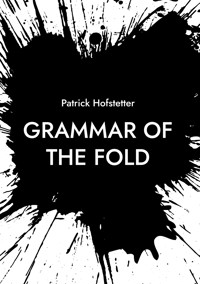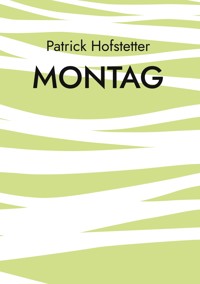Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Vater, den alle für tot hielten. Eine Tochter, die nicht aufhört zu suchen. Eine Wahrheit, die niemand sehen darf. Als Kind verliert Mara ihren Vater durch einen rätselhaften Suizid im See. Jahre später tauchen Hinweise auf, dass er nie gestorben ist, sondern Opfer eines Pharmakonzerns wurde, der Menschen in geheimen Laboren für Experimente missbraucht. Mara begibt sich auf eine gefährliche Reise in die Ukraine. Zwischen zerstörten Städten, eiskalten Schneefeldern und den Kellern einer vergessenen Klinik stößt sie auf Beweise, die mächtige Gegner um jeden Preis im Dunkeln halten wollen. Verfolgt von Killern, verraten von Verbündeten, getrieben von der Stimme ihres Vaters, kämpft Mara um die Wahrheit und um ihr eigenes Überleben. Doch je näher sie der Enthüllung kommt, desto klarer wird: Manche Wahrheiten sind tödlicher als jede Lüge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Nikita, Kateryna, Liliane
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1 – Die Tage des Schweigens
Kapitel 2 – Das, was bleibt
Kapitel 3 – Die falsche Identität
Kapitel 4 – Der fehlende Name
Kapitel 5 – Der Beobachter
Kapitel 6 – Die Spur des Vaters
Kapitel 7 – Die Lüge im Schweigen
Kapitel 8 – Die Jahre des Wartens
Kapitel 9 – Ankunft im Schatten
Kapitel 10 – Die Tür ohne Namen
Kapitel 11 – Die Hand im Nacken
Kapitel 12 – Yelena
Kapitel 13 – Der Bunker
Kapitel 14 – Die Jagd beginnt
Kapitel 15 – Der Kreis der Schatten
Kapitel 16 – Die Akte im Dunkel
Kapitel 17 – Phase K
Kapitel 18 – Die letzte Sichtung
Kapitel 19 – Der Mann aus Charkiw
Kapitel 20 – Vorbereitung auf den Abstieg
Kapitel 21 – Tor zur Hölle
Kapitel 22 – Stimmen im Dunkel
Kapitel 23 – Entscheidung im Schatten
Kapitel 24 – Die Jagd der Schatten
Kapitel 25 – Niemandem vertrauen
Kapitel 26 – Der falsche Helfer
Kapitel 27 – Entscheidung im Nebel
Kapitel 28 – Das Netz
Kapitel 29 – Feuer im Bahnhof
Kapitel 30 – Letzte Zuflucht
Kapitel 31 – Die Wahrheit tropft
Kapitel 32 – Die andere Wahrheit
Kapitel 33 – Belagerung
Kapitel 34 – Allein im Schneesturm
Kapitel 35 – Der Handel
Kapitel 36 – Im Netz der Retter
Kapitel 37 – Unter fremden Augen
Kapitel 38 – Keine Zuflucht
Kapitel 39 – Der Lauf durch Eisen und Feuer
Kapitel 40 – Der Sturz
Kapitel 41 – Atem im Dunkeln
Kapitel 42 – Jäger im Schnee
Kapitel 43 – Belagerung im Lokschuppen
Kapitel 44 – Bühne der Wahrheit
Kapitel 45 – Die Straße nach Kiew
Kapitel 46 – Schatten über Kiew
Kapitel 47 – Live oder Tod
Kapitel 48 – Sturm
Kapitel 49 – Unter der Stadt
Kapitel 50 – Über der Erde
Kapitel 51 – Gesicht der Wahrheit
Kapitel 52 – Jagd durch die Menge
Kapitel 53 – Zuflucht im Verborgenen
Kapitel 54 – Der letzte Weg
Kapitel 55 – Die Stahltür
Kapitel 56 – Kein Ausweg
Kapitel 57 – Richtung Dnipro
Kapitel 58 – Dnipro
Kapitel 59 – Die Festung
Kapitel 60 – Der letzte Raum
Epilog – Drei Jahre danach
Prolog
Der See lag wie eine schwarze Fläche vor uns, unbewegt, als hielte er den Atem an. Nebel hing tief über dem Wasser, fraß die Konturen des Ufers und ließ die Welt klein und erstickt erscheinen. Ich erinnere mich an das Summen in meinen Ohren – dumpf, wie ein Pfeifen nach einem Knall. Damals wusste ich nicht, dass es der Beginn einer langen Störung war, ein Symptom, das mich nie mehr verlassen sollte.
„Er ist dort reingegangen.“
Die Stimme meiner Mutter klang gebrochen, während sie neben mir am Ufer stand. Ihre Finger klammerten sich so fest um meine Schulter, dass es schmerzte.
Ich sah auf die Stelle hinaus, an der der Suchscheinwerfer der Polizei über die dunkle Fläche glitt. Ein Kreis aus Licht, der vergeblich nach Leben tastete. Ich war sieben Jahre alt, und alles, was ich wahrnahm, war das Stechen hinter den Augen, das Dröhnen im Kopf und der Geschmack von Metall auf meiner Zunge. „Er hat Medikamente genommen,“ hörte ich einen Polizisten sagen. „Zu viele. Das Wasser hat den Rest erledigt.“
Ein Mann in Uniform wandte sich zu uns um. Seine Worte klangen gedämpft, wie durch Watte: „Es tut mir leid. Wir haben den Körper gefunden.“
Ich weiß noch, wie ich mich abwandte. Ich konnte den Blick nicht auf die Bahre richten, die sie aus dem Wasser trugen. Der Gestank von Algen, Chemikalien und etwas Bitterem – wie Tabletten – stieg mir in die Nase. Ich presste die Hände auf meine Ohren, doch das Pfeifen blieb, schrill und unausweichlich.
Damals begann ich zu zweifeln. Nicht an seinem Tod – den glaubte ich, so wie es mir alle sagten – sondern an dem, was wirklich geschehen war. Irgendetwas stimmte nicht.
Es war nicht nur das Wasser, das ihn verschluckt hatte. Es war etwas anderes, etwas, das ich noch nicht benennen konnte.
Und dieser Zweifel sollte mich mein ganzes Leben begleiten.
Kapitel 1 – Die Tage des Schweigens
Am Morgen nach der Bergung roch das Haus nach kaltem Kaffee und nassem Wollstoff. Meine Mutter ließ die Vorhänge geschlossen; nur eine dünne Linie aus grauem Licht sickerte über das Fensterbrett und zeichnete einen blassen Schnitt auf den Boden. Über Nacht hatte sie die Bilder meines Vaters von der Kommode genommen. Die blanken Rechtecke aus Staub sagten lauter als jedes Wort, was nicht mehr geduldet wurde.
Der Dorfpfarrer kam zuerst. Er sprach leise, fast flüsternd, und stellte Fragen, die ich nicht verstand. Meine Mutter nickte, nickte immer, als gäbe es für alles eine Form, in die man es pressen konnte. Ich saß auf der Stufe zum Flur und hörte jedes zweite Wort. „Zeit… Trost… Gottes Wille…“ Keines davon passte zu der Bahre, die sie gestern ans Ufer getragen hatten.
Das Pfeifen in meinen Ohren blieb. Es begleitete mich, wenn ich den Löffel in den zu süßen Kakao tauchte, wenn ich auf der Toilette saß, wenn ich im Zimmer stand und nicht wusste, wohin mit meinen Händen. Ein dünner, schriller Faden, der die Welt voneinander trennte: hier ich, dort alles andere.
Gegen Mittag kam der Arzt, nicht der vom See, ein anderer. Ein Mann mit feinem Mantel und Lächeln, das keinen Halt fand. Er roch nach Rasierwasser und Gummi. Er sprach mit meiner Mutter in der Küche, während ich an der Tür lauschte. Das Wort „Medikation“ fiel mehrmals, dann „Anxiolyse“, „Schlafhygiene“, „posttraumatisch“. Das Einzige, was ich begriff: Sie wollten, dass mein Kopf leiser wird.
Er fragte auch nach meinem Vater: ob es Anzeichen gegeben habe, ob er in Behandlung war, ob er etwas genommen hatte. Meine Mutter hielt den Blick auf die Tischplatte gerichtet, als stünde darauf die richtige Antwort. „Er war müde“, sagte sie. „Sehr müde in letzter Zeit.“ Der Arzt nickte so, wie Erwachsene nicken, wenn sie eine Schleuse schließen.
Am Abend lagen Tabletten auf dem Küchentisch, eine kleine weiße Schachtel, namenlos für mich, wichtig für alle anderen. Meine Mutter drehte sie mit der Fingerspitze, als könne sie dadurch etwas aus ihnen herauslesen. „Nur für die Nacht“, sagte sie, aber ihre Stimme klang, als spräche sie zu sich selbst.
Ich fragte nicht. Ich war sieben. Ich nahm, was man mir reichte, wie man eine Jacke nimmt, wenn man friert. Die Tablette löste sich auf der Zunge zu einem bitteren Staub, den ich nicht schnell genug mit Wasser hinunterspülen konnte. Nach zehn Minuten wurde die Luft weich. Die Geräusche im Haus traten einen Schritt zurück. Das Pfeifen blieb, aber es störte mich nicht mehr; es war, als hätte jemand Watte in die Ritzen gestopft.
In der Nacht wachte ich auf, weil ich glaubte, Schritte zu hören. Nicht draußen – in mir. Ein dumpfes Tappen entlang der Schädeldecke. Ich setzte mich auf, atmete langsam, so wie der Arzt es erklärt hatte, und wartete, bis der Puls nachgab. Das Wasser vom See suchte mich in meinen Träumen, aber es war kein Gesicht darin, kein Ruf. Nur die Kälte, die Ruhe, die zu viel Ruhe.
Am nächsten Tag kamen die Männer vom Amt. Einer notierte „Todesursache: vorläufig“, der andere hakte Fragen ab. Haben Sie Medikamente im Haus gefunden? Hat Ihr Mann Rezepte eingelöst? Namen. Ich sah, wie meine Mutter die Lippen formte, als rechnete sie im Kopf. „Er hatte Tabletten“, sagte sie schließlich, leise. „Wegen der Nerven. Fürs Schlafen.“ Der Mann schrieb, ohne aufzusehen. „Von wem?“ – „Vom Hausarzt.“ – „Seit wann?“ – „Ein paar Monate.“ – „Welche Dosis?“ – „Ich… ich weiß es nicht.“
Es gab Dinge, die man im Haus nicht laut sagte.
Dass mein Vater manchmal nachts in der Küche saß und ins Leere starrte. Dass er nach bestimmten Tagen roch – nach dem Krankenhaus, nach Desinfektionsmittel, nach diesem kalten Metallhauch, der jetzt auch im Bad hing. Dass er sie „kleine Helfer“ nannte und lachte, wenn meine Mutter ihm den Blick aus dem Gesicht pflücken wollte.
Nach der Beerdigung – ein grauer Vormittag, ein zu leichter Sarg, zu kurze Ansprachen – war das Haus voller Menschen, und dennoch fühlte es sich leerer an als je zuvor. Kuchen, der niemandem schmeckte. Hände, die zu lange an einem Arm blieben. Floskeln, die in den Manteltaschen steckenblieben. Als die letzte Tasse gespült und die Tür hinter dem letzten Gast zu war, setzte meine Mutter sich an den Küchentisch und schrieb einen Zettel, die Schrift klein, präzise: „Kein Besuch.“ Sie klebte ihn innen an die Haustür, als könnte man die Welt so abhalten.
Ich begann Notizen zu machen. In einem Schulheft, mit einem Bleistift, der zu weich war.
„Geruch im Bad: neu“ – „Tabletten: fehlen“ – „Wasser: leise“. Es waren keine Sätze, eher Sicherungen. Es beruhigte mich zu wissen, dass etwas festgehalten war, das mir sonst entglitt.
Jede Nacht legte ich das Heft unter mein Kissen, als sei es ein Talisman gegen das Vergessen.
Einmal, spät, als meine Mutter in der Küche die Tassen spülte, öffnete ich den Badezimmerschrank. Hinter den Rasierklingen, hinter der alten Flasche mit der blauen Flüssigkeit lagen zwei Blister in einer neutralen Papphülle. Keine Apothekennamen, kein Logo.
Nur ein Stempel: Lot-Nummer, Herstellungsdatum, kryptische Buchstaben. Ich nahm einen Blister in die Hand. Ein Rascheln durchfuhr die Stille – sie hatte es gehört. „Was machst du dort?“ Ihre Stimme war scharf wie Glas. Ich hielt den Atem an, legte die Schachtel zurück, so sacht, als hätte sie Gewicht, und schloss die Tür. Sie kam nicht näher. Wir schwiegen uns an wie zwei Leute, die ein Tier im Zimmer wissen, das man mit Worten nur reizt.
In der Schule wurde ich still. Ich beantwortete Fragen korrekt und schnell, um den Blick der Lehrerin wieder loszuwerden. Auf dem Heimweg blieb ich am Zaun des Sportplatzes stehen und starrte auf die Kreidelinien. Alles, was geordnet war, beruhigte. Alles, was rannte, machte mich müde. Einmal kam eine Mitschülerin neben mich, sie fragte etwas, das ich nicht verstand, ich sagte „nein“ und wusste erst später nicht mehr, worauf.
Am Ende der zweiten Woche stellte der Arzt die Dosis um. „Nur vorübergehend“, sagte er. Meine Mutter nickte. Ich nickte. Niemand fragte, was „vorübergehend“ in einem Haus bedeutete, in dem die Uhren seit dem See anders gingen.
Eines Abends, als ich im Flur an der Garderobe stand und so tat, als würde ich Schuhe sortieren, hörte ich, wie meine Mutter telefonierte. „Nein, nicht gut“, sagte sie. Kurze Pause. „Er hatte es… vom Klinikum. Nicht vom Dorf. Ja, ein Freund.
Die haben da… Muster. Sie sagten, es sei sicher.“
Wieder eine Pause. „Nein, niemand soll kommen. Bitte nicht.“
Ich hielt den Atem an, bis es brannte. Muster.
Sicher. Klinikum. Worte, die ich kannte, als wären sie aus der Zeitung gefallen und bei uns auf dem Teppich liegen geblieben. Ich legte mich später ins Bett und stellte mir einen Schrank vor, voll mit namenlosen Schachteln, und die Menschen, die sie verteilten, in Mänteln, die nicht nach uns rochen, sondern nach Metall und kalter Luft.
An diesem Abend behielt ich die Tablette länger auf der Zunge. Sie schmeckte bitterer als sonst.
Ich schluckte und zählte bis hundert, dann bis zweihundert, bis die Wände wieder weich wurden.
Draußen war der See nicht zu hören. Und doch, wenn ich lange genug lauschte, glaubte ich, ein Rauschen zu spüren, das nicht durch die Luft ging, sondern unter der Haut. Ich dachte nicht an Gesichter, nicht an Stimmen. Ich dachte an Listen und Chargen und an das, was in Schränken liegt, wenn niemand hinsieht.
Es waren die Tage des Schweigens, und ich nahm sie in mich auf wie Wasser, das den Boden langsam dunkel färbt.
Kapitel 2 – Das, was bleibt
Der Winter kam früh. Reif lag morgens auf den Stufen, und der See trug an den Rändern hauchdünnes Eis, das beim ersten Steinwurf in Sternmuster zersprang. Ich ging nicht mehr gern ans Ufer, aber ich ging. Nicht aus Mut – aus Zwang. Als müsste ich dem Ort beibringen, dass ich ihn noch kenne.
Meine Mutter arbeitete wieder. Sie verließ das Haus mit einem Gesicht, das man nicht ansprach, und kam zurück, als wäre sie weggetragen worden. In den Abenden, die wir miteinander verbrachten, sprachen wir über Dinge, die man zählen konnte: Rechnungen, Einkäufe, Stunden. Alles andere ließ sie liegen wie die eingerollten Teppichkanten, über die man immer wieder stolpert.
Manchmal kam der Hausarzt. Er brachte keine Blumen. Er brachte Formulare und neue Rezepte. Er strich mir über den Kopf und sagte:
„Das wird.“ Seine Augen sagten: „Es dauert.“ Ich lernte, dass Erwachsene Sätze besitzen, die Türen sind, die in beide Richtungen schließen.
Ich beobachtete. Nicht aus Misstrauen, aus Selbstschutz. Welche Schublade sie jetzt öfter öffnete. Welche Nummern sie wählte und nicht zu Ende sprach. Welche Namen sie mied. Einmal fiel ein Rezeptzettel zu Boden. Ich hob ihn auf, bevor sie es konnte. „Danke“, sagte sie zu schnell. Ich las die Buchstaben, so ruhig ich konnte. Kein Apothekenstempel. Ein Code. Dann nahm sie ihn mir aus der Hand, legte ihn zu den Rechnungen und schob alles in eine Mappe, die nicht zu den anderen passte.
Die Tabletten blieben. Einige Nächte vergaß sie daran zu denken; dann lag ich wach und sah dem Schatten der Garderobe beim Wachsen zu.
Andere Nächte stellte sie das Glas mit Wasser neben mein Bett, und ich tat so, als schliefe ich, bis sie ging, dann setzte ich mich auf und nahm die Pille im Dunkeln. Es war ein Handel ohne Worte: Sie gab mir die Möglichkeit, nicht zu fühlen; ich gab ihr die Illusion, dass es mir besser ging.
In der Schule fragte die Klassenlehrerin, ob ich mit der Psychologin sprechen wolle. Ich schüttelte den Kopf. Sie gab mir einen Zettel mit einem Termin. Ich steckte ihn ein, trug ihn eine Woche lang in der Hosentasche und wusch ihn dann mit. Er klebte in Fetzen an der Innenseite, wie eine Haut, die sich abzieht.
An einem Samstagnachmittag stand ich vor der Tür des Badezimmers, während meine Mutter drinnen war. Durch das Holz drang der Geruch von etwas Scharfem, Alkoholischem. Ein kurzes metallisches Klicken. Ein Schrank, eine Ampulle, die gegen Glas stößt. Das Pfeifen in meinen Ohren schwoll an wie eine Sirene, die man in der Ferne nicht orten kann. Ich legte die Stirn an die Tür, kühl, glatt. Meine Hände waren feucht.
Später fand ich im Wäschekorb die Hülle einer Spritze. Aufgedruckt: „Nur für klinische Anwendung.“ Kein Herstellername. Kein Ort.
Am Montag darauf stand ich vor der Bibliothek.
Ich gab der Dame am Tresen meinen Ausweis und schrieb auf einen Zettel: „Zeitschriften – Medizin“. Sie sah mich an, als hätte ich einen Witz gemacht, und führte mich an ein Regal, das nach Staub roch. Ich verstand kaum etwas. Aber ich konnte lesen, wie Worte aussehen, wenn sie wichtig sind. Placebo. Doppelblind. Off-label. Ich schrieb sie in mein Heft, neben „Wasser: leise“.
Das Dorf sprach inzwischen wieder. Nicht mit uns. Übereinander. „Er war schon immer labil“ – „Sie hätte es merken müssen“ – „Die Arbeit, der Druck“. Niemand sagte „falsch identifizierte Leiche“. Niemand sagte „Muster aus der Klinik“.
Niemand sagte überhaupt „Klinik“. Man sagte „Krankenhaus“, wenn man krank war, und man sagte „Pech“, wenn man keinen anderen Begriff fand.
Ich begann, mir Fragen zu stellen, die für Kinder nicht gedacht sind. Wer verordnet Medikamente ohne Namen? Wer liefert sie? Warum riecht das Bad plötzlich nach Dingen, die nicht im Dorf verkauft werden? Warum sagt der Arzt „vorübergehend“, wenn die Zeit sich ausdehnt wie Gummi?
Ich erzählte niemandem von den Antworten, die mein Körper gab: dem Druck hinter den Augen, wenn ich an den See dachte; dem Schwindel, wenn ich eine Verpackung sah, die nicht in ein Regal passte; dem Kribbeln in den Fingern, wenn ich die Schulhefte aufschlug und nicht nur Buchstaben, sondern Linien sah, die von einem Punkt zum anderen wollten.
Es gab einen Nachmittag, an dem ich beschloss, die Dinge zu zählen, die ich weiß. Ich setzte mich an den Küchentisch, holte mein Heft, schrieb jede Zeile so, dass sie wie eine Sicherung aussah:
1. Er war nicht müde. Er war anders.
2. Sie nennen es sicher, wenn sie meinen: wir wissen es nicht.
3. Der Geruch im Bad ist neu.
4. Die Tabletten sind nicht aus dem Dorf.
5. Wasser behält Geheimnisse besser als Menschen.
Als meine Mutter den Raum betrat, klappte ich das Heft zu. Sie sah es, sah mich, sagte nichts.
Wir aßen Suppe. Die Löffel klapperten gegen den Teller. Manchmal ist das Geräusch des Löffels das Einzige, was bleibt, wenn Sprache nicht mehr taugt.
In jener Nacht träumte ich von dem See ohne Nebel. Die Oberfläche glatt wie Glas, die Ränder hart, frostig, das Licht kalt. Ich stand nicht am Ufer. Ich stand in einem Raum ohne Fenster, und doch hörte ich das Wasser. Jemand sprach, eine Männerstimme, sachlich: „Titration.
Beobachtungszeit sechzig Minuten.
Dokumentieren.“ Ich wachte auf, weil ich wusste, dass dieses Wort nicht zu mir gehörte und dennoch in meinem Mund lag wie eine Münze.
Am Morgen zitterten meine Hände, als ich die Brotdose schloss. Meine Mutter bemerkte es nicht. Sie stand am Telefon und hielt den Hörer so, dass er kein Geräusch machte. Ich hörte nur ihren Atem. Als sie den Hörer auflegte, sagte sie:
„Heute früher zu Hause.“ Ich nickte und wusste, dass „früher“ an manchen Tagen „später“ bedeutete.
Auf dem Schulweg blieb ich am Kiosk stehen, der alte Mann blätterte in einer Zeitung. Eine Überschrift sprang mir entgegen: „Pharmariese testet neues Schlafmittel – Studien laufen.“ Das Foto zeigte ein Glas Gebäude mit blauen Scheiben, in denen der Himmel hing. Ich dachte an unser Bad, an die Spritzenhülle, an die neutrale Schachtel. Ich kaufte die Zeitung nicht.
Ich nahm das Bild mit.
Als ich am Nachmittag die Haustür öffnete, roch es nach Zitrone. Meine Mutter hatte gewischt.
Die Mappe mit den Rechnungen lag nicht mehr auf dem Regal. Der Badezimmerschrank war leer, bis auf Verbandszeug und Pflaster. Die Tablettenbox war ordentlich im Küchenregal verstaut, mit einem neuen Etikett: „Für Mara – abends“.
Ich setzte mich an den Tisch und starrte auf das Etikett, bis die Buchstaben zu tanzen begannen.
Irgendwo in einem Gebäude mit blauen Scheiben saßen Menschen, die solche Etiketten druckten, und irgendwo lag eine Liste, auf der stand, wer sie tragen sollte.
Später, als es dunkel wurde, und der Reif vor dem Fenster schimmerte, stand ich an der Spüle und trank Wasser aus dem Glas meiner Mutter.
Es schmeckte nach nichts. Und doch dachte ich an Chargen und Zahlen und daran, dass Wasser alles löst, wenn man ihm Zeit lässt.
Das Pfeifen in meinen Ohren war an diesem Abend leiser. Vielleicht, weil ich müde war.
Vielleicht, weil man manche Geräusche nur hört, wenn man sehr still ist.
Ich nahm die Tablette, legte mich hin und übte, die Minuten in gleichmäßigen Reihen zu denken.
Ich stellte mir vor, wie ich sie später wieder zusammensetze, wenn ich groß bin, und wie die Reihen dann zu einer Spur werden. Eine Spur, die nicht zum Ufer führt, sondern dahin, wo jemand beschlossen hat, dass Menschen Zahlen sind.
Und ich schwor mir, dass ich diese Spur nicht verlieren würde. Nicht hier. Nicht jetzt. Nicht in diesem Haus, das das Schweigen besser kann als ich.
Kapitel 3 – Die falsche Identität
Es vergingen Wochen, dann Monate, und das Haus verwandelte sich in einen Ort, an dem man nicht mehr laut sprach. Die Möbel standen da wie Zeugen, die niemand befragen wollte. Der Küchentisch blieb gedeckt, auch wenn wir längst aufgegessen hatten. Meine Mutter ließ die Teller manchmal über Nacht stehen, als könnte das Porzellan beweisen, dass wir noch zu zweit waren.
Im Dorf schwieg niemand so gründlich wie wir.
Auf der Straße hörte ich geflüsterte Sätze: „Er war schon lange labil.“ – „Sie hätte es merken müssen.“ – „Die Arbeit, der Druck.“ Worte, die in Küchenfenstern hängen blieben, sobald ich vorbeiging. Ich lernte, nicht hinzusehen. Doch jedes Flüstern nagte wie ein Insekt an mir.
Eines Nachmittags, es war windig, die Blätter peitschten durch den Garten, kam ein Fremder ans Tor. Dunkler Mantel, Aktentasche, der Blick eines Mannes, der seinen Auftrag kennt. Meine Mutter empfing ihn in der Küche, wie alle anderen. Ich hörte ihre Stimmen, tief, kurz angebunden. Doch dann fiel ein Satz, der mein Herz stocken ließ: „Die Identifizierung war schwierig.“