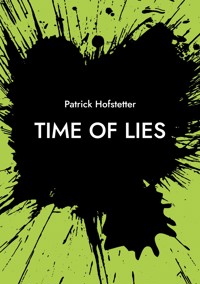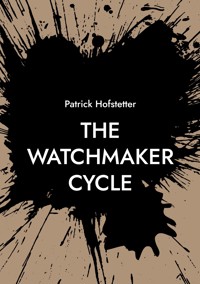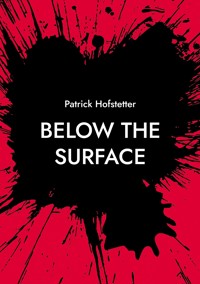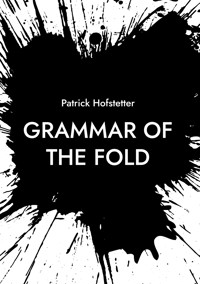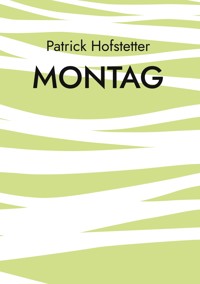Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Romanshorn am Bodensee. Ein idyllischer Hafen, Züge, die kommen und gehen und ein Geheimnis, das nicht im Wasser bleiben will. Als der Fischer Hansjörg Koller eine Leiche zwischen seinen Netzen entdeckt, gerät die kleine Stadt aus dem Gleichgewicht. Kommissar Jakob Hugentobler, müde und desillusioniert nach Jahrzehnten im Dienst, soll den Fall aufklären. An seiner Seite: Clara Heberli, jung, idealistisch und überzeugt davon, dass Menschen mehr sind als ihre Fehler. Doch hinter den Fassaden von Romanshorn lauern Lügen, Schulden und alte Rechnungen. Jeder schweigt und doch hat jeder etwas zu erzählen. Zwischen Pflegeheim, Hafenkneipe und verborgenen Transporten spinnt sich ein Netz, das immer enger wird. Je tiefer Hugentobler und Clara graben, desto deutlicher zeigt sich: Dies war kein Unfall. Und die Wahrheit könnte beide mehr kosten, als sie bereit sind zu geben. Ein fesselnder Bodensee-Krimi über Schuld, Hoffnung und den schmalen Grat zwischen Licht und Schatten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Nikita, Kateryna, Liliane
Disclaimer
Die folgende Erzählung ist ein Werk der Fiktion. Alle Figuren, Handlungen und Dialoge sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen – lebend oder verstorben – sowie mit tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Der Schauplatz Romanshorn dient ausschließlich als atmosphärische Kulisse.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Disclaimer
Kapitel 1 – Jakob Hugentobler
Kapitel 2 – Clara Heberli
Kapitel 3 – Fund im Hafen
Kapitel 4 – Der Notruf
Kapitel 5 – Stimmen im Hafen
Kapitel 6 – Polizeiarbeit
Kapitel 7 – Die Suche nach Tino
Kapitel 8 – Die erste Spur
Kapitel 9 – Am Stammtisch
Kapitel 10 – Neue Spuren
Kapitel 11 – Verdeckte Spuren
Kapitel 12 – Stimmen im Treppenhaus
Kapitel 13 – Spuren in der Pflege
Kapitel 14 – Miras Umfeld
Kapitel 15 – Der Widerspruch
Kapitel 16 – Zweite Befragung
Kapitel 17 – Die Spurensicherung
Kapitel 18 – Ein unbedachter Moment
Kapitel 19 – Schatten über Bruno
Kapitel 20 – Hafenstimmen
Kapitel 21 – Der Schuppen
Kapitel 22 – Die Konfrontation
Kapitel 23 – Das Verhör
Kapitel 24 – Der verborgene Faden
Kapitel 25 – Der Schatten im Hafen
Kapitel 26 – Der Name
Kapitel 27 – Blut und Wahrheit
Kapitel 28 – Das Auge der Kamera
Kapitel 29 – Lukas’ Welt
Kapitel 30 – Claras Zweifel
Kapitel 31 – Verdacht
Kapitel 32 – Ein leises Unbehagen
Kapitel 33 – Der Knoten im Kopf
Kapitel 34 – Erste Begegnung
Kapitel 36 – Ein anderer Blick auf Bruno
Kapitel 37 – Der Fund
Kapitel 38 – Zwei Wahrheiten
Kapitel 39 – Das letzte Wort
Kapitel 40 – Claras Entscheidung
Kapitel 41 – Das Gewicht der Wahrheit
Kapitel 42 – Der innere Riss
Kapitel 43 – Der Zwiespalt
Kapitel 44 – Die Entscheidung
Kapitel 45 – Nebel über Romanshorn
Epilog – Stimmen im Nebel
Impressum
Kapitel 1 – Jakob Hugentobler
Jakob Hugentobler mochte Menschen nicht. Er hatte es nie getan, auch nicht, bevor er Polizist geworden war. Aber in dreißig Jahren Dienst hatte er gelernt, dass sein Misstrauen nicht unbegründet war. Menschen logen. Immer. Manche aus Not, manche aus Gewohnheit, manche einfach, weil es ihre Natur war.
Er stand am Kai von Romanshorn, das Gesicht dem grauen See zugewandt, und rauchte eine Zigarette, die längst schal schmeckte. Der Rauch brannte in seiner Kehle, aber er zog ihn tief ein, als könne er die Leere in sich füllen. Die Stadt hinter ihm summte leise: Züge, die am Bahnhof einfuhren, Stimmen von der Promenade, das Klappern von Fahrrädern auf nassem Pflaster. Aber er hörte das kaum. Hugentobler hörte nur das Wasser. Dieses gleichmäßige Schlagen der Wellen gegen die Kaimauer, monoton und unaufhörlich – es war ihm vertrauter als jedes menschliche Wort.
Er war ein großer Mann, breitschultrig, aber mit der Haltung eines, der sein Gewicht schon zu lange trägt. Sein Gesicht war grob geschnitten, tief gefurcht. Die grauen Augen hatten diesen Ausdruck, den man bei Polizisten findet, die zu lange in dieselben Abgründe geblickt haben: kein Staunen mehr, keine Wut, nur ein müdes Akzeptieren. Er sprach selten, und wenn, dann kurz und hart. Kollegen nannten ihn hinter vorgehaltener Hand „den Fels“. Er wusste es, und er hasste den Namen. Felsen fühlen nichts. Felsen stehen nur da, werden von Wind und Wasser geschliffen, bis nichts mehr übrig ist.
In seinen frühen Jahren hatte er noch geglaubt, der Beruf bedeute, Gerechtigkeit zu schaffen. Er hatte gedacht, er könne Menschen retten, Unschuld bewahren. Doch die Jahre hatten ihn eines Besseren belehrt. Er hatte Kinder gesehen, die Opfer der eigenen Eltern wurden. Frauen, die nachts weinend in der Wache saßen und am nächsten Tag wieder zu ihren Männern zurückgingen. Männer, die so lange betrogen und bestohlen hatten, bis sie selbst nicht mehr wussten, was Wahrheit war.
Er hatte Mörder verhört, die lächelten, als sie erzählten. Junkies, die ihm ins Gesicht gespuckt hatten. Betrunkene, die schworen, nie wieder zu trinken – bis er sie zwei Wochen später im selben Zustand fand. All das hatte ihn nicht härter gemacht, sondern leerer. Jeder neue Fall war keine Überraschung mehr, nur eine Wiederholung mit anderen Gesichtern.
Hugentobler war geschieden. Seine Tochter lebte in Zürich, studierte, rief selten an. Wenn sie es tat, nannte sie ihn „Papa“, und jedes Mal war es, als gehörte dieser Name nicht zu ihm. Er war zu lange der Kommissar gewesen, der Mann mit dem Block und den grauen Augen. Der Vater, den man nicht brauchte.
Freunde hatte er keine. Kollegen ja, aber keine Freunde. Er war keiner, mit dem man nach Feierabend Bier trinken ging. Er war keiner, den man einlud, wenn man heiratete oder ein Kind bekam. Und er wollte es auch nicht. Gesellschaft machte ihn müde. Smalltalk war für ihn schlimmer als jede Mordermittlung. Er war lieber allein, mit den Akten, mit dem See, mit einer Zigarette.
Romanshorn war seine Stadt. Er hätte längst nach Zürich oder Winterthur wechseln können, die Angebote hatte es gegeben. Aber er war geblieben. Nicht aus Liebe, nicht aus Heimatgefühl, sondern weil er wusste, dass auch hier, in dieser kleinen Stadt am See, die Dunkelheit groß genug war. Mord, Verrat, Gier – sie waren nicht an Großstädte gebunden. Sie wucherten überall, wo Menschen lebten. Und Hugentobler war da, um sie zu sehen. Mehr nicht.
Wenn er durch Romanshorn ging, kannte er die Gesichter. Er wusste, wer seine Frau schlug, wer seine Steuern nicht zahlte, wer schwarz arbeitete, wer heimlich trank. Er wusste es, und er trug es wie einen inneren Katalog mit sich herum. Für ihn war die Stadt kein freundlicher Ort mit Fähren und Touristen, sondern ein Flickenteppich aus kleinen und großen Lügen.
Er war kein schlechter Mensch. Aber er glaubte nicht mehr daran, dass Menschen gut waren. Das machte ihn zu einem besseren Polizisten – und zu einem schlechteren Menschen. Er wusste es, und er nahm es hin.
An diesem Abend stand er also wieder am Kai, die Hände tief in den Taschen, den Blick hinaus auf das graue Wasser. Er spürte die Kälte in seinen Knochen, aber sie störte ihn nicht. Es war besser, Kälte zu spüren, als gar nichts mehr.
Jakob Hugentobler. Kommissar. Alle nannten ihn beim Nachnamen. Und das war ihm recht. Denn wer ihn nur so nannte, erwartete auch nicht mehr, als er geben konnte.
Kapitel 2 – Clara Heberli
Clara Heberli liebte Romanshorn. Für viele war es nur eine Kleinstadt am Bodensee, mit Bahnhof, Hafen und einer Handvoll Geschäften. Für sie war es der Mittelpunkt der Welt. Hier war sie aufgewachsen, hier kannte sie jede Ecke, jeden Geruch, jedes Geräusch.
Schon als Kind war sie zum See gerannt, wann immer sie konnte. Sie hatte stundenlang am Ufer gesessen, Steine ins Wasser geworfen, Möwen beobachtet, die wie lebendige Pfeile über den Himmel zogen. Wenn die Fähre aus Friedrichshafen einlief, hatte sie die Ankunft wie ein Ereignis gefeiert. Es war für sie ein Stück Ferne, das plötzlich nah war. Später, als Jugendliche, war sie nachts mit dem Fahrrad ans Hafenbecken gefahren, hatte mit Freunden auf den Stegen gesessen, Bierflaschen klirrten, und das Wasser roch nach Diesel und Freiheit.
Romanshorn war für sie ein Ort der Erinnerungen. Der kleine Kiosk am Hafen, wo sie ihre erste Zigarette gekauft hatte. Das Freibad, in dem sie das Schwimmen gelernt hatte. Der Bahnhof, von dem sie das erste Mal alleine nach Zürich gefahren war, nervös, mit flatterndem Herz. Alles in dieser Stadt war verbunden mit einem Stück ihrer eigenen Geschichte.
Heute, mit Anfang dreißig, war Clara unverheiratet, allein. Sie lebte in einer kleinen Wohnung mit Blick auf den See. Manchmal fragte sie sich, ob ihr Leben zu eng geworden war, ob sie den Schritt hinaus in die weite Welt verpasst hatte. Aber dann stand sie am Ufer, roch den Wind, sah die Fähren und Züge, die kamen und gingen, und sie wusste: Romanshorn war klein und gleichzeitig offen. Man musste nicht weg, um zu spüren, dass die Welt größer war.
Clara war Polizistin geworden, weil sie an Menschen glaubte. Sie wollte verstehen, warum sie taten, was sie taten. Sie wollte das Unrecht aufdecken, nicht, weil sie an Strafe dachte, sondern weil sie an Wahrheit glaubte. Für sie war Wahrheit wie das Licht, das durch Nebel brach: manchmal schwach, manchmal flackernd, aber immer notwendig.
Ihr Blick auf die Menschen war das Gegenteil von Hugentoblers. Sie bewunderte ihn – seine Ruhe, seine Erfahrung, seine Unerschütterlichkeit. Wenn er einen Raum betrat, schien es, als würden alle Stimmen leiser. Er war wie ein Anker, schwer, fest, unbeweglich. Aber sie sah auch, wie viel Dunkelheit er in sich trug. Sie wusste, dass er an nichts Gutes mehr glaubte. Dass er Menschen nur noch als Ansammlung von Fehlern sah.
Clara mochte ihn, aber manchmal machte er ihr Angst. Nicht, weil er hart war – sondern weil er so müde war. Weil er aussah, als hätte er schon zu oft Recht behalten, wenn er sagte: „Die Leute sind schlechter, als du denkst.“ Sie fragte sich manchmal, ob sie irgendwann so werden würde wie er. Ob der Beruf sie genauso leer machen würde.
Aber bis jetzt trug sie ihren Glauben wie ein Schild. Sie war überzeugt, dass man Menschen helfen konnte, dass nicht alles verloren war. Vielleicht war sie naiv. Vielleicht würde sie eines Tages merken, dass Hugentobler recht hatte. Aber noch nicht. Noch wollte sie kämpfen, für jedes kleine Stück Wahrheit, das sie finden konnte.
Wenn sie abends am See entlangging, allein, dachte sie manchmal: Er ist wie Romanshorn. Grau, schwer, unbeweglich. Und ich bin wie der See selbst. Manchmal ruhig, manchmal stürmisch, aber immer in Bewegung.
Und irgendwo tief in ihr gab es diesen Gedanken, den sie nicht laut sagte: Vielleicht brauchte Romanshorn beide – Hugentobler mit seiner Traurigkeit und sie mit ihrem Glauben. Vielleicht war nur im Zusammenspiel aus Dunkelheit und Hoffnung das möglich, was sie suchten: die Wahrheit.
Kapitel 3 – Fund im Hafen
Romanshorn erwachte an diesem Morgen sanft. Die Sonne legte sich wie ein goldener Schimmer über die Wellen des Bodensees, Möwen zogen ihre Kreise, vom Bahnhof her kam das rhythmische Klacken der Züge, die Menschen hinaus in die Welt brachten oder von dort hereinholten. Auf der Promenade schlenderten Spaziergänger, ein paar frühe Jogger zogen ihre Bahnen. Es roch nach frisch gebrühtem Kaffee aus dem kleinen Café am Hafenplatz, nach nassem Holz und Diesel, dieser eigentümliche Geruch, der Romanshorn seit Jahrzehnten prägte.
Romanshorn konnte zauberhaft sein. Wenn die Fähre aus Friedrichshafen anlegte, wenn Kinder lachend über die Mole rannten, wenn die Sonne das Wasser glitzern ließ wie einen Teppich aus Silber. Ein Ort, an dem man sich sicher fühlte, klein und überschaubar.
Doch Idylle war zerbrechlich.
Hansjörg Koller wusste das. Er war Mitte fünfzig, seit über zwanzig Jahren verheiratet mit Marianne, Vater von zwei erwachsenen Kindern, die längst aus dem Haus waren. Er war kein gebürtiger Romanshorner, sondern aus dem Appenzellerland hierhergezogen. Doch er hatte sich den Platz am Hafen erarbeitet, Schritt für Schritt, und verkaufte sich als einer, der die Tradition der Fischerfamilien am See weiterführte. Immer freundlich, immer zu einem Schwatz bereit, einer, den die Leute kannten und grüßten.
Ob er wirklich so war, wie er wirkte, wusste niemand so genau. Aber er trug das Bild eines ehrlichen Arbeiters mit Stolz. Jeden Morgen stand er früh auf, fuhr hinaus, zog seine Netze ein, als wäre es nicht nur Beruf, sondern Berufung. Wer ihn sah, sah einen Mann, der sich Mühe gab, aufrecht durchs Leben zu gehen.
An diesem Morgen stand Koller am Ende von Steg drei, die Hände fest um die Taue gelegt, als sich sein Netz verhakte. Er fluchte leise, zog fester – und sah etwas im Wasser treiben. Zuerst dachte er an einen Sack, ein Stück Holz. Doch dann erkannte er die Hand. Bleich, reglos. Ein goldener Ring blitzte matt im Morgenlicht. Der Körper hing halb im Wasser, halb in den Seilen, das Gesicht nach oben, die Augen leer, starr in den Himmel.
Koller erstarrte. Ein paar Sekunden stand er nur da, das Herz hämmerte, der Atem flach. Dann stieß er einen Schrei aus, so roh und laut, dass die Möwen erschrocken aufflatterten und Hunde auf der Promenade anschlugen. Der Morgenzauber war in Stücke gerissen.
Mit zitternden Fingern griff Koller nach seinem Handy, wählte die 117. Die Sonne schien weiter, die Fähre lief ein, das Wasser glitzerte – aber in Romanshorn hatte sich etwas verändert. Ein Schatten lag nun über dem Hafen, und er würde bleiben.
Kapitel 4 – Der Notruf
Hansjörg Kollers Hände zitterten, als er das Handy aus der Jackentasche zog. Die Finger waren noch nass vom Tau, er musste zweimal auf das Display tippen, bis die Verbindung stand. Sein Herz schlug so laut, dass er kaum die Freizeichen hörte. Dann knackte es in der Leitung.
„Polizeinotruf Thurgau, Disponentin Meier. Was ist passiert?“
Ihre Stimme klang klar, fest, eingeübt. Doch in ihrem Inneren zog sich etwas zusammen. Sie hieß Katharina Meier, war 34 Jahre alt und seit vier Jahren in der Einsatzzentrale. Ursprünglich hatte sie einmal Krankenschwester werden wollen, aber nach einem Praktikum im Spital merkte sie, dass sie nicht mit Blut umgehen konnte. Stattdessen war sie in die Welt der Kommunikation gerutscht, hatte sich zur Disponentin ausbilden lassen. Sie war gut im Zuhören, gut im Strukturieren, und sie mochte den Gedanken, in der Krise Ruhe auszustrahlen.