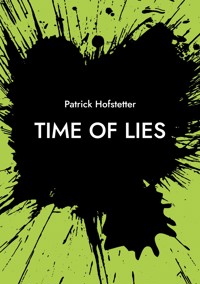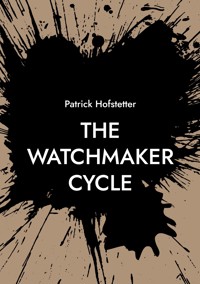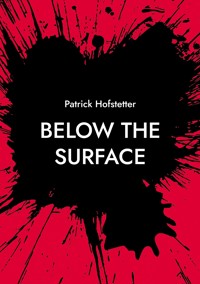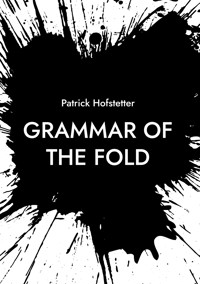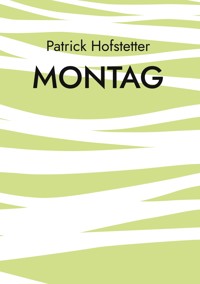Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die stille Injektion Ein Fall für Inspektorin Keller Ein Mann stirbt im Zug, lautlos, ohne Zeugen, nur eine winzige Einstichspur verrät das Gift. Für Inspektorin Keller beginnt damit ein Ermittlungsfall, der sie tief in ein Geflecht aus Pharmakonzernen, Macht und persönlichen Racheakten führt. Je weiter sie gräbt, desto deutlicher wird: Der Mord ist nur die Spitze eines Systems, das seine Gegner zum Schweigen bringt. Doch während die Indizien verschwimmen, wächst auch die Gefahr für Keller selbst und plötzlich weiß sie nicht mehr, wem sie trauen kann. Ein atmosphärischer Thriller über tödliche Geheimnisse, stille Waffen und die Frage, wie viel Wahrheit ein Mensch erträgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Nikita, Kateryna, Liliane
Inhaltsverzeichnis
Der Fund
Die erste Autopsie
Alte Schatten
Die heile Fassade
Das Flüstern der Kinder
Doppeltes Spiel
Der Maulwurf
Der Schatten der Pharmaindustrie
Der Drohbrief
Die Frau im Zwielicht
Der Geliebte im Verhör
Unter Druck
Verdacht auf Verrat
Der zweite Einstich
Julia
Alles deutet auf sie
Die falsche Analyse
Die Kinder im Fokus
Der wahre Täter
Das Angebot
Die Presse
Der mediale Zusammenbruch
Der Zerfall
Keller im Fadenkreuz
Die Falle
Die Verdrehung der Beweise
Der innere Zusammenbruch
Der Lockvogel
Die Spur im Köder
Das Schweigen der Zeugen
Der erzwungene Pakt
Der Verdacht gegen Vogt
Katz und Maus
Das Gegenspiel
Der Angriff
Die Gegenoffensive
Der Showdown beginnt
Die Villa
Die Enthüllung
Nach dem Sturm
Die Rückkehr der Schatten
Der Kreis der Namen
Die erste Warnung
Der innere Verrat
Die Falle im Präsidium
Dr. Albrecht
Die Jagd
Das Gesicht des Architekten
Julias Geheimnis
Der Preis der Wahrheit
Angriff auf den Architekten
Die Stimme aus der Menge
Die Explosion
Flucht ins Dunkel
Untergetaucht
Die Schattenantwort
Der Überfall
Jagd durch die Stadt
Substanz C
Das zweite Gesicht
Julias Entscheidung
Die Falle
Der Prozess
Opfer
Schlussstein
Der Fund
Der Zug glitt in den Zürcher Hauptbahnhof, als hätte er vergessen, dass es Bremsen gibt—so sanft, dass die schläfrigen Körper in den Abteilen nur ein wenig nach vorn nickten. Ein Montagmorgen, eine Stunde, in der selbst die Reklametafeln gähnten. Das Licht zwischen den Gleisen war milchig, die Station feucht vom Nachtregen; irgendwo zischte eine Leitung, irgendwo riss jemand gedämpft eine Kaffeekapsel auf und fluchte.
Im Wagen drei, Sektion B, blieb ein Mann sitzen. Er saß am Fenster, Mantel ordentlich zugeknöpft, Stirn an die Scheibe gelehnt, als lausche er noch dem letzten Rest Fahrtwind. Die Spiegelung im Glas gab ihm einen ruhigen Zwilling: geschlossenes Lid, ruhige Wange, der Mund ein dünner Strich, wie bei jemandem, der noch einen Gedanken festhält, bevor er aufsteht. Um ihn herum erhoben sich die anderen, nahmen Taschen von Gepäckablagen, schoben Jackenärmel glatt, entdeckten auf ihren Displays rote Zahlenkolonnen, Kalendereinträge, „in fünfzehn Minuten“. Der Mann blieb sitzen.
Der Schaffner hieß Reto Minder, ein Mann mit verlässlichen Schuhen und einem Stift in der Brusttasche, der dort nie wegrutschte. Die Fahrt hatte pünktlich begonnen und pünktlich geendet, und das war schon die halbe Geschichte eines guten Tages. Er kontrollierte routiniert die Abteile, ein Blick, zwei Handgriffe: vergessene Trinkflaschen, eine Mütze in Kindergröße, ein Regenschirm, der klatschnass die Polster dunkler färbte.
„Guten Morgen, Endstation,“ sagte er in die Luft, die nicht antwortete. Er blieb am Sitz des Mannes stehen. „Chef, wir sind da.“ Keine Reaktion. Ein leichtes Klopfen auf die Rückenlehne, das man nicht unhöflich nennen konnte.
Der Mann bewegte sich nicht. Reto nahm das in jenem Ton zur Kenntnis, in dem man in der Früh Dinge zur Kenntnis nimmt: mit pragmatischer Geduld. Vielleicht Kopfhörer. Vielleicht wirklich eingeschlafen, jene Sorte Schlaf, die man nur in Zügen findet, dicht und schwer wie Blei. Reto beugte sich vor. Keine Kopfhörer. Der Atem beschlug die Scheibe nicht.
„Entschuldigen Sie?“ Er berührte die Schulter, sanft. Die Schulter gab nach, als sei da nur Stoff und darunter ein hohler Raum.
Etwas in Reto zog sich zusammen, ein altes, instinktives Wissen, das er nicht benennen musste. Es war die Stille, nicht die Bewegungslosigkeit. Die Stille, die sicher war, endgültig. Er sah sich um. Der Wagen war leer bis auf die Papierbecher, die vom Ende der Pendlerbühne kündeten. Aus dem Nachbarabteil drang das Abräumen des Reinigungsteams, das vertraute Scheppern von Eimer gegen Metall.
Reto atmete tief ein, zählte im Kopf bis drei, drückte den Notrufknopf am Kommunikationsgerät und meldete in einer Stimme, die professionell klang, was seine Hände schon wussten.
Die Bahnpolizei kam zuerst. Zwei Uniformen, deren Schritte ein anderes Gewicht hatten. Sie warteten auf die Rettung, wie man auf einen Satz wartet, von dem man ahnt, dass er nicht mehr geschrieben wird. Eine Notärztin, die aussah, als sei ihr Schlaf ein längst aufgegebener Vertrag, legte die Finger an die Halsseite des Mannes, an die Handgelenke, hob die Lider, deren Kühle sie nicht kommentierte. Sie machte die Dinge, die man macht. Und dann machte sie die Dinge, die man macht, wenn es zu spät ist: die Uhrzeit notieren, den Mund schließen, den Mantel wieder ordentlich legen. Der Tod bekam in diesem Moment einen Eintrag, und Einträge machen Dinge wahr.
„Wahrscheinlich Herzstillstand,“ sagte einer der Beamten, ein junger, dessen Hüfte die Dienstwaffe noch nicht ganz selbstverständlich trug. „Passiert.“
„Passiert,“ wiederholte die Ärztin, nicht zustimmend und nicht widersprechend, als wäre das Wort ein Gegenstand, den man in die Hand nimmt, um sein Gewicht zu spüren. Sie vermerkte das Alter des Mannes, geschätzt Mitte vierzig, gepflegt, Ehering links. Keine sichtbaren Verletzungen. Die Haut an den Händen leicht grauer, als der Morgen sein dürfte. Reto stand daneben und sah auf seine Schuhe, die verlässlich waren, und doch waren sie gegen diese Art Unordnung machtlos.
Sie fanden den Ausweis in der Brieftasche, Bankkarten, Fotos. Auf einem Bild die Umarmung eines Mädchens, Zöpfe, Zahnlücke.
Auf einem anderen die Szenerie eines Sommersees, der zu voll ist, um idyllisch zu sein, und ein Mann, der sich in die Kamera hinein anstrengt, glücklich zu wirken. Der Name, sauber gedruckt, eine Adresse in einem Zürcher Kreis, der an Werktagen Kinderwagen schiebt und samstags Bio-Märkte besucht.
„Wir informieren die Angehörigen,“ sagte der ältere Polizist, der schon durch genug Küchen gegangen war, um zu wissen, dass es keine richtige Art gibt, eine falsche Nachricht zu bringen. Er bat Reto um einen separierten Raum. Reto führte sie in eine nüchterne Ecke der Serviceebene, die nach Putzmittel roch. Ein Neonlicht brummte. Die Ärztin schrieb still.
Die Ehefrau hob beim ersten Klingeln ab. Ihre Stimme war kontrolliert, sie sagte ihren Namen mit der Deutlichkeit einer Person, die es gewohnt ist, in Systemen aufzutreten: Arzttermine, Lehrergespräche, Versicherungen.
Als der Polizist sich nannte, hörte man eine kleine Pause, so kurz, dass man sie vergessen könnte, wenn man nicht darauf geachtet hätte.
Er bat sie zu kommen, sprach von einer gesundheitlichen Situation, vom Bahnhof, von einem Raum, der diskret sei. Er vermied das Wort „Tod“ wie ein glühendes Metall.
Sie kam in einem Mantel, der zu leicht war für den Regen, und mit einer Frisur, die verriet, dass man morgens mit Kindern nicht alle Kämpfe gewinnt. Ihre Hände hielten die Tasche, als sei darin ein Objekt, das nicht fallen darf. Als sie den Raum betrat und die Ärztin sah, verstand sie in einer Art, für die es keine Worte gibt. Der erste Laut, der aus ihr kam, war keiner. Es war Luft, die den Körper verlässt, ohne zu wissen, warum.
Dann kamen Worte, viele. „Nein“, „Wie“, „Er war doch“, „Gestern Abend“, „Er ist so…“. Sie weinte, dann weinte sie nicht, so abrupt, dass es wie ein Schnitt wirkte. Sie setzte sich, stand wieder auf, ging zur Wand, als müsse sie sich an etwas Festem orientieren, und kehrte zurück zum Stuhl, der ihr nichts anbot außer seiner Existenz.
Als man sie fragte, ob es Vorerkrankungen gebe, schüttelte sie den Kopf zu schnell. „Er ist gesund.
Er war gesund. Pendelt, arbeitet, läuft am Sonntag.“ Sie lächelte kurz, entsetzlich fehl am Platz, ein Reflex, der sagte: Ich bin höflich, ich funktioniere.
„Hatte er in letzter Zeit… Stress?“ fragte der Jüngere, diese Art Frage, die wie ein Pflaster klingt. Sie nickte. „Wie jeder. Ein Projekt, das ihm wichtig ist. Aber er—“ Sie brach ab. „Er ist zuverlässig.“ Das Wort blieb im Raum wie ein Foto, das niemand abhängen will.
Die Formalitäten zogen die nächsten Minuten in ein Raster: Unterschriften, Erklärungen, Telefonnummern. Die Ärztin sprach leise über die Notwendigkeit einer Untersuchung, ein „Standardverfahren“, sagte sie, und das Wort „Standard“ klang, als fasse es einen Sturm in eine Schublade. Die Ehefrau nickte. Ihre Hände hielten die Tasche immer noch, weiß um die Knöchel. Als sie hinausging, blieb sie einen Moment am Türrahmen stehen. „Ich muss die Kinder holen,“ flüsterte sie, und in dem Satz lag eine Welt, die jetzt jede Struktur verlieren würde.
Der Körper wurde vorbereitet, diskret, geordnet.
Eine graue Decke, ein Wagen, der leiser rollte, als seine Räder versprachen. Draußen atmete der Bahnhof in seinem eigenen Rhythmus, Züge kamen und gingen, Durchsagen zerschnitten die Luft in Abschnitte. Von den Gleisen her wehte eine feuchte Kälte, die sich in den Fluren verirrte.
Im Institut für Rechtsmedizin stank es nicht, wie Laien es sich vorstellen: nicht nach Chemie, nicht nach Blut. Es roch nach Sterilität und nach Papier, nach Protokollen, die in Schränken schlafen. Dr. Jan Gertsch, ein Mann mit einer Ruhe, die nicht eingefroren, sondern durchdacht war, nahm die Übergabe entgegen, bedankte sich mit dem leisen Respekt, den er für die stillen Arbeiten hatte. Er ließ sich den Fundort schildern, die Uhrzeit, die ersten Beobachtungen. „Herzstillstand?“ fragte der Polizist.
„Herzstillstand ist am Ende von vielem,“ antwortete Gertsch, nicht arrogant, nur präzise.
„Wir schauen.“
Die Vorbereitung war Routine: dokumentieren, fotografieren, Kette der Beweismittel schließen.
Der Körper lag auf dem Edelstahl wie ein Satz, der auf seinen Punkt wartete. Gertsch bewegte die Arme, prüfte Hände, Nägel, Haut. Er notierte die abgenutzte Stelle am Ehering, die leichte Druckspur am Nasenrücken—vielleicht von einer Brille, die der Mann heute nicht getragen hatte.
Kein Erstickungshinweis, keine Hämatome, die Geschichten erzählten. Er ließ das Licht frontal fallen, dann schräg. Schräges Licht ist gnadenlos, es macht sicht-, was nicht gesehen werden will.
„Seltsam,“ murmelte er, und die Assistentin hob den Kopf. Gertsch fuhr mit dem Fingerkuppen in der Region der linken Schulter, knapp unterhalb des Schlüsselbeins. Da war eine Unregelmäßigkeit, kaum mehr als der Schatten einer Mücke auf Sommerhaut. Ein winziger Punkt, so unscheinbar, dass er den Blick beleidigte, der Spektakel erwartete.
„Was haben Sie?“ fragte die Assistentin.
Gertsch nahm eine Lupe, nicht aus Theatralik, aus Gewohnheit. Der Punkt zeigte an den Rändern eine Hauchverfärbung, nicht blau, nicht rot—eher das blasse Gelb, das entsteht, wenn die Haut auf etwas reagiert, das nicht ihr gehört.
Er drückte minimal, nicht genug, um Spuren zu verwischen, gerade so viel, dass die Oberfläche antwortete.
„Ein Einstich,“ sagte er, mehr zu sich als zu anderen. „Winzig. Sehr sauber.“
Die Assistentin holte die Kamera näher heran.
Der Klick klang wie ein Urteil.
Draußen zog ein weiterer Zug durch den Morgen, die Wagenkette ein Geräuschband, das sich über die Dächer legte. Drinnen war es still.
Gertsch richtete sich auf und sah auf den Mann hinab, der aussah, als könne ihn ein Name wecken, den jemand liebevoll ruft. „Kein natürlicher Tod,“ sagte er leise, und sein Ton war der einer Tür, die sich schließt, damit eine andere sich öffnen kann.
Später, als die Probe gesichert war und die Etiketten klebten, rief der Polizist zurück in den Bahnhof. Reto stand gerade am Automaten und hielt eine Styroportasse, deren Inhalt nach verbranntem Karamell schmeckte. Das Telefon summte in seiner Brusttasche. „Ja?“ sagte er.
„Wir brauchen alles,“ sagte die Stimme. „Jedes Detail. Er war schon seit Stunden tot.“
Und in der Rechtsmedizin, unter einem Licht, das keine Gnade kannte, zeichnete eine Kamera die kleinste Geschichte auf, die eine Haut erzählen kann: den winzigen Einstich an der Schulter.
Die erste Autopsie
Das Institut für Rechtsmedizin lag abseits der Innenstadt, ein Zweckbau aus Beton und Glas, dessen Fassade so nüchtern war, dass sie jede Regung erstickte. Kein Schild, das auffällig prangte, nur eine Nummer am Eingang, eine unscheinbare Klingel, dahinter sterile Flure. Hier wurde nichts für die Öffentlichkeit ausgestellt – hier wurde seziert, archiviert, protokolliert.
Wahrheit, heruntergebrochen auf Tabellen und Gewebeproben.
Dr. Jan Gertsch betrat den Sektionssaal wie eine Kirche. Er sprach selten während der Arbeit, er brauchte keine Musik, keine unnötigen Worte.
Seine Assistentin, Marlen, kannte seine Gesten inzwischen so gut, dass sie ihm Werkzeuge reichte, noch bevor er die Hand hob. Die Geräusche des Raumes waren wie ein Herzschlag: das gleichmäßige Brummen der Neonröhren, das leise Klicken der Instrumente auf Edelstahl, das kratzende Geräusch des Stifts auf Papier.
Der Tote lag auf der Bahre, zugedeckt mit einem Tuch, das sich über Brust und Schultern spannte.
Nichts an ihm wirkte ungewöhnlich. Ein Mann wie viele: gepflegtes Gesicht, Hände, die von Schreibtischarbeit erzählten, keine groben Narben, keine sichtbaren Verletzungen. Jemand, der gestern noch mit der S-Bahn heimgefahren wäre, hätte das Leben ihn nicht an diesem Morgen verlassen.
„Wir beginnen um 09:47 Uhr,“ sagte Gertsch, und Marlen notierte es in der gewohnten Kühle einer Dokumentation.
Das Tuch wurde zurückgeschlagen. Die Haut des Mannes war blass, aber nicht verfärbt. Kein Drama, keine Spuren eines Kampfes. Für Laien hätte es wie der Inbegriff eines friedlichen Todes gewirkt. Doch Gertsch wusste: die Stille täuscht.
Er begann systematisch. Augen, Mund, Hals, Brust – jeder Bereich ein Kapitel, das gelesen werden musste. Er öffnete, maß, wog, beschrieb. Herz: glatt, gesund, keine Vergrößerung, kein Verschleiß. Lunge: frei von Wasser, frei von Fremdkörpern. Blutbahnen: erstaunlich klar. Für Sekunden regte sich in ihm der Verdacht, dass der Tod doch „natürlich“ gewesen sein könnte, ein abruptes Versagen ohne Vorwarnung. Aber dann erinnerte er sich an die Einstichstelle.
„Zurück zur Schulter,“ murmelte er, als er mit einer Pinzette die Haut an dieser Stelle leicht anhob. Ein winziger Punkt, fast unsichtbar, wie ein Mückenstich. Aber Gertsch war kein Mann, der Mückenstichen Glauben schenkte.
„Was meinen Sie?“ fragte Marlen, ihre Stirn in Falten gelegt.
„Ein Einstich,“ sagte er leise. „Sehr sauber. Fast professionell.“
Er entnahm Gewebeproben, fixierte sie, reichte sie ins Labor. Minuten dehnten sich zu Stunden, während die Geräte ihre Arbeit machten.
Summen, leuchten, analysieren. Gertsch wartete, die Hände verschränkt, als betete er.
Dann die ersten Werte: ungewöhnliche Spuren, kaum messbar, aber vorhanden. Nicht Morphin, nicht Insulin, nicht eines der klassischen Gifte, die jeder Gerichtsmediziner kennt. Etwas Komplexes. Etwas, das in kein medizinisches Lehrbuch passt.
„Verdammt elegant,“ murmelte er, fast widerwillig anerkennend. „Das ist keine Alltagsdroge. Das ist Hightech.“
Marlen blinzelte. „Hightech?“
„Eine Substanz, die man nicht kaufen kann. Die nur in Labors entsteht, die für den Rest der Welt verschlossen sind.“ Er sah auf, seine Stimme wurde härter. „Das hier ist Mord. Und er war geplant.“
Die Tür öffnete sich mit einem leisen Geräusch, das im Raum wie ein Donnerschlag wirkte. Eine Frau trat ein, ihr Mantel noch feucht vom Regen, die Bewegungen entschlossen. Sie stellte sich nicht mit Handschlag vor, sondern nur mit einem kurzen Nicken.
„Inspektorin Keller,“ sagte sie knapp. „Ich übernehme.“
Gertsch kannte ihren Ruf – hartnäckig, präzise, gefürchtet für ihre Geduld im Zerlegen von Widersprüchen. Sie trat näher, sah sich den Körper an, den Einstich, die Apparate. Kein Anflug von Ekel, nur dieser konzentrierte Blick, der alles wie durch ein Brennglas sah.
„Ihr Befund?“
„Kein Herzversagen. Kein Unfall. Er ist vergiftet worden – mit einer Substanz, die nur jemand aus der Hochforschung beschaffen kann.“
Ein kurzer Moment Stille. Dann nickte Keller.
„Also kein Zufall. Kein Überfall. Sondern jemand, der genau wusste, was er tat.“
Ihre Augen glitten über den Toten, über die Ordentlichkeit, die ihn umgab. Sie sah nicht einen Körper, sie sah ein Rätsel.
„Dann,“ sagte sie leise, „haben wir es mit einem Mordfall zu tun. Und nicht irgendeinem.“
Und in diesem Augenblick bekam der Tod des unscheinbaren Pendler-Vaters ein neues Gewicht: nicht als Schicksalsschlag, sondern als kalkulierte Tat in einem Spiel, das größer war als alle, die in diesem Raum standen.
Alte Schatten
Das Archiv des Polizeipräsidiums lag im Kellergeschoss, ein Ort, der mehr nach Vergessen roch als nach Aufbewahrung. Keller ging durch die schmalen Gänge, an deren Wänden metallene Regale mit Aktenordnern standen. Die Neonröhren über ihr flackerten, als sträubten sie sich, noch einmal Licht auf die Geschichten zu werfen, die hier in vergilbtem Papier gefangen lagen.
Die Personalakte von Markus Meier war dicker als erwartet. Keller setzte sich an einen der blanken Tische, auf deren Oberfläche Kerben von Jahrzehnten zeugten, und öffnete den grauen Ordner. Zwischen den üblichen Formularen – Lebenslauf, Beurteilungen, medizinische Unterlagen – fand sie Berichte, die älter waren als alles, was sie bislang über den Mann wusste.
Vor knapp zehn Jahren hatte es einen Vorfall gegeben: ein Laborunfall, nüchtern vermerkt als „ungeklärter Zwischenfall bei einer Testreihe“.
Ein Patient war damals verschwunden, offiziell hieß es „Vertragsauflösung“. Doch die Formulierungen waren schief, als seien sie von einer Hand geschrieben, die zu sehr bemüht war, harmlos zu klingen. Und da war Meiers Unterschrift, unter den Sicherheitsprotokollen.
Mit seinem Namen besiegelte er, dass es keine Unregelmäßigkeiten gegeben habe.
Keller beugte sich tiefer über das Papier, ihre Stirn legte sich in Falten. Eine handschriftliche Notiz war am Rand gekritzelt: „Verdacht auf Vertuschung. Weiterverfolgung nicht möglich.“
Die Schrift war hastig, kaum leserlich, als habe jemand in letzter Minute einen Gedanken zu Papier gezwungen, bevor die Akte in der Versenkung verschwand.
Sie schlug die nächste Seite auf und spürte, wie ihr Herz einen Schlag aussetzte. Auf der Rückseite eines Formulars klebte ein Post-it.
Anders als die vergilbten Blätter war dieses Papier neu, knallgelb, die Schrift schwarz und deutlich.
„Fragen Sie nicht weiter.“
Keller riss den Blick vom Zettel los und sah sich um. Der Raum war leer, nur das Summen der Lampen über ihr. Doch der Gedanke ließ sie nicht los: Jemand hatte diese Akte kürzlich geöffnet. Jemand, der wusste, dass sie hier landen würde.
Sie schloss den Ordner langsam, fast ehrfürchtig, als halte sie ein Beweisstück in den Händen, das mehr Gewicht hatte als alle Spuren zuvor. Der tote Mann, der so friedlich im Zug gewirkt hatte, war kein unbeschriebenes Blatt. Alte Schatten begleiteten ihn, und vielleicht war sein letzter Morgen in Zürich nur das Ende einer Geschichte, die längst begonnen hatte.
Die heile Fassade
Das Haus lag in einem ruhigen Viertel am Stadtrand, Reihenhäuser mit gepflegten Hecken, Kinderfahrrädern auf den Einfahrten, der Duft von frisch gemähtem Rasen, obwohl es längst Herbst war. Inspektorin Keller parkte den Wagen ein Stück weiter, als wolle sie dem Gebäude Zeit geben, sich auf ihren Besuch vorzubereiten. Sie blieb einen Moment sitzen, die Hände am Lenkrad, die Stirn leicht gesenkt. In den Fenstern spiegelte sich der blasse Vormittag, eine Sonne, die sich nicht entscheiden konnte, ob sie Wärme spenden wollte oder nur dekoratives Licht.
Als sie ausstieg, bellte irgendwo ein Hund, verstummte gleich wieder. Der Kies knirschte unter ihren Schritten. Sie klingelte, hörte dahinter schnelle Bewegungen, das hektische Zusammensuchen von Ordnung.
Die Ehefrau öffnete. Julia. Ihr Gesicht war eingefallen, doch die Lippen trugen noch Reste von Lippenstift – eine Geste, die nicht für den Besuch bestimmt war, sondern für das eigene Spiegelbild. Sie hielt sich am Türrahmen fest, als müsse sie sich abstützen.
„Frau Meier?“ fragte Keller ruhig.
Julia nickte, und einen Moment später standen sie im Wohnzimmer. Es war ein Raum, wie man ihn in Katalogen sieht: helle Vorhänge, ein weißes Sofa, Bilderrahmen auf einem Regal.
Überall Fotos: Familienurlaube, Kinder mit Eiscreme, ein Mann im Anzug, der die Tochter hoch in die Luft hielt. Szenen, die so perfekt wirkten, dass sie fast gestellt sein mussten.
„Setzen Sie sich,“ sagte Julia, und ihre Stimme war brüchig, aber kontrolliert. Sie brachte Kaffee, stellte zwei Tassen auf den Tisch, ohne Zucker, ohne Milch, als hätte sie den Automatismus beibehalten, auch wenn der Anlass ihn längst sinnlos machte.
Keller ließ den Blick schweifen. Auf einem Tischchen lag ein Stapel Zeitschriften: Erziehung, Architektur, ein Wirtschaftsmagazin. Nichts, was nach einer Krise roch. Die Kinderzeichnungen am Kühlschrank zeigten Sonne, Haus, Familie.
„Ihre Kinder?“ fragte Keller, um das Schweigen zu füllen.
„In der Schule,“ antwortete Julia. „Ich wollte, dass ihr Tag so normal wie möglich bleibt.“ Ihre Hände umklammerten die Tasse, ohne zu trinken.
„Ihr Mann – wie würden Sie ihn beschreiben?“
Julia hob den Kopf, und für einen Moment flackerte Stolz in ihren Augen. „Zuverlässig.
Liebevoll. Immer da für die Kinder. Er hat alles für uns getan.“ Dann bröckelte der Ausdruck, und sie wandte den Blick ab. „Er war…“ Sie suchte nach einem Wort, fand keins, trank einen Schluck, als könne sie Zeit kaufen.
„Gab es Spannungen in letzter Zeit?“ Keller hielt die Stimme neutral, fast weich.
Julia schüttelte den Kopf. „Wie in jeder Ehe. Aber nichts… nichts Ernstes.“
Eine Pause. Keller beobachtete die kleine Zuckung im Gesicht, die verriet, dass die Worte eine Spur zu schnell kamen.
Die Nachbarin meldete sich ungefragt. Eine Frau Mitte fünfzig, die im Vorgarten gearbeitet hatte und den Besuch der Polizei bemerkt hatte, trat durch den Gartenzaun heran. Keller öffnete ihr, hörte den vorgebeugten, halb verschwörerischen Tonfall:
„Sie waren ein schönes Paar, wirklich. Aber… man hat sie oft streiten hören. Abends. Wenn die Fenster offen standen.“
Julia erstarrte, hörte jedes Wort. „Das waren… Kleinigkeiten,“ sagte sie scharf, zu scharf. „Das ist normal.“
Keller notierte nichts, sie speicherte. Ihre Augen blieben auf Julia, deren Hände wieder fester die Tasse umschlossen, als wolle sie sie zerbrechen.
Später, als Keller das Arbeitszimmer betrat – ein schmaler Raum, geordnet, Bücherregale, ein Schreibtisch mit einer akkuraten Anordnung von Akten – fiel ihr Blick auf den Boden unter der Schublade. Ein kleiner Spalt. Sie kniete sich, tastete. Mit einem leisen Klicken löste sich eine Abdeckung. Dahinter: mehrere USB-Sticks, sorgfältig in einem Umschlag verstaut.
Sie hielt sie im Licht, drehte sie zwischen den Fingern. Kein Name, keine Markierung. Nur der Verdacht, dass diese kleinen Speicherstücke schwerer wogen als jedes Familienfoto an der Wand.
Julia stand in der Tür, erbleichte, als sie die Funde sah.
„Was… was soll das?“ flüsterte sie.
Keller sah sie lange an, antwortete nicht sofort.
Dann steckte sie die Sticks in eine kleine Plastiktüte, versiegelte sie.
„Etwas,“ sagte sie schließlich, „das uns vielleicht erklärt, warum Ihr Mann nicht mehr lebt.“
Die Worte hingen in der Luft wie Rauch, der nicht vergehen wollte.
Und in diesem Moment bekam das Bild des perfekten Familienvaters erste Risse – Risse, die in Abgründe führen konnten.
Das Flüstern der Kinder
Es war später Nachmittag, als Keller noch einmal in das Reihenhaus zurückkehrte. Julia war nicht anwesend; eine Nachbarin hatte die Kinder für ein paar Stunden beaufsichtigt, während die Mutter Besorgungen erledigte. Keller nutzte die Gelegenheit, um mit den Kindern zu sprechen – allein, ohne die kontrollierende Präsenz der Erwachsenen.
Im Wohnzimmer lagen Spielsachen verstreut: Legosteine, eine aufgeschlagene Kinderbibel, ein Puzzle, dem ein Teil fehlte. Zwei kleine Gestalten saßen auf dem Teppich, die Tochter mit Zöpfen und einer Zahnlücke, der Sohn ein Jahr jünger, schüchtern, aber wachsam. Sie sahen Keller mit großen Augen an, die fragten: Was willst du von uns, das wir nicht schon verloren haben?
„Ich weiß, das ist schwer,“ begann Keller leise, fast wie eine Lehrerin, die versucht, Vertrauen zu wecken. „Aber ich brauche eure Hilfe. Damit wir verstehen, was mit eurem Papa passiert ist.“
Die Tochter nickte ernsthaft, als wolle sie schon erwachsen sein. Der Junge rutschte näher zu seiner Schwester, griff nach ihrer Hand.
„Erzählt mir von dem Abend, bevor er weggefahren ist,“ sagte Keller.
„Wir haben gegessen,“ begann das Mädchen.
„Spaghetti. Papa hat gelacht, aber nur kurz.
Danach… haben Mama und Papa gestritten.“
„Worüber?“ fragte Keller sanft.
Das Mädchen zuckte die Schultern. „Über… irgendwas Wichtiges. Wir durften nicht zuhören.
Aber sie waren laut.“
Der Junge hob plötzlich den Kopf. „Papa war traurig,“ sagte er. Seine Stimme war brüchig, aber sicher. „Er hat uns ins Bett gebracht. Hat uns geküsst.“
„Und was hat er gesagt?“
Das Kind dachte nach, runzelte die Stirn, als würde es sich an ein Geheimnis erinnern. „Er hat gesagt: ‚Habt keine Angst.‘“
Keller spürte, wie sich eine Gänsehaut an ihrem Nacken ausbreitete. „Habt keine Angst“ – ein Satz, der wie ein Abschied klang, wie ein letzter Versuch, Sicherheit zu geben, während er selbst schon wusste, dass er in Gefahr war.
„Hatte er Angst?“ fragte Keller vorsichtig.
Die Tochter nickte langsam. „Ja. Aber nicht vor Mama.“
Die Worte hingen in der Luft wie ein unsichtbares Gewicht.
Keller hielt den Atem an. Sie durfte nicht zu viel hineinlesen, durfte die Kinder nicht in eine Richtung drängen. Aber dieser Satz, so schlicht, so kindlich gesagt, war stärker als jeder Beweis.
„Wovor dann?“ fragte sie leise.
Die Tochter blickte auf die Legosteine, die sie nervös in den Händen drehte. Dann flüsterte sie, kaum hörbar: „Vor seiner Arbeit.“
Der Junge nickte ernsthaft, als hätte er etwas bestätigt, das sie beide schon lange wussten.
Keller saß einen Moment schweigend da. Sie hörte nur das Ticken der Uhr und das Rascheln der Kinderhände im Spielzeug. In diesem stillen Wohnzimmer, mit seinen bunten Bildern und harmlosen Puzzles, hatte sie eine Wahrheit gehört, die schwerer wog als jede Akte im Polizeipräsidium.
Als Julia später zurückkehrte, sprach Keller kein Wort darüber, was die Kinder gesagt hatten.
Doch als sie zum Auto ging, wusste sie: Das Netz spannte sich weiter – und es führte nicht nur in die Ehe, sondern tief hinein in die Schatten der Firma.
Doppeltes Spiel
Die USB-Sticks lagen auf dem Schreibtisch des Kriminaltechnischen Labors wie kleine, unscheinbare Zeugen. Schwarzes Plastik, verkratzt, anonym. Doch Keller wusste: manchmal wiegt ein paar Gramm Kunststoff mehr als jede Waffe.
Der Spezialist, ein junger IT-Forensiker mit schief sitzender Brille und einem Kaffeefleck auf dem Hemd, schloss den ersten Stick an. Der Bildschirm erwachte, Zeilen von Ordnern erschienen, nüchtern beschriftet, aber unterkühlt verdächtig: Projekt AURORA, Klinische Daten, Protokoll vertraulich.
„Er hat das nicht zufällig mit nach Hause genommen,“ murmelte Keller.
Der Forensiker klickte sich durch Tabellen, PDFs, verschlüsselte Dateien. „Das sind Forschungsunterlagen… hochsensibel.
Medikamente, die offiziell noch in der Testphase sind. Krebsstudien, soweit ich das sehe. Wer immer das hier kopiert hat, hat seine Finger tief in den Firmenservern gehabt.“
Auf dem Bildschirm flackerten Grafiken, Balkendiagramme, Notizen. Neben nüchternen Zahlen standen Kommentare – Randbemerkungen, Zweifel an den offiziellen Studienergebnissen. „Daten lückenhaft.“ – „Nebenwirkungen verharmlost.“ – „Patientenprotokolle gefälscht?“
Keller lehnte sich vor. „Also hat er Beweise gesammelt. Gegen seine eigene Firma.“
„Oder für die Konkurrenz,“ entgegnete der Forensiker. „Kommt drauf an, wie man’s liest.“
Sie schwiegen. Nur das leise Summen der Festplatten füllte den Raum. Auf einem Stick fanden sie E-Mails – interne Korrespondenz zwischen dem Opfer und seinem Vorgesetzten.
Keine offenen Drohungen, aber ein Unterton aus Misstrauen. Formulierungen wie: „Halten Sie sich bitte an die vereinbarten Grenzen.“ Oder:
„Wir müssen loyal bleiben, sonst wird alles gefährdet.“
Keller spürte, wie sich das Puzzle verschob.
Bislang war der Mann ein tragisches Opfer gewesen, jetzt deutete vieles darauf hin, dass er selbst ein Spiel gespielt hatte – und zwar ein gefährliches.
Später, im Büro, ließ sie die Dateien noch einmal auf sich wirken. Sie öffnete Projekt AURORA.
Eine Abhandlung über ein neuartiges Krebsmedikament. Erste Ergebnisse vielversprechend, fast zu gut, um wahr zu sein.
Aber zwischen den Zeilen: Manipulation.
Studien, die abgebrochen wurden, ohne dass Gründe genannt wurden. Zahlen, die zu glatt wirkten.
Und dann eine handschriftliche Notiz, eingescannt: „Wenn das rauskommt, stürzt alles ein.“
Keller starrte auf die Worte, als lausche sie einer Stimme aus dem Grab.
In der Nacht konnte sie nicht schlafen. Die Bilder vom Autopsiesaal, der winzige Einstich, die kalte Haut – sie mischten sich mit den neuen Erkenntnissen. War der Mann ein Whistleblower, der die Wahrheit ans Licht bringen wollte? Oder ein Verräter, der sich in die Arme der Konkurrenz warf?
Sie dachte an Julia, die Ehefrau, an ihre kontrollierte Fassade. Wusste sie von den Sticks?
War sie Teil davon? Oder nur eine weitere Person in einem Spiel, das größer war als ihre Ehe?
Am nächsten Morgen rief der Forensiker an.
Seine Stimme klang elektrisiert. „Ich habe noch etwas. Interne Mails. Der Vorgesetzte des Opfers – die beiden hatten mehr als nur Meinungsverschiedenheiten. Da sind Andeutungen von Drohungen. Versteckt, aber eindeutig: ‚Wenn Sie das weiter verfolgen, haben Sie ein Problem.‘“ Keller schloss die Augen. Jede neue Spur machte den Fall größer, nicht kleiner.
Sie legte auf, stand am Fenster ihres Büros und sah hinaus in die Stadt. Menschen gingen ihren Wegen nach, ahnungslos, während hier im Hintergrund eine Wahrheit brodelte, die Karrieren, Firmen, vielleicht Leben zerstören konnte.
Dann griff sie zum Telefon, wählte die Nummer der Firma, in der das Opfer gearbeitet hatte. Sie forderte ein Gespräch an – mit dem Vorgesetzten.
Noch wusste sie nicht, dass sie mit genau jenem Mann sprechen wollte, der diesen Mord wie einen Schachzug kalkuliert hatte.
Der Maulwurf
Die Gänge des Konzerns wirkten an diesem Vormittag wie aufgeräumte Alibis. Glaswände, hinter denen Körper sich bewegten, ohne Spuren zu hinterlassen; Teppiche, die jede Schwere verschluckten; leise Gespräche, die sich an Regeln hielten. Keller meldete sich am Empfang, bekam einen Besucherausweis, der so steril glänzte, als sei er kein Stück Plastik, sondern eine Erlaubnis, die Wirklichkeit zu betreten. Ein junger Assistent brachte sie durch Schleusen und Drehkreuze, sein Lächeln war derart korrekt, dass man vergessen konnte, wie unaufrichtig es war.
Der Raum, in dem sie auf Herrn Schneider wartete, war ein „Projektbüro“: ein Tisch, zu groß, um vertraulich zu sein, eine Wand voller Whiteboard-Markierungen in Farben, die Begeisterung vorgaben. Drei Stühle, eine Karaffe Wasser, zwei Gläser. Das Fenster zeigte auf einen Innenhof, in dem die Bäume symmetrisch gepflanzt waren—selbst die Natur wirkte hier synthetisch.
Schneider kam pünktlich. Schlank, Anfang dreißig, Haut, die zu wenig Tageslicht kannte. Die Krawatte wirkte wie etwas, das er sorgfältig übte. Er gab ihr die Hand, setzte sich und legte das Firmen-Notebook genau im rechten Winkel auf die Tischplatte. Seine Augen suchten ständig einen Fixpunkt—die Tischkante, den Markierungsstift, die Uhr—bloß nicht Kellers Blick.
„Danke, dass Sie sich Zeit nehmen,“ sagte sie.
„Natürlich.“ Er lächelte kurz. „Ich helfe, wo ich kann.“
„Sie kannten Herrn Meier gut?“
„Wir… arbeiteten in benachbarten Teams.“ Er räusperte sich. „Sicherheit und präklinische Auswertung berühren sich häufig.“
Keller nickte. „Mir wurde gesagt, er habe viele Fragen gestellt.“
„Er war gewissenhaft.“ Das Wort fiel zu schnell.
„Sehr genau.“