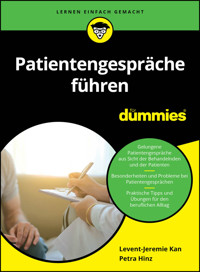
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Ein unverblümt praxisnahes Handbuch für mehr Verständnis für beide Seiten
Verstehen und verstanden werden – nicht selten ein Problem zwischen Behandelnden und Patient. Das kann dieses Buch ändern. Aus verschiedenen Perspektiven stellen Ihnen die Autoren die Ursachen des vielschichtigen Kommunikationsproblems differenziert sowie zielgerichtet vor. In Form von Denkanstößen, Empfehlungen und praktischen Übungen bieten Sie Ihnen auch greifbare Lösungen dazu an. Dabei erklären sie, wie Sie sie erfolgreich auf Ihre individuelle Situation übertragen. In welche Themenschwerpunkte Sie sich hineinarbeiten, welche Ziele Sie sich setzen – all das bleibt Ihnen überlassen.
Sie erfahren
- Was Behandelnder und Patienten jeweils voneinander erwarten
- Wie Sie Fettnäpfchen und Konflikte vermeiden
- Welchen Einfluss Ihre Patientengespräche auf Ihren beruflichen Erfolg nehmen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Patientengespräche führen für Dummies
Schummelseite
KRITIKFÄHIGKEIT
Gute Kritikfähigkeit
Schlechte Kritikfähigkeit
Ihnen gelingt es, auch in unangenehmen Momenten aufmerksam zuzuhören.
Ihnen fällt es schwer,
den Anderen ausreden zu lassen.
Sie fassen das Gesagte nicht als persönlichen Angriff auf, sondern als Bitte um eine Lösung.
Sie äußern umgehend Gegenkritik, die nicht einmal Bezug zu den Aussagen des Gegenübers nimmt.
Sie sehen die Unterhaltung als Chance
zum Wachsen und wollen auch wachsen.
Sie lehnen das Gesagte sowohl spontan
als auch langfristig ab.
Sie setzen sich mit dem Gesagten
ernsthaft auseinander.
Sie neigen zu abfälligen Gesten
und/oder Kommentaren.
Sie vergleichen Ihre Sichtweise mit der des Gesprächspartners, ohne zu werten.
Sie tendieren dazu,
in der Diskussion laut zu werden.
LÖSUNGSANSÄTZE FÜR ALLGEMEINE PROBLEME IN PATIENTENGESPRÄCHEN
Gut strukturierte organisatorische Abläufe mit Mitarbeitern klar absprechenDigitale Kommunikationsmittel anbieten und Patienten so im Vorfeld (Symptom-)Fragebögen ausfüllen lassenKeine »Massenabwicklung« von BesuchernSitzungen sorgfältig planen, einhalten und genügend Gleitzeit zwischen ihnen einberechnenTerminausfälle nutzen, um Bürokratisches zu erledigen oder (Video-)Telefonate zu führenNeue, unangekündigte Besucher bitten, Termine zukünftig vorab anzufragen und deren Besuche hinten anstellenPatienten, insbesondere Not- und Spezialfälle an andere Behandler weiterleiten, die mehr Ressourcen und Zeit zur Verfügung habenWIE SIE SICH AUF PATIENTENGESPRÄCHE VORBEREITEN KÖNNEN
Eigeninitiative und Neugier: Anstatt in eine Art stumpfer Gleichgültigkeit der Arbeitsroutine zu verfallen, setzen Sie sich regelmäßig Ziele, die Sie antreiben. Erinnern Sie sich daran, warum Sie Ihre Berufswahl trafen und was Ihnen daran Freude bereitet. Danach ermöglichen Sie sich, diese Freuden auch tatsächlich wieder auszuleben.Lieber Vorsicht als Nachsicht: Für Behandlungen von Erkrankungen gilt dasselbe wie für Gespräche mit Patienten – lieber vorsorgen, als hinterher Schaden zu begrenzen oder zu berichtigen. Sollte Ihnen die Bindung Ihrer Patienten am Herzen liegen, setzen Sie sie nicht voraus. Lernen Sie sie gemächlich genauer kennen und betrachten Sie sie als Individuen anstatt als Teil einer großen Gemeinschaft. Gehen Sie mögliche Missverständnisse besonnen an. Und konfrontieren Sie Patienten keinesfalls mit Problemen, die sie nicht betreffen: Teilen Sie zum Beispiel keine Klagen über Mitarbeiter oder über private Angelegenheiten mit ihnen.Eines nach dem anderen: Damit Sie sich weder mit zu vielen Aufgaben überfordern noch jene schleifen lassen, ist es »wichtig«, eine Aufgabe nach der nächsten zu erledigen – das gilt ebenso für Anliegen von Patienten. Gehen Sie Dringliches direkt an und vertagen Sie anderes, auch wenn es für den Patienten wichtig ist.Erst den anderen verstehen, dann verstanden werden: Hören Sie Ihrem Patienten aufmerksam zu. Gehen Sie so mit ihm um, wie Sie es sich für sich selbst und Ihre Nahestehenden von einem Behandler wünschen würden. Vermeiden Sie also, ihn schroff zu unterbrechen oder anderweitig herabzusetzen, nur weil Sie seine Aussagen möglicherweise für irrelevant erachten. Versuchen Sie, den Patienten samt seiner Beweg- und Hintergründe zu verstehen, bevor Sie schlussfolgern oder gar noch Verständnis für Ihre Lage von ihm erwarten.Kritisch motiviert: Erfolge passieren selten zufällig, ohne eigenes Zutun. Um in jeglicher Hinsicht erfolgreich zu sein, sollten Sie nach Verbesserungen streben. Hinterfragen Sie zwischenzeitlich, was Sie mit Ihrer Arbeit, insbesondere mit Patientengesprächen eigentlich erreichen möchten beziehungsweise wofür Sie arbeiten.Gemeinschaftliche Unterstützung: Sie können nicht alle fachlichen, formellen und auch noch sozialen Anforderungen allein erfüllen. Anstatt also durch Termine zu hetzen, um möglichst viele abzuwickeln, lernen Sie, Aufgaben bewusst weiterzugeben und sich auf Ihre Mitarbeiter zu verlassen.Disziplin und Ehrgeiz: Klare Zielsetzungen sind nur der Anfang jeder Entwicklung. Zwar lässt sich einiges spontan verändern, vieles aber nur kleinschrittig über Zeiträume verteilt. Das erfordert, den eigenen Ehrgeiz immer wieder aufs Neue zu entfachen und auch mal unbeliebte Situationen mit Disziplin auszuharren – ohne dabei in gewohnte, unvorteilhafte Verhaltensmuster zu verfallen. Erarbeiten Sie stattdessen neue bereichernde Muster, die Sie über fortdauerndes Wiederholen verinnerlichen und Ihnen mit der Zeit nicht mehr viel Konzentration abverlangen.Patientengespräche führen für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book is published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe © [Copyright-Jahr] by Wiley Publishing, Inc. [or the name of the copyright holder as it appears in the original Eng lang edition.]
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: DragonImages - stock.adobe.comKorrektur: Petra Heubach-Erdmann
Print ISBN: 978-3-527-72083-5ePub ISBN: 978-3-527-84262-9
Widmung
Dieses Buch ist allen Heilberuflern und Patienten gewidmet, die ein besseres Miteinander anstreben.
Danksagung
Als Erstes bedanken Frau Dr. Hinz und ich uns bei Marcel Ferner und Gabriele Kalmbach. Mit ihren wertvollen Anregungen und Rückmeldungen bereicherten sie die Inhalte des Buches maßgeblich.
Als Nächstes gilt unser Dank David Frankiewicz. Tatkräftig unterstützte er uns in allen Angelegenheiten der Formatierung. Ohne seine Hilfe hätte sich das Erscheinungsdatum um weitere Monate verzögert.
Auch bedanken wir uns bei Heike Agne, unserer Fachkorrektorin. Als ausgebildete Gesundheitspflegerin, Neurologin sowie Psychiaterin war es ihr möglich, die Inhalte aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ihr unermüdlicher Einsatz mitsamt der konstruktiven Kritik war von unschätzbarem Wert.
Zusammengefasst danken wir allen Beteiligten für die inspirierende Erfahrung, an dem Projekt »Patientengespräche führen für Dummies« wachsen zu dürfen!
PS: Ein zusätzliches »Dankeschön« an Dr. Petra Hinz! Dafür, dass sie sich so unkompliziert auf die spontane Zusammenarbeit einließ und mich bei der Fertigstellung des Buches begleitete. Abschließend möchte ich meinen Dank noch Roswitha Haverbeck aussprechen, die mir zur anstrengenden Anfangszeit der Buchgestaltung immer wieder die Motivation gab, weiterzumachen.
Über die Autoren
Levent-Jeremie Kan ist ein engagierter Psychologischer Berater, der sich auf die individuelle Beratung und Förderung von Menschen verschiedener Altersgruppen spezialisiert hat. Mit ganzheitlichem, praktischem Ansatz greift er Inhalte aus verschiedenen wissenschaftlich-psychologischen Disziplinen auf, darunter Entwicklungs-, Gesprächs-, Gestalt- und Verhaltenspsychologie. Darauf aufbauend unterstützt er Patienten, ihre Ernährung sowie Schlafhygiene zu verbessern, und erarbeitet mit ihnen individuelle Strategien, um so einschneidende Ereignisse zu bewältigen und ihre grundlegende Lebensqualität zu steigern. In Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Unternehmen gestaltete er psychologische Fortbildungen für Ärzte und Informationsbroschüren für Patienten. Dabei widmet er sich einer Bandbreite sensibler Themen: von der Beeinträchtigung der Sexualität durch gewisse Erkrankungen und deren Therapien über den Umgang mit Angstpatienten bis hin zur Betreuung von Sterbenden sowie ihren Angehörigen.
Als geschätzte Behandlerin des Autors erklärte sich Dr. Petra Hinz ohne zu zögern bereit, zunächst die Fachkorrektur anzufangen und später sogar die Co-Autorenschaft des Buches zu übernehmen. Im seit 1960 bestehenden Familienbetrieb arbeitet sie seit 25 Jahren als niedergelassene Fachzahnärztin für Kieferorthopädie. An ihrem Beruf schätzt sie besonders den Kontakt zu ihren Patienten und Mitarbeitern, was sie auch nach außen trägt und so als angesehene, beliebte Behandlerin in ihrer Region gilt. Seit 2018 leitet sie regelmäßig Fortbildungen über kieferorthopädische Themen für Zahnärzte und Zahnmedizinisches Fachpersonal in der Haranni Academie in Herne. In diesen legt sie nicht nur Wert auf qualitativ hochwertige fachliche Inhalte, sondern betont mit Nachdruck, wie Behandlungen und Untersuchungen patientengerecht durchgeführt werden. Durch ihre langjährige Erfahrung sowie ihre patientenorientierte Einstellung konnte sie das bereits fortgeschrittene Buch noch mit nennenswerten Anstößen erweitern.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Widmung
Danksagung
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Teil I: Keine Patientengespräche ohne Arzt-Patienten-Beziehung
Teil II: Patientengespräche im Arbeitsalltag
Teil III: Grundlagen der Gesprächsführung
Teil IV: Fettnäpfchen in Patientengesprächen
Teil V: Patientengespräche praktisch angehen
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Bonuskapitel
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Keine Patientengespräche ohne Arzt-Patienten-Beziehung
Kapitel 1: Alles beginnt mit der Arzt-Patienten-Beziehung
Die Arzt-Patienten-Beziehung im Wesentlichen
Patientengespräche früher und heute
Das Märchen vom Mediziner im Wunderland
Kapitel 2: Kurze Vorstellungsrunde der Behandler
Nicht nur Ärzte führen Patientengespräche
Kapitel 3: Behandler und Patienten: Zwei Welten treffen aufeinander
So sehen Behandler ihre Arbeit mit Patienten
So bewerten Patienten ihre Besuche bei Behandlern
Ihre persönlichen Sichtweisen als Behandler und Patient
Kapitel 4: Behandler und Patient als Verbündete
Patientenorientierung als Mittel, erfolgreiche Patientengespräche zum Zweck
Kapitel 5: Konventionen und Ethik
Konventionen im Gesundheitswesen
Hippokratischer Eid
Ethik als Konvention, Moral als Regel
Wer Gutes tut, dem Gutes widerfährt
Kapitel 6: Korruption hat viele Gesichter
Korruption im Gesundheitswesen
Die Gesichter des Wirtschaftskolosses »Pharmazie«
Das gnädige Gesicht der Pharmazie
Gelegenheit macht Gesundheitsdiebe
Gründe für korruptes Verhalten
Zweifelhafte Kontrolle: Die Entscheidung liegt in einer Hand
Kapitel 7: Ethik als Lösung für das Korruptionsproblem
Erst mit sich selbst, dann mit anderen zurechtkommen
Maßnahmen gegen Gesundheitskorruption
Als Opfer gegen Korruption angehen
Teil II: Patientengespräche im Arbeitsalltag
Kapitel 8: Äußere sowie innere Vorgaben
Neue Gesetze verändern Patientengespräche
Vorgaben der Bundesärztekammer
Vorgaben der Krankenkassen
Allgemeine Anweisungshierarchie im Gesundheitswesen
Die wenigsten Arzt-Patienten-Beziehungen fangen bei null an
Kapitel 9: Routinierte Abläufe von Sprechstunden und Visiten
Gute Voraussetzungen für Patientengespräche
Erstbesuch eines Patienten
Unsittliche Umstände heute, unsittlichere Umstände damals
Zeitmanagement: Wartezeit heilt keine Wunden
Willkommen im digitalen Zeitalter
Kapitel 10: Indirekte Patientengespräche
Leitfaden für jegliche Patientenbeziehungen
Ihr Ruf eilt Ihnen voraus
Teil III: Grundlagen der Gesprächsführung
Kapitel 11: Kommunikation 1.0: Verbale Kommunikation
Kommunikation zusammengefasst
Dialoge, Monologe und mehr
Konnotationen
Ein Gespräch auf mehreren Ebenen führen: Das Vier-Ohren-Modell
Die Floskel »Floskel«
Kapitel 12: Kommunikation 2.0: Paraverbale Kommunikation
Stimme ist Stimmung
Die Artikulation
Die Intonation
Die Resonanz der Stimme
Achtung, Rechtschreibfalle: »R-h-y-t-h-m-u-s«
Intonieren, Resonieren, Rhythmisieren
Kapitel 13: Kommunikation 3.0: Nonverbale Kommunikation
Die Körpersprache
Die Mimik
Glaubhafte Gesichtsausdrücke statt gewöhnungsbedürftiger Grimassen
Die Gestik
Die Atmung
Die räumliche Distanz
Kapitel 14: Kommunikation 4.0: Emotionale Kommunikation
Gefühle und Emotionen sind gefühlt dasselbe
Der Einfluss von Emotionen auf (Körper-)Sprache und Verhalten
Achtsam mit den eigenen Gefühlen als auch denen der Patienten umgehen
Der Wert von Werten
Kapitel 15: »Man kann nicht nicht kommunizieren«
Die
NEUE
Sprache des 21. Jahrhunderts: Emojis
Verbale und nonverbale Kommunikation im Einklang
Keine Kommunikation ohne Missverständnisse
Ignorieren oder Schweigen: Das vermeintliche Nicht-Kommunizieren
Teil IV: Fettnäpfchen in Patientengesprächen
Kapitel 16: Fettnäpfchen 1.0: Gehörtes und Gesagtes gegen Verstandenes
Interpretationen sind unerlässlich für Patientengespräche
Missverständnis ist nicht Missverständnis
Kapitel 17: Fettnäpfchen 2.0: Selbst- und Fremdwahrnehmung
Man sucht sich (nicht) aus, wer man ist
Achtung, Zungenbrecher: »Au-Then-Ti-Zi-Tät«
Kapitel 18: Fettnäpfchen 3.0: Nichts als Lügen
Man kann nicht nicht eigennützig lügen
Woran Sie Lügen erkennen können
Je ehrlicher der Behandler, desto ehrlicher der Patient
Kapitel 19: Fettnäpfchen 4.0: Kulturen und Klischees
Verschiedene Kulturen und Religionen in der Patientengemeinschaft: Islam
Verschiedene Kulturen und Religionen in der Patientengemeinschaft: Christentum
Verschiedene Kulturen und Religionen in der Arbeitsgemeinschaft
Vorurteile halte ich für ein Gerücht
Kapitel 20: Fettnäpfchen 5.0: Eine bunte Klientel fordert mehr als Schwarz-Weiß-Malerei
Patientengespräche mit Kindern führen
Patientengespräche mit Jugendlichen führen
Patientengespräche mit Senioren führen
Kassen- und Privatpatienten
Wenn neue Patienten das Ego fordern
(Passiv-)Aggressive Patienten
Was Behandler als Patienten erleben
Kapitel 21: Fettnäpfchen 6.0: Patienten mit Behinderungen
Spektren innerhalb des Spektrums
Körperliche Behinderung
Geistige Behinderung
Autismus-Spektrum-Störungen
Offiziell keine soziale Behinderung: Soziopathie
Kapitel 22: Fettnäpfchen 7.0: Sprachbarrieren und Hemmungen
Wenn jemand nicht einmal »Bahnhof« versteht
Tabuisierte Patientengespräche führen
Das große Thema »Sexualität«
Den Tod kann man nicht totschweigen
Aufklärungsbedarf und Hilfebedürftigkeit erkennen
Verantwortung, nicht Schuld
Kapitel 23: Fettnäpfchen 8.0: »M/W/D« – Sprachliche Geschlechterdifferenzierung
Was, wen und wie man überhaupt »gendert«
Befürworter des Genderns
Kritiker des Genderns
Gendern in der Praxis
Teil V: Patientengespräche praktisch angehen
Kapitel 24: Konfliktfreie Konfrontationen
Konfliktpotenzial in Gesundheitsberufen
Ich bin kritikfähig, Sie sind kritikfähig, wir alle sind kritikfähig
Konflikte lösen: Zum Streiten gehören immer zwei
Kapitel 25: Von Menschenkenntnis zu Empathie
Empathie, nicht Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft oder Rücksichtnahme
Kleiner Zusatz: Der Antagonist Ihrer Geschichte – Der Dunkle Empath
Kapitel 26: Intuition und Reflexion
Dem Bauchgefühl vertrauen
Nachdenken nicht dem Zufall überlassen
Kapitel 27: Ein klarer Kopf, um das Gelernte zu verinnerlichen
Realistische Erwartungen
Selbstfindung ist ein Prozess
Innere Stärke nach außen tragen
Berufliches von Privatem trennen
Innovative Lösungsansätze für bekannte Probleme in Patientengesprächen
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 28: Zehn Tipps für gelungene Patientengespräche
Aufgeschlossene Körpersprache
Authentizität und Natürlichkeit
Beruhigende, klare sowie respektvolle Sprechweise
Digitaler Fortschritt
Diplomatie, Reflexion und Selbstbeherrschung
Echte Interaktion auf Augenhöhe
Nachbereitung und Feedback
Perspektive des Patienten berücksichtigen
Transparente, zielführende Gesprächsführung
Vorbereitung
Kapitel 29: Zehn Gründe, an Patientengesprächen zu arbeiten
Behandlungserfolge
Beidseitiger Zugewinn
Effizienz
Fachliches sowie persönliches Wachstum
Harmonie
Inspiration für das Umfeld
(Selbst-)Bestätigung
Therapietreue
Wachsende Beliebtheit durch professionelle Ausstrahlung
Vorbilder stoßen auf Anklang
Kapitel 30: Zehn wiederkehrende Probleme in Patientengesprächen
Diskriminierung von Andersartigkeiten
Fehlende Nachverfolgung und Rückmeldung
Mangelhaftes Management
Mangelnde Klarheit und Struktur im Gespräch
Tunnelblick auf die eigene Fachrichtung
Übermäßiger Gebrauch von Fachsprache
Unangemessene Körpersignale
Unausgeglichene Arzt-Patienten-Beziehung
Unvereinbare Erwartungen und Prioritäten
Unzureichendes Zuhören
Kapitel 31: Zehn Lösungsansätze für Probleme in Patientengesprächen
Lösungsorientierung
Offenheit und Verständnis zeigen
Patientengespräche mit Kindern
Patienten mit kognitiven Einschränkungen
Sprachbarrieren überwinden
Stabiles, wertschätzendes Netzwerk
Tabuthemen zulassen
Verantwortung übernehmen
Vorbehalte auflösen
Wertfreiheit
Kapitel 32: Zehn zeitlose Vorbilder von Heilberuflern
Albert Schweitzer (1875–1965)
Beat Richner (1947–2018)
Florence Nightingale (1820–1910)
Elizabeth Blackwell (1821–1910)
Jeanne Mance (1606–1673)
Marie Curie (1867–1934)
Patch Adams (1945)
Paul Edward Farmer (1959–2022)
Temple Grandin (1947)
Viktor Frankl (1905–1997)
Kapitel 33: Zehn allgemeine Kommunikationsübungen
Aktives Zuhören
Alltagsdiplomatie
Anpassung des Fremd- und Selbstbilds
Anspannung und Entspannung
Empathie
Erweiterung des Wortschatzes
Körpersprache
Neutrale Erwartungshaltung
Rollenspiele
Sprachliche Klarheit
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: (Un-)angemessene Verhaltensweisen von Behandlern und Patienten
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Untersuchungsmaßnahmen der Heilpraktiker
Kapitel 4
Tabelle 4.1: Selbsttest – Patientenorientierung
Tabelle 4.2: Auflösung Selbsttest – Patientenorientierung
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Gesetze für Ärzte
Tabelle 5.2: Auslöser für Gewissenskonflikte
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Preisvergleich: Gesundheitsleistungen und Luxusgüter
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Rechtsgrundlagen
Tabelle 8.2: Muster-Berufsordnung
Tabelle 8.3: Kassenärztliche Bundesvereinigung
Tabelle 8.4: Vergleich der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen
Tabelle 8.5: Patientenkontakt in Kliniken und Praxen
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Qualitätsmanagement zusammengefasst
Tabelle 9.2: Videosprechstunden
Tabelle 9.3: Vor- und Nachteile von Videosprechstunden
Tabelle 9.4: Videosprechstunden
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Selbsttest – Mitarbeiterfreundlichkeit
Tabelle 10.2: Auflösung – Mitarbeiterfreundlichkeit
Tabelle 10.3: Werbung von Ärzten
Kapitel 11
Tabelle 11.1: Umgangssprachliche Konnotationen
Tabelle 11.2: Oft verwechselte Konnotationen
Tabelle 11.3: Konnotationen des Arztberufs
Tabelle 11.4: Konnotierte Eigennamen
Tabelle 11.5: Wonach Empfänger das Gehörte bewerten
Tabelle 11.6: Unbedachte Floskeln und Verallgemeinerungen
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Gegenüberstellung von Atemweisen
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Mimik und ihre Bedeutung
Tabelle 13.2: Gesten von Behandlern
Tabelle 13.3: Gesten von Patienten
Tabelle 13.4: Aussagekraft von Körpersprache
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Selbsttest – Circumplex-Modell der Affekte erstmals von James Russ...
Tabelle 14.2: Auflösung – Circumplex-Modell der Affekte erstmals von James Russe...
Tabelle 14.3: Körperreaktionen und ihre Auslöser
Kapitel 15
Tabelle 15.1: Selbsttest – Emojis benennen
Tabelle 15.2: Auflösung – Emojis benennen
Tabelle 15.3: Fehldeutungen von Patientenverhalten
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Patientenaussagen interpretieren
Tabelle 16.2: Unabsichtliche Falschaussagen
Tabelle 16.3: Falsche Gleichsetzungen
Kapitel 18
Tabelle 18.1: Ehrliche und unehrliche Kommunikation
Kapitel 19
Tabelle 19.1: Selbsttest – rassistische Vorurteile
Tabelle 19.2: Selbsttest – Gerüchte
Kapitel 20
Tabelle 20.1: Gesetzlich und privat Versicherte
Kapitel 21
Tabelle 21.1: Gehörloser Patient in oder außer Sichtweite
Tabelle 21.2: Intelligenzquotient
Kapitel 22
Tabelle 22.1: Risikofaktoren und Warnzeichen
Kapitel 23
Tabelle 23.1: Gendern mit »Y«
Kapitel 24
Tabelle 24.1: Gute und schlechte Kritikfähigkeit im Vergleich
Kapitel 25
Tabelle 25.1: Selbsttest – Merkmale von Empathie
Kapitel 27
Tabelle 27.1: Selbsttest – Zielsetzung für Patientengespräche
Tabelle 27.2: Selbstreflexion
Kapitel 33
Tabelle 33.1: Gesundheit am Arbeitsplatz
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Redezeit von Patienten
Abbildung 1.2: Aufklärungsdefizit in Patientengesprächen
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Wie Behandler ihren Austausch mit Patienten bewerten
Abbildung 3.2: Was Behandler an ihrem Beruf schätzen
Abbildung 3.3: Was Behandler an ihrem Beruf stört
Abbildung 3.4: Wie gern Patienten zum Behandler gehen
Abbildung 3.5: Was Patienten wertschätzen
Abbildung 3.6: Woran sich Patienten stören
Abbildung 3.7: Selbsttest – Umfrage für Behandler
Abbildung 3.8: Selbsttest – Umfrage für Patienten
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Von Beratung zu Bindung
Abbildung 4.2: Vorlage zur Patientenbefragung
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Psychische Gewalt durch Behandler
Abbildung 6.2: Warum Behandler psychische Gewalt ausüben
Abbildung 6.3: Wie Long-Covid-Patienten ihre Erfahrungen mit Behandlern bewerten
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Anweisungshierarchie in Kliniken
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Wartezeiten von Patienten
Abbildung 9.2: Kreislauf des Qualitätsmanagements
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Das Vier-Ohren-Modell
Abbildung 11.2: Aufklärung über Beeinträchtigung der Gesundheit
Abbildung 11.3: Wunsch nach zukünftiger Veränderung
Abbildung 11.4: Collage
Abbildung 11.5: Selbsttest – Bingo-Floskeln im Alltag
Abbildung 11.6: Selbsttest – Bingo-Floskeln in Patientengesprächen
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Gesten und Haltungen von Behandlern und Patiente...
Abbildung 13.2: Gebärden für Anfänger
Abbildung 13.3: Distanzzonen
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Selbsttest – Emoji-Botschaften verstehen
Abbildung 15.2: Auflösung – Emoji-Botschaften verstehen
Abbildung 15.3: Ursache von Fehldeutungen
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Sender und Empfänger
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Selbst- und Fremdbild formen das »Ich«.
Abbildung 17.2: Wahrnehmung von Eigenschaften
Kapitel 20
Abbildung 20.1: Patientengespräch mit einem Kind
Abbildung 20.2: Selbsttest – Kreuzworträtsel
Abbildung 20.3: Auflösung – Kreuzworträtsel
Abbildung 20.4: Ausdrucksformen von Mobbing
Abbildung 20.5: (Keine) Sonderbehandlung für Behandler
Abbildung 20.6: Behandler als Patienten
Kapitel 21
Abbildung 21.1: Gebärden für Fortgeschrittene
Abbildung 21.2: Anteil der Dunkle Triaden in der Weltbevölkerung
Kapitel 24
Abbildung 24.1: Selbsttest – Diplomatie
Abbildung 24.2: Mögliche Antworten
Kapitel 25
Abbildung 25.1: Drei Emotionen
Abbildung 25.2: Zehn Emotionen
Abbildung 25.3: Dunkle Empathie im Vergleich zu anderen Persönli...
Kapitel 26
Abbildung 26.1: Selbsteinschätzung von Frauen und Männern zum Er...
Abbildung 26.2: Wer ein falsches Lächeln auf Fotos erkennt
Kapitel 27
Abbildung 27.1: Ein Problem schrittweise angehen
Abbildung 27.2: Die Acht Säulen des Wohlbefindens
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Widmung
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
9
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
263
264
265
266
267
268
269
270
271
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
Einführung
Patientengespräche: Jeder Mensch kommt mal in die Lage, solche zu führen – ob als Patient oder Behandler. Warum also ein Handbuch dazu lesen, wenn man Erfahrungen auch eigenständig sammeln kann? Erinnern Sie sich etwa an Erlebnisse, in denen Sie sich als Praktizierender eines Heilberufs wenig souverän im Umgang mit Patienten fühlten? Die Unterhaltung eine andere Richtung nahm, als Sie eigentlich beabsichtigten? Oder eine unerklärlich unangenehme Stimmung herrschte? Nicht jedes Patientengespräch verläuft so, wie man es sich wünscht. Die Ursachen dafür einschließlich einer Vielzahl an Strategien zu deren Bewältigung finden Sie hier.
Ob noch in der Ausbildung oder bereits seit Jahrzehnten berufstätig – für alle Behandler gilt: Die Arbeit mit Patienten ist mehr als nur Teil des Arbeitsalltags. Sie ist der Grund. Im Stress oder Trott des Berufslebens vergessen Behandler schon mal, dass die gemeinsamen Treffen für Kranke eher besonders, sogar aufwühlend sind. Damit Sie also in Ihrem Beruf erfolgreich sein können, müssen Sie einerseits verschiedene Patientengruppen, ihre Besonderheiten, Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede kennenlernen und ihnen angemessen begegnen. Andererseits müssen Sie dabei auch äußere Rahmenbedingungen wie Gesetze, Konventionen und die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberuflern berücksichtigen. All das sollte dann noch mit der persönlichen Einstellung zu vereinbaren sein. Selbst für fähige Fachkundige oder erfahrene Menschenkenner ist das keine kleine Herausforderung. Darüber hinaus ändern sich mit dem Zeitgeist auch die Anforderungen an jedes Arzt-Patienten-Verhältnis. Sich auf dem Laufenden zu halten, sich zu bilden und weiterzuentwickeln, ist daher eine entscheidende Grundvoraussetzung für den lang anhaltenden Erfolg. Letztlich liegt es aber gleichermaßen am Behandler wie am Patienten, angenehme, bereichernde Erfahrungen aus den gemeinsamen Patientengesprächen zu ziehen.
Über dieses Buch
»Patientengespräche führen für Dummies« soll ein alltagstaugliches Mini-Lexikon sein, in dem Fachbegriffe und verschachtelte Sätze nur Ausnahmen sind. Immerhin ist es als ein für jedermann leicht verständliches Handbuch zur Förderung der Kommunikations- und Sozialkompetenzen gedacht. Einiges von dem, was Sie hier lesen werden, mag Ihnen bereits bekannt sein oder offensichtlich erscheinen. Tatsächlich sind gewisse Inhalte auch weder bahnbrechende Neuheiten noch allgemeingültige Patentrezepte. Vielmehr dienen sie der Aufklärung, sollen Denkanstöße liefern, an Wichtiges erinnern und zur Verbesserung des zwischenmenschlichen Miteinanders motivieren.
Schwerpunktmäßig konzentriert sich das Buch auf den Kontakt zwischen Behandlern und Patienten. Dazu machen Sie sich mit den vielen kleinen Bausteinen vertraut, aus denen sich dieser Kontakt zusammensetzt: Die Ausdrucksweise oder Aussprache bestimmt nicht allein über den Ausgang eines Gesprächs. Nein, nonverbale Kommunikationsmittel wie Körpersprache, emotional-soziale sowie psychologische Reize sind erheblich einflussreicher. Selbst vermeintlich unzusammenhängende Einflüsse wie der Ort, die Kleidung und Außenstehende üben großen Einfluss auf ein Patientengespräch aus.
Lernen Sie von anderen Heilberufen, darunter Ärzten, Pflegern und Therapeuten. Aus ihren Erfahrungen können Sie wichtige Erkenntnisse ziehen. Zum Beispiel, dass Patientengespräche mehr als nur dem Informationsaustausch dienen. Für Patienten ist die Beziehung zum Behandler von weitaus höherer Bedeutung. Das Auswendiglernen der Anregungen und Empfehlungen dieses Buches reicht allerdings nicht aus, um an Souveränität zu gewinnen. Einige Erfahrungen müssen Sie selbst machen, um sich weiterzuentwickeln. Scheuen Sie sich daher bitte nicht, die angebotenen Übungen auch wirklich umzusetzen und ihrem Nutzen so überhaupt erst eine Chance zu geben. Das Gelernte nutzt Ihnen dann womöglich mehr als nur in Ihrer Tätigkeit als Heilberufler, sondern ebenso in anderen Lebensbereichen.
Konventionen in diesem Buch
Keine Gendersprache: Trotz des hohen Stellenwerts von Diversität samt seiner gesellschaftlichen Für-Bewegung entschloss ich mich der Lesbarkeit halber, auf die zeitgemäße sprachliche Differenzierung der Geschlechter zu verzichten. Entsprechend nicht-angepasste Berufs- und Personenbezeichnungen bitte ich als Anrede für »den Menschen« zu verstehen, die uns alle als Spezies ansprechen soll. Aus diesem Grund verwende ich auch den zusammenfassenden Begriff »Behandler«, der jeden Heilberuf einschließt, anstatt den Lesefluss durch wiederholte Aufzählungen zu unterbrechen. Ich hoffe sehr, dass diese Entscheidung keineswegs Ihr Interesse am Lesen beziehungsweise die Relevanz des Gelesenen für Sie schmälert!
Keine Patentrezepte: Ob Behandler oder Patient – Sie wissen, Menschen und ihre Meinungen sind verschieden. Außerdem ist das Thema »Kommunikation« bei Weitem zu vielschichtig, als dass ich in diesem Buch alle erdenklichen Szenarien samt Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten beleuchten könnte. Genauso wenig kann und möchte ich Ihnen persönliche Entscheidungen abnehmen. Vielmehr soll dieses Buch Ihr Bewusstsein erweitern und Sie so bei Ihren Entscheidungsfindungen unterstützen. Betrachten Sie das Gelesene daher als abwechslungsreiches Angebot an Praktiken sowie Stilmitteln, aus denen Sie selbst aussuchen, welche für Sie und Ihre Patientengespräche geeignet sind.
Kontroverse, polarisierende Inhalte: Über die Kapitel des Buches verteilt werden Sie auf zahlreiche Tabuthemen stoßen, wie Korruption, Rassismus, Sexualität und Tod. Um die dargestellte Problematik greifbarer zu machen, finden Sie zu jedem Tabu echte Fallbeispiele – diese könnten manche Leser emotional stark berühren. Zudem sind nicht alle der begleitenden Empfehlungen und Schlussfolgerungen bis ins kleinste Detail ausdifferenziert. Fassen Sie sie deshalb als Mehrheitsmeinungen auf. Insbesondere in diesen kontroversen Kapiteln habe ich versucht, auf eine möglichst »politisch-korrekte« Ausdrucksweise zu achten. Falls mir das aber nicht immer gelungen sein sollte, sehen Sie es mir bitte nach. Schließlich verändern sich Gesetze, Konventionen und Ähnliches fortlaufend. Außerdem hat jeder eine persönliche Auffassung dazu, was »angemessen« ist. Das macht es nahezu unmöglich, nicht doch irgendwo, bei irgendwem anzuecken – übrigens ein Hinweis, den Sie auch für sich beherzigen sollten und der sich durch alle Kapitel des Buches zieht.
Datenschutz und Privatsphäre: Tatsächlich gehen alle vorgestellten Patientenfälle aus echten Erfahrungsberichten hervor. Jedoch habe ich sie abgewandelt, sodass sie das Ansehen und die Vertraulichkeit der Betroffenen nicht gefährden. Gewisse dieser vermeintlichen Einzelfälle oder auch allgemeineren Studienergebnisse sind durchaus kritisch dargestellt, manche rufen beim Lesen sogar womöglich Unbehagen hervor. Ihre Darstellung dient nicht dazu, Einzelpersonen oder ganze Berufsgruppen an den Pranger zu stellen, sondern auf ernst zu nehmende wiederkehrende Probleme aufmerksam zu machen.
Hinweise zur Formatierung: Die meisten Aufzählungen sind alphabetisch, nicht zwingend nach Wichtigkeit geordnet. Außergewöhnliche Fallbeispiele, persönliche Erfahrungen und Zitate finden Sie in Form von grau unterlegten Kästen. Internetadressen sind in dieser Schreibmaschinenschrift dargestellt. Zusätzlich finden Sie zu jedem ausgeschriebenen Link einen QR-Code, den Sie mit der Kamerafunktion Ihres Mobiltelefons spielend leicht scannen und öffnen können. Um die Seitenzahl des Buches zu begrenzen, habe ich auf ein Quellenverzeichnis verzichtet. Studien und andere Fremdquellen sind im Text aber ausführlich genug beschrieben, dass Sie sie anhand weniger Schlagwörter einfach über die Internetsuche wiederfinden.
Was Sie nicht lesen müssen
»Patientengespräche führen für Dummies« ist vor allem als Nachschlagewerk gedacht. Sie haben also die Möglichkeit, es der Reihe nach zu lesen oder sich einzelne Abschnitte herauszusuchen, die Sie besonders ansprechen. Da das Buch so aufgebaut ist, dass Sie problemlos ohne Vorkenntnisse in jedes Kapitel einsteigen können, bleibt die Entscheidung bei Ihnen.
Sollten Sie eher der »praktische Typ« sein, eignen sich vor allem Teil III bis VI, in denen Sie zahlreiche Selbsttests und Übungen vorfinden. So haben Sie die Möglichkeit, direkt an Ihren Kommunikationsfertigkeiten zu arbeiten. Orientieren Sie sich dabei am Stichwortverzeichnis und an dem entsprechenden Symbol »Übung«. Für den Fall, dass Sie doch eher zu den »Theoretikern« gehören und sich für Definitionen, Fallbeispiele, Statistiken und Ähnliches interessieren, erkennen Sie derartige Inhalte anhand der Symbole »Definition« oder »Wissenschaftlicher Kram«.
Törichte Annahmen über den Leser
Handbücher über »Kommunikation« finden sich mittlerweile zu Genüge. Die meisten davon sind allerdings nicht direkt auf Patientengespräche ausgerichtet. Sie sind eher allgemein gefasst und zum Teil oberflächlich. Daraus entstammt auch die Motivation, ein Buch zu schreiben, das sich vorwiegend mit der Gesprächsführung zwischen Behandlern und Patienten beschäftigt und dabei Tabus nicht ausblendet. Wer interessiert sich für ein solches Buch? Wer profitiert davon? Vielleicht törichterweise stelle ich mir die Leser von »Patientengespräche führen für Dummies« so vor:
Sie sind in der Ausbildung und möchten noch praxisnäher auf Ihren bevorstehenden Arbeitsalltag vorbereitet werden, vor allem auf den Umgang mit Patienten.
Sie praktizieren bereits seit einiger Zeit, sind aber neugierig auf mögliche Ergänzungen zu Ihrem Wissen, möchten Ihr Gedächtnis auffrischen oder einfach schauen, inwieweit Ihre Einstellung und Ihr Handeln mit dem übereinstimmen, was in diesem Buch empfohlen wird.
Sie interessieren sich grundsätzlich für das Thema »Kommunikation« und möchten konkrete Grundlagen, Tipps und Übungen dazu kennenlernen.
Sie möchten sich mehr in die Lage Ihrer Patienten hineinversetzen, sich mit deren Perspektive vertraut machen.
Für ausgiebige Fortbildungen fehlen Zeit und Geld. Daher suchen Sie gebündelte, handfeste Informationen, die Sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch schnell und einfach umsetzen können.
Sie sind Angehöriger eines angehenden oder bereits praktizierenden Behandlers und denken sich: »An Patientengesprächen zu arbeiten, ist sinnvoll – das sollte man sich anschauen!«
Sie sind selbst auch in der Rolle des Patienten und möchten dem wechselwirkenden Einfluss beider Rollen auf den Grund gehen.
Da dieses Buch aktuelle Ereignisse, zeitlose Probleme und auch innovative Ansätze aufgreift, eignet es sich für angehende sowie erfahrene Behandler aller Gesundheitsberufe gleichermaßen und selbst für Personen, die in der pharmazeutischen Branche tätig sind, oder auch Patienten, die die Treffen mit ihren Behandlern mal aus der anderen Perspektive verstehen möchten.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
»Patientengespräche führen für Dummies« setzt sich aus sieben abwechslungsreichen, inhaltlich miteinander verknüpften Teilen zusammen. Jeder Teil konzentriert sich dabei auf einen besonderen Schwerpunkt. Die große Auswahl an vielfältigen Inhalten gibt Ihnen die Möglichkeit, für sich individuell festzulegen, in welchen Anwendungsbereichen Sie sich weiterbilden möchten und was Sie vielleicht vorerst überspringen.
Für einige Leser könnte diese Themenvielfalt zunächst anspruchsvoll wirken. In dem Fall gehen Sie nach dem »Buffet-Prinzip« vor: Sehen Ihr Projekt »Patientengespräche führen« als Teller und die verschiedenen Kapitel als Gerichte. Schauen Sie sich vorerst lediglich die Überschriften an. Suchen Sie sich dann die interessantesten aus. Alles auf einmal auszuprobieren, würde in jeglicher Hinsicht überfordern – genauso wie beim Essen. Gehen Sie es also schrittweise und in Ruhe an! Sobald Sie »gesättigt« sind, sollten Sie es auch erst einmal dabei belassen und ein anderes Mal weiterlesen.
Um sich dann wieder im Buch zurechtzufinden, orientieren Sie sich einfach an den Beispielsymbolen, dem Inhalts- sowie Stichwortverzeichnis. So gelangen Sie schnell an die Informationen, die für Sie relevant sind.
Teil I: Keine Patientengespräche ohne Arzt-Patienten-Beziehung
Als Einstieg für alle folgenden Teile fasst Teil I das Thema »Patientengespräche« im Wesentlichen zusammen. Zunächst erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über die Zusammenarbeit zwischen Behandlern und Patienten und wie sich diese über die Jahrhunderte hinweg veränderte. Im Zuge dessen erfahren Sie Genaueres über den Aufbau von Patientengesprächen, die Funktionen der beiden Rollen sowie die Nutzen und Probleme, die sich aus der Arbeit mit Patienten ergeben. All dies stelle ich Ihnen aus den Perspektiven von Patienten, Behandlern und auch Außenstehenden vor.
Trotz hoher moralischer Ansprüche und der unbestreitbaren Bedeutung für die Gesellschaft zeigt dieser Teil auf, wie anfällig das Gesundheitssystem für Korruption ist. Dabei verdeutlichen brisante Fallbeispiele die positiven als auch negativen Seiten der Gesundheitsarbeit. Dieser Teil beschränkt sich jedoch nicht auf die Darstellung von Hintergründen und Ursachen. Er bietet auch konkrete Lösungsansätze für die angesprochenen Probleme. Diese Lösungsvorschläge sind für alle menschennahen Berufe gleichermaßen relevant.
Teil II: Patientengespräche im Arbeitsalltag
In Teil II begeben Sie sich mitten in den beruflichen Alltag von Heilberuflern. Schauen Sie sich im Vergleich zwischen Kliniken und Praxen an, wie Patientengespräche üblicherweise ablaufen, welche formellen Besonderheiten sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind und wer alles Einfluss auf den Kontakt zwischen Behandlern und Patienten nimmt. Denn bevor Patienten zum Beispiel einem Arzt oder Therapeuten begegnen, treffen sie auf weiteres Gesundheitspersonal, das eine wesentliche Rolle im Behandlungsprozess spielt. Deshalb erfahren Sie hier auch, wie Sie Ihre Mitarbeiter zur erfolgreichen Patientenarbeit motivieren.
Des Weiteren macht dieser Teil darauf aufmerksam, dass nicht nur der direkte Kontakt mit dem Patienten, sondern scheinbar nebensächliche, äußere Faktoren wie Kleidung, Räumlichkeiten und selbst Werbung ebenfalls zu seiner Erfahrung beitragen. Was Patienten gut finden und was nicht – all das lesen Sie hier.
Teil III: Grundlagen der Gesprächsführung
Teil III stellt Ihnen sowohl wichtige Grundlagen als auch vereinzelte wissenschaftliche Vertiefungen vier großer Kommunikationsarten vor: die verbale, die paraverbale, die nonverbale und die emotionale Kommunikation. Hier wird deutlich, dass Ausdrucksweise, Aussprache und andere sprachliche Fertigkeiten tatsächlich eher wenig über den Verlauf eines Gesprächs entscheiden. Um das Risiko von Missverständnissen oder Konflikten zu minimieren, müssen Sie daher all Ihre Kommunikationsmittel in einen möglichst stimmigen Einklang bringen.
Da man seine Kommunikation jedoch nicht allein beim Lesen verbessern kann, bietet Ihnen dieser Teil ein abwechslungsreiches Angebot an praktischen Anleitungen, um Ihre Fähigkeiten in bestimmten Schwerpunkten gezielt zu verbessern. Je effektiver Sie kommunizieren, desto zufriedener der Patient, und gleichzeitig können Sie Zeit sparen. Sie sehen: Es gibt mehr als einen Grund, um an seiner Gesprächsführung zu arbeiten.
Teil IV: Fettnäpfchen in Patientengesprächen
In Teil IV wird es besonders spannend! Hier finden Sie allerlei Besonderheiten, Gefahren, Probleme und Tabus, die Patientengespräche für Sie bereithalten. Daher vorab der Hinweis: Dieser Teil ist durchaus informativ, manche Kapitel aber auch besonders bewegend. In dem einen oder anderen Leser lösen sie möglicherweise starke Emotionen aus.
Durch die Vorstellung verschiedenster Patientengruppen einschließlich zahlreicher echter Fallbeispiele können Sie einen greifbareren Bezug zu den vielfältigen Problematiken herstellen. Ergänzend dazu finden Sie praxisnahe Tipps, wie Sie mit diesen höchst unterschiedlichen Patienten sowie Situationen zielführend umgehen, um eben mögliche Fettnäpfchen zu vermeiden.
Zur Überprüfung oder Vertiefung Ihres Verständnisses haben Sie hier die Möglichkeit, eine Reihe an Selbsttests durchzuführen – stellen Sie Ihr soziales Geschick auf die Probe! Das übergeordnete Ziel von Teil IV ist es, die eigenen Grenzen, die der Patienten und letztlich auch die der Behandlungsmöglichkeiten zu erkennen, sodass Sie ihnen entweder bewusst ausweichen oder sie bestenfalls erfolgreich überwinden.
Teil V: Patientengespräche praktisch angehen
Teil V ist gewissermaßen Ihre »Abschlussprüfung« vor der eigentlichen Patientenarbeit. Vollgepackt mit kreativen Tests, praktischen Tipps und unterhaltsamen Übungen, soll Ihnen dieser Teil spielerisch Wissen vermitteln. Einige der Aufgaben fordern Konzentration und Zeit – gehen Sie sie also am besten gemächlich beziehungsweise in Ihrem Tempo an.
Nicht nur fasst Teil V zusammen, was Sie bis hierhin gelernt haben, sondern bietet ebenfalls verschiedene Hilfestellungen, das Gelernte auf persönliche Weise zu verarbeiten. Schließlich sollen die Inhalte des Buches keine Gehirnwäsche sein, die alle Leser gleichschaltet. Im Gegenteil: Sie sollen Sie ermutigen, Ihren persönlichen Stil als Heilberufler beizubehalten, gegebenenfalls mit neuer Inspiration zu erweitern. Denn genau wie die Authentizität von Patienten zu fördern ist, ist auch die von Behandlern von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Ich hoffe, damit Ihre Neugier für diesen zugegebenermaßen aufwendigeren Teil geweckt zu haben, sodass Sie mit Offenheit ans Lernen herangehen! Schließlich soll dieses Buch kein trockener Lehrstoff, sondern ein lebensnaher Begleiter sein, um sowohl beruflich als auch persönlich zu wachsen.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Als überschaubares Nachwort ist Teil VI eine kompakte Ansammlung von inspirierenden Inhalten. Einerseits greift er die wichtigsten Einzelheiten der vorherigen Teile auf, andererseits stellt er Ihnen Interessantes sowie Wissenswertes vor, das Ihre grundsätzliche Sichtweise auf Patientengespräche bereichern soll: von nützlichen Hinweisen über alltagstaugliche Kommunikationsübungen bis hin zu Vorbildern. All dies dient dem Zweck, Ihnen zu einem klareren Bild davon zu verhelfen, wie Sie als Behandler mit Ihren Patienten umgehen möchten.
Bonuskapitel
Zusätztlich zu diesem gedruckten Buch stellen wir Ihnen einige Inhalte als Bonuskapitel online zur Verfügung: Dort machen Sie sich unter anderem die Aus- und Weiterbildung von verschiedenen Heilberufen vertraut – mit besonderem Augenmerk auf die Vorbereitung von Patientengesprächen versteht sich. Als angehender Behandler erfahren Sie, was Sie erwartet und wie Sie sich über Pflichtprogramme hinaus weiterbilden. Als bereits praktizierender Behandler können Sie vergleichen, was sich seit Ihrer Ausbildung verändert hat und welche Bildungsangebote Sie vielleicht noch nachholen möchten. Lernen Sie auch, welchen Einfluss Ihre scheinbar nebensächlichen Entscheidungen auf Ihre Patientengespräche nehmen – zum Beispiel zur Wahl Ihrer Kleidung oder zur Raumgestaltung. Was Patienten von ihren Behandlern erwarten, was Behandler von ihren Patienten erwarten und wie sich diese Haltungen wiederum auf die gemeinsame Arzt-Patientenbeziehung auswirkt, all das finden Sie hier.
Die Bonuskapitel finden Sie hier: https://www.wiley-vch.de/ISBN9783527720835
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Das Symbol »Achtung« sollten Sie nicht überspringen! Denn hier finden Sie wichtige Hinweise zu ethischen sowie gesetzlichen Fallen, um Sie vor Grenzüber schreitungen zu schützen.
Das Symbol »Beispiel« verweist auf Fall- und Patientenbeispiele, die das jeweilige Thema praxisnah veranschaulichen.
Das Symbol »Definition« eignet sich für Leseratten und Theoretiker, alle anderen können es überspringen, ohne Wesentliches zu verpassen. Hier stoßen Sie auf Worterläuterungen samt etwas Hintergrundwissen.
Das Symbol »Erinnerung« greift entweder zuvor Gelesenes auf oder erinnert an allgemein Bekanntes. Hin und wieder das Gedächtnis aufzufrischen, schadet nicht.
Das Symbol »Studie« stellt Ihnen Forschungen, Studien, Statistiken, Umfragen und andere Erhebungen vor. Zusammengefasst finden Sie hier Fakten, die den behandelten Sachverhalt ergänzen.
Das Symbol »Tipp« weist auf hilfreiche Tipps zur Verbesserung Ihrer Gesprächsführung mit Patienten hin.
Das Symbol »Übung« leitet praktische Übungen ein, für die Sie tatsächlich aktiv werden, also mehr als nur lesen müssen.
Das Symbol »Hintergrundwissen« eignet sich für Leseratten und Theoretiker, alle anderen können es überspringen, ohne Wesentliches zu verpassen. Fakten, Historisches, Konventionen, Theorien – hier erhalten Sie zusätzliche Auskünfte und tiefgehende Erläuterungen, um die behandelten Inhalte zu vertiefen.
Wie es weitergeht
Jedes Patientengespräch ist bis zu einem gewissen Grad einzigartig. Deshalb lässt es sich nicht eins zu eins mit dem vorherigen oder nächsten vergleichen. Dennoch kann man selbst aus einzigartigen Erfahrungen allgemeinnützliches Wissen ziehen und auch Gemeinsamkeiten zu weniger besonderen Situationen erkennen.
Nochmals zur Erinnerung: Anhand der Einleitung und des Inhaltsverzeichnisses dürfen Sie gern selbst entscheiden, welche Überschriften für Sie von Bedeutung sind und welche Sie überspringen. Jedes Kapitel enthält nützliche Auskünfte, die nicht zwangsläufig Vorkenntnisse aus vorherigen Teilen erfordern. Sie brauchen das Buch somit nicht von vorne nach hinten zu lesen.
Einige Fallschilderungen mögen überspitzt wirken, wahrscheinlich sogar emotional berühren. Ich möchte niemanden verurteilen oder ihm gar vorschreiben, wie er seinen Beruf »richtig« auszuüben hat. Letztlich sollen die Inhalte dieses Buches schlicht zur Verbesserung von Gesprächen anregen. Ich glaube daran, dass »Patientengespräche führen für Dummies« einen solchen Denkanstoß liefern kann, und wünsche viel Inspiration als auch Spaß beim Lesen!
Teil I
Keine Patientengespräche ohne Arzt-Patienten-Beziehung
IN DIESEM TEIL …
beginnen Sie mit dem Ausgangspunkt für alle weiteren Inhalte des Buches. Bevor Sie sich mit gezielten Übungen zum erfolgreichen Führen von Patientengesprächen auseinandersetzen, stelle ich Ihnen zunächst allgemeinere Rahmenbedingungen sowie einige Besonderheiten von Patientengesprächen vor. Hier lernen Sie die gesellschaftlichen Normen kennen, die den direkten oder auch indirekten Kontakt zwischen Behandler und Patienten im Laufe der Zeit geprägt haben. Gesellschaft, Politik und Wirtschaft beeinflussen zunehmend stärker, was Behandler und Patient voneinander erwarten und wie sie letztlich miteinander umgehen. Was davon als Chance und Nutzen, was als Risiko und Schaden zu betrachten ist, hängt im Wesentlichen von der Einstellung des Behandlers und der seines Patienten ab.
In kritischen Gegenüberstellungen von anerkannten Forschungsergebnissen und persönlicheren Fallbeispielen erfahren Sie, welche Sichtweisen die Betroffenen zu ihrer Zusammenarbeit vertreten. Aus diesen unterschiedlichen Erwartungen an den jeweils anderen ergeben sich nicht selten Konflikte. Denen können Sie durchaus gezielt vorbeugen oder ebenso zielbewusst in der Situation entgegnen. So gewährleisten Sie den Erfolg Ihrer Arzt-Patienten-Beziehung.
Kapitel 1
Alles beginnt mit der Arzt-Patienten-Beziehung
IN DIESEM KAPITEL
Behandler und Patienten arbeiten gemeinschaftlichGesellschaftliche und persönliche Vorstellungen von Arzt-Patienten-Beziehungen ändern sichPatienten zuzuhören, spart auf Dauer ZeitDie Voraussetzung für jedes Patientengespräch bildet die Arbeit zwischen Behandler und Patient – die sogenannte »Arzt-Patienten-Beziehung«. Obwohl sie sich seit Anbeginn der Medizingeschichte fortlaufend weiterentwickelt, blieben gewisse Erwartungen sowie Werte stets gleich: So wurde der Austausch von allein medizinischen Inhalten bereits in der Antike nicht als einzig sinnige Aufgabe eines Behandlers (an-)erkannt. Neben einem hohen Maß an Verantwortung forderte man sprachliches sowie zwischenmenschliches Geschick im Umgang mit Patienten von ihm. Der Kranke galt dagegen als unwissender Schützling, dessen leibliches sowie seelisches Wohlergehen unter allen Umständen zu fördern sei.
Die Arbeit eines jeden Behandlers kann nicht ohne den Kontakt zum Patienten erfolgen. Je nach Anlass verlaufen Patientengespräche unterschiedlich – manche kurz, routiniert und sachlich, andere hingegen anspruchsvoller, ausgiebiger und persönlicher.
Die Arzt-Patienten-Beziehung im Wesentlichen
Beschränkt man den Begriff »Arzt-Patienten-Beziehung« auf das Wortwörtliche, so betitelt er am ehesten eine der gängigsten Umgangsformen innerhalb des Gesundheitswesens: die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patienten. Arzt-Patienten-Beziehungen bezeichnen allerdings nicht ausschließlich die Tätigkeit von Ärzten, sondern schließt ebenfalls die von Behandlern aus anderen Gesundheitsberufen ein. Da die kurze Begriffserläuterung noch nicht erklärt, was den Kontakt zwischen einem Fach- und Nichtkundigen ausmacht, schauen Sie sich dazu einige der vielen komplexen Bausteine näher an, aus denen er sich zusammensetzt:
Eine sich ergänzende Rollenverteilung, in der der Heilberufler den Hilfe suchenden Laien berät und behandelt.
Patientengespräche machen den Hauptanteil der Zusammenarbeit aus.
Beide Parteien treffen persönliche Entscheidungen, bei denen Sachlichkeit wie auch Zwischenmenschlichkeit von Bedeutung sind.
Aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung wird dem Behandler eine größere Entscheidungsberechtigung sowie Verantwortlichkeit zugesprochen.
Kulturelle, ökonomische, soziale, technische und wissenschaftliche Einflüsse geben der Zusammenarbeit sich stetig wandelnde Rahmenbedingungen vor.
Sowohl individuelle als auch kollektive Vorstellungen wirken sich fortlaufend auf die Zusammenarbeit von Gesundheitsanbietern und Hilfesuchenden aus. So hat sich der Informationsstand der Patienten seit dem Zugang zum Internet oder zu Selbsthilfegruppen maßgebend verändert. Gleichzeitig erwarten sie mehr Kundenorientierung und fassen die Behandlung mittlerweile vielmehr als Dienstleistung auf. Solche Dienstleistungen können je nach Beruf oder Fachgebiet folgendermaßen aussehen:
Ausstellung von Anträgen, Attesten, Rezepten und Ähnlichem
Begleitung und Hausbesuche
Ein- und Überweisungen zu Kliniken, Praxen oder anderen Versorgungseinrichtungen
Fachkundige therapeutische Aufklärung sowie Behandlungen
Kontaktaufnahme zu beziehungsweise Vermittlung an Weiterbehandler
Pflegerische Anwendungen
(Video-)telefonische Beratungen
Die Dienstleistung einschließlich des daran gebundenen Patientengesprächs richtet sich vorrangig nach dem Anliegen des Patienten; beispielsweise erfordert die Betreuung von noch unbekannten Besuchern eine weitaus tiefer gehende Gesprächsführung und damit ebenfalls mehr Zeit als die einfache, rein formelle Ausstellung von Wiederholungsrezepten für bereits bekannte Patienten.
Grundsätzlich wird der Arzt-Patient-Beziehung ein erheblicher Einfluss auf den Krankheitsverlauf, Gesundungswillen sowie Behandlungserfolg zugeschrieben: Kooperiert ein Patient nicht, können therapeutische Maßnahmen erfolglos bleiben. Daher ist eine wichtige Aufgabe des Behandlers, neben treffenden Diagnosen zu stellen und passenden Therapien durchzuführen, seinen Patienten zur Behandlungstreue anzuspornen. Wie sich die Beziehung langfristig entwickelt, hängt größtenteils von Gesprächen ab. Dabei nehmen beide Parteien mit ihren teils unbewussten Vorstellungen gleichermaßen Einfluss auf das Geschehen.
Im Vergleich: Gute und schlechte Arzt-Patienten-Beziehungen
Letztlich gibt es nicht die eine Definition davon, wie eine gute oder schlechte Arzt-Patienten-Beziehung tatsächlich aussieht. Dennoch lassen sich gewisse Erkennungsmerkmale erfassen, die in unserer Gesellschaft weitreichend übereinstimmend bewertet werden (siehe Tabelle 1.1).
Der Behandler verhält sich gut, wenn er
den Wert anderer Heilberufe und deren Anteil an der Behandlung anerkennt.
die emotionalen Bedürfnisse des Patienten erkennt und darauf eingeht.
ehrliches Interesse daran zeigt, dass sich Patienten am Behandlungsort wohlfühlen.
vor- als auch nachbereitend Einfluss auf den respektvollen Umgang der Mitarbeiter mit Patienten nimmt.
Verantwortung für all seine Handlungen und die seiner Belegschaft übernimmt, anstatt sich mit Ausflüchten zu winden.
Der Patient verhält sich gut, indem er
erst mal mit einem Ansprechpartner arbeitet, anstatt regelmäßig neue aufzusuchen.
dem Behandler sowie dessen Mitarbeiter wertschätzend begegnet.
den Behandlungsort ordentlich, sauber und ohne Störungen der Abläufe verlässt.
die Klinik oder Praxis unvoreingenommen oder zumindest mit realistischen Erwartungen betritt.
Rücksicht auf die Grenzen, das Wohlbefinden und die Zeit aller am Behandlungsort Anwesenden nimmt.
Der Behandler verhält sich schlecht, wenn er
aufgrund seiner mangelhaften Fähigkeiten in der Gesprächsführung fehlerhafte Diagnosen und Therapien stellt.
Behandlungen und Untersuchungen wortlos ohne Erklärungen durchführt.
dem Handeln seiner Mitarbeiter gleichgültig gegenübersteht.
die unzureichende Fachkenntnis des Patienten übergeht.
Patienten wegen Antipathien, Sympathien oder auch des Versicherungsstatus unterschiedlich gewissenhaft versorgt.
Der Patient verhält sich schlecht, indem er
den Behandler durch zweifelhaft eigennützige Bitten beziehungsweise Forderungen in Gewissenskonflikte bringt.
den Behandler für unerfüllte Wünsche mit einer schlechten Bewertung bestraft.
Internetrecherchen über das Können und Wissen des Heilberuflers stellt.
sich nicht eigenverantwortlich an seiner Genesung beteiligt.
ungeachtet jeglicher Nachteile für die Mitarbeiter oder andere Patienten die Zeit des Behandlers vereinnahmt.
Tabelle 1.1: (Un-)angemessene Verhaltensweisen von Behandlern und Patienten
Ob Behandler oder Patient – jeder hat eine eigene Meinung dazu, was in Patientengesprächen sinnvoll ist und was nicht. Nicht selten unterscheiden sich die Sichtweisen dazu voneinander. Doch sobald ein Behandler selbst die Rolle des Patienten einnimmt, kann sich seine Haltung mit dem Rollenwechsel verändern. Andersherum genauso.
Erkennungsmerkmale einer guten Arzt-Patienten-Beziehung
Hier finden Sie zunächst allgemeinere Gesichtspunkte, die als bereichernd beziehungsweise vorteilhaft für das Verhältnis zwischen Behandlern und Patienten gelten:
Aneinander angepasstes Sprachniveau und den anderen aussprechen lassen
Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
Die eigene, möglicherweise negative Stimmung nicht am anderen auslassen
Die Gesundheit steht über Einnahmen oder Kosten
Einladende Räumlichkeiten
Einvernehmliche, nicht eigennützige oder rücksichtslose Zielsetzungen
Gemeinschaftliche Zusammenarbeit sowie Respekt füreinander
Gleichwertige Betrachtung des anderen
Grundsätzliches Interesse an der Verbesserung der Umstände
Individuell an den Patienten ausgerichtete Diagnostik und Therapie
Keine bis wenig Hemmungen, aufwühlende Gesprächsinhalte anzusprechen
Offenheit, Kritikfähigkeit und Lösungsorientierung
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, kein spürbarer Zeitdruck
Sympathie und gleichzeitig eine gute fachliche Qualität
Therapietreue und -erfolg
Unaufdringlichen Blickkontakt halten
Verständnis für und Vertrauen in den anderen
Vertraulicher Umgang mit dem Besprochenen
Einige der hier aufgezählten Punkte mögen Ihnen als selbstverständlich erscheinen. Doch scheitert es leider oft an ihrer Umsetzung beziehungsweise Einhaltung.
Erkennungsmerkmale einer schlechten Arzt-Patienten-Beziehung
Sehen Sie die folgenden Stichpunkte als ernst zu nehmende Warnzeichen dafür an, dass sich Grundlegendes an der Beziehung zwischen Behandlern und Patienten zum Positiven verändern sollte.
Den anderen mit Problemen belasten, die ihn nicht betreffen
Die Absicht, den anderen beziehungsweise die Zusammenarbeit auszunutzen
Kein Einfühlungsvermögen oder Verständnis für die Lage des anderen
Keine Einigkeit beziehungsweise nur schwer zu vereinbarende Erwartungshaltungen
Keinerlei Verständnis oder Wertschätzung für den anderen
Mangelnder Respekt
Romantische und/oder sexuelle Absichten
Ungemütliche Räumlichkeiten
Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit
Unüberwindbare Sprachbarrieren
Vertreten eigennütziger Interessen, insbesondere zulasten des jeweils anderen
Wenig Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
Wiederholte Missverständnisse
Zu hohes wirtschaftliches Interesse; der Patient möchte um jeden Preis Geld sparen, der Behandler möglichst hohe Einnahmen erzielen
Zu wenig Sachlichkeit, kein Spielraum für konstruktive Ideen und/oder Kritik
Zulassen von Ablenkungen und Unterbrechungen während der Besprechung
Nun haben Sie einige der wesentlichen Merkmale von »guten« sowie »schlechten« Arzt-Patienten-Beziehungen aus gesellschaftlicher Sicht kennengelernt.
Fotografieren, kopieren Sie die beiden Auflistungen oder nehmen Sie das ganze Buch mit zu Ihrem Arbeitsplatz. Dort vergleichen Sie dann, welche der Punkte auf Ihre Patientenarbeit zutreffen. Entscheiden Sie anschließend, was Sie beibehalten oder verändern möchten.
Keine Arzt-Patienten-Beziehung ohne Patientengespräche
Patientengespräche finden üblicherweise in folgender Form statt:
Alltags- und Arbeitsgespräche
Gedankenaustausche
Ab- und Aufklärungen
Konfliktgespräche
Auseinandersetzungen
Persönliche sowie wissenschaftliche Erfahrungsberichte
Diskussionen
Problem-Lösungsgespräche
Frage-Antwort-Sequenzen
Sachbezogene Kurzgespräche
Im Zuge von Digitalisierung und Globalisierung verändern sich Bedürfnisse und Gewohnheiten. Das wirkt sich auf Patientengespräche aus. So nehmen einige Patienten gerne (Video-)Telefonate oder andere digitale Kommunikationsformen für den Kontakt mit ihren Behandlern in Anspruch. Diese dürfen allerdings nicht den direkten, persönlichen Kontakt vollständig ersetzen.
Nach den auf medizinische Psychologie spezialisierten Wissenschaftlern Julian Bird und Steven Arthur Cohen-Cole haben Patientengespräche auch unabhängig vom persönlichen Anliegen des Hilfesuchenden grundsätzlich diese Ziele zu verfolgen:
Eine Beziehung aufbauen, beibehalten und erfolgreich abschließen
Die Ursachen des Problems ermitteln und dessen Verlauf überwachen
Behandlungspläne anfertigen und Informationen vermitteln
Egal, wie fordernd der Umgang mit einigen Patienten auch sein sollte, der berufliche Erfolg des Behandlers hängt nicht unwesentlich vom Erfolg seiner einzelnen Gespräche ab. Mit »Gesprächen« ist nicht gemeint, dass ein Patient nur schnell ein Rezept verschrieben bekommt und am besten noch schneller die Praxis wieder verlässt; selbst oder gerade mit Stammpatienten sollten Sie sich regelmäßig gründlicher unterhalten. Denn im Alltagstrott können Sie so manches übersehen.
Für den Behandler sind Patientengespräche sachlicher Teil seiner Arbeitsroutine. Für den Patienten sind sie wiederum eher seltenere, persönliche Erfahrungen, von denen er sich Unterstützung zu seinem Problem verspricht. Obwohl er mit seinem Anlass zur Kontaktaufnahme gewisse Rahmenbedingungen vorgibt, sollten bestimmte Abläufe und Ziele stets erfüllt oder zumindest beachtet werden: Zum einen erfordert jede Begegnung vom Behandler, pauschale Vorgaben einzuhalten, zum anderen soll er sich anpassungsfähig, flexibel auf Individuen einlassen. Das ist nicht immer eine einfach zu bewältigende Herausforderung. Eine geübte Ausdrucksweise samt Körpersprache reicht dafür nur teilweise. Bedürfnisse und Erwartungen zu kennen, der Ruf des Arbeitsplatzes und selbst die Wahl der eigenen Kleidung tragen indirekt zum Gesprächsverlauf bei.
Patientengespräche früher und heute
Vorstellungen von der Arzt-Patienten-Beziehung sind vermutlich ebenso alt wie die Medizin selbst. Im Laufe der Geschichte wurde das Verhältnis zwischen Arzt und Patient wiederholt neu diskutiert und entsprechend definiert – so auch heute. Dafür ist nicht nur die wissenschaftliche Entwicklung der Medizin, sondern sind ebenfalls kulturelle und rechtliche Reformen verantwortlich. So setzen regelmäßig überarbeitete Gesundheitskonzepte zusammen mit den zeitgenössischen Forderungen der Gesellschaft immer wieder neue Maßstäbe; die Vorstellungen von einer gelungenen Zusammenarbeit sind demnach stark von den Normen einer Epoche abhängig.
Patientengespräche in der Antike
Etwa 460 – 370 vor Christus soll Hippokrates geistige sowie körperliche Hygiene, analytisches Denken, Empathie und persönliche Integrität vom Mediziner gefordert haben. Er sah ihn in der Verantwortung, alle therapeutischen Handlungen auf sorgfältige Beobachtung, Befragung als auch interaktiver Untersuchung zu stützen. Hippokrates' Definition der ärztlichen Tätigkeit machte den Behandler zum nahezu Alleinverantwortlichen für den Verlauf von Patientengesprächen. Auf seinen Wertvorstellungen beruht der »Hippokratische Eid«, der fast 2000 Jahre als berufliche Richtlinie für Mediziner galt.
Patientengespräche in der Nachkriegszeit
1948 löste das Genfer Gelöbnis den Eid des Hippokrates ab, der als symbolische, traditionelle Vorlage diente. Das Gelöbnis hielt fest, dass
das Wohl des Kranken
die Abwendung von Schaden
die Erhaltung des Lebens
die Würde des Menschen
Vertrauenswürdigkeit
unter allen Umständen vom Mediziner zu wahren sei. Darüber sollte es eine hochwertige, menschenwürdige Versorgung von Patienten sichern. Warum war das notwendig? Einerseits galt es, veraltete Regelungen an den Zeitgeist anzugleichen: Zum Beispiel war Ärzten das operative Entfernen von Blasensteinen ursprünglich untersagt und stattdessen ausschließlich Steinschneidern vorbehalten. Mit dem Beruf des Urologen wurde dieses Verbot jedoch hinfällig. Andererseits gaben zu viele an die Öffentlichkeit herangetragene Beschwerden über Ärzte, die ihre Macht sowie besondere gesellschaftliche Stellung missbrauchten, einen weiteren Anlass zur Verschärfung der Richtlinien.
Mit jeder Anpassung des Arzt-Patienten-Verhältnisses veränderten sich die Bedingungen für eine angemessene Gesprächsführung: Hatte der Patient zuvor noch die vermeintlich willkürlichen Entscheidungen seines Behandlers ohne jegliche Beanstandungen oder gar Zweifel hinzunehmen, wurde nun auch seine Vorstellung stärker berücksichtigt. Folglich gewann neben dem körperlichen nun auch das seelische Wohl der Patienten an höherem Stellenwert.
In den 1950ern erwartete der amerikanische Soziologe Talcott Parsons vom Mediziner, dass er die Entscheidung über krank und gesund fällt. Zudem sollte er jeden Menschen gleichermaßen fachlich kompetent und menschenfreundlich therapieren. Dies schließe sowohl Krankheitsvor- und -nachsorge als auch die emotionale, soziale Versorgung ein. Die Rolle des Patienten sah Parsons eher gegensätzlich zu der des Behandlers: Der Kranke wurde aufgrund seines Zustands von gewissen Verantwortlichkeiten entbunden, solange er zumindest einen klaren Willen zur Gesundung zeige.
Patientengespräche in der (Post-)Moderne
In den 1980er-Jahren wurde das seither bestehende Ungleichgewicht in der Rollen- sowie Verantwortlichkeitsverteilung kritisch hinterfragt – jedoch nicht ausschließlich zugunsten der Patienten. Auch Behandlern widerfuhren nun Zugeständnisse. So legte der Soziologe Johannes Siegrist neue Kriterien für die Zusammenarbeit innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung fest:
Behandler sind weder alleinmachende Reparateure noch anordnende Vormunde.
Ethische Grenzen sind zu wahren und soziale Ungleichheit zu verringern.
Kranke sind über Beratungen zur Mitarbeit zu ermuntern.
Therapeutische Grenzen und Möglichkeiten sind ausdrücklich zu besprechen.
War der Mediziner ursprünglich noch Ermittler, Moderator und Richter in einem, solle er heute als gleichberechtigter Partner mit dem Patienten zusammenarbeiten. Mit dem neuen Maß an Mitbestimmung wuchs ebenso die Mitverantwortung des Kranken für seinen Behandlungserfolg.
Vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Gesundheitsversorgungssystem in Deutschland erheblich verändert: Durch die Fortschritte in der Medikamentenentwicklung und Medizintechnologie, die zwar auch aus wirtschaftlichem Interesse vorangetrieben werden, haben sich Behandlungsmöglichkeiten enorm vervielfacht. Nicht nur können schwerwiegende oder bislang unerkannte Krankheiten weitreichender untersucht sowie therapiert werden, darüber hinaus sind die neuen Maßnahmen und Mittel nun zugänglicher für viele Menschen. Zusätzlich sorgen gesellschaftliche Bewegungen wie Reformen im Bildungswesen und die Gleichstellung der Frau für noch mehr Vielfalt in Arzt-Patienten-Verhältnissen. Da eine Vielzahl von Heilberuflern ihre Arbeitsbedingungen seit Langem beklagt, sollen die angestrebten Verbesserungen gleichermaßen Patienten wie Behandlern zugutekommen.
Das Märchen vom Mediziner im Wunderland
Es war einmal ein Kaninchen im weißen Kittel, das jeden seiner Patienten täglich fragte: »Na, wie geht es uns denn heute?« – dürftige Witze über Mediziner und ihre Gesprächsführung gibt es zu Genüge. Doch leider sind einige dieser Witze widersinnige Wirklichkeit. Über verschiedenste Medien beklagen Patienten immer wieder, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen. Stattdessen würden sie von ihren Behandlern unter Druck gesetzt. Derartige Beschwerden finden Sie in allen sozialen Schichten sowie Teilen der Welt – auch in Ihrem Umfeld. Der am häufigsten genannte Grund für eine unzureichende Patientenversorgung: keine Zeit.
Noch vor allem anderen sollte ein Behandler im Termin mit seinem Patienten eines tun: Zuhören. Denn ohne zureichendes Verständnis von Hintergründen und Zusammenhängen kann keine treffende Diagnose, geschweige denn Behandlung folgen.
Studienergebnisse aus Deutschland und Österreich zeigen, dass Patienten beim Arztbesuch schon nach durchschnittlich 15 Sekunden unterbrochen werden. In 50 Prozent der Fälle wendet sich der Behandler sogar vom Gegenüber ab, indem er Nebentätigkeiten ausführt, wie die Karteikarte zu lesen oder den Computer zu bedienen. Prof. Ulrich Schwantes vom Hausärzteverband Brandenburg leitete eine ähnliche Studie, in der 500 Patientengespräche näher untersucht wurden. Deren Auswertung ergab, dass die Hilfesuchenden ihr Anliegen höchstens 90 Sekunden lang schildern durften, in der Regel aber schon weitaus früher unterbrochen wurden – viele Mediziner redeten ihren Patienten schon nach 10 bis 20 Sekunden dazwischen (siehe Abbildung 1.1).
Abbildung 1.1: Redezeit von Patienten
Als die Behandler ihre Gespräche selbst einschätzen sollten, gaben sie an, ihren Patienten bis zu drei Minuten zugehört zu haben. Tatsächlich dauerten aber nur wenige der Gespräche überhaupt insgesamt 150 Sekunden.
Zweifelsohne stellt dies nicht mehr als eine Stichprobe dar. Dennoch bestätigen derartige Untersuchungen, dass die subjektive Zeitwahrnehmung von der tatsächlich vergangenen Zeit stark abweichen kann.
Reden ist Silber, Zuhören ist Gold
Medizinische Ausbildungen werden grundlegend immer differenzierter und weitreichender. Dennoch bleibt die Förderung von dialogischen und psychosozialen Fähigkeiten dabei nicht selten auf der Strecke.
Ein Wiener Feldversuch prüfte, ob Mediziner zunächst 60 Sekunden am Stück zuhören können. War dies der Fall, stieg die Zufriedenheit der Hilfesuchenden nachvollziehbar an. Ein Drittel der Patienten gab an, dass sie sich durch ihren Behandler ausreichend aufgeklärt fühlten; die anderen zwei Drittel kritisierten, dass sie nur etwa die Hälfte der Auskünfte zur Diagnose und Therapie verstanden, wovon sie wiederum nochmals die Hälfte nach etwa 30 Minuten vergaßen. So konnten sie sich letztlich nur einen Bruchteil des Patientengesprächs merken (siehe Abbildung 1.2).
Abbildung 1.2: Aufklärungsdefizit in Patientengesprächen
Mangelhafte Kommunikation hat Nachteile für die persönliche Befindlichkeit des Patienten, seinen Behandlungsverlauf und letztlich für die gesamte Arzt-Patienten-Beziehung. Aufgrund des eher unaufmerksamen Zuhörens ziehen Behandler nämlich fälschliche Schlüsse, die dann zu Fehldiagnosen als auch entsprechenden Fehlbehandlungen führen. Auch die von Behandlern oft beklagte fehlende Therapietreue ist nach Studien auf die verbesserungswürdige Arzt-Patienten-Kommunikation zurückzuführen. So sollen sich weniger als die Hälfte der Patienten an therapeutische Anordnungen halten.
Neben dem Wunsch nach Behandlung ist ein Hauptanliegen der Patienten, von ihrem Behandler ernst genommen zu werden. Wird die anfängliche Auskunftsbereitschaft des Patienten zu früh unterbrochen, kann nur schwer Vertrauen geschaffen werden und keine sachgerechte Anamnese erfolgen.
Behandler in der Zwickmühle
Die beklagte Ungeduld der Behandler macht die Begegnung nicht nur für Patienten zu einer unschönen Erfahrung. Sie verdeutlicht ebenfalls, wie stark die Heilberufler unter Druck stehen. Aufrufe, Demonstrationen, Streiks und Umfragen zeigen, dass auch sie mit ihren Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben. So sind mangelhafte Patientengespräche einerseits durchaus der hohen Arbeitsbelastung der Behandler samt der fehlenden Zeit geschuldet. Andererseits richten Patienten vermehrt zu hohe, beinahe unerfüllbare Erwartungen an das Gesundheitspersonal.





























