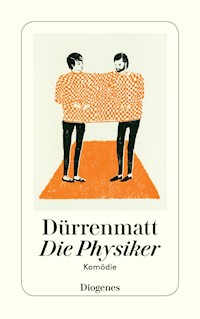14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Anhand von vier Gedichten und einem Prosatext untersucht Hermann Burger zentrale Motive und Chiffren Celans, wobei zahlreiche Querverweise auf andere Werke der Sicherung und Konkretion der Deutung dienen. Burger zeigt, daß zwar Celan sich in einer geschlossenen Sprachwelt bewegt, die mit dem höchsten Anspruch erbaut ist, auch noch das Unsagbare wenigstens zu berühren – daß aber diese Sprachwelt zugleich über einem Abgrund tiefer Sprachskepsis schwebt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Ähnliche
Hermann Burger
Paul Celan
Auf der Suche nach der verlorenen Sprache
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorwort
Diese Studie bemüht sich um das Verständnis der Sprach- und Gestaltungsproblematik, wie sie im Werk Paul Celans in Erscheinung tritt. Während in den Gedichtbänden Mohn und Gedächtnis und Von Schwelle zu Schwelle die Thematisierung des kreativen Prozesses eine wichtige Rolle spielt, auch dort, wo nicht explizit vom »Wort« die Rede ist, stoßen wir von der Sammlung Sprachgitter an immer häufiger auf Texte, welche ihre Sprachlichkeit reflektieren und das Ungenügen des Dichters an der gefundenen Form zum Ausdruck bringen. Wir beschränken uns auf fünf Einzelinterpretationen. Den drei Gedichten Umsonst …, Die Winzer und Mit wechselndem Schlüssel aus der Frühzeit stellen wir zwei Beispiele aus der späteren Periode gegenüber: die Prosadichtung Gespräch im Gebirg und Weggebeizt … aus dem Band Atemwende, halten uns aber beim Aufbau der Arbeit nicht an die chronologische Reihenfolge, da sich das Thema am besten anhand des Prosastückes exponieren läßt.
Die ausgewählten Texte sollen indessen nicht bloß als Illustration einer Theorie der Celanschen Sprachskepsis dienen. Im Vordergrund steht in jedem der fünf Abschnitte die Interpretation des in sich geschlossenen Kunstwerks. Wir gehen so vor, daß wir zur Erhellung der einzelnen Motive und Chiffren jeweils möglichst viele Parallelstellen zu Rate ziehen, ohne freilich zu glauben, daß es angebracht wäre, einen Katalog von Schlüsselwörtern zusammenzustellen und das Unbekannte mechanisch auf Bekanntes zurückzuführen. Der Sinn des synoptischen Verfahrens liegt vielmehr darin, zu zeigen, wie konsequent sich dieser Dichter an das von ihm errichtete Zeichen-System hält. Eine Dichtung Paul Celans kann nur verstehen, wer sich die Mühe nimmt, sie Wort für Wort aus dem Kontext des Gesamtwerks herauszuschälen.
Der Titel dieser Studie bedarf einer kurzen Erläuterung. Er ist nicht in dem Sinne gemeint, daß Paul Celan die reine, aus dem Schweigen heraus geborene Sprache, auf die seine Dichtung zuhält, einmal besessen habe. Wie vor allem das Gespräch im Gebirg und das Gedicht aus der Atemwende deutlich werden lassen, handelt es sich dabei eher um eine utopische »Ursprache«, die freilich zum Vorbild für die dichterische Zeichensprache wird, weil ihre Gültigkeit in der Identität von Wort und Ding verbürgt ist. An ihr versucht sich Celan zu orientieren. Er sagt in der Büchner-Preis-Rede:
»Das absolute Gedicht – nein, das gibt es gewiß nicht, das kann es nicht geben!
Aber es gibt wohl, mit jedem wirklichen Gedicht, es gibt, mit dem anspruchslosesten Gedicht, diese unabweisbare Frage, diesen unerhörten Anspruch.« (Me 145)
Die vorliegende Interpretation fragt danach, in welcher Weise der »unerhörte Anspruch« die formale und die inhaltliche Struktur der Prosa und der Verse bestimmt, wie sich das paradoxe Unterfangen, sprechend zu verstummen, auf die Gestalt von Celans Dichtung auswirkt.
Dabei dürfen wir nicht vergessen, aus welchem Raum der Dichter stammt. Paul Anczel – so hieß er mit dem bürgerlichen Namen – wurde 1920 als Sohn deutsch-jüdischer Eltern in Czernowitz (Bukowina) geboren. Es ist die Landschaft, »in der ein nicht unbeträchtlicher Teil jener chassidischen Geschichten zu Hause war, die Martin Buber uns allen auf deutsch wiedererzählt hat« (Br 127), bekennt er in der Bremer Rede. Celans Dichtung ist in der mystischen Tradition der Chassidim verwurzelt, aber auch gezeichnet von der bitteren Erfahrung der totalen Sprach-Pervertierung nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Eltern des Dichters wurden 1942 in ein Vernichtungslager deportiert. Der Sprachverlust, der Rückzug ins Schweigen hängt eng mit dem persönlich erlittenen Judenschicksal zusammen. Ein »furchtbares Verstummen« (Br 128) ist die Antwort auf die Greueltaten, die am jüdischen Volk begangen worden sind. Erst nachdem die Sprache die Vernichtung sozusagen am eigenen Leib erfahren hat, darf sie verwandelt wieder zutage treten. Wenn wir die utopische Richtung dieser Dichtung bestimmen wollen, müssen wir den biographischen Ausgangspunkt miteinbeziehen. Paul Celan ist auf der Suche nach einer Sprache, die der schrecklichen Erfahrung aus der Zeit, da es ihm »den Atem und das Wort« (Me 141) verschlagen hat, gewachsen wäre.
1 Der Weg zum Ursprung
Eines Abends, die Sonne, und nicht nur sie, war untergegangen, da ging, trat aus seinem Häusel und ging der Jud, der Jud und Sohn eines Juden, und mit ihm ging sein Name, der unaussprechliche, ging und kam, kam dahergezockelt, ließ sich hören, kam am Stock, kam über den Stein, hörst du mich, du hörst mich, ich bin’s, ich, ich und der, den du hörst, zu hören vermeinst, ich und der andre, – er ging also, das war zu hören, ging eines Abends, da einiges untergegangen war, ging unterm Gewölk, ging im Schatten, dem eignen und dem fremden – denn der Jud, du weißt’s, was hat er schon, das ihm auch wirklich gehört, das nicht geborgt wär, ausgeliehen und nicht zurückgegeben –, da ging er also und kam, kam daher auf der Straße, der schönen, der unvergleichlichen, ging, wie Lenz, durchs Gebirg, er, den man hatte wohnen lassen unten, wo er hingehört, in den Niederungen, er, der Jud, kam und kam.
Kam, ja, auf der Straße daher, der schönen.
Und wer, denkst du, kam ihm entgegen? Entgegen kam ihm sein Vetter, sein Vetter und Geschwisterkind, der um ein Viertel Judenleben ältre, groß kam er daher, kam, auch er, in dem Schatten, dem geborgten – denn welcher, so frag und frag ich, kommt, da Gott ihn hat einen Juden sein lassen, daher mit Eignem? –, kam, kam groß, kam dem andern entgegen, Groß kam auf Klein zu, und Klein, der Jude, hieß seinen Stock schweigen vor dem Stock des Juden Groß.
So schwieg auch der Stein, und es war still im Gebirg, wo sie gingen, der und jener.
Still war’s also, still dort oben im Gebirg. Nicht lang war’s still, denn wenn der Jud daherkommt und begegnet einem zweiten, dann ist’s bald vorbei mit dem Schweigen, auch im Gebirg. Denn der Jud und die Natur, das ist zweierlei, immer noch, auch heute, auch hier.
Da stehn sie also, die Geschwisterkinder, links blüht der Türkenbund, blüht wild, blüht wie nirgends, und rechts, da steht die Rapunzel, und Dianthus superbus, die Prachtnelke, steht nicht weit davon. Aber sie, die Geschwisterkinder, sie haben, Gott sei’s geklagt, keine Augen. Genauer: sie haben, auch sie, Augen, aber da hängt ein Schleier davor, nicht davor, nein, dahinter, ein beweglicher Schleier; kaum tritt ein Bild ein, so bleibt’s hängen im Geweb, und schon ist ein Faden zur Stelle, der sich da spinnt, sich herumspinnt ums Bild, ein Schleierfaden; spinnt sich ums Bild herum und zeugt ein Kind mit ihm, halb Bild und halb Schleier.
Armer Türkenbund, arme Rapunzel! Da stehn sie, die Geschwisterkinder, auf einer Straße stehn sie im Gebirg, es schweigt der Stock, es schweigt der Stein, und das Schweigen ist kein Schweigen, kein Wort ist da verstummt und kein Satz, eine Pause ist’s bloß, eine Wortlücke ist’s, eine Leerstelle ist’s, du siehst alle Silben umherstehn; Zunge sind sie und Mund, diese beiden, wie zuvor, und in den Augen hängt ihnen der Schleier, und ihr, ihr armen, ihr steht nicht und blüht nicht, ihr seid nicht vorhanden, und der Juli ist kein Juli.
Die Geschwätzigen! Haben sich, auch jetzt, da die Zunge blöd gegen die Zähne stößt und die Lippe sich nicht ründet, etwas zu sagen! Gut, laß sie reden …
»Bist gekommen von weit, bist gekommen hierher …«
»Bin ich. Bin ich gekommen wie du.«
»Weiß ich.«
»Weißt du. Weißt du und siehst. Es hat sich die Erde gefaltet hier oben, hat sich gefaltet einmal und zweimal und dreimal, und hat sich aufgetan in der Mitte, und in der Mitte steht ein Wasser, und das Wasser ist grün, und das Grüne ist weiß, und das Weiße kommt von noch weiter oben, kommt von den Gletschern, man könnte, aber man soll’s nicht, sagen, das ist die Sprache, die hier gilt, das Grüne mit dem Weißen drin, eine Sprache, nicht für dich und nicht für mich – denn, frag ich, für wen ist sie denn gedacht, die Erde, nicht für dich, sag ich, ist sie gedacht und nicht für mich –, eine Sprache, je nun, ohne Ich und ohne Du, lauter Er, lauter Es, verstehst du, lauter Sie, und nichts als das.«
»Versteh ich, versteh ich. Bin ja gekommen von weit, bin ja gekommen wie du.«
»Weiß ich.«
»Weißt du und willst mich fragen: Und bist gekommen trotzdem, bist, trotzdem, gekommen hierher – warum und wozu?«
»Warum und wozu … Weil ich hab reden müssen vielleicht, zu mir oder zu dir, reden hab müssen mit dem Mund und mit der Zunge und nicht nur mit dem Stock. Denn zu wem redet er, der Stock? Er redet zum Stein, und der Stein – zu wem redet der?«
»Zu wem, Geschwisterkind, soll er reden? Er redet nicht, er spricht, und wer spricht, Geschwisterkind, der redet zu niemand, der spricht, weil niemand ihn hört, niemand und Niemand, und dann sagt er, er und nicht sein Mund und nicht seine Zunge, sagt er und nur er: Hörst du?«
»Hörst du, sagt er – ich weiß, Geschwisterkind, ich weiß … Hörst du, sagt er, ich bin da. Ich bin da, ich bin hier, ich bin gekommen. Gekommen mit dem Stock, ich und kein andrer, ich und nicht er, ich mit meiner Stunde, der unverdienten, ich, den’s getroffen hat, ich, den’s nicht getroffen hat, ich mit dem Gedächtnis, ich, der Gedächtnisschwache, ich, ich, ich …«
»Sagt er, sagt er … Hörst du, sagt er … Und Hörstdu, gewiß, Hörstdu, der sagt nichts, der antwortet nicht, denn Hörstdu, das ist der mit den Gletschern, der, der sich gefaltet hat, dreimal, und nicht für die Menschen … Der Grün-und-Weiße dort, der mit dem Türkenbund, der mit der Rapunzel … Aber ich, Geschwisterkind, ich, der ich da steh, auf dieser Straße hier, auf die ich nicht hingehör, heute, jetzt, da sie untergegangen ist, sie und ihr Licht, ich hier mit dem Schatten, dem eignen und dem fremden, ich – ich, der ich dir sagen kann: – Auf dem Stein bin ich gelegen, damals, du weißt, auf den Steinfliesen; und neben mir, da sind sie gelegen, die andern, die wie ich waren, die andern, die anders waren als ich und genauso, die Geschwisterkinder; und sie lagen da und schliefen, schliefen und schliefen nicht, und sie träumten und träumten nicht, und sie liebten mich nicht und ich liebte sie nicht, denn ich war einer, und wer will Einen lieben, und sie waren viele, mehr noch als da herumlagen um mich, und wer will alle lieben können, und, ich verschweig’s dir nicht, ich liebte sie nicht, sie, die mich nicht lieben konnten, ich liebte die Kerze, die da brannte, links im Winkel, ich liebte sie, weil sie herunterbrannte, nicht weil sie herunterbrannte, denn sie, das war ja seine Kerze, die Kerze, die er, der Vater unsrer Mütter, angezündet hatte, weil an jenem Abend ein Tag begann, ein bestimmter, ein Tag, der der siebte war, der siebte, auf den der erste folgen sollte, der siebte und nicht der letzte, ich liebte, Geschwisterkind, nicht sie, ich liebte ihr Herunterbrennen, und, weißt du, ich habe nichts mehr geliebt seither;
nichts, nein; oder vielleicht das, was da herunterbrannte wie jene Kerze an jenem Tag, am siebten und nicht am letzten; nicht am letzten, nein, denn da bin ich ja, hier, auf dieser Straße, von der sie sagen, daß sie schön ist, bin ich ja, beim Türkenbund und bei der Rapunzel, und hundert Schritt weiter, da drüben, wo ich hinkann, da geht die Lärche zur Zirbelkiefer hinauf, ich seh’s, ich seh es und seh’s nicht, und mein Stock, der hat gesprochen zum Stein, und mein Stock, der schweigt jetzt still, und der Stein, sagst du, der kann sprechen, und in meinem Aug, da hängt der Schleier, der bewegliche, da hängen die Schleier, die beweglichen, da hast du den einen gelüpft, und da hängt schon der zweite, und der Stern – denn ja, der steht jetzt überm Gebirg –, wenn er da hineinwill, so wird er Hochzeit halten müssen und bald nicht mehr er sein, sondern halb Schleier und halb Stern, und ich weiß, ich weiß, Geschwisterkind, ich weiß, ich bin dir begegnet, hier, und geredet haben wir, viel, und die Falten dort, du weißt, nicht für die Menschen sind sie da und nicht für uns, die wir gingen und einander trafen, wir hier unterm Stern, wir, die Juden, die da kamen, wie Lenz, durchs Gebirg, du Groß und ich Klein, du, der Geschwätzige, und ich, der Geschwätzige, wir mit den Stöcken, wir mit unsern Namen, den unaussprechlichen, wir mit unserm Schatten, dem eignen und dem fremden, du hier und ich hier – – ich hier, ich; ich, der ich dir all das sagen kann, sagen hätt können; der ich’s dir nicht sag und nicht gesagt hab; ich mit dem Türkenbund links, ich mit der Rapunzel, ich mit der heruntergebrannten, der Kerze, ich mit dem Tag, ich mit den Tagen, ich hier und ich dort, ich, begleitet vielleicht – jetzt! – von der Liebe der Nichtgeliebten, ich auf dem Wege hier zu mir, oben.«[1]
Paul Celan geht in dieser Prosadichtung wohl von seinem persönlich erlittenen Judenschicksal aus, doch merken wir bald, daß der Weg der beiden »Geschwisterkinder«, die einander im Gebirge begegnen, zugleich der lange und beschwerliche Weg des jüdischen Volkes ist. Der Dichter versucht, sowohl der privaten als auch der historischen Erfahrung gerecht zu werden als einer, der sich selber auf einer Expedition befindet und dabei in immer einsamere Gegenden vorstößt. Im Dialog zwischen »Groß« und »Klein« offenbart sich der jüdische Fluch, die Entfremdung von der Natur und die tiefe Kluft, welche die Juden von ihren Mitmenschen trennt. Renate Böschenstein-Schäfer, die diesen Text in ihrer Interpretation ›Anmerkungen zu Paul Celans Gespräch im Gebirg‹[2] umfassend gewürdigt hat, sagt: »So scheint es, als sei das Schicksal, nicht von dieser Erde zu sein, ein grundsätzlich menschliches, das indessen von der Geistesgebundenheit der Juden schärfer erlitten wird.«[3] Der jüdische Dichter wäre somit ein Priester der allgemein-menschlichen Heimatlosigkeit, ein Heimatloser unter Scheinheimischen. Die Parallele zu Kafka drängt sich auf. Der Landvermesser K. im Roman Das Schloß, der ohne Gehilfen und ohne seine Instrumente in ein gottverlassenes Dorf zieht, um das Land der Bauern zu vermessen, und an seiner Vermessenheit, mit der er die Geheimnisse des Schlosses zu ergründen sucht, letztlich zugrunde geht, verkörpert auf seine Weise die Situation des jüdischen Dichters, die durch das Schicksal eines geschundenen Volkes eine besondere Verschärfung erfahren hat. Dort eine öde Winterlandschaft, bei Celan ein verlassenes Gebirgstal. Es läge nahe, den Vergleich weiterzutreiben und die anonyme Macht Kafkas, wie sie durch das Schloß oder das Gericht repräsentiert wird, bei Celan in der Sprachproblematik zu sehen, von der er genauso unheilbar gebannt zu sein scheint wie der um ein »Viertel Judenleben ältre« (G 18–19) vom schmalen Lichtspalt, welcher aus dem Tor des Gesetzes dringt. Denn auf eine Definition der Sprache läuft das Gespräch im Gebirg hinaus, obwohl sein Gegenstand zunächst das jüdische Dasein ist.
Es ist das Verdienst Renate Böschensteins, schon am ersten Satz dieser Prosa gezeigt zu haben, daß der Duktus der Sprache das gebrochene Verhältnis des Dichters zu ihr verkörpert. Der Satzbau entspricht eher dem Prinzip der französischen »phrase segmentée« als der deutschen, synthetischen Syntax. Die französische Segmentation (Moi, je n’arrive pas à le résoudre, ce problème) erlaubt dem Dichter, die Satzglieder stückweise vorzuführen, und zwar in der Reihenfolge ihrer emotionalen Wichtigkeit. Wenn die Bauern bei Ramuz sich viel häufiger dieser Form bedienen als die gebildeten Stände, so spiegelt sich darin ihre einfache Denkstruktur. Celans Stammelsyntax, die man mittels der Segmentation leicht ins Französische übersetzen könnte, hat einen andern Ursprung. Er macht genau das Gegenteil von Kleist. Auch Kleist segmentiert seine Sätze, aber um der Übersicht des logischen Zusammenhangs willen. Wenn Kleist das Subjekt an den Anfang stellt wie der Dramatiker den Personennamen und es mit einem Komma von der Aussage trennt[4], so haben wir bei Celan eher den Eindruck, er schreibe in der Prosa ähnlich wie in der Lyrik syntaktisch locker gefügte Zeilen untereinander. Kleist zementiert den logischen Zusammenhang mit einem Übermaß an Konjunktionen, Celan läßt die Fugen offen, um ja nicht den Eindruck der Eindeutigkeit zu erwecken. Diesem Prinzip bleibt er auch in den so zahlreichen nachgestellten Adjektiven treu. Das vorangehende Attribut bestimmt das Nomen zum voraus, das nachhinkende korrigiert bloß die allgemeine Vorstellung. Wir begegnen einer Sprache, in der laufend berichtigt oder sogar aufgehoben wird, was soeben gesagt worden ist: »… und mit ihm ging sein Name, der unaussprechliche, ging und kam …« (G 3–4). Ahnlich wie Kafkas widersprüchliche Reflexionen letztlich nur dazu dienen, uns die Sinnlosigkeit des Reflektierens vor Augen zu führen, macht uns die Sprache hier die Unmöglichkeit des endgültigen Benennens vor. Das treffende Wort wird durch das umkreisende Wort ersetzt, der gemeißelte durch den zerbröckelten Satz, der einem Gefäß gleicht, in das fortwährend Löcher geschlagen werden. Man hat den Eindruck, der einmal fixierte Inhalt werde sofort wieder preisgegeben, fließe aus, die Sprache diene nur dazu, ihn zu verschütten.
Diese Stilgebärde verdichtet sich im paradoxen Ausdruck: »… ich, den’s getroffen hat, ich, den’s nicht getroffen hat, ich mit dem Gedächtnis, ich, der Gedächtnisschwache, ich, ich, ich …« (G 85–87). Nur in der Einheit des Widerspruchs kann sich, so scheint es, Celan der Lüge entziehen. Die paradoxe Wendung gibt ein Ziel an, aber sie läßt den Weg offen, der zu ihm führt. Es kann so gut die negative wie die positive Richtung sein. Der paradox Sprechende versucht, die Waage zwischen Plus und Minus im Gleichgewicht zu halten. Er erzeugt nur das Spannungsfeld, in dem sich die Wörter wie Magnetspäne um die Wahrheitskerne scharen können. Der geometrische Ort dieser Wahrheit wäre der »Meridian« (Me 148), von Pol zu Pol führend. Dieser Polarität werden wir in Celans Gedichten auf Schritt und Tritt begegnen, in zahllosen Oxymora. Das Oxymoron scheint eine der wenigen poetischen Figuren zu sein, mit denen Celan der Komplexität seiner seelischen Erfahrungen gerecht zu werden vermag. Das Paradoxon stellt sich ein, weil der Zwang zur bestimmten Wortwahl und die Regeln der Grammatik eine absolute Aussage verunmöglichen, weil die Sprache gleichzeitig den Gegenstand zeigt und verstellt. Die lyrische Sprache möchte das Geheimnis nur in klingende Laute verwandeln. Durch die unvermeidliche Logik zwingt sie uns aber zur Erklärung, wie es beschaffen sei. Wenn sich in der lyrischen Sprache die »Möglichkeit einer Verständigung ohne Begriffe«[5] ankündigt, dann leuchtet uns erst recht ein, weshalb Celan die Stilmittel ausschöpft, die zur Aufhebung einer klaren Begrifflichkeit führen. Die Flucht ins paradoxe Gestammel ist die letzte Konsequenz eines Dichters, der trotz des gewaltigen Sprachverschleißes in den Jahren nach Hitlers Machtergreifung, trotz der Behauptung, daß man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könne, vom Tiefsten und Letzten seiner Seele künden will, weil es ihm nicht gegeben ist, eine schützende Hornhaut wachsen zu lassen. Wenn Celan in seiner Bremer Rede von seinem Verhältnis zur deutschen Sprache nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs sagt:
»Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie mußte nun hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse todbringender Rede.« (Br 128),
so klingt dieser Abschnitt wie eine Vorankündigung der syntaktischen Verstümmelungen, die wir im Gespräch im Gebirg, das 1959, also ein Jahr später, entstanden ist, antreffen. Weil die Sprache, wie Celan fortfährt, keine Worte hergab für das, was geschah, wird die Wahl der Zeichen zum Fluch für den Dichter. Im Oxymoron findet dieser Fluch seinen knappsten Ausdruck.
Für die Läuterung der Sprache in der Einheit der Gegensätze hat Celan im Gedicht Einmal eine Formel gefunden. Er spricht vom Waschen der Welt durch den Erlöser, meint aber zugleich die Utopie einer Welterlösung durch die Sprache in den Versen:
»Eins und Unendlich,
vernichtet,
ichten.
Licht war. Rettung.« (A 103)
»Eins und Unendlich«, das Konkrete und das Absolute werden in der paradoxen Sprache vernichtet. Das Allgemeine wird also nicht wie beim Goetheschen Symbolbegriff durch das Besondere repräsentiert, sondern mit ihm zusammen zerstört. Anders ausgedrückt: Keinem einzelnen Zeichen könnte Celan die Verkörperung dessen zutrauen, was ein Symbol für ihn zu leisten hätte. Er scheint den Satz Bubers im Ohr zu haben, der das Mißtrauen der jüdischen Mystik gegenüber der Sprache auf einen Nenner bringt: »Das Wort ist ein Abgrund, durch den der Redende schreitet.«[6] Doch erst im Prozeß der Vernichtung werden die »tausend Finsternisse« erfahrbar gemacht.
»Sie [die Sprache] ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah; aber sie ging durch dieses Geschehen. Ging hindurch und durfte wieder zutage treten, ›angereichert‹ von all dem.«
(Br 128)
Auf dieses Hindurchgehen allein kommt es an, denn das heißt doch wohl, daß die Sprache in der Paradoxie nicht nur zerstört, sondern auch geläutert und neu aufgebaut wird. Um diesen Vorgang sichtbar zu machen, greift Celan auf seine sprachwissenschaftlichen Kenntnisse zurück. Das mittelhochdeutsche Verbum »ihten« bedeutet, wie Peter Horst Neumann nachgewiesen hat, »zu etwas machen«, denn die Wurzel »iht« (etwas) steht dahinter.[7] Aus der Vernichtung der Antipoden »Eins und Unendlich« geht etwas hervor, ja das »ichten« steckt bereits implizit im Wort »ver-nichten«. Und aus »ichten« assoziiert Celan in der letzten Zeile »Licht«. Das ist, von der Sprache her gesehen, die Rettung, die in der Kette »Eins und Unendlich – vernichten – ichten – Licht« abgebildet wird. »Licht« wäre, im Rahmen dieser engen Deutung, die Stufe einer neuen sprachlichen Erkenntnis. Daß die Vernichtung der Sprache bis in die Zerlegung des einzelnen Wortes gehen kann, zeigen die folgenden Verse aus dem Gedicht … Rauscht der Brunnen:
»Wir werden das Kinderlied singen, das,
hörst du, das
mit den Men, mit den Schen, mit den Menschen, ja das« (N 35)
Das Wort »Mensch«, das Celan nicht mehr hinzusetzen wagt, wird zertrümmert in seine beiden Silben »Men« und »Schen«, die in der deutschen Sprache keinen Sinn ergeben. Das Unfaßbare, das, wozu der Mensch geworden ist, wird in einem Zeichen vernichtet. Doch gleich setzt der Vorgang des »ichtens« ein. Das englische »men« bedeutet »Menschen«, ebenso das chinesische »shen«. In den scheinbar sinnlosen Trümmern wird somit das Preisgegebene doppelt zurückgewonnen. Dies ist die Paradoxie der Vernichtung und Erneuerung auf engstem Raum. Das Englische und das Chinesische stehen zeichenhaft für die neue, fremde Sprache, die Fremdsprache der Lyrik.
Der kleine Exkurs war nötig, um zu verstehen, weshalb Celan eine beinahe archaische Syntax der festgefügten Periode vorzieht. Es geht ihm darum, die Vieldeutigkeit des Paradoxons auf den Satzbau zu übertragen. Dies geschieht durch fortlaufende Berichtigungen und Ergänzungen. Die Sonne, aber nicht nur sie, ist untergegangen. Der Jud ist nicht nur Jud, sondern auch der Sohn eines Juden. Er geht und kommt, er ist er selbst und der andere, er geht im eigenen und im fremden Schatten. Jede primäre Setzung erhält dadurch den Charakter des Vorläufigen. Es entsteht kein übersichtliches Gefüge von Haupt- und Nebensätzen. Angehängte Satzteile führen zu endlosen Reihen, syntaktisch unverstrebte, durch Gedankenstriche abgetrennte Glieder erschweren das Verständnis, und man hat das Gefühl, man gehe beim Lesen im Kreis herum. Ein rhythmisches Phänomen, das uns später bei den Gedichten noch beschäftigen wird.
Kehren wir zurück zum Text, und zwar zu jener Stelle, die uns auch inhaltlich auf das Sprachproblem vorbereitet! Celan unternimmt es zunächst, das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Abbild in der Vorstellung zu klären:
»Da stehn sie also, die Geschwisterkinder, links blüht der Türkenbund, blüht wild, blüht wie nirgends, und rechts, da steht die Rapunzel, und Dianthus superbus, die Prachtnelke, steht nicht weit davon. Aber sie, die Geschwisterkinder, sie haben, Gott sei’s geklagt, keine Augen. Genauer: sie haben, auch sie, Augen, aber da hängt ein Schleier davor, nicht davor, nein, dahinter, ein beweglicher Schleier; kaum tritt ein Bild ein, so bleibt’s hängen im Geweb, und schon ist ein Faden zur Stelle, der sich da spinnt, sich herumspinnt ums Bild, ein Schleierfaden; spinnt sich ums Bild herum und zeugt ein Kind mit ihm, halb Bild und halb Schleier.«
Dieser Abschnitt ist geradezu ein Musterbeispiel für die vorhin genannte Sprache der Unsicherheit, die sich fortlaufend korrigieren möchte. Nicht weniger als drei Appositionen kommen vor. Das »aber sie« bezieht der Leser zunächst auf »Rapunzel« und »Dianthus superbus«, bevor die Beifügung »die Geschwisterkinder« den logischen Zusammenhang herstellt. Und sehr bezeichnend ist, daß auf den Komparativ »genauer«, mit dem der zweite Satz beginnt, nicht nur keine Präzision, sondern das pure Gegenteil des Gesagten folgt. Der Schleier hängt zunächst vor, dann hinter den Augen. Zusätzlich wird er als »ein beweglicher« qualifiziert. Aus dem Faden entsteht ein Schleierfaden. Dieses ständige Verbessern im Bewußtsein, daß die Sprache das »genauer« niemals erfüllen kann, hängt zusammen mit der Unfähigkeit, die Welt mittels der Sinnesorgane als objektive Realität zu erfahren. Celan konstruiert einen Modellfall des Sehens. Die beiden Juden bleiben stehen auf der Straße und blicken um sich. Da blühen in nächster Nähe Türkenbund, Rapunzel und Prachtnelke, blühen so wild wie nirgends sonst. Aber trotzdem haben die Geschwisterkinder keine Augen für die Blumen. Was sie sehen, sind nur Abbilder. Die lateinische Bezeichnung wird aus dem Gedächtnis hergeholt, das wissenschaftliche Etikett. Laute, die für den Nicht-Lateiner und den botanisch Ungeschulten leere Hülsen darstellen. Eine unsichtbare Mauer schiebt sich zwischen Mensch und Natur. Sie haben Augen, so wird berichtigt, aber einwärtsgekehrte. Ein Schleier verhängt die objektive Wahrnehmung. Das Bild bleibt hängen im Gewebe und wird eingesponnen von einem Faden, der wie das Sekret einer Spinne die Beute umwickelt. Ein Kind wird gezeugt, halb Schleier und halb Bild. Aus der Raupe schlüpft gleichsam ein Falter. Diese Fäden, die Celan im Gedicht »Schliere« etwas deutlicher »seelenbeschrittene Fäden« (Sp 19) nennt, dürfen wohl als Chiffre für die seelische Substanz des Dichters gelesen werden. Die Metamorphose entspricht etwa dem Vorgang, für den Novalis den treffenden Aphorismus gefunden hat: »Das Auge ist das Sprachorgan des Gefühls. Sichtbare Gegenstände sind die Ausdrücke der Gefühle.«[8] So wie wir die Dinge anschauen, verleihen wir ihnen bereits unser persönliches Gepräge. Es besteht aber kein Zweifel, daß diese Verschleierung – »Schleier« drückt deutlich genug den negativen Aspekt des Verhüllens aus – von Celan nicht nur als schöpferisches Glück, sondern auch als Qual der Entfremdung von der Natur empfunden wird. Er ist weit entfernt vom magischen Idealismus eines Novalis. Er möchte die Prachtnelke in ihrem Sein begreifen und nicht nur als Zeichen seines Gemüts sehen. Die Einsamkeit im Gebirg ist auch die Verlorenheit dessen, der in allen Dingen nur ein Echo seiner Seele findet. Von einem Blinden zu einem Sehenden werden, würde für Celan heißen: durch den Schleier hindurchstoßen zum Wesen der Dinge.
In der Sammlung Atemwende steht ein kleines Gedicht, das die Verwandlung der Bilder zum Thema hat:
»HALBZERFRESSENER, maskengesichtiger Kragstein,
tief
in der Augenschlitz-Krypta:
Hinein, hinauf
ins Schädelinnre,
wo du den Himmel umbrichst, wieder und wieder,
in Furche und Windung
pflanzt er sein Bild,
das sich entwächst, entwächst.« (A 61)