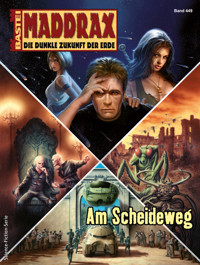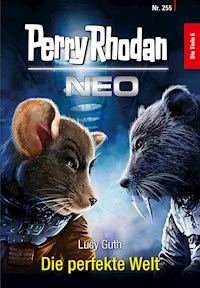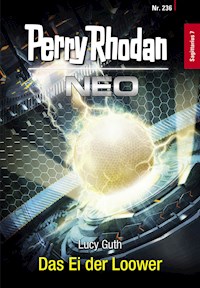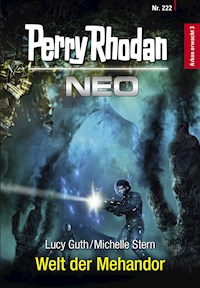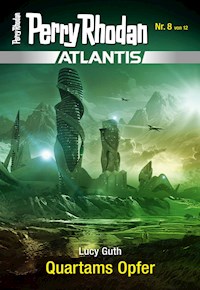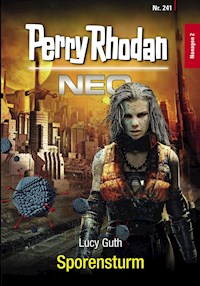Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Vor sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan auf Außerirdische getroffen. Seither ist die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen und hat fremde Welten besiedelt. Sie hat sich aber auch in kosmische Kämpfe verwickeln lassen – mit teils dramatischen Folgen. Seit einigen Jahren umkreisen die Erde und der Mond eine fremde Sonne im fernen Kugelsternhaufen M 3. Außerdem haben die Überschweren unter ihrem Anführer Leticron mehrere Jahre lang das Solsystem und alle Kolonieplaneten der Erde besetzt. Erst nach fünf Jahren können die Posbis, die robotischen Freunde der Menschheit, sie vertreiben. Während sich die Menschen von dieser Zeit erholen, geschieht Ende des Jahres 2107 etwas Furchtbares: Perry Rhodan bricht tot zusammen. Was ist mit dem Terraner geschehen? Wie sich herausstellt, findet er sich – aber nur sein Gehirn – auf einem unbekannten Planeten wieder. Rhodan ist FREMDER ALS FREMD ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 280
Fremder als fremd
Lucy Guth
Cover
Vorspann
Prolog
1. Im Nichts
2. Doynschto
3. Dagor
4. Ein seltsames Ceynach
5. Die Verwandlung
6. Über Ceynachs
7. Neue Gerüche
8. Die Caddron-Vaga
9. Lexayny
10. Modetrends
11. Fluchtmöglichkeiten
12. In den Katakomben
13. Auf der Flucht
14. Jagd
15. Der Nyschatsch
16. Überlegungen
17. Glücksspiel
18. Der Kalphyrer
19. Keyskett
20. Antorschok
21. Beobachterin
22. Galko Tschem
23. Helfer im Dunkeln
24. Die Spelze
25. Am Hafen
26. Unverhoffte Helfer
Impressum
Vor sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan auf Außerirdische getroffen. Seither ist die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen und hat fremde Welten besiedelt. Sie hat sich aber auch in kosmische Kämpfe verwickeln lassen – mit teils dramatischen Folgen.
Seit einigen Jahren umkreisen die Erde und der Mond eine fremde Sonne im fernen Kugelsternhaufen M 3. Außerdem haben die Überschweren unter ihrem Anführer Leticron mehrere Jahre lang das Solsystem und alle Kolonieplaneten der Erde besetzt. Erst nach fünf Jahren können die Posbis, die robotischen Freunde der Menschheit, sie vertreiben.
Während sich die Menschen von dieser Zeit erholen, geschieht Ende des Jahres 2107 etwas Furchtbares: Perry Rhodan bricht tot zusammen. Was ist mit dem Terraner geschehen? Wie sich herausstellt, findet er sich – aber nur sein Gehirn – auf einem unbekannten Planeten wieder. Rhodan ist FREMDER ALS FREMD ...
Prolog
Dise Yaanztroner drängten sich so dicht, dass es kaum ein Durchkommen gab. Ich bekam einen Stoß gegen den Kopf, einen weiteren in den Magen, doch ich kümmerte mich nicht darum. Ich musste vorwärts, zwischen ihnen hindurch. Es gab keine Alternative.
Eine Ceynach-Jägerin ruhte niemals, bis sie ihr Ziel erreicht hatte.
War er dort, auf der Aussichtsplattform, von der aus man den Start der SEGEMUUR beobachten konnte? Ich drückte grob mehrere Schaulustige beiseite, die sich an gekühlter Miirrbowle gütlich taten, die ein Straßenverkäufer für wenige Kuschtas anbot. Das empörte Geschrei der Angerempelten ignorierte ich. Ein Blick in die Runde verriet mir, dass er nicht da war.
Mit drei Sprüngen war ich auf der Brüstung, die vorn um die Aussichtsplattform verlief. Das wurde mit einem entsetzten Kreischen quittiert, weil ich dabei eine Yaanztronerin in die Tiefe stieß. Zappelnd stürzte ihr schlanker Körper hinab und klatschte ein paar Schritte unter uns in eine Wagenladung Tenjofrüchte. Violetter Saft spritzte in alle Richtungen, als die Früchte mit albernen Ploppgeräuschen aufbrachen. Sogar meine Beine wurden noch mit dem Saft besudelt, obwohl ich so weit über der Sauerei stand.
Immerhin ein weicher Fall, da hatte sie Glück gehabt.
Wütende Schreie, haarige Hände, die nach mir griffen. Ich hatte genug gesehen und entschlüpfte meinen Häschern problemlos. Da ich mein Ziel endlich entdeckt hatte, raste ich den Kai entlang, der eine Sackgasse war: von wuchtigen Frachtbehältern umbaut, eine tödliche Falle. Mein Ziel war an das jenseitige Ende geflüchtet.
Eine Ceynach-Jägerin wusste, wie sie ihr Opfer in die Enge trieb. Es war der perfekte Hinterhalt. Die ahnungslosen Yaanztroner, die sich am Eingang der Gasse versammelt hatten, weil der Blick auf den startenden Frachter von dort aus besonders gut war, ahnten nicht, dass sie bei dieser gnadenlosen Jagd zu Helfershelfern wurden.
1.
Im Nichts
Völlige Orientierungslosigkeit. Verwirrung. Angst. Und in all dem Chaos sein Bewusstsein. Er wusste im Moment nicht, wo er war und was mit ihm passierte, aber seiner Identität war er sich überaus sicher.
Ich bin Perry Rhodan.
Er klammerte sich an diesen Gedanken, denn viel mehr hatte er zunächst nicht. Er versuchte, sich zu erinnern, was geschehen war.
Eben noch war er in einem Raumschiff gewesen, in einer großen Zentrale, um ihn herum Freunde und Vertraute. Die Erinnerungen waren verschwommen und purzelten in seinem Kopf durcheinander wie Bauklötze in einem Kinderzimmer. Er wollte sie fassen, doch es gelang ihm nicht.
Er verspürte den dumpfen Druck herannahender Kopfschmerzen und hätte sich gern mit den Fingern die Schläfen gerieben. Das ging jedoch nicht. Er hatte es ausprobiert. Das Problem war: Er fühlte seinen Körper nicht mehr. Was auch immer ihm zugestoßen war, es hatte dafür gesorgt, dass er sich nicht bewegen konnte. Er wollte die Augen öffnen, aber es blieb dunkel. Er versuchte zu lauschen. Er hörte nichts.
Seine anderen Sinne ließen ihn ebenfalls im Stich: Er konnte weder riechen noch spürte er etwas, er schmeckte nicht mal seinen eigenen Speichel. Er konnte nicht schlucken, spürte keine Atemzüge. Da war nichts, absolut nichts.
In all der Leere war er sich nur einer Sache sicher: Ich bin Perry Rhodan.
Was war mit ihm passiert? Bin ich tot?
Nein, das glaubte er eigentlich nicht. Das Jenseits, oder was auch immer einen Menschen nach dem Sterben erwartete, hatte er sich stets anders vorgestellt.
Außerdem war er unsterblich, jedenfalls quasiunsterblich. Er hatte einst ein Gerät namens Zellaktivator erhalten, das ihm ewiges Leben garantierte, sofern er nicht gewaltsam oder durch einen Unfall umkam. Dieses Gerät war zwar nicht mehr vorhanden, doch die dauerhafte Unterbrechung seines Alterungsprozesses war geblieben. Zumindest war das bislang der Fall gewesen.
Vielleicht habe ich mich geirrt. Mag sein, dass ich doch tot bin.
Etwas in ihm wehrte sich gegen diese Idee. Nein, so einfach ist es nicht. Ich bin immer noch da! Aber wo?
Er zwang sich zur Ruhe, um seine Gedanken zu ordnen. Was war geschehen?
Ein Raumschiff, ja. Die SOL. Er war in der Zentrale gewesen, mit dem Kommandanten Chart Deccon. Mit Thora, seiner Frau. Er hatte mit einem Wissenschaftler gesprochen: Eric Leyden.
Moment, ist Eric Leyden nicht tot? In seinem Gehirn ging immer noch einiges durcheinander.
Leyden hatte etwas von Impulsen erzählt, von Planetenmaschinen und von einem »Superimpuls«. Und dann ...
Dann war da dieser stechende Schmerz in meinem Kopf. Das Gefühl, als würde ich weggerissen. Und alles wurde schwarz.
War er bewusstlos gewesen? Oder hatte er sich übergangslos in diesem seltsamen Zustand wiedergefunden? Er war nicht sicher.
Was war das also für ein Ort? Eine Art transzendentale Zwischenwelt? Es hatte eine Zeit in seinem Leben gegeben, da hätte er so etwas als Unsinn abgetan. Mittlerweile hatte er zu viel erlebt und zu viele Erfahrungen gesammelt, um diesen Gedanken rundheraus zu verwerfen. Er war zu den Sternen geflogen, hatte den ersten Kontakt der Menschheit zu einer außerirdischen Spezies hergestellt, hatte mit Wesenheiten gesprochen, die aus reiner Energie zu bestehen schienen, hatte ferne Galaxien bereist und Wunder gesehen, von denen andere nur träumen konnten.
Vor hundert Jahren, als er als kleiner Junge durch Manchester geradelt war, hätte nicht nur er solche Ideen als Phantasiegeschichten beurteilt. Doch mittlerweile schrieb man das Jahr 2107, und die Menschheit hatte in vielerlei Hinsicht Flexibilität beweisen müssen – nicht nur, was vermeintlich abstruse Ideen anging.
Mit einem Mal wurde ihm kalt. Das erfüllte ihn mit Begeisterung, denn er war sicher, dass es ein echtes Empfinden war. Ihm war kalt. Dass ich mich darüber jemals so freuen würde ...
Diese Empfindung bedeutete, dass es ein »Draußen« gab – etwas, das ihn frieren ließ. Er verstand nicht, warum er seinen Körper nicht spürte, warum er sich weder bewegen noch irgendwie artikulieren oder mit der Außenwelt kommunizieren konnte. Immerhin: Es gab etwas außer ihm, und das war schon mal etwas. Was genau, wusste er nicht. Ein Hoffnungsschimmer vielleicht.
Er erinnerte sich vage an einen Artikel, den er vor einiger Zeit gelesen hatte. Darin war es um Menschen gegangen, die am »Locked-in-Syndrom« litten: Patienten, die bei vollem Bewusstsein waren, jedoch nicht in der Lage, sich zu bewegen oder verständlich zu machen. Was mich befallen hat, muss etwas Ähnliches sein.
Mit dem Unterschied, dass er zudem von seiner Außenwelt nichts wahrnahm, von der plötzlichen Kälte mal abgesehen. Die Betroffenen, von denen er gelesen hatte, konnten durch Augenbewegungen kommunizieren. Er selbst allerdings fühlte seine Augen nicht, konnte sie also weder öffnen noch bewegen. Er war nicht nur eingeschlossen, sondern gleichzeitig von der Außenwelt ausgeschlossen.
Sozusagen ein Totally-Locked-Syndrom, dachte er mit einem Anflug von Humor. Diese Benennung würde Leyden gefallen.
Der Artikel hatte auch eine neue Technologie beschrieben, die sich BPI nannte. Die Abkürzung stand für »Brain-Positronic-Interface« und war eine Weiterentwicklung der seit Langem in der Neuromedizin angewandten »Brain-Computer-Interfaces«. Dabei wurden die geschädigten Gehirne mit einer leistungsfähigen Positronik vernetzt. Medizinische Naniten dockten in den relevanten Zerebralbereichen an und übermittelten die elektrische, magnetische und hämodynamische Aktivität des Gehirns an die Medopositronik, die sämtliche Informationen auswertete und in Kommunikation verwandelte. Menschen mit Locked-in-Syndrom konnten auf diese Weise buchstabieren oder gar die Kontrolle über bestimmte Körperfunktionen zurückerlangen.
Wenn es so etwas ist, werden Sam Breiskoll und Sud das mit Sicherheit diagnostizieren und eine Behandlung einleiten können, dachte er optimistisch.
Breiskoll war der Chefarzt der SOL, das Mentamalgam Sud war mit außergewöhnlichen Heilfähigkeiten und großer Fachkompetenz ausgestattet. Beide gehörten zu den brillantesten Medizinern der Gegenwart. Rhodan wusste, dass er sich auf sie verlassen konnte.
Diese Situation würde sich klären, da war er sicher. Im Zweifelsfall würde er sich selbst aus dieser Lage befreien, so wie er es bereits unzählige Male zuvor geschafft hatte, aus vermeintlich hoffnungslosen Umständen zu entkommen.
2.
Doynschto
»Ich habe gesagt: Zurücktreten!«, brüllte der Raytare. Sein Schockstab schnellte vor und traf die Brust der Demonstrantin, die ein mit krakeliger Schrift bedecktes Schild emporhielt.
Ihr zierlicher, mit bereits leicht golden schimmerndem Flaum bedeckter Körper zuckte einige Male wild, ehe er auf den Boden fiel. Die anderen Yaanztroner der kleinen Protestgruppe, die im Eingangsbereich des Röhrenbahnhofs standen, ließen ihre Schilder fallen und stoben in alle Richtungen davon.
Während zwei weitere Raytaren die bewusstlose Frau hochhoben, ging Doynschto zügig und mit gesenkten Ohren an der Szene vorbei, die Augen starr zu Boden gerichtet, um die Aufmerksamkeit der Sicherheitsleute nicht auf sich zu ziehen. Das kompromisslose Vorgehen der Raytaren war nicht ungewöhnlich, und immerhin hatten sie die Protestierenden gewarnt.
Die Dummköpfe hätten einfach nur ihre Plakate nehmen und verschwinden sollen, dachte Doynschto in einer Mischung aus Mitleid und Verachtung. Er trat auf eins der Plakate – alte Verpackungsmaterialien, auf die die Leute ihre Losungen gemalt hatten und »mehr Kuschtas für bessere Nahrung« forderten.
Demonstrationen kamen in Nopaloor häufig vor, und ebenso häufig wurden sie von den Raytaren auf genau diese Weise beendet. Dass ihm eine solche Szene bereits am Morgen begegnete, auf dem Weg zur Arbeit, war indes nicht so häufig. Die Zeiten wurden schlimmer. Das bekam Doynschto zu spüren.
Er warf einen Blick zurück auf das Haus, in dem sich seine vergleichsmäßig luxuriöse Wohnung befand. Es war einer von zahllosen Schlauchbauten, die sich dicht an dicht reihten und deren runde Fassaden fast aneinanderstießen. Seine geräumigen zwei Zimmer im vierunddreißigsten Stockwerk musste er mit niemandem teilen – aber wie lange würde das so bleiben? Die Nachbarwohnungen waren bereits aufgeteilt worden, weil die Bewohner nicht mehr genug Statuspunkte zur Verfügung hatten. Seine Nachbarn zur Linken hatten ihre zwei ältesten Kinder auf die Straße gesetzt, weil mehr als sechs Yaanztroner in einem Zimmer wahrhaftig nicht gingen.
Na ja, die beiden waren fast in der Jungmauser; die sind alt genug, um in der Hauptstadt auch allein zurechtzukommen.
Doynschto ging an der Transmitterreihe vorbei, die den Röhren vorgelagert war. Unablässig sprangen Yaanztroner und andere Einwohner von Nopaloor in die verschiedenen Modelle und verschwanden.
Mit leichtem Unbehagen wandte er den Blick ab. Er hatte keine echte Transmophobie – ein Bruder von ihm dagegen hatte derartige Panik vor Transmittern, dass ihn Atemnot und Gliederzittern befielen, wenn er nur in die Nähe eines solchen Geräts kam. Dennoch verspürte auch Doynschto ein gewisses Unbehagen gegenüber einem Transmitterdurchgang und nutzte diese überall verfügbare Technik nur, wenn es unumgänglich war. Bei einem Termin auf der anderen Seite der Stadt beispielsweise.
Er war deshalb ganz froh, dass er seinen morgendlichen Weg zur Arbeit mit einer Röhre erledigen konnte. Dieses altertümliche Transportsystem war allerdings nur für kurze Strecken ausgebaut – und extrem störanfällig.
Als er seinen Zusteig erreichte, hatte sich davor bereits eine Warteschlange gebildet.
»Was ist denn diesmal wieder los?« Er stöhnte verärgert auf.
Ein fülliger Duynter – von einem Yaanztroner nur durch die rostbraune Fellfarbe zu unterscheiden, die in diesem Fall zum Großteil unter einem kuttenartigen Überwurf verschwand – drehte sich zu Doynschto um. »Zusammenstoß am Knotenpunkt beim Proklamat. Die Sicherheitsventile haben versagt, drei Passagiere sind kollidiert. Es wird immer schlimmer.«
Doynschto verzog das Gesicht. Am Proklamat – dem Regierungsviertel – musste er vorbei. Das würde seinen Transport verzögern. Tatsächlich kam es in jüngster Zeit häufiger vor, dass die Miniaturkabinen, die jeweils nur einen Passagier transportierten, zusammenstießen. Sie wurden mit Druckluft durch das Röhrensystem befördert, und bislang waren die Unfälle glimpflich abgelaufen.
Die Sache brachte selbst einen Transmitterskeptiker wie Doynschto zum Überlegen. Beim Transmittersystem gab es zwar hin und wieder Todesfälle, die stetig steigende Zahl der Röhrenbahnkollisionen ließ dieses Risiko jedoch geringer erscheinen.
»Hat jemand gesagt, wie lange das noch dauert?«, fragte Doynschto den Duynter.
Der Dicke wies auf eine Digitalanzeige über ihrer Röhre: »Mindestens eine Liss. Die Leute hat es ganz schön ineinander verkeilt, heißt es. Dauert bestimmt eine Weile, die Bergung.«
Doynschto stieß einen leisen Fluch aus, der etwas mit den Vorfahren derer zu tun hatte, die sich das Röhrensystem ausgedacht hatten, und wandte sich zum Gehen. Er konnte es sich nicht leisten, zu spät zu kommen. Nicht solange er bei Izgaat auf der Abschussliste stand.
Kurz überlegte er, ob er sich zu einer Transmitternutzung überwinden sollte, entschied sich dann aber doch, zu Fuß zu gehen. Wenn er sich beeilte, konnte er in einer Viertelliss da sein, und damit nur ein paar Aliss verspätet. Mit viel Glück würde Izgaat das nicht mal bemerken.
Auf der Straße verfiel Doynschto in einen gleichmäßig trabenden Schritt, der Zusammenstöße mit anderen verhinderte – auf dem dicht frequentierten Weg gar nicht so einfach – und ihm gleichzeitig ein leidlich schnelles Vorankommen ermöglichte. Er war nicht mehr der Jüngste, aber noch war der feine Haarwuchs an seinem Körper saftig grün und nicht von Goldfäden durchzogen. Er hätte besser in Form sein können; seine Arbeit ließ das jedoch nicht zu. Er verbrachte viel Zeit in der Hirnbank – gerade deswegen ärgerte es ihn, dass Izgaat ständig auf seinen Passivierungsquoten herumritt. Er hatte sie zweimal verfehlt, nur läppische zwei Mal im vergangenen Jahr – aber das rieb ihm sein Vorgesetzter immer wieder unter die Nase.
Die Empörung über diese Ungerechtigkeit beschleunigte Doynschtos Schritte. Die Schlauchhäuserzeilen flogen zur so an ihm vorbei. Einmal wäre er beinahe vor den Handkarren eines alten Fulgmyrers gelaufen. Das Echsenwesen stellte den vom Nacken bis zum Gesäß verlaufenden Sichelkamm auf und beschimpfte ihn unflätig. Als Doynschto den Kerl ignorierte, griff der Fulgmyrer in den Karren und warf ihm einen Pritchy hinterher. Hätte sich Doynschto nicht geduckt, hätte ihn das Gemüse am Rücken getroffen und seinen nagelneuen Arbeitsanzug mit orangefarbenen Flecken besudelt. Stattdessen verfehlte ihn der Pritchy und traf die Rikscha eines vorbeifahrenden Isnos.
Doynschto zog den Kopf zwischen die Schultern und eilte weiter, während die Rikscha anhielt und der Leibwächter des Reichen ausstieg. Der Fulgmyrer ließ seinen Handkarren stehen und rannte davon. Keine Ladung Pritchys war wertvoll genug, um sich von einem Handlanger der Reichen aus dem Isnoviertel verprügeln zu lassen. Der Karren schon gar nicht, er hatte nicht mal ein Antigravmodul, sondern musste tatsächlich durch manuelle Kraft geschoben werden.
Von diesen Dingern sah man in diesem Stadtteil eher wenige. Doynschto lebte zwar nicht in einem Viertel wie Isno, in dem sich die Bewohner frei stehende Häuser mit kleinen Grünstreifen leisten konnten. Sein Wohnviertel war dennoch kein Slum, in dem sich die Ärmsten herumtrieben.
Zumindest noch nicht, dachte er, während er weiterhastete. Wenn sich seine Befürchtungen bewahrheiteten und Izgaat ihn tatsächlich loswerden wollte, musste er wahrscheinlich umziehen ...
In plötzlicher Angst schüttelte Doynschto den Kopf. Er war seit vielen Jahren Zerebralpfleger in der Stalakk-Gehirnbank. Er machte seine Arbeit gut, denn er hatte viel Erfahrung und wusste, wie er mit den Ceynachs und den Trägerkörpern umgehen musste, damit die Transplantation möglichst gut verkraftet wurde. Was scherte es ihn da, wenn er die Quoten nicht erfüllte? Es ging ihm darum, die Ceynachs erfolgreich in der Passivität zu bewahren und später in gutem Zustand in die Trägerkörper zu übermitteln.
Izgaat aber war jemand, für den so etwas nicht zählte. Ihn interessierten nur Zahlen, Quoten und Ergebnisse. Er wäre durchaus imstande, Doynschto durch einen jüngeren Arbeiter zu ersetzen, bei dem vielleicht mehr Ceynachs auf der Strecke blieben, der jedoch eine höhere Schlagzahl in seiner Bilanz stehen hatte.
»Entwürdigend«, murmelte Doynschto empört und wusste nicht recht, ob er damit sich selbst oder die Gehirne meinte.
Der Gedanke, seine Arbeit zu verlieren, ließ seine großen Ohren erzittern. In der Milliardenmetropole war es kein Problem, Ersatz für ihn zu finden. Wenn es in Nopaloor eins im Überfluss gab, waren es Yaanztroner. Ein Jobverlust wäre eine Katastrophe für Doynschto. Es würden weniger Statuspunkte auf sein Kuschtuka fließen. Weniger Kuschtas auf dem Statuskonto bedeutete, dass er sich bestimmte Privilegien nicht mehr leisten konnte: keine zwei Zimmer mehr, nur noch fleischlose Mahlzeiten aus weniger frischem Obst und Gemüse ...
Nicht ohne Grund machte er seit mehreren Sonnenumläufen jede Menge Überstunden. Er musste Izgaat doch von seiner Qualität überzeugen.
Sein Arbeitsplatz lag in einem der Außenbezirke von Nopaloor. Von dort aus war das Stadtzentrum – dominiert vom Palastturm des Raytschas – nicht mehr zu sehen. Die Gehirnbank war in einem imposanten, kuppelförmigen Gebäude aus rosafarbenem Plastbeton untergebracht.
Als Doynschto dort eintraf, wünschte er sich, er hätte allen schlechten Bauchgefühlen zum Trotz den Transmitter genommen. Sein Anzug war durchgeschwitzt, sein Fell an Armen und Beinen verklebt. Und er war eine halbe Liss zu spät. Er hatte sich, was die Entfernung anging, gehörig verschätzt.
Zähneknirschend identifizierte er sich mit seinem Dienstausweis und ignorierte den halb mitleidigen, halb schadenfrohen Blick des Sicherheitsmanns am Eingang.
Der Hauptkomplex war unterplanetar angelegt. Im oberen Teil gab es lediglich die Vorführbereiche, in denen reiche Kunden in multifunktionalen Präsentationsräumen Ausschau nach potenziellen Zweitgehirnen halten konnten.
Die Kontore, in denen Zerebralpfleger wie Doynschto arbeiteten, erstreckten sich bis tief in die Planetenkruste hinunter. Er trat in den Antigravschacht, stieg auf der richtigen Ebene aus und sah einen langen, leeren Gang vor sich. Sein Arbeitsraum lag ganz am Ende. Er musste an zahlreichen Türen von Kollegen vorbei, und hinter jeder davon konnte Izgaat auf der Lauer liegen.
Möglichst leise eilte Doynschto den Gang entlang. Seine Schritte hallten in seinen empfindlichen Ohren dennoch so laut wie die Trommeln bei einer Bordinparade.
Und selbst wenn ich erwischt werde – ich kann nichts dafür, es war die dreimal vergrammelte Röhrenbahn! Ich bin sonst immer pünktlich, und ich habe so viele Überstunden, dass ich zehn Tage zu Hause bleiben könnte ...
Er hatte den Eingang zu seinem Arbeitsraum fast erreicht, als sich direkt neben ihm eine Tür öffnete.
»Doynschto!«
Erschrocken fuhr er zusammen, geriet ins Straucheln und wäre beinahe gestürzt.
Erwischt!, dachte er panisch. Jetzt schmeißt Izgaat mich raus!
Aber es war nicht Izgaat, der seinen Namen gerufen hatte. Es war Lexayny, eine junge Kollegin. Sie war keine Zerebralpflegerin, sondern eine Wartin in der Ausbildung. Sie hatte noch nicht direkt mit den Ceynachs zu tun, sondern sorgte lediglich dafür, dass die technischen Anlagen funktionierten.
Mit großen Augen sah sie Doynschto an, der reflexartig in eine Art Abwehrstellung gegangen war. Er hatte Lexayny stets als schüchtern, sogar ziemlich verhuscht wahrgenommen und nahm an, dass seine Reaktion sie mehr erschreckt hatte als sie ihn.
»Was machst du hier? Bist du gerade erst gekommen?«, fragte sie vorsichtig.
»Ein Unfall in der Röhrenbahn«, sagte er kurz angebunden. Er wollte nichts anderes als an seine Arbeit. Er hatte Lexayny im Verdacht, dass sie ihn anhimmelte und eine Paarung anstrebte. Nichts lag ihm ferner. Er wünschte weder eine Partnerin noch Kinder – das eine brachte das andere meist mit sich. Es gab genug Spreu, er musste nicht zur Verbreitung weiterer Spelzen beitragen. »Deswegen ...«
»Wollen wir später zusammen in die Pause gehen?«, fragte sie.
Grimmasch, die ist aber hartnäckig! Doynschto wollte kein Aufsehen erregen, hatte allerdings keine Lust, auf Lexaynys Avancen einzugehen. »Du siehst selbst, ich bin spät dran, also werde ich heute keine Pause machen.« Er senkte entschuldigend die Ohren. »Nächstes Mal vielleicht.«
Ohne auf eine weitere Reaktion zu warten, zog er seinen Dienstausweis und öffnete damit die Tür.
Und stand Izgaat gegenüber. Vor Schreck hätte Doynschto beinahe seine Karte fallen gelassen.
Izgaat hatte sich an den Tank gelehnt, in dem Trägerkörper auf die Transplantation vorbereitet wurden, und die langen Arme vorwurfsvoll verschränkt.
»Ach, der hohe Raytscha geruht, auch mal an seiner Arbeitsstelle zu erscheinen? Ich hoffe, du hast gut geschlafen, Doynschto.« Seine Stimme troff vor Hohn.
Doynschto konnte nicht antworten. Die Worte blieben ihm wie altes Heekobrot im Hals stecken.
Izgaats rote Augen funkelten wütend. Doynschto hielt nicht viel von solch lyrischen Umschreibungen, aber in diesem Moment hatte er tatsächlich das Gefühl, dass gleich kleine Blitze aus den Augen des Zerebralaufsehers schießen und ihn durchbohren würden.
»Wo warst du, Doynschto?«, fragte sein Vorgesetzter anklagend. »Du solltest bereits seit fünfzig Aliss bei der Arbeit sein. Du bist heute für die Passivierung der neuen Ceynachs zuständig!«
»Ich ... äh ...«, stammelte Doynschto. Im Angesicht des wütenden Izgaat waren seine ganzen Argumente wie weggeblasen.
»Ich habe ihn aufgehalten, Izgaat«, sprang ihm Lexayny zur Seite. »Habe ihn auf dem Gang angesprochen, und wir sind ins Schwatzen gekommen.«
Warum tut sie das? Ich will das nicht!
Izgaats breite Lippen verzogen sich abfällig. »Eine halbe Liss lang? Das glaube ich nicht. Langsam ist das Maß voll, Doynschto. Mach dich an die Arbeit, und wenn du heute Abend nicht die vorgegebene Passivierungsquote erfüllt hast, wird das Konsequenzen für dich haben.« Er hob die Hand und drohte mit dem verkümmerten zweiten Daumen. »Ernsthafte Konsequenzen, die dir überhaupt nicht gefallen werden. Hast du verstanden?«
Doynschtos Ohren sanken herab. Er fühlte sich elend. »Ja, Izgaat.«
Der Zerebralaufseher eilte zur Tür, wo er sich noch einmal umdrehte und Lexayny anherrschte: »Und du machst gefälligst weiter!« Dann knallte er die Tür hinter sich zu.
Kurz herrschte peinliche Stille.
»Tja«, sagte Lexayny. »Dann geh ich mal wieder arbeiten.«
»Ja«, antwortete Doynschto tonlos und wartete, bis sie gegangen war. Dann ließ er sich auf den Laborstuhl sinken.
3.
Dagor
Das Gefühl der Hilflosigkeit verwandelte sich langsam, aber sicher in Zorn. Perry Rhodan wurde wütend. Es half ihm aber nichts: Er schwebte nach wie vor in der Leere, ohne zu wissen, was mit ihm geschehen war und was er dagegen tun konnte. So gesehen, verwandelte sich die Hilflosigkeit nicht – sie bekam nur einen bösen Gefährten.
Erneut forschte er nach hilfreichen Erinnerungen. Leydens Gerede von Superimpulsen. Wie so oft hatte sich der Wissenschaftler völlig in seinem Element befunden und sich in seinem Fachchinesisch verheddert. Doch die Sache mit dem weiträumig anmessbaren hyperenergetischen Superimpuls war einigermaßen deutlich.
Ist womöglich auch anderen dasselbe zugestoßen wie mir?, fragte er sich beunruhigt.
Gucky ... Der Ilt war mit Rhodan zusammen in der Zentrale gewesen, als es passiert war. Vielleicht konnte der Mausbiber ihm helfen.
Gucky, hörst du mich?, dachte er intensiv. Der Ilt war dafür bekannt, dass er seine telepathischen Finger selten bei sich behalten konnte. Und diese Art der Kontaktaufnahme hatte schon häufiger funktioniert. Dieses Mal verhallten Rhodans mentale Rufe jedoch ohne Reaktion.
Telepathisch antworten kann mir Gucky zwar nicht. Aber er ist sonst fast immer prompt zu meiner Hilfe gekommen. Allerdings: Selbst wenn Gucky reagiert hat und nun direkt neben mir steht – ich würde es gar nicht mitbekommen.
Dieser Gedanke machte Rhodan nur noch zorniger. Ich will hier raus! Wo auch immer ich bin: Ich habe noch so viel zu tun!
Gerade erst hatte es so ausgesehen, als ob endlich wieder Ruhe in dem kleinen Sternenreich der Menschen einkehren würde. Sie hatten es geschafft, das Solsystem von den Gon-Mekara zu befreien, dennoch warteten zahlreiche neue Aufgaben. Nicht zuletzt war die Erde noch immer im Akonsystem, und sie mussten einen Weg finden, sie samt dem irdischen Mond zurückzubringen. Stattdessen war Rhodan zur Untätigkeit verdammt.
Zur Hilflosigkeit und Wut gesellte sich die Ungeduld. Und sie war fast das Schlimmste.
Er wusste nicht, wie lange es dauerte, aber irgendwann änderte sich etwas.
Was ist das? Werde ich ... bewegt?
Rhodan konnte nicht spezifizieren, woran genau er das zu merken glaubte. Vielleicht hing es mit seinem Astronautentraining zusammen, das gefühlt eine Million Jahre zurücklag. Er hatte jedenfalls mit einem Mal den Eindruck, dass sich etwas an der Schwerkraft änderte. Vielleicht war es auch lediglich sein Wunsch, dass sich endlich etwas tun sollte.
Trotzdem, irgendwas sagte ihm, dass tatsächlich etwas mit ihm geschah. Konnte denn etwas geschehen? Gab es das Außen noch?
Er glaubte noch immer nicht, dass er tot war. Vielmehr ließ ihn die Idee des Locked-in-Syndroms, die er gehabt hatte, nicht los. Wenn er auf einer Krankenstation lag, würde man sicher erkennen, in welcher Situation er sich befand.
Aber was, wenn nicht? Wenn seine Gehirntätigkeit übersehen wurde, wenn seine Freunde und seine Familie womöglich glaubten, dass er hirntot war und nichts mehr wahrnahm? Wenn sie die Medomaschinen abschalteten, weil sie meinten, dass keine Hoffnung mehr bestand?
Oder noch schlimmer: Wenn einfach gar nichts passierte, um ihn aus diesem erbarmungswürdigen Zustand zu befreien? Wenn er in seinem potenziell unsterblichen Körper gefangen war, auf ewig?
Wie lange kann ich das durchhalten, ohne verrückt zu werden?
Dann eine unerwartete Empfindung: Schmerz. Ein Stechen in ... Wo genau? In seiner Schläfe? In seinem Schädel? Er konnte es nicht richtig verorten. Jedenfalls tat es höllisch weh. Hätte er gewusst, wie – er hätte laut aufgeschrien.
Nur wenige Sekunden später verspürte er eine bleierne Müdigkeit. Vielleicht war es sogar eine gute Idee, eine Weile zu schlafen. Wenn er danach aufwachte, war der Albtraum hoffentlich vorbei.
Nein! Er riss sich mental zurück, drängte die Müdigkeit in den Hintergrund. Etwas versucht, mich einzuschläfern. Das lasse ich nicht zu!
Etwas? Oder eher jemand? Wer tat ihm das an?
Vielleicht ist es ein Arzt auf der Medostation ... Sam Breiskoll oder Sud. Muss ich operiert werden und soll deswegen in Narkose?
Das wäre eine Möglichkeit. Dann durfte er sich nicht dagegen wehren. Dann war es eventuell notwendig, dass er schlief.
Rhodan glaubte allerdings nicht ernsthaft daran.
Für eine Narkose bekommt man doch keine Spritze in den Kopf!
Nein, seine Intuition sagte ihm, dass er sich nicht betäuben lassen durfte. Was auch immer ihm injiziert wurde, er würde dagegen ankämpfen.
Ein weiterer Stich. Eine neue Welle Müdigkeit. Rhodan hielt dagegen, wehrte sich. Es war ein bisschen wie im Trainings-Dagorkampf gegen Thora: Druck und Gegendruck, Halten und Stoßen, nur nicht nachlassen.
Schade, dass mir mein körperliches Dagortraining derzeit nichts nutzt. Nur die mentale Stärke, die beim Training ebenfalls geschult wird.