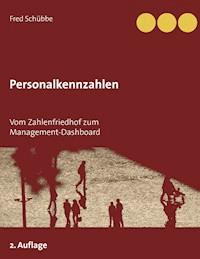
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Welche Personalkennzahlen brauchen Sie wirklich? Wie vermeiden Sie den Informations-Overkill, ohne wirklich Wichtiges zu übersehen? Diese und viele andere Fragen beantwortet dieses Buch und begleitet Sie auf Ihrem Weg vom Zahlenfriedhof zum Management-Dashboard. Über 100 Personalkennzahlen werden in einem übersichtlichen Katalog erklärt und Sie erfahren, worauf es bei ihrer Verwendung ankommt. - Systematisch und richtig, von Anfang an - Fehler vermeiden, Effizienz erhöhen - Die "richtigen" Kennzahlen auswählen - Ansprechend darstellen - gut verkaufen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort zur zweiten Auflage
Werden Personalkennzahlen
überhaupt noch gebraucht?
Nicht selten habe ich mir diese Frage gestellt, wenn ich in den letzten Jahren verfolgt habe, wohin sich das Personalmanagement entwickelt. Beobachtet man aktuelle Diskussionen und Literatur, insbesondere aus dem amerikanischen Raum, gewinnt man den Eindruck, dass die herkömmliche Kennzahl längst abgelöst sei durch ganzheitliche Analysen und hoch entwickelte Prognosetools, die –durch mobilen Zugang von überall erreichbar- dem Manager die richtigen Entscheidungen vorgeben oder sie ihm sogar abnehmen. Wer braucht noch eine Fluktuationskennzahl zur Analyse der Austritte (oder überhaupt einen Personaler), wenn der geeignete Kandidat für eine vakante Position durch ausgeklügelte Algorithmen und den Zugang zu Persönlichkeitsprofilen vollautomatisch gesucht und gefunden wird?
Die Realität sieht bisweilen noch anders aus. Jede Technologie braucht von den ersten Installationen bis zur flächendeckenden Verbreitung einen längeren Zeitraum. Bestehende Systeme müssen zunächst einmal "ihr Geld verdienen" und werden trotz verfügbarer Neuerungen nicht vor Ende der Abschreibungsdauer abgelöst. Verfügbare Budgets werden auch nicht unbedingt vorrangig für die Ablösung von Personalsystemen priorisiert und die Vielzahl der teils konträren Interessen verschiedenster Entscheidungsträger verhindern ein allzu schnelles Ausbreiten neuer Technologien. Damit ist nicht nur der in Ländern mit starker Mitbestimmung vorhandene eventuelle Hemmschuh "Betriebs- bzw. Personalrat" gemeint. Auch die Personaler selbst sind nicht zwangsläufig Treiber derartiger Veränderungen, denn vielen von ihnen ist klar, dass sich ihre Aufgabenstellung mit dem Ausrollen der jetzt schon technisch möglichen Funktionen nachhaltiger verändern wird, als durch die Einführung von ERP-Software und die Installation des Drei-Säulen-Modells von Dave Ulrich in den letzten Jahrzehnten. Workflows werden in der Lage sein, weit über die bekannte Automatisierung administrativer Schritte hinauszugehen und auch Aufgaben übernehmen können, die bislang die Aufmerksamkeit verschiedener Beteiligter im Unternehmen binden und werden dann ganze Prozessketten abbilden. Von der Kontaktaufnahme des Bewerbers bis zum Vertragsabschluss und seiner ersten Gehaltszahlung erfolgen alle Arbeitsschritte vollautomatisch. Utopie? Sicher nicht. Wirklichkeit? Bisher kaum.
Zurück zu Kennzahlen: Wenn dann also die Ermittlung einer Kennzahl tatsächlich durch künstliche Intelligenz abgelöst sein sollte, wird es aber immer noch diejenigen brauchen, die die Kriterien vorgeben, nach denen ein System prognostiziert, welches Ereignis zukünftig eintritt und anweist, was dann zu tun ist. Sie werden künftig die wahren Entscheidungsträger sein, denn sie bestimmen durch ihre Vorgaben das Verhalten von Systemen, nicht nur für den Einzelfall, sondern als Regel und verfügen damit über Entscheidungsmacht, die weit über die eines einzelnen Managers hinausgeht.
Fred Schübbe
Norderstedt, im Januar 2016
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur zweiten Auflage
Information Overflow
1. Personalkennzahlen entwickeln
1.1. Von der Strategie zur Personalinformation
1.2. Kennzahlen als Mosaikstein im Personalcontrolling
1.3. Auswertungen aus dem Personaldatenbestand
1.4. Personalkennzahlen klassisch bis innovativ
1.5. Kennzahlen bringen Licht in den Dschungel
1.6. Die richtigen Kennzahlen auswählen
1.7. Automatische Ermittlung
1.8. Soll und Ist
1.9. Messen oder fühlen?
1.10. Datenschutz und Mitbestimmung
1.11. Big Data im Personalwesen
2. Personalkennzahlen darstellen
2.1. Kennzahlentypen
2.1.1. Grundzahlen
2.1.2. Relative Zahlen
2.1.3. Indexwerte
2.1.4. Rating-Skalen
2.2. Darstellungsformen von Kennzahlen
2.2.1. Tabellen
2.2.2. Diagramme
2.2.3. Symbole
2.3. Zeitlicher Bezug von Kennzahlen
3. Personalkennzahlen verstehen
3.1. Betrachtungsobjekte von Personalkennzahlen
3.1.1. Personal
3.1.2. Personalarbeit
3.1.3. Strategieverfolgung des Personaleinsatzes
3.2. Inhaltliche Strukturierung von Kennzahlen
3.3. Qualitative Kennzahlen
3.4. Kennzahlenvergleich - Benchmarking
3.5. Scorecards
3.6. Externe Quellen für Vergleichszahlen
3.6.1. Selbstorganisierte Peer-Groups
3.6.2. Hochschulprojekte
3.6.3. Teilnahme an Benchmarkingprojekten
3.6.4. Öffentlich zugängliche Datenquellen
4. Kennzahlenkatalog
4.1. Personalbestand
4.2. Personalstruktur -Bestand-
4.3. Personalstruktur -Veränderungen-
4.4. Personalbewegungen
4.5. Personalbedarf
4.6. Personalbeschaffung
4.7. Personalabbau / -freisetzung
4.8. Vergütung
4.9. Kosten und Ertrag
4.10. Zeitwirtschaft
4.11. Gesundheit
4.12. Führung
4.13. Bildung und Entwicklung
4.14. Motivation / Commitment
4.15. Personal intern
5. Vom Kennzahlensystem zum Themendashboard
5.1. Aufbau von Themendashboards
5.2. Dashboard Personalrisikomanagement
5.3. Dashboard Demografische Entwicklung
5.4. Dashboard Gesundheit
5.5. Dashboard Recruiting
5.6. Dashboard Kosten
6. Schlussbetrachtung
Fünf wichtige Punkte für den Erfolg
7. Stichwortverzeichnis
"Wir ertrinken in Informationen, aber hungern nach Wissen"
John Naisbitt
Amerikanischer Zukunftsforscher
Information Overflow
Orts- und zeitunabhängig stehen Informationen in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Sie erreichen uns über Gespräche, Eindrücke, Berichte, Schriften und Bilder. Die elektronischen Medien ermöglichen eine beliebige, aufwandslose Vervielfältigung und schaffen Transportzeiten praktisch ab. In einer durch digitale Medien bestimmten Welt ist die produzierbare und verfügbare Menge an Informationen nicht mehr durch materialbedingte Restriktionen begrenzt oder begrenzbar. Während in einer Welt ohne digitale Medien die nennenswerte Bereitstellung von Informationen nur unter Einsatz von finanziellen Mitteln oder durch den (begrenzten) Zugang zu den vorhandenen Medien möglich war ("Wissen ist Macht"), kann durch Digitalisierung, sowohl im privaten, als auch im geschäftlichen Bereich jeder Informationen beliebiger Art und beliebigen Inhaltes generieren, verbreiten und auch erlangen. Soziale Netzwerke, leicht handhabbare Datenformate, jederzeit verfügbare Informationszugänge verhindern es, dass Informationen vor ihrer Verbreitung einen qualitativen Filter passieren müssen. Sie vermehren und verbreiten sich unabhängig von ihrer Relevanz, ihrem Wahrheitsgehalt und ohne Rücksicht darauf, ob ihre Entstehung und Verbreitung beabsichtigt oder gewünscht sind. Ereignisse bleiben nicht mehr deshalb unbemerkt, weil es nicht gelingt, sie zu dokumentieren, sondern eher, weil die Dokumentation im Überfluss der Datenmenge nicht wahrgenommen wird.
Gesellschaftliche Verflechtungen, insb. auch internationale Kooperationen und Zusammenschlüsse, potenzieren die Informationsmenge und deren Vernetzungen. Die Zunahme von Komplexität in Organisationsstrukturen stellt nicht nur höhere Anforderungen an die Gestaltung von Entscheidungsprozessen, sondern vervielfacht auch die Menge der mit ihnen verbundenen Daten. Insbesondere dann, wenn Organisationsstrukturen nicht passgenau aufeinander abgestimmt sind, kommt es zu Datenredundanzen und -verlusten. Matrixorganisationen, die Einbindung mehrerer Kompetenzträger und unklare Berichtsstrukturen generieren ihrerseits eine erhöhte Datenmenge bei steigender Unübersichtlichkeit. Die Notwendigkeit im internationalen Umfeld, Vorlagen, Gespräche und Korrespondenz in andere Sprachen zu übersetzen, schafft zusätzliche Anforderungen an die Stringenz der Informationsbearbeitung und erhöht ihrerseits die Menge der vorgehaltenen Daten.
Was auf gesellschaftlicher Ebene ausreichend und in beeindruckenden Zahlen beschrieben ist, findet seinen Niederschlag in der Informationsmenge und -struktur, mit der sich jeder Einzelne im Berufs-, aber zunehmend auch im Privatleben konfrontiert sieht. Untersuchungen ergaben, dass Mitarbeiter bis zur Hälfte ihrer Arbeitszeit mit unproduktiven Tätigkeiten im Bereich des Datenmanagements verbringen. Hierzu zählen vor allem das erfolglose Suchen von Informationen, die Wiederherstellung von verlorenen Inhalten, Versionskontrollen, Angleichung von Datenformaten etc. Hinzu kommt die eigentliche, als produktiv angenommene Arbeit mit den Daten. Im Rahmen dieses Umfeldes des Datenchaos wachsen gleichzeitig die Anforderungen, die an die auf Basis dieser Daten zu treffenden Entscheidungen gestellt werden. Die zeitlichen Rahmen, die zur Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen, werden enger. Der Handlungs- und Kostendruck, dem sich viele Unternehmen ausgesetzt sehen, schlägt sich in kürzeren Produktionszeiten nieder. Nicht nur der zeitliche Druck steigt, auch die Tragweite von Entscheidungen nimmt zu, da gleichartige Themen vielfach gebündelt oder durch Migrationen auch rechtlich unter einem Dach bearbeitet werden. So betrifft eine Entscheidung zunehmend nicht nur kleine Einheiten oder bindet geringe finanzielle Beträge, sondern tangiert beispielsweise ganze Unternehmen und Konzerne, wenn Funktionen zentral gebündelt sind. Immer weitergehende Verknüpfungen von Daten suggerieren die Möglichkeit, Entscheidungskompetenz an die Systeme abzugeben – gefährlich, wenn die Übersicht über die Zusammenhänge verloren gegangen ist.
Die beschriebenen und auf vielen Ebenen erlebbaren Entwicklungen machen deutlich: Es wird darauf ankommen, das Informationszeitalter als solches zu begreifen. Dazu gehört unter anderem, dass sich Unternehmen professionell mit der Transformation von Daten zu Informationen beschäftigen müssen. Es ist notwendig, das Speichern der Daten und den Datenzugriff sicher und gleichzeitig komfortabel zu gestalten. Das Erstellen und Aufbewahren von Daten muss ebenso Regeln unterliegen wie deren Vernichtung. Die komplexen Herausforderungen des Informationsmanagements sind längst aktuell und keine Bestandteile von Zukunftsszenarien mehr. Das Ende der Entwicklung ist jedoch weder erreicht noch in Sicht. Man schätzt, dass sich das Volumen an digital vorliegenden Daten jährlich bis alle zwei Jahre verdoppelt. Internet of Things und das Wachstum der Schwellenländer gelten als die Haupttreiber dieser Entwicklung1.
Diese Beobachtungen sind unternehmensunabhängig und fachbereichsübergreifend gültig und betreffen das private wie das professionelle Umfeld. Das Überleben im Datendschungel wird auch für die Generation der "Digital Natives" eine Herausforderung werden. Wer es schafft, sich als Individuum oder Unternehmen in diesem Umfeld sicher zu bewegen, und die Spreu vom Weizen zu trennen, wird gegenüber Mitbewerbern klare Vorteile haben. Diese spezielle Form der Methodenkompetenz wird sich zu einem Alleinstellungsmerkmal entwickeln, das kaum durch Anderes zu kompensieren sein wird.
Der dargestellte Hunger nach Informationen führt auch im Personalwesen dazu, dass Kennzahlen nahezu unabhängig von den sich verändernden Schwerpunktthemen immer Konjunktur haben. "Personalcontrolling mit Kennzahlen", "Balanced Scorecard für HR" und ähnlich heißen Veranstaltungen, die scharenweise Besucher anziehen und bei den Ausrichtern vermutlich für volle Kassen sorgen. Zu Recht suchen Unternehmen Wege, um die zunehmende Komplexität zu beherrschen. Kennzahlen können ein Hilfsmittel auf dem Weg dorthin sein. Leider wird der Weg oft falsch herum beschritten. Mehr oder weniger wahlfrei werden Kennzahlen ausgewählt und ermittelt. Erst im zweiten Schritt sucht man dann nach einer Anwendungsmöglichkeit und in einem (oft auch vernachlässigten) dritten Schritt folgt die Frage, ob man aus der ausgewählten Kennzahl überhaupt eine –möglichst strategisch relevante- Aussage ableiten kann. Die Ermittlung einer Personalkennzahl steht jedoch erst am Ende einer Kette von Überlegungen, die nicht in der Personalabteilung beginnt. Was ist die Strategie des Unternehmens und wie können wir mit Hilfe von Daten sichtbar machen, ob wir uns dem Ziel dieser Strategie nähern? Welche Verhaltensweisen unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner geben Auskunft darüber, ob die Mitglieder unserer Belegschaft unsere Strategie unterstützen? Lange Zeit hat sich das Personalcontrolling auf die technische Funktion der Kennzahlenermittlung konzentriert, seine Fähigkeiten in diesem Bereich ausgebaut oder sich in vielen Fällen auch darauf ausgeruht. Nach wie vor ist keine Ressource so wenig professionell gesteuert wie die personelle, obgleich die Beteuerung, dass aller Unternehmenserfolg vom Personal abhinge, fast einem Mantra gleich wiederholt wird. Die Art und Weise der Präsentation von Personalkennzahlen in vielen Unternehmen (erkennbar z. B. in veröffentlichten Personalberichten) gibt Auskunft darüber. Diese Vernachlässigung kann -auch angesichts der sich verändernden Herausforderungen an die Personalfunktion durch den demografischen Wandel- heute nicht mehr akzeptiert werden. Personalkennzahlen werden also weiter Konjunktur haben, ihre unreflektierte Ermittlung und Publikation reicht aber nicht mehr aus, um dem Management eine wertvolle Unterstützung zu sein.
Deshalb geht es auch in diesem Buch primär um die Ermittlung von Personalkennzahlen, denn das notwendige Handwerkszeug ist nach wie vor unverzichtbar. Die unternehmensindividuelle, auf die vorhandene Strategie ausgerichtete Zusammenstellung und Ausprägung bleibt aber Aufgabe des Anwenders. Einige kritische Anmerkungen zu Detailthemen und auch zu einigen sehr verbreiteten Kennzahlen sollen Argumente liefern, im Rahmen der Professionalisierung des Personalcontrollings von bekannten Wegen abzuweichen und neue zu erkunden. Ein Ausblick auf die nächsten Entwicklungsstufen im Rahmen der "Big-Data"-Diskussion rundet das Bild ab.
1 Tatsächlich gehen die Schätzungen über die Entwicklung des Datenvolumens aufgrund der Unübersichtlichkeit und fehlenden Standardisierung weit auseinander.
Teil I
1. Personalkennzahlen entwickeln
1.1.Von der Strategie zur Personalinformation
Das Steuern eines Unternehmens hat -vereinfacht dargestellt- viele Parallelen mit dem Führen eines Schiffes. Das Ziel ist es, sicher und schnell einen Hafen zu erreichen. Mehrere Routen führen zu diesem Hafen und es gibt für die Wahl jeder Route gute Argumente. Die eine Strecke ist länger, aber führt durch ruhigeres Gewässer. Die andere verspricht ein schnelleres Ankommen, aber das Fahrwasser ist unruhig und verlangt von der Crew mehr Einsatz, Kenntnisse und Erfahrung. Der Kapitän hat über die bevorzugte Route zu entscheiden. Ihm stehen Navigationsinstrumente, Karten, der Funkkontakt zu anderen Schiffen, eine begrenzte Anzahl von Crewmitgliedern und die eigene Erfahrung zur Verfügung. Lotsen, sein Navigator, der Steuermann und andere beraten gemeinsam mit dem Kapitän, welche Route gewählt werden und mit welcher Geschwindigkeit das Schiff die Strecke befahren soll. Kennen alle Informationsgeber das wahre Ziel und die Strategie des Kapitäns? Wissen sie beispielsweise, dass die geladene Ware nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zielhafen gewinnbringend verkauft werden kann? Oder kennen sie die Absprachen mit der Konkurrenzreederei über die Vermeidung gleicher Handelsrouten? Wissen sie, worauf es bei der Entscheidungsfindung wirklich ankommt? Wie wählen sie die Informationen aus, die sie dem Kapitän geben, ohne über Handlungszwänge, Präferenzen und Hintergründe informiert zu sein? Ist es ihnen nicht möglich, Informationen nach Relevanz auszuwählen, werden sie zwangsläufig alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen ungefiltert präsentieren. Im entstehenden Informations-Tsunami wird es dem Kapitän schwerfallen, zeit- und sachgerecht zu entscheiden.
Die Wirkungskette ist bereits vielfach und deutlich beschrieben worden. Aus der Unternehmensstrategie leitet sich die Personalstrategie ab. Stehen beispielsweise die Zeichen auf Wachstum, wird das Personalmanagement dieses mit dem Auf- und Ausbau geeigneter Instrumente, insb. im Bereich des Personalmarketings und der Rekrutierung unterstützen. Das Personalcontrolling wird seinen Schwerpunkt wiederum auf die Informationsversorgung und die Steuerung genau dieser Themen legen.
Abb. 1: Einbindung der Personalfunktionen in das Unternehmensmanagement
Es wird die Prozesse hinsichtlich ihrer Effizienz untersuchen und Kennzahlen liefern, die z. B. Besetzungsnotwendigkeiten und -erfolge aufzeigen. Gleichzeitig wird es einen Fokus auf die Identifikation und Bewertung von Risiken legen, die in der gegebenen Unternehmens- und Personalsituation relevant sind. Erfolgsentscheidend ist also die Art, wie das Personalmanagement in die Unternehmensführung eingebunden ist. Ist dies in ausreichendem Maße der Fall, kann das Personalcontrolling durch Bereitstellung adäquater Informationen dafür sorgen, dass "informierte Entscheider2" in der Lage sind, im Sinne ihrer Strategie zielorientiert zu handeln und der daraus resultierende Erfolg nicht das Ergebnis einer Verkettung von Zufällen wird.
1.2.Kennzahlen als Mosaikstein im Personalcontrolling
Im Personalcontrolling wird zwischen operativen und strategischen Elementen unterschieden. Das Ziel eines strategischen Personalcontrollings lässt sich erreichen, wenn die operativen Bestandteile sicher beherrscht werden. Zwar können diese nach erfolgreicher Implementation weitestgehend automatisiert betrieben werden, es ist jedoch nicht möglich, ohne sie ein strategisch ausgerichtetes Personalcontrolling zu betreiben. Dies wird vielfach übersehen oder aufgrund des vom Management aufgebauten Erfolgsdruckes vernachlässigt. Einen Belastungstest wird ein solches Personalcontrolling nicht bestehen, denn den Antworten fehlt es an Unterbau mit Substanz. Wie ein Haus muss das Personalcontrolling vom Fundament aus gebaut werden. Nachträglich lassen sich versäumte "Bauabschnitte" nicht ohne Verzicht auf Stabilität hinzufügen.
Die beim Aufbau des Personalcontrollings zunächst notwendige Basisarbeit hat rein operativen Charakter. Hierzu zählen die Ermittlung des Personalbestandes, das Erstellen von Personal- und Personalkostenstatistiken ebenso wie ein Standardreporting mit unkommentierten, quantitativen Angaben zur Personalsituation. Erst, wenn diese Instrumente zuverlässig und dauerhaft etabliert wurden, können die nächsten Schritte folgen. Diese sind dann, auf den rein operativen Instrumenten aufbauend, schon stärker strategisch oder zumindest Strategie unterstützend ausgerichtet. Kennzahlen gehören dazu, sofern sie nicht willkürlich ausgewählt, sondern auf Basis der Unternehmensstrategie ermittelt wurden und einen Zielbezug aufweisen. Ebenso wird eine nächste Stufe erreicht, wenn das Personalcontrolling herausgegebene Kennzahlen kommentiert, also mit Themen des weiteren Umfelds verknüpft, Zusammenhänge herstellt und bewertet.
Die Konzentration auf die Ermittlung von Personalkennzahlen an dieser Stelle könnte den Eindruck erwecken, dass ihre Ermittlung allein die Zielerreichung des Personalcontrollings sicherstellen würde. Richtig ist jedoch, dass Personalkennzahlen Mosaiksteine sind, aus denen nur in Verbindung mit anderen Elementen ein erkennbares Gesamtbild wird. Daher ist es sinnvoll, den Bestand an sofort oder nach Vorbereitung verfügbaren Personalkennzahlen zu kennen und diese dann im Gesamtkontext der zu bearbeitenden Aufgabenstellung zu verwenden.
Für die Köche unter den Lesern: Allein mit einem Schrank voller Gewürze lässt sich kein Essen auf den Tisch bringen. Beim Kochen aber auf eine Vielzahl an Gewürzen zurückgreifen zu können, ist eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Zubereitung.
Wenn nachfolgend von Personalkennzahlen die Rede sein wird, dann sind diese immer als Zutaten, als Gewürze, als einige von vielen Bestandteilen des Personalcontrollings zu verstehen.
1.3.Auswertungen aus dem Personaldatenbestand
Die Datenbasis für die Aufbereitung von Personalkennzahlen ist in den meisten Fällen das operative Personalsystem des Unternehmens. Nicht in allen Unternehmen liegen alle notwendigen Daten in einem gemeinsamen System vor, so dass ggf. mehrere Datenquellen für die Aufbereitung von Kennzahlen benötigt werden. Dies stellt dann eine besondere Herausforderung dar, da Inkonsistenzen nicht ungewöhnlich sind und bei der Ermittlung erkannt und berücksichtigt werden müssen. Außerdem muss zwischen den Systemen ein gemeinsames Identifikationsmerkmal gefunden werden, um die Daten in einen Zusammenhang zu bringen. Dies wird meist die Personalnummer des Mitarbeiters sein.
Für Zwecke des Personalcontrollings ist ein vom operativen Personalsystem getrennter Datenbestand unabdingbar. Laufende Auswertungen aus dem operativen System führen nicht nur zu einer Mehrbelastung des Systems, sie sind auch gekennzeichnet von einer mangelnden Reproduzierbarkeit, da im operativen System Änderungen erfolgen, die nicht immer historisch korrekt abgegrenzt werden können. So führt die gleiche Auswertung, an mehreren Zeitpunkten durchgeführt, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Datenhaltende Personalsysteme verfügen i. d. R. über konfigurierbare Export-Schnittstellen, die Daten in andere Systeme überführen können. Dabei empfiehlt es sich, einen hinsichtlich der in ihm enthaltenen Mitarbeiter möglichst ungefilterten Datenbestand zu extrahieren und die notwendigen Einschränkungen später vorzunehmen. Die entnommenen Daten werden in ein für Auswertungszwecke geeignetes System importiert und dort ggf. mit anderen Daten kombiniert. In diesem System vereinigen sich die Daten aus mehreren Vorsystemen, indem sie durch ein gemeinsames Identifikationsmerkmal verknüpft werden.
Abb. 2: Primärsysteme und Sekundärsystem
Diese Systemarchitektur und die Auswahl bzw. der Aufbau eines sog. Sekundärsystems gehören zu der Basisarbeit des Personalcontrollings und wird daher in diesem Zusammenhang nicht näher beschrieben3.
1.4.Personalkennzahlen klassisch bis innovativ
Fragt man -auch Fachkundige- nach Personalkennzahlen, so antwortet der überwiegende Teil der Befragten mit den Begriffen "Durchschnittsalter", "Krankenquote" und "Fluktuation". Diese Kennzahlen sind weit verbreitet und die Konzentration der Nennungen auf wenige Elemente macht deutlich, dass das Thema noch sehr eingeschränkt wahrgenommen wird. Trotzdem wird der Anschein erweckt, man könne mit Kennzahlen die Personalarbeit von Unternehmen oder gar das Unternehmen selbst steuern. Dass dies so einfach nicht ist, und dass auch die Frage erlaubt ist, ob sich Personalkennzahlen überhaupt zur Steuerung eignen, wird klar, wenn man sich näher mit der Ermittlung und der Aussagekraft dieser Daten beschäftigt. Aufgrund bestehender Zweifel pauschal auf sie zu verzichten, wäre jedoch auch der falsche Weg, denn fachgerecht ermittelte, empfängerorientiert aufbereitete und qualifiziert kommentierte Personalkennzahlen geben natürlich dem Personal- und Unternehmensmanagement wertvolle Hinweise und Handlungsempfehlungen.
Im Rahmen dieses Buches sind etwa 110 Personalkennzahlen in 15 Gruppen thematisch zusammengestellt worden. Einige von ihnen werden ausführlich kommentiert, besonders jene, welche aus Sicht des Autors gern einmal kritisch hinterfragt werden dürfen. In der Zusammenstellung der Personalkennzahlen sind neben den Bekannten auch einige ungewöhnliche Ansätze zu entdecken. Letztere sollen zum Nachdenken anregen und deutlich machen, dass es nicht immer darauf ankommt, mathematisch-komplexe Analysen auf die Beine zu stellen, sondern dass eine geschärfte Beobachtungsgabe gepaart mit einer Fantasie für Darstellungs- und Kombinationsformen hilft, ungewöhnliche, aber höchst interessante Einblicke in Themen des Personals und des Personalmanagements zu bekommen.
1.5.Kennzahlen bringen Licht in den Dschungel
Die Ermittlung und die Darstellung von Kennzahlen helfen, einer Situation oder Entwicklung ein "Gesicht" zu geben und so aus subjektiven Eindrücken einen objektiven Tatbestand werden zu lassen. Eine Kennzahl generiert daher nichts Neues, sondern ist lediglich eine Darstellung eines zu einem definierten Zeitpunkt oder in einem definierten Zeitraum existierenden Zustands. Kennzahlen schaffen keine Realitäten, sondern bilden diese ab. Sie dienen dazu, ein komplexes Geschehen so zu strukturieren, dass die wesentlichen Informationen und Handlungsnotwendigkeiten zu Tage treten.
Im unstrukturierten Informationsdschungel kann das wirklich Wichtige nicht oder nur zufällig erkannt werden. Dieses Bild erklärt in Teilen die zunehmende Bedeutung von Personalcontrolling und damit auch von Personalkennzahlen in Unternehmen. Im Zusammenhang mit komplexeren Unternehmensstrukturen, kürzeren Entscheidungszeiträumen und steigendem Handlungsdruck wächst die Notwendigkeit, Transparenz zu schaffen. "Gute" Kennzahlen liefern daher die entscheidenden Informationen, ohne unberechtigt zu simplifizieren. Sie objektivieren Argumente, stellen Risiken und Chancen dar und verdichten und strukturieren Einzelinformationen so, dass der Informationsempfänger überhaupt eine Chance hat, ihren Gehalt in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit aufzunehmen. Die Anforderungen an ihre Darstellung wachsen gleichermaßen. Während sich vor Jahren Kennzahlen und Kennzahlensysteme noch in Form von Datenblättern verkaufen ließen, werden heute farblich ausgearbeitete oder sich bewegende Darstellungen erwartet. Ampeln, Cockpits oder animierte Grafiken ersetzen die Zahlenfriedhöfe früherer Zeiten. 3D-Cubes, von allen Seiten zu betrachtende Datenmengen, die nach beliebigen Kriterien flexibel gefiltert und in ihrer Granularität verändert werden können, sind jedoch meist noch Zukunftsmusik. "Simplify your Life", auch im Controlling.





























