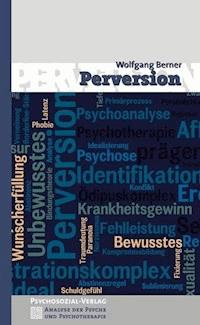
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Psychosozial-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Analyse der Psyche und Psychotherapie
- Sprache: Deutsch
Das Studium der Perversionen eröffnete Freud tiefe Einsichten in die Funktionsweise von Sexualität und Erotik, die für seine Theoriebildung über die menschliche Psyche von entscheidender Bedeutung waren. Viele dieser Einsichten haben bis heute ihre Gültigkeit, viele wurden inzwischen ergänzt und differenziert. Heute wird der Begriff der Perversion im Kontext der Psychiatrie kaum mehr verwendet, sondern zunehmend durch die Bezeichnungen 'Paraphilie' oder 'Störung der Sexualpräferenz' ersetzt. Dennoch bezeichnen diese Termini keine identischen Phänomene, wie der Autor in der Auseinandersetzung mit den Gründen der Neudefinition anschaulich darlegt. Ein zentrales Anliegen des Bandes ist es, zu zeigen, dass und wie die klassische Psychoanalyse – etwa bei Fetischismus, Exhibitionismus oder Sadismus – hilfreich sein kann. Dabei werden die für eine Perversionstherapie notwendigen Parameter betrachtet und auch weitere mögliche Therapieformen vorgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolfgang Berner
Perversion
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
E-Book-Ausgabe 2012
© der Originalausgabe 2011 Psychosozial-Verlag
Walltorstr. 10, D-35390 Gießen
Fon: 06 41 - 96 99 78 - 18; Fax: 06 41 - 96 99 78 - 19
E-Mail: [email protected]
www.psychosozial-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung & Layout: Hanspeter Ludwig, Gießen
www.imaginary-art.net
Satz: Andrea Deines, Berlin
Inhalt
Einleitung
Der Begriff der Perversion wird heute im Kontext der Psychiatrie und Psychotherapie kaum noch benutzt. In den psychiatrischen Klassifikationssystemen wird er durch die Bezeichnung »Paraphilie« (DSM-IV-TR) oder durch »Störung der Sexualpräferenz« (ICD-10) ersetzt. Die Gründe dafür sind vielfältig, und ihre Darstellung wird mir die Gelegenheit geben, deutlich zu machen, warum der alte Begriff der Perversion und die neuen Begriffe nicht dieselben Phänomene bezeichnen. Der Perversionsbegriff wird heute vorrangig in der Psychoanalyse verwendet, scheint aber auch dort schon lange nicht mehr ausschließlich das zu bezeichnen, was Sigmund Freud ursprünglich damit gemeint hatte.
In den ersten Kapiteln dieses Buches wird es zunächst um eine Begriffsklärung gehen, bevor die damit bezeichneten Phänomene behandelt werden können. Ein kurzer Ausflug zu den »Grenzlinien zwischen Körper und Psyche«, die Freud veranlassten, seine Triebtheorie mit den beiden Grundkräften Libido und Destrudo zu konzipieren, soll zeigen, wo wir heute (in der Biologie und Psychologie) diese Grenzlinie ziehen könnten. Freud verstand den Trieb als »Arbeitsauftrag des Körpers an die Psyche«. Gerade bei der Sexualität kann man an diesen »Arbeitsaufträgen« nicht vorbeigehen. Die neueren Konzepte aus Biologie und Evolutionspsychologie haben das, was als »Störung der sexuellen Präferenz« bezeichnet wird, beeinflusst und in indirekter Form auch unsere Vorstellungen von der Perversion im psychoanalytischen Sinn.
Die meisten ursprünglich von Richard von Krafft-Ebing (zwischen 1886 und 1902) als »Perversionen« beschriebenen Phänomene, die später von Freud einer psychodynamischen Betrachtung und Interpretation unterzogen wurden, sind heute noch anzutreffen und werden in den folgenden Kapiteln exemplarisch (eine Enzyklopädie der Perversion ist nicht zu leisten) und mit Fallbeispielen beschrieben, so wie man ihnen in der psychotherapeutischen Praxis begegnet.
Die psychodynamischen Ansichten über die Entstehung von Perversionen haben sich stark verändert. Die Frage, ob diese Veränderungen mehr geänderten Blickwinkeln oder ob diese neuen Blickwinkel neuen Erkenntnissen entsprechen, muss einstweilen offenbleiben. Liegt es daran, dass die alten Sichtweisen zu wenig therapeutische Effekte zeigten, oder hat das ganze Thema »Sexualität und Erotik« eine neue gesellschaftliche Bedeutung bekommen, die es notwendig macht, ganz andere Erscheinungen zu »pathologisieren« und für behandlungsbedürftig zu erklären, als das vor hundert Jahren der Fall war?
Ein Beispiel der geänderten Sicht ist, dass auch Psychoanalytiker heute geneigt sind, eine erzwungene Kohabitation mit einem heterosexuellen Partner als Perversion zu bezeichnen, besonders wenn diese grob ausbeutenden Charakter hatte und nur dem Spannungsabbau eines der beiden Beteiligten diente. Nach der klassischen Definition handelte es sich dabei keineswegs um eine »Perversion«, sondern höchstens um Egoismus, möglicherweise um einen asozialen Übergriff. Der klassische Psychoanalytiker hätte sich vermutlich gefragt, ob er einen so psychopathisch veranlagten Menschen überhaupt analysieren könne, er wäre aber nicht auf die Idee gekommen, dem Betreffenden die Diagnose »Perversion« zu geben, da er ja keine Probleme hat, das Sexualziel der Kohabitation mit einem dazu geeigneten Partner zu vollziehen.
Aber außerhalb dieser definitorisch kontroversen Fälle möchte ich zeigen, dass wir auch in den »klassischen Fällen« (Fetischismus, Sadismus und Exhibitionismus) zunächst die zugrunde liegende Persönlichkeitsstruktur untersuchen und differenzieren müssen, um entscheiden zu können, welche Form einer psychoanalytischen oder einer anders strukturierten Therapie den Personen angeboten werden kann. Ein Hauptanliegen dieses Bandes wird sein, zu zeigen, dass die klassische Psychoanalyse in einigen dieser Fälle (bei der neurotischen, eventuell auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstruktur) Hilfe bringen kann, dass bei anderen Fällen eine etwas veränderte psychoanalytische Technik zur Anwendung kommen muss und dass in den mit Psychoanalyse nicht behandelbaren Fällen psychoanalytisches Verstehen andere Techniken effektiver gestalten lässt.
Klassifikationen in der Psychiatrie: Störungen der Sexualpräferenz oder Paraphilie
Um zu verstehen, warum sich die Psychoanalyse noch immer der Bezeichnung »Perversion« bedient, ist zunächst zu klären, warum diese Bezeichnung in den empirisch orientierten Wissenschaften aufgegeben wurde. Die Definitionen im Bereich der Psychiatrie sind nur vor dem Hintergrund der Ideologie der modernen psychiatrischen Klassifikationssysteme zu verstehen, die sich erst nach einem schwierigen Einigungsprozess unter Fachvertretern entwickelt haben: Für das »Diagnostic and Statistical Manual« (DSM) – dessen vierte Fassung derzeit im Gebrauch ist – fand dieser Einigungsprozess innerhalb der Mitglieder der Vereinigung amerikanischer Psychiater (APA) statt; für die »Internationale Klassifikation der Krankheiten« (ICD) – deren zehnte Revision in Europa als verbindlicher Standard gilt – innerhalb der Psychiater der Weltgesundheitsorganisation.
Diese Ideologie vermeidet es, sich für eine der kontroversen Konzepte über die ungeklärte Entstehung psychischer Störungen (auch der Krankheitsbegriff wird vermieden) festzulegen, und will Störungen auf einer beobachtbaren Symptomebene definieren, wobei die genannten Symptome jeweils »reliabel« beschreibbar sein müssen – das heißt, mehrere Beobachter würden diese Symptome nach Prüfung des Falles in gleicher Weise sehen und beschreiben können.
Ein weiterer Grundsatz psychiatrischer Diagnostik besteht darin, nur jene Phänomene dem Störungsbegriff zuzuordnen, die tatsächlich eine möglichst objektive und subjektive Funktionseinschränkung (Leiden) für den Betroffenen bedeuten. Gerade in jenen Bereichen, in denen eindeutige körperliche Funktionseinschränkungen – das Definitionsmerkmal körperlicher Krankheiten – fehlen, ist Vorsicht und Beschränkung geboten, um der Gefahr zu entgehen, dass die Medizin als Sanktionsmittel von der Gesellschaft missbraucht wird. Das ist besonders bei den sogenannten Persönlichkeitsstörungen und den sexuellen Störungen so. In einer »offenen« demokratischen Gesellschaft gehört der Schutz von Minderheiten zu den Grundprinzipien. Zu solchen Minderheiten gehören auch Menschen mit bestimmten sexuellen Vorlieben, etwa der Neigung zu promisken Beziehungen oder erotischen Fesselspielen. Sie sollen weder direkt noch indirekt zu einer Behandlung gezwungen werden, wenn sie selbst nicht leiden und auch niemand anderen gefährden.
Durch die Erfahrungen des Missbrauchs der Medizin unter bestimmten politischen Verhältnissen gewarnt, haben sich daher die großen internationalen Psychiater-Vereinigungen entschlossen, ihr diagnostisches Instrumentarium von allen moralisierenden und anderen einseitigen Wertsystemen so weit wie möglich freizuhalten und sich auf das zu beschränken, was als die ursprüngliche und anerkannte Aufgabe der Medizin in der Gesellschaft gilt: individuelles (körperliches) Leiden zu benennen (Diagnosen zu stellen) und mit den Maßnahmen zu behandeln, die die Integrität der Person am wenigsten gefährden (Therapien durchzuführen): Nur Leiden, die körperlichen Ursprungs sind oder bei denen ein Zusammenhang mit körperlichem Erleben naheliegt, fallen unter die Zuständigkeit der Medizin. Der Begriff der Störung bezeichnet den großen Übergangsbereich zwischen behandlungsorientierter Psychologie und (psychiatrischer) Medizin.
Da besonders im Bereich der Psychosomatik ein ständiger wechselseitiger Einfluss von Körper und Psyche reflektiert werden muss, bedarf es für diesen Übergangsbereich eines eigenen Begriffs. Das gilt auch – wenn nicht sogar besonders – für sexuelle Vorlieben – etwa die Begeisterung für einen Fetisch –, wobei sich die Frage aufdrängt, ob sie überhaupt als behandlungsbedürftig angesehen werden dürfen.
Diese Frage hat sich besonders an der Homosexualität entzündet, die nach einer heftig geführten Debatte in der amerikanischen Psychiater-Vereinigung zunächst aus dem amerikanischen DSM entfernt wurde und anschließend auch aus der ICD verschwand. Damit war es den Vertretern der homosexuellen Minderheit gelungen, endlich nicht mehr als krank oder prinzipiell gestört im psychiatrischen Sinn bezeichnet zu werden, sondern als eine »Variante des Natürlichen« Anerkennung zu finden.
Ähnliche Tendenzen haben nun auch Interessenvertreter anderer sexueller Vorlieben gezeigt, wie der an BDSM-Interessierten (die Abkürzung bezeichnet Vorlieben für »bondage«, »discipline«, »submission«, »sadism« und »masochism«, um das belastete Wort »Sadomasochismus« zu vermeiden). Sie haben den Anspruch, dass auch ihre Vorlieben nicht als behandlungsbedürftige Störung disqualifiziert werden. Da allerdings nach den genannten psychiatrischen Diagnosesystemen nur diejenigen sexuellen Vorlieben dem Störungsbegriff zugeordnet werden, bei denen eindeutig subjektives Leiden auftritt oder bei denen anderen zugefügtes Leiden eindeutig objektivierbar ist, scheinen die BDSM-Interessierten ohnehin nicht betroffen. Das wäre nur so lange der Fall gewesen, solange man den umfassenderen Begriff »Perversion« beibehalten hätte.
Störung der Sexualpräferenz (ICD-10) beziehungsweise Paraphilie (DSM-IV-TR) wird in den diagnostischen Manualen zunächst allgemein definiert:
wiederkehrende, intensive, sexuell erregende Fantasien, sexuell dranghafte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen, bezogen aufnichtmenschliche Objekte,das Leiden oder die Demütigung von sich selbst oder eines Partners,Kinder oder andere nicht einwilligende bzw. nicht einwilligungsfähige Personen;Dauer der angesprochenen Symptome, um sie als Störung bezeichnen zu können: mindestens sechs Monate;die Störung kann obligaten oder episodischen Charakter haben;sie muss zu Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen Lebensbereichen geführt haben.Diese allgemeinen Definitionsmerkmale werden im DSM-IV-TR als Kriterium A bezeichnet. Das Kriterium B definiert im Einzelnendie Bedingungen der Diagnosen fürPädophilie, Voyeurismus, ExhibitionismusundFrotteurismusauf der einen Seite sowie desSadismusauf der anderen Seite. Während für die ersten vier Diagnosen das »Ausleben« der Störung genügt, wird für den Sadismus die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass dieser einvernehmlich mit einem Partner ausgelebt werden könnte, was dann nicht mehr als behandelbare Störung, sondern als eine »Vorliebe« gelten würde.
Bei Sadismuswird die Diagnose gestellt, wenn die Person das sexuell dranghafte Bedürfnis mit einernicht einverstandenenPersonausgelebthat oder wenn das Bedürfnis zu deutlichem Leiden oder zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten führte. Die übrigen Paraphilien werden diagnostiziert, wenn das Bedürfnis in klinisch bedeutsamer Weise zum Leiden oder zu einer Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen Funktionsbereichen führt.
Bei diesen Definitionen wird deutlich, dass sich auch der Gegenstand, den die Bezeichnung »Störung der Sexualpräferenz« bzw. »Paraphilie« umfasst, von dem unterscheidet, was man früher allgemein als »Perversion« bezeichnet hat. Das war ein sexuelles Erregungsmuster, das das vermeintliche biologische Ziel der Sexualität, nämlich das Zeugen von Kindern durch Kohabitation mit einem heterosexuellen Partner, aufgegeben hat und sich mit einem Teil der damit verbundenen Lust als Hauptziel begnügte. Es handelte sich um eine Art sexueller Ersatzbefriedigung zur Vermeidung von Kohabitation und Prokreation.
Die neuen Begriffe der Paraphilie bzw. der Störung der Sexualpräferenz stellen ein anderes zentrales Definitionsmerkmal in den Vordergrund, und das ist die Beziehungsfeindlichkeit. Die Unfähigkeit, die eigenen sexuellen Bedürfnisse in Gegenseitigkeit mit einem Partner zu teilen und zu entwickeln, wird zum zentralen Merkmal, gleich ob es sich um die Idealisierung eines Fetischs handelt oder einen sadistischen Impuls, der die Angst im Auge des anderen benötigt, um sexuelle Erregung zu erreichen. Darum werden auch in den derzeitigen psychiatrischen Klassifikationen sadomasochistische Arrangements, bei denen beide Partner im gegenseitigen Einvernehmen handeln, nicht mehr als »Störung« eingestuft, sondern als eine private Vorliebe, die für psychologische oder medizinische Therapeuten ohne Belang sind, solange niemand darunter leidet.
Im Einzelnen werden in den Klassifikationen die in der Tabelle genannten Störungen abgehandelt.
Tabelle 1: Die einzelnen Störungen der Sexualpräferenz (ICD-10) bzw. Paraphilien (DSM-IV-TR)
Die letzten zwei Kategorien in der ICD und die letzte im DSM sind besonders wichtig, da es auf der phänomenologischen Ebene eine große Zahl weiterer beschreibbarer Störungen gibt – etwa die Koprophilie (eine Vorliebe für Fäkalien) oder den Amelotatismus (eine Faszination an amputierten Gliedmaßen) –, die als Einzelerscheinungen oder in Kombination auftreten können. Die erstaunliche Vielfalt der beschreibbaren Störungen, unter denen die Betroffenen mehr oder weniger leiden, wirft die Frage auf, wie es wohl möglich ist, dass so ganz unterschiedliche Vorlieben entstehen können, die – besonders wenn sie ausschließlichen Charakter haben – oft nur einer kleinen Minderheit von Menschen – zum weitaus überwiegenden Teil Männern – nachvollziehbar erscheinen. Die anderen stehen zunächst staunend davor und können nicht verstehen, wie diese Vorlieben zur einzigen und ausschließlichen sexuellen Lustquelle werden.
Die veränderte gesellschaftliche Haltung gegenüber dem, was vor etwa 130 Jahren von Richard von Krafft-Ebing und vor etwas mehr als 100 Jahren von Sigmund Freud als »Perversion« bezeichnet wurde, drückt sich in der eben beschriebenen psychiatrischen Klassifikation aus. Aber auch im Rahmen der Psychoanalyse hat sich trotz Beibehaltung des Begriffs das Spektrum dessen, was als Perversion bezeichnet wird, deutlich verschoben, was nur vor dem Hintergrund einer hundertjährigen Entwicklung zu verstehen ist.
Die Entwicklung des psychoanalytischen Perversionsbegriffs
Die »Perversion« bei Sigmund Freud
In den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) definiert Sigmund Freud die Perversion zunächst nicht anders als seine Zeitgenossen: Perversion wäre eine (dauerhafte, nicht nur gelegentlich auftretende) Abweichung vom Sexualziel der Kohabitation. Diese Abweichung könne einerseits (als »anatomische Überschreitung«) andere Körperteile betreffen (etwa eine Vorliebe für Füße im Fetischismus), andererseits auch durch Fixierung auf Handlungen entstehen, die bei den meisten anderen Menschen vorläufige Sexualziele auf dem Weg zur Kohabitation darstellen (etwa das Küssen oder ausschließliches Streicheln): Es handelt sich in beiden Fällen von Abweichungen um Überbetonung von Lustelementen, wie sie auch bei gewöhnlichen sexuellen Begegnungen vorkommen.
Die Abweichung vom Sexualobjekt der heterosexuellen Kohabitation auf ein gleichgeschlechtliches Objekt wird nicht ohne Weiteres zur Perversion gerechnet, sondern ihr als »Inversion« zunächst an die Seite gestellt, was als erster Ansatz verstanden werden kann, die Homosexualität deutlich von den Perversionen abzugrenzen. Dies gilt heute als ganz selbstverständlich, damals aber musste das schon aufgrund des zentralen Definitionsmerkmals – Vermeidung von Prokreation – anders gesehen werden.
Die bei Freudangeführten Detailbetrachtungen entsprechen zum größten Teil einer scharfsinnigen, kritischen Sichtung der Beobachtungen der damaligen Sexualwissenschaft – vor allem jenen von Richard von Krafft-Ebing, Havellock Ellis, Ivan Bloch und Magnus Hirschfeld, ohne dass Freud deren theoretische Schlüsse immer ganz mitvollzogen hat. Das wird deutlich am Beispiel des Fetischismus, bei dem Freud Binets Ansicht, dass es sich dabei um frühe Verknüpfungen scheinbar unbedeutender Wahrnehmungen mit sexueller Erregung handle, zunächst teilt, dann aber hinterfragt, warum solche Verknüpfungen nicht öfter vorkommen und damit eine Vielfalt erregender Gegenstände erzeugen. Damit lenkt er den Blick darauf, dass dieAusschließlichkeit des Fetischs als einzig erregenden Stimulusin diesen Fällen das eigentlich Erklärungsbedürftige sei (Freud 1905, S. 57).
Der neue Blick des Freud’schen Ansatzes besteht in der Beobachtung von Ähnlichkeiten der Phänomenologie der Perversionen mit dem lustvollen Spielen von Kindern mit ihren erogenen Zonen und frühen, damit verbundenen Sexualfantasien (beschrieben als »Partialtriebe«): Bei Perversionen werden die aus oraler und analer Zeit stammenden Sexualbetätigungen überbetont und zur Abwehr der mit Konfliktangst verbundenen genitalen Betätigungen eingesetzt. Auch bei den lediglich durch fließende Übergänge vom Normalen abgegrenzten »Neurotikern« (Hysterie- und Zwangskranken) würden sich gehemmte Tendenzen von infantilen Sexualäußerungen finden, die dem kindlichen Spiel und den damit verbundenen Fantasien entsprechen. Dies ist allerdings nur zu erschließen und nicht direkt zu beobachten, sodass diese Generalisierung bis heute umstritten bleibt – auch innerhalb der psychoanalytischen Schulen.
In späteren Jahren hat sich Freud von der rein phänomenologischen Beschreibung der Perversion (Definition durch beobachtbare Symptome bzw. Handlungen) weitgehend abgewandt und die Perversion nur noch psychodynamisch definiert, also lediglich durch ihre Funktion für das Seelenleben. ImFetischismus(1927) und in derIchspaltung im Abwehrvorgang(1940) wird der Fetisch zum zentralen Definitionselement der Perversion. Die Bezeichnung »Perversion« wird nur mehr für die Formen bizarren Sexualverhaltens benutzt, wo angenommen werden kann, dass Kastrationsangst der Anlass war, einen (körpernahen) Fetisch erotisch zu besetzen und ihm den Vorzug vor der Stimulierung durch den Körper eines Sexualpartners zu geben. Die Perversion wird durch ihre Funktion, vor Kastrationsangst zu schützen, definiert, was im Falle des Fetischismus daran erkannt wird, dass ohne einen solchen Fetisch Kohabitation kaum mehr möglich ist.
»Kastrationsangst« bedeutete ursprünglich für Freud die Angst vor dem Verlust des Lust spendenden Organs – des Penis –, hervorgerufen durch traumatische Erlebnisse im Zusammenhang mit der ersten bewussten Wahrnehmung des Geschlechtsunterschiedes. Der Anblick der Penislosigkeit der Frau lässt den Knaben fürchten, ihm könnte »auch« sein Genitale abhandenkommen. Eine Möglichkeit, die Kastrationsangst zu umgehen, war nach Freud (1927) das Vermeiden des Anblicks des Sexualorgans der Frau – das gleichzeitig stimulierend und Angst auslösend wirkt – und das Abwenden des Blicks auf etwas, was gleichzeitig beruhigend und Sicherheit spendend wirkt: ein Kleidungsstück oder ein anderer Körperteil.
Spätere Autoren haben den möglichen Zusammenhang mit dem von Donald W. Winnicott (1953) beschriebenen »Übergangsobjekt« ausführlich diskutiert. Das Tuch oder Kuscheltier, zu dem das Kind Zuflucht nimmt, wenn es die Trennung von der Mutter nicht erträgt, und das später die Ablösung von ihr erleichtert. Winnicott selbst (ebd.) und einer Reihe weiterer Autoren wie Robert C. Bak (1974) war es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass das »Übergangsobjekt« in der Entwicklung fast aller Kinder eine wichtige Rolle zur Überwindung von Trennungsängsten spiele. Es repräsentiere immer einen Teil der Mutter und erfahre nur ganz selten (erst in der phallischen Phase oder auch noch später) eine Sexualisierung, werde als Masturbationshilfsmittel benutzt und könne so zum Fetisch werden. Bak hebt hervor, dass es auch Fetische gebe, die keinen Bezug zum Übergangsobjekt hätten.
Besonders ausführlich hat sich Phyllis Greenacre (1979) der Frage gewidmet, worin der Unterschied zwischen Übergangsobjekt und Fetisch besteht: Während das Übergangsobjekt meist etwas Weiches und nicht scharf Abgegrenztes sei – es müsse sich gut anfühlen –, wären Fetische oft hart, von großer Konkretheit und oft spiele der Geruch eine wichtige Rolle (siehe das Kapitel zum psychodynamischen Verständnis).
Bei Freud repräsentiert der Fetisch dem durch den Anblick des weiblichen Genitales erschrockenen Jungen denPhallus der Frau. Der Blick heftet sich an einen Körperteil der Mutter oder einen Gegenstand, um den Geschlechtsunterschied nicht wahrnehmen zu müssen. Ein Teil des kindlichen Ichs anerkenne, was es gesehen habe – »die Lücke« –, stelle sich damit der Realität und entwickle sich weiter. Dieser Teil werde aber durch einen Riss (eine Spaltung) vom anderen Teil des kindlichen Ichs getrennt, mit dem das Kind die Wahrnehmung verleugne (so tut, als ob es nichts gesehen hätte – Freud 1940): Ein Leben lang wird dieser verleugnende Teil des Ichs einerseits sexuelles Begehren und Fantasieren bestimmen, andererseits an das ursprüngliche kindliche Niveau der Wahrnehmung gebunden bleiben. Freud hat die Frage nicht ausreichend beantwortet,warumfür manche Männer der Anblick des weiblichen Genitales etwas so massiv Erschreckendes habe, dass sie zum Fetisch Zuflucht nehmen müssten, und für andere dieses »Trauma« durchaus bewältigbar bleibe.
Sheldon Bach hat sehr anschaulich eine Antwort auf diese Frage gegeben, die viele Psychoanalytiker teilen:
»Man könnte mutmaßen, dass in manchen Fällen die ganze Mutter – nicht nur ihr Genitale – traumatisch war. Oder, um es konkreter auszudrücken: dass manche der Kinder, die diesen Anblick traumatisch finden, nicht nur eine fantasierte Lücke im Bereich des weiblichen Genitales entdeckten, sondern eine aktuelle Lücke in der Bezogenheit, und dass so die ganze kindliche Seele mobilisiert wird, um diese Lücke zu verleugnen und zu überbrücken. In bestimmten Fällen kann man diese Fantasie von einem erschreckenden genitalen Nichts als eine ultimative Körper-Metapher für eine Serie von Verlusten ansehen, die in der Angst kulminierten, dass es niemanden gebe, der liebt oder geliebt werden kann« (Bach 1994, S. 12, eigene Übersetzung).
Das mütterliche Genitale scheint in dieser Metapher einen Mangel an Bezogenheit zu repräsentieren, einen Mangel der Bezogenheit der Mutter zu ihrem Kind. Aus diesem Grund hat auch Nikolaus Becker darauf aufmerksam gemacht, dass eine Perversion auch heute noch als Abwehr libidinöser Triebabkömmlinge, die Kastrationsangst heraufbeschwören, konzeptualisiert werden könnte, aber »mit den Besonderheiten der dazugehörenden dyadischen Beziehungsabkömmlinge, die von der Mutter stammen« (Becker 2008, S. 160): Das heißt, das Triebbedürfnis sollte nie ohne die gesamte Objektrepräsentanz, auf die es ursprünglich einmal gerichtet war (die Mutter), gesehen werden.
Psychoanalytische Perversionskonzepte heute
Um die Beziehung zwischen Mutter und Kind geht es auch zunehmend bei jenen psychoanalytischen Autorinnen und Autoren, die sich in den letzten fünfzig Jahren mit dem Thema beschäftigt haben: Robert C. Bak (1953) zum Beispiel war einer der ersten, der bei Fällen von Fetischismus eine Störung der Mutter-Kind-Beziehung beschrieb, die zu massiven Trennungsängsten führte. Phyllis Greenacre (1953, 1955, 1968, 1970 und 1979) beschrieb mehrfach Störungen der Mutter-Kind-Beziehung in den ersten 18 bis 24 Lebensmonaten des Kindes, die zu einer Störung des Körper-Selbst und daraus resultierend des gesamten Selbst-Bildes führten, zu einer Projektion von Aggression auf alle Beziehungsobjekte. Je deutlicher vom primären Bezugsobjekt schon früh Gefahr auszugehen schien, umso mehr wird sich die Kastrationsangst während der dann folgenden phallischen und ödipalen Periode intensivieren.
Masud R. Khan (1983) schlug sogar vor, in Perversionen das Sexualobjekt als »as-if transitional object« (ein Pseudo-Übergangsobjekt) zu sehen. Er bezog sich dabei auf Winnicotts Feststellung, dass in Fällen, in denen es aufgrund mangelnder mütterlicher Haltefunktion zu einer mangelnden Integration von Ich-Funktionen kommt, das Übergangsobjekt (der tröstende Deckenzipfel oder das Kuscheltier) eine ganz andere Funktion und andere Eigenschaften annimmt. Es werde in solchen Fällen zum Fetisch und als Masturbationsmittel benutzt – was sonst mit dem Übergangsobjekt von Kindern kaum bis gar nicht geschehe. Die Konsequenz sei eine spätere Zuflucht zu einem perversen Beziehungsstil und die Vermeidung affektiv warmer und intimer Beziehungen.
Ähnlich argumentiert Joyce McDougall (1985), wenn sie feststellt, dass bei Patienten mit Perversionen oft zu beobachten sei, dass die Mutter-Kind-Beziehung den Prozess stetiger Internalisierung nicht genügend fördern konnte, sodass das Kind nur unzureichend eine autonome psychische Struktur auszubilden vermochte. Der Zusammenbruch der Internalisierungsprozesse führe auch dazu, dass das Kind das Übergangsobjekt nicht ausreichend genug nutze, um sich die Trennung von der Mutter zu erleichtern. Das bedeutet, dass sich in diesen Fällen das Übergangsobjekt nicht wie sonst weiterentwickle, sodass es schließlich die »ganze mütterliche Person« symbolisieren könne. Es bleibe ein hoch erotisierter »Persönlichkeitsteil« (Partialobjekt) mit einer sehr direkten und konkreten Fähigkeit, Lust hervorzurufen (etwa durch Benutzung während der Masturbation).
Deutlich weiter reicht Robert J. Stollers (1975) Perspektive, der die mit der Perversion verbundenen aggressiven Gefühle ganz in den Vordergrund stellt, wenn er Perversion die »erotische Form von Hass« nennt beziehungsweise die Umkehrung einer Niederlage in der Kindheit in einen Triumph im Erwachsenenalter. Stollers Positionwird von einem Großteil der Psychoanalytiker geteilt und seine Definition der Perversion gilt damit als die verbindlichste (vgl. Brenner 1996; Eshel 2005; Stein 2000; Berner 2005).
Nach Stollers Ansicht bedeutet Kastrationsangst nicht einfach Angst vor dem Verlust des Lust spendenden Organs, sondern Angst vor dem Verlust der Identität als Mann und des Gefühls einer Zugehörigkeit, die sich auf die Geschlechtsidentität bezieht. Denn in der frühen Kindheit identifizierten sich zunächst beide Geschlechter mit der Mutter und entwickelten so eine primär weibliche Identität. Um sich wirklich männlich zu fühlen, müsse sich der Junge in seiner Entwicklung der Aufgabe stellen, seine ursprüngliche Identifikation mit der Weiblichkeit aufzugeben beziehungsweise sie zu transformieren. Eine Störung in diesem Transformationsprozess ist nach Stoller der stärkste Förderer der Perversion (»the greatest promotor of perversion« – Stoller 1975, S. 99).
Durch die Betonung der Notwendigkeit dieses Transformationsprozesses hat Stoller auch einen der wichtigsten psychodynamischen Faktoren angesprochen, der erklären kann, warum Perversionen bei Männern wesentlich häufiger anzutreffen sind als bei Frauen, die ja einen solchen Prozess der Desidentifizierung (Greenson 1968) nicht benötigen. Sie behalten ja ihr Leben lang die Geschlechtsidentität der Mutter bei. Ihre Abgrenzungen von der Mutter haben einen ganz anderen Charakter (vgl. Fast 1984).





























