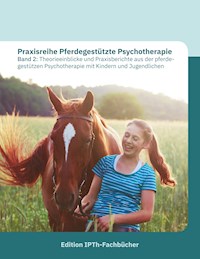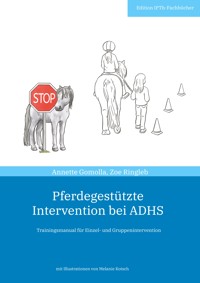
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch "Pferdegestützte Intervention bei ADHS" ist ein Trainingsmanual für die professionelle Pferdegestützte Therapie bzw. Reittherapie. Reittherapeut*innen erhalten ein durchdachtes und wissenschaftlich evaluiertes Training für Kinder mit Aufmerksamkeits-Defizit-Störungen für Einzel- und Gruppenintervention mit Pferd . Neben Fachinformationen zur Tier- und Pferdegestützten Therapie bei ADHS umfasst das Buch im ersten Teil eine ausführliche Beschreibung des Trainings. Der zweite Teil besteht aus den Trainingsaufgaben und Stundenabläufen. Eine begleitende Elternarbeit wird vorgestellt. Befundungs- und Befragungsbögen sind enthalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Ein Manual für die Pferdegestützte Therapie und Pädagogik - lange war dies für Fachkräfte, die mit Pferden arbeiten, nicht unbehagliche Vorstellung. Zu viel ist zu beachten bezüglich der Pferde und der einzelnen Klienten. Ein „Kochbuch“ für eine Intervention mit diesen wundervollen Lebewesen, die so viel ihrer eigenen Persönlichkeit in die Interventionen einbringen, konnte man sich schwer vorstellen. Und die individuellen Bedürfnisse der Pferde und Klienten? Wie können die in manualisierter Form berücksichtigt werden? Die Befürchtungen sind nicht aus der Welt geräumt, doch wir beobachten, dass sich das Feld der Pferdegestützten Interventionen mehr und mehr professionalisiert und die darin arbeitenden Personen ein hohes Maß an Verantwortung und Selbstreflexion mitbringen. Daher möchten wir mit diesem Manual eine Anleitungshilfe geben, um Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung eine möglichst durchdachte und auf ihre Schwierigkeiten zugeschnittene Intervention zu ermöglichen. Das Trainingsmanual stützt sich auf langjährige therapeutische Arbeitserfahrung mit Kindern und Pferden und einer großen Studie zur Pferdegestützten Therapie bei ADHS.
Wir erheben mit diesem Buch und der darin beschriebenen Intervention nicht den Anspruch, dass es die einzig mögliche Weise ist, mit Kindern mit ADHS zu arbeiten. Wir möchten Fachpersonen, die aus einem sozialen Grundberuf kommen und eine qualifizierende Weiterbildung im Sinne des Berufsverbandes für Fachkräfte Pferdegestützter Interventionen e.V. durchlaufen haben, eine Hilfestellung in der Planung und Durchführung einer Intervention geben, die auf Kinder mit ADHS zugeschnitten ist. Dabei bezeichnen wir die Intervention als „Training“, da viele verhaltenstherapeutische Methoden einbezogen sind. Wir hoffen, dass der Begriff „Training“ nicht negativ konnotiert verstanden wird. In einer Intervention, die die Hauptsymptomatik bei ADHS verändern möchte, ist es nötig, das Kind explizite Lernerfahrungen machen zu lassen und neue Verhaltensweisen einzuüben. Wir gehen mit den Kindern dabei einen Weg ausschließlich über positive Verstärkung. Durch die genaue Beschreibung und Operationalisierung der Intervention können unterschiedliche Therapeut*innen an verschiedenen Orten in verschiedenen Settings einen positiven therapeutischen Prozess gestalten.
Weiterhin wissen wir um die grundlegend therapeutische Wirkung der Nachnährung und Nachreifung durch die ausgebildeten und psychisch gesunden sowie in Beziehung stehenden Pferde. Wir möchten selbstverständlich, dass die Fachkräfte dieses Manual als Hilfestellung verstehen und weiterhin eigenständig entscheiden, wenn bei einem Kind andere Methoden und Inhalte im Vordergrund stehen sollten. Daher richtet sich dieses Manual ausschließlich an ausgebildete Fachkräfte Pferdegestützter Interventionen mit ihren ausgebildeten Therapiepferden. Letztere leisten eine unglaublich wertvolle Arbeit und ihre Bezugspersonen müssen über die individuelle Stressbelastbarkeit sowie Regulationsfähigkeit und -möglichkeiten wissen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude in der Umsetzung. Wir hoffen, dass Sie genauso positive Erfahrungen mit dieser fokussierten, therapeutischen Intervention machen wie wir.
Ihre Annette Gomolla und Zoe Ringleb
Konstanz, im März 2023
Inhalt
TEIL I: Theoretische Hintergründe
Kapitel 1: Grundlagen Aufmerksamkeitsdefizitstörung
1.1. Symptomatik bei ADHS
1.2. Diagnostik
1.3. Ätiologie
1.4. Verlauf
Kapitel 2: Komorbide Störungen
2.1 Störung des Sozialverhaltens
2.2 Bindungsstörungen
2.3 Trauma.
Kapitel 3: Etablierte Behandlungsansätze bei ADHS
3.1 Pharmakologie
3.2 Elterntrainings und Beratung von Erzieher*innen/Lehrer*innen
3.3 Verhaltenstherapeutische Trainings für Kinder
3.4 Neurofeedback- und Achtsamkeitsbasierte Trainings
Kapitel 4: Vertiefung kindzentrierter verhaltenstherapeutischer Interventionen bei ADHS
4.1 Marburger Konzentrationstraining.
4.2 Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern
4.3 ATTENTIONER
Kapitel 5: Tiergestützte Interventionen
5.1 Wissenschaftliche Befunde zur Tiergestützten Intervention bei ADHS
Kapitel 6: Pferdegestützte Intervention bei ADHS
6.1 Begründung für Pferdegestützte Interventionen bei ADHS
6.2 Rahmenbedingungen für Pferdegestützte Interventionen
6.3 Evaluationsstudie zum ADHS-Einzeltraining mit Pferd
TEIL II: Praxis der Pferdegestützten Intervention bei ADHS
Kapitel 7: ADHS-Training mit Pferd - Anleitung zur Einzelintervention
7.1 Elemente des Einzeltrainings
7.2 Befundung
7.3 Übungsübersicht Einzeltraining
7.4 Stundenabläufe Einzeltraining
Kapitel 8: ADHS-Training mit Pferd - Anleitung zur Gruppenintervention
8.1 Elemente des Gruppentrainings
8.2 Übungsübersicht Gruppentraining.
8.3 Stundenabläufe Gruppentraining.
Kapitel 9: ADHS-Training mit Pferd - Elternarbeit
9.1 Allgemeines zur Elternarbeit bei ADHS
9.2 Elternarbeit begleitend zum Pferdegestützten Training
9.3 Individuelles Training für Eltern am Pferd
Literaturverzeichnis
ANHANG
Autorenbeschreibung
Weitere Hinweise
TEIL I:
THEORETISCHE HINTERGRÜNDE
1. Grundlagen Aufmerksamkeitsdefizitstörung
Das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom gehört zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter und ist gekennzeichnet durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. In der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KIGGS Welle 21) in Deutschland wurde zwischen 2014 und 2017 die Prävalenz von ADHS untersucht. 4,4% der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen drei bis 17 Jahren wurden in diesem Zeitraum mit ADHS diagnostiziert (Göbel et al., 2018, S. 46), wobei mehr Jungen als Mädchen von diesem Störungsbild betroffen sind (Schäfer & Rüther, 2007). Im Vergleich mit der KIGGS Erhebung aus dem Jahr 2003-2006, zeigt sich ein Rückgang von circa einem Prozent der Lebenszeitprävalenz von ADHS. Es handelt sich hierbei jedoch nur um Kinder im Alter von drei bis acht Jahren. Grund für den Rückgang könnten veränderte bzw. verbesserte Maßnahmen in der Gesundheitsförderung und -versorgung sein (Göbel et al., 2018). Bei ca. 60% der Betroffenen ist ADHS eine chronische Symptomatik, die auch noch im Erwachsenenalter besteht (Häßler, 2008).
Die Behandlungsansätze in der Therapie von ADHS sind vielfältig und umfassen medikamentöse Behandlung, Verhaltenstherapie, Beratung von Eltern, Familien und pädagogischen Fachkräften (F. Petermann & Ruhl, 2011, S. 686).
Die Versorgung von Kindern mit ADHS umfasst in bislang noch unspezifischen Herangehensweisen tiergestützte und pferdegestützte Interventionen. Dieses Manual legt einen Grundstein für eine professionelle Pferdegestützte Intervention bei ADHS, welches alle fachlichen Hintergründe des Störungsbildes berücksichtigt. Das hier dargestellte Einzeltraining mit Pferd ist wissenschaftlich evaluiert, die Studienergebnisse werden beschrieben.
1.1 Symptomatik bei ADHS
Die drei Hauptsymptome der ADHS sind Aufmerksamkeitsstörungen, Impulsivität und Hyperaktivität (Wittchen & Hoyer, 2011). Die Aufmerksamkeitsstörung äußert sich durch eine hohe Ablenkbarkeit, dem Abbrechen von Aufgaben und Tätigkeiten und vielen Flüchtigkeitsfehlern. Außerdem meiden Betroffene Aufgaben, bei der eine längere kognitive Anstrengung gefordert wird und haben Schwierigkeiten bei der Organisation verschiedener Pflichten (Jacobs & Petermann, 2013). Die Impulsivität äußert sich auf kognitiver, emotionaler sowie motivationaler Ebene. Die Betroffenen platzen oft mit der Antwort heraus oder haben Schwierigkeiten ihre Emotionen zu kontrollieren. Kennzeichen der Hyperaktivität sind eine starke motorische Aktivität, welche durch die Betroffenen nur schwer reguliert werden kann sowie stetige Ruhelosigkeit mit innerer Unruhe (Wittchen & Hoyer, 2011).
1.2 Diagnostik
Eine multimodale Diagnostik zur eindeutigen Abgrenzung der Aufmerksamkeitsstörung zu anderen Störungsbildern ist unabdingbar. Zu Beginn wird ein Screening zur Überprüfung des Verdachts durchgeführt, wobei Eltern, Lehrer*innen sowie das betroffene Kind befragt werden. Ergeben sich hieraus Hinweise auf ADHS werden weitere diagnostische Schritte wie Interviews, Verhaltensbeobachtungen, psychologische Tests und eine medizinische Untersuchung durchgeführt.
Die Diagnose des ADHS kann nach zwei verschiedenen Diagnosesystemen erfolgen. Zum einen nach dem ICD-10 bzw. ICD-11 und zum anderen nach dem DSM-V . Damit es zu einer sicheren Diagnose von ADHS kommen kann, muss die Verhaltensstörung durch ausführliche Diagnostik sowie neurologische Untersuchungen einer ärztlichen Fachperson festgestellt werden (Brandau et al., 2020). Entwicklungsbedingt verändert sich das Verhalten in der Zeit vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter. In der Erkennung und Diagnose von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter sind daher Kenntnisse der Entwicklungspsychologie relevant. Nur so kann altersentsprechendes Verhalten gegenüber altersinadäquatem Verhalten abgegrenzt werden, was dementsprechend eine besondere Herausforderung an die Diagnose stellt (Ravens-Sieberer et al., 2011, S. 648).
Im ICD-10 und DSM-V werden zusätzliche Kriterien beschrieben, welche bei einer Diagnose von ADHS erfüllt sein müssen: Die Symptome müssen vor dem siebten Lebensjahr auftreten, mindestens sechs Monate lang bestehen, unangemessen für den Entwicklungsstand sein und mindestens zwei Lebensbereiche beeinträchtigen. Hiermit sind soziale, schulische oder berufliche Bereiche gemeint, in denen es zu einer klinisch bedeutsamen Beeinträchtigung kommt. Für die Diagnose müssen andere psychische Störungen, geistige Behinderung oder psychosoziale Probleme als Grund für das Verhalten ausgeschlossen werden können (Ravens-Sieberer et al., 2011, S. 648).
Nach DSM-V gehört ADHS zu den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung, was sich durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität äußert. Die Auswirkungen werden besonders in der Schule und in sozialen Interaktionen sichtbar. Es wird zwischen drei Typen unterschieden: 1) die Aufmerksamkeitsdefizit/-Hyperaktivitätsstörung als Mischtyp, welcher gleichermaßen durch eine Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität/Impulsivität gekennzeichnet ist; 2) der vorwiegend unaufmerksame Typ mit vermehrten Auffälligkeiten in der Unaufmerksamkeit; 3) der vorwiegend hyperaktive Typ mit Hyperaktivität/Impulsivität im Vordergrund (First, 2017, S. 211).
Die Diagnose F90.0- einfache Aufmerksamkeitsdefizit- und Aktivitätsstörung gehört im ICD-10 zu den Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend bzw. zu F90, den Hyperkinetischen Störungen. Eine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität (F98.80) gehört zu F 98.8 sonstigen nicht näher bezeichneten Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend.
Hyperkinetische Störungen beginnen in den ersten fünf Lebensjahren. Sie sind gekennzeichnet durch mangelnde Ausdauer bei der Durchführung einer kognitiven Tätigkeit, beispielsweise das Nichtbeenden von Aufgaben sowie eine desorganisierte, schwer zu regulierende und überschießende Aktivität. Kinder mit einer hyperkinetischen Störung werden oft als impulsiv, unachtsam und distanzlos erlebt.
Die Unaufmerksamkeit ist gekennzeichnet durch Schwierigkeiten die Aufmerksamkeit bei Aufgaben aufrechtzuerhalten, mangelnde Organisationsfähigkeit oder einer hohen Ablenkbarkeit. Zudem fällt es den Betroffenen schwer, Schulaufgaben zu erledigen bzw. zu beenden. Sie verlieren Gegenstände, vergessen Aufgaben, oder erwecken den Eindruck, zu träumen und nicht ansprechbar zu sein.
Motorische Unruhe und fehlende Impulskontrolle sind Kennzeichen von Hyperaktivität und Impulsivität. Das zeigt sich beispielsweise in der Schule, sodass die betroffenen Kinder nicht ruhig auf ihren Plätzen sitzen können, ständig aufstehen oder Gespräche unterbrechen. Wenn auf einen Reiz hin gehandelt wird, ohne darüber nachzudenken und die Konsequenzen abzuwägen, dann wird von Impulsivität gesprochen. Diese Symptome sind von Kind zu Kind unterschiedlich ausgeprägt und können sich während der Entwicklung verändern. Unaufmerksamkeit und/ oder Hyperaktivität-Impulsivität müssen jedoch in unterschiedlichen Lebensbereichen wie zu Hause, in der Schule oder bei Freunden auftreten, damit ADHS diagnostiziert werden kann (Dilling et al., 2015).
Nach dem ICD-11 gehört ADHS nicht mehr zu den hyperkinetischen Störungen, sondern nun zu F06 psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungsstörungen. ADHS ist hier in der Kategorie der neuronalen Entwicklungsstörungen zu finden. Neuronale Entwicklungsstörungen sind gekennzeichnet durch Verhaltens- und kognitive Störungen, die den Erwerb und die Ausführung von intellektuellen, sprachlichen oder sozialen Funktionen beeinträchtigen, was sich während der Entwicklungsphase zeigt. Zudem wird von einem Beginn bereits in der frühen bis mittleren Kindheit ausgegangen. Es wird zwischen drei Subtypen von ADHS unterschieden: F6A05.0 vorwiegend unkonzentriert, F6A05.1 vorwiegend hyperaktiv-impulsiv und F6A05.2 kombiniert. Für die Diagnose müssen jeweils alle diagnostischen Kriterien für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung erfüllt sein. Vom vorwiegend unkonzentrierten Erscheinungsbild wird gesprochen, wenn die Unaufmerksamkeit überwiegt. Ebenso zeigt sich hyperaktivimpulsives Verhalten vermehrt beim vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ. Beim kombinierten Typ sind beide Symptome gleich stark ausgeprägt (World Health Organization, 2019).
Neue Ansätze in der Diagnostik und Therapie zum ADHS werden im Folgenden kurz beschrieben. Brown (2018) betrachtet ADHS nicht als eine Verhaltensstörung, sondern als eine Störung der Exekutivfunktionen, welche durch die Entwicklung beeinflusst wird und sich in der Lebensspanne von Kindheit und Jugendalter differenziert. „Unter dem Begriff ‚Exekutive Funktionen‘ werden Regulations- und Kontrollmechanismen zusammengefasst, die ein zielorientiertes und situationsangepasstes Handeln ermöglichen“ (Drechsler, 2007, S. 233). In Bezug auf die Diagnostik von ADHS postulieren F. Petermann und Macha (2005, S. 136), dass eine entwicklungsorientiere Diagnose für ADHS relevant sein könnte. Mithilfe von Entwicklungstests können Aussagen über den allgemeinen Entwicklungsstand des Kindes getroffen werden, da mehrere Funktionsbereiche erfasst werden (Esser & Petermann, 2010, S. 11). Zudem sind Entwicklungstests hilfreich, damit der Verlauf des Störungsbildes aufgezeigt werden kann, um dementsprechend die Interventionsmaßnahmen anzupassen (F. Petermann & Macha, 2005, S. 136).
Emotionale Unempfindsamkeit und Furchtlosigkeit vor den Konsequenzen des eigenen Verhaltens sind typische Merkmale. Die Kinder und Jugendlichen verspüren in der Regel keinen Leidensdruck und zeigen daher auch wenig Bereitschaft zur Veränderung. Zum Teil besitzen sie eine geringe Empathie für andere Menschen. Die Auftretenshäufigkeit dissozialer Auffälligkeiten steigt vom Kindes- bis zum Jugendalter an und verringert sich ab dem jungen Erwachsenenalter wieder. Art und Ausprägung der Symptomatik zeigen sich deutlich geschlechtsabhängig: Jungen zeigen häufiger direkte und ernsthaft aggressive Verhaltensweisen mit Delinquenz als Mädchen (F. Petermann & Petermann, 2013).
1.3 Ätiologie
ADHS ist eine komplexe Störung, die durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren beeinflusst wird. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine neurobiologische und genetische Störung handelt (Brandau et al., 2020, S. 14). Verschiedene Studien berichten eine hohe Vererbbarkeit von ADHS (Biederman, 2005; Coolidge et al., 2000; Martin et al., 2002), außerdem werden bei der Entstehung verschiedene neurobiologische Faktoren diskutiert. Bei Kindern mit ADHS zeigt sich eine Verkleinerung verschiedene Gehirnareale, wie z.B. dem Corpus callosum (Giedd et al., 1994) oder den Basalganglien (Filipek et al., 1997). Durch bildgebende Verfahren konnte gezeigt werden, dass bei Kindern mit ADHS Regionen des Präfrontalkortex, die Verbindungsbahnen zum limbischen System und der Nucleus Caudatus schlechter durchblutet werden als bei Kindern ohne ADHS (Bush et al., 2005). Neurophysiologisch lässt sich die schlechtere Hemmung des Verhaltens durch eine Störung der exekutiven Funktionen erklären (Barkley & Murphy, 2006). Zudem besteht ein Zusammenhang zwischen einem geringen Geburtsgewicht und ADHS (Botting et al., 1997).
Weiterhin werden Veränderungen in verschiedenen Neurotransmittern berichtet, die die Entwicklung von ADHS bedingen. Dazu zählt Serotonin, welches für die Impulskontrolle verantwortlich ist, Noradrenalin, das die Aufmerksamkeit und Aktivität beeinflusst sowie Dopamin. Im zentralen Nervensystem ist Dopamin einer der wichtigsten Neurotransmitter, der für Aufmerksamkeits- und Impulskontrolle (Brandau et al., 2020, S. 34), Wahrnehmung, motorische Steuerung sowie Denken und Fühlen zuständig ist (Brandau et al., 2020, S. 27). Bei Betroffenen mit ADHS wurde eine geringe Sensitivität des Dopamin-D4-Rezeptor festgestellt, wodurch es zu einer verringerten Wirkung des Neurotransmitters kommen kann (Faraone et al., 2005).
Weitere Einflussfaktoren sind prä- und perinatale Bedingungen wie Alkoholmissbrauch, Sauerstoffmangel während der Schwangerschaft, Frühgeburt oder ein niedriges Geburtsgewicht (Faraone et al., 2005). Zudem wird vermutet, dass Umweltgifte wie Blei (David et al., 1972, S. 900) oder ein hoher Phosphatgehalt in Nahrungsmitteln Verhaltensstörungen wie ADHS bedingen können (Hafer, 1998), was aufgrund des eingeschränkten Forschungsstandes jedoch kritisch betrachtet werden muss. Psychosoziale Einflüsse sind keine Ursache der ADHS, dennoch beeinflussen sie die Ausprägung der Symptomatik. Im Zuge dessen spielt vor allem das familiäre Umfeld eine große Rolle. Dabei sind der Erziehungsstil, die Strukturierung des Alltages und die Bindungserfahrung der Kinder (Brandau et al., 2020, 36 ff.) zu nennen.
Das bio-psycho-soziale Modell von Döpfner et al. (2013, 17 f.) (siehe Abbildung 1) integriert verschiedene Ursachen und Prozesse zur Entstehung von ADHS. Vor allem die biologischen Ursachen wie genetische Dispositionen, Schädigungen des zentralen Nervensystems oder auch Toxine, Allergene und Nahrungsmittelintoleranzen können als ein Teil der Ursachen für die Entstehung von ADHS ausgemacht werden. Psychosoziale Belastungen haben zudem einen Einfluss auf neurobiologische Strukturen, was die Ausprägung der Symptomatik beeinflusst. Darüber hinaus steht die psychosoziale Ausgangssituation in einem wechselwirkenden Zusammenhang mit den Interaktionen und der sozialen Situation des Kindes.
Eine ungünstige familiäre Situation kann die ADHS-Symptomatik verschlimmern. Daraus können sich im Rückschluss wieder vermehrt Probleme in der Interaktion mit Bezugspersonen ergeben.
Abbildung 1: Bio-psychosoziales Modell zur Entstehung von ADHS (modifiziert nach Döpfner et. al., 2010)
1.4 Verlauf
Über die Altersstufen hinweg zeigen sich verschiedene Symptomatiken, die im Folgenden genauer beschrieben werden. Es soll jedoch erwähnt sein, dass sich die bisherigen Ergebnisse aus unterschiedlichen Studien hauptsächlich auf den Verlauf von Jungen beschränken, da, wie bereits bei der Prävalenz erwähnt wurde, mehr Jungen als Mädchen von ADHS betroffen sind.
Im Säuglings- und Kleinkindalter ist ein hohes körperliches und psychisches Aktivitätsniveau zu beobachten. Zudem zeigen sich Schlaf- und Essprobleme sowie eine schwierigere Interaktion zwischen Bezugspersonen und Kind. Während des Vorschulalters zeigen sich Hyperaktivität, wenig Spielausdauer, Entwicklungsdefizite und oppositionelle Verhaltensweisen. Im Schulunterricht sind Kinder mit ADHS häufig schnell abgelenkt, unruhig und haben Lernschwierigkeiten. Im sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen kann es zu einem ablehnenden Verhalten der anderen kommen. Allgemein zeigen sich Selbstwertprobleme, die den genannten Schwierigkeiten in diesem Alter zu Grunde liegen (Döpfner et al., 2013, S. 19). Die Hauptsymptomatik der ADHS zeigt sich bei den Betroffenen chronisch über die Lebenspanne hinweg. Hyperaktivität und Impulsivität können sich während des Lebensverlaufs verändern oder auch zurückbilden. Die Aufmerksamkeitsstörung hingegen bleibt ausgeprägt (U. Petermann & Petermann, 2019, S. 81). Im Jugendalter zeigen sich aggressives Verhalten sowie Auffälligkeiten im emotionalen Bereich, Alkohol- und/oder Drogenmissbrauch können hinzu kommen (Döpfner et al., 2013, S. 136).
Zu den Schutzfaktoren von ADHS zählen Geborgenheit auf emotionaler Ebene, Unterstützung durch die Familie, Kontakt zu Gleichaltrigen, körperliche Gesundheit sowie die kognitive Begabung des Kindes. Der letzte Aspekt hat vor allem eine große Auswirkung auf den schulischen Bereich. Die betroffenen Kinder kompensieren die ADHS-Symptomatik mit ihrer hohen Intelligenz.
Allgemein gilt zu sagen, dass eine frühzeitige Erkennung des Störungsbildes und entsprechende Therapiemaßnahmen maßgebende versorgungsbezogene Schutzfaktoren sind (Huss, 2008, S. 604). Hier wird auch von Präventionsmaßnahmen gesprochen. Unter dem Begriff Prävention werden Maßnahmen verstanden, die eine Krankheit verhindern oder den Krankheitsverlauf vermindern. Maßnahmen, die das Auftreten einer Störung verhindern, werden als primäre Präventionen bezeichnet (Zänker & Becker, 2006, S. 279). In Bezug auf ADHS wären dies Schutzmaßnahmen wie Unterstützung durch die Familie oder vermehrte Forschung zu den Ursachen und der Entstehung von ADHS. Die sekundäre Prävention umfasst vor allem eine Früherkennung, damit ein chronischer Verlauf verhindert werden kann. Folgeprobleme werden mit tertiärer Prävention versucht einzudämmen (Slesina, 2007), beispielsweise durch verschiedenen Behandlungsmaßnahmen.
1 KIGGS Erste Ergebnisse der KiGGS-Studie, zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Robert-Koch-Institut, https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/Basiserhebung/Ergebnisbroschuere.pdf?__blob=publicationFile (Stand Feb 2023)
2. Komorbide Störungen
Die Auswirkungen der ADHS sind mitunter sehr weitreichend und schwerwiegend. Die beschriebenen Symptome führen u.a. dazu, dass Kinder mit ADHS weniger beliebt sind und von Peers häufiger abgelehnt werden als Kinder ohne ADHS. Betroffene haben größere Schwierigkeiten, Freundschaften zu knüpfen und aufrecht zu erhalten (Gawrilow, 2016). In der weiteren Folge der ADHS kann es zu geringeren schulischen bzw. beruflichen Erfolgen, mehr Unfällen, einer weniger ausgeprägten Selbstfürsorge sowie einem höheren Risiko für Substanzmissbrauch als bei Menschen ohne ADHS kommen (Daly et al., 2016).
Zu diesen Problemen kommen in den meisten Fällen komorbide Störungen hinzu. 30 bis 50% haben oppositionelle Verhaltungsstörungen oder aggressiv-dissoziale Störungen. Häufig sind außerdem Lernstörungen (20%) und emotionale Störungen wie Angststörungen (20%), depressive Störungen (15%) und soziale Unsicherheit (Wittchen & Hoyer, 2011). Die Komorbiditäten sind vor allem bei Kindern mit hyperaktivem-impulsiven Verhalten zu finden (Lalonde et al., 1998). Im nachfolgenden werden einige der Komorbiditäten näher beleuchtet.
2.1 Störung des Sozialverhaltens
Unser Leben ist geprägt von sozialen Normen und Regeln für ein funktionierendes Zusammenleben. Wird davon über ein gewisses Maß abgewichen und „ein sich wiederholendes und andauerndes Muster dissozialen, aggressiven oder aufsässigen Verhaltens“ (Dilling & Freyberger, 2019, S. 314) beobachtet, wird dies als Störung des Sozialverhaltens bezeichnet. Wittchen und Hoyer (2011) zählen zu den klinisch relevanten Verhaltensweisen „ein extremes Maß an Streiten oder Tyrannisieren, ungewöhnlich häufige oder schwere Wutausbrüche und Ungehorsam, Grausamkeit gegenüber Menschen oder Tieren, (…) Beschädigungen von Eigentum, Brandstiftung, Stehlen, Lügen (...) Schulabsentismus oder dem Weglaufen von zu Hause“. Bei aggressiven und dissozialen Verhaltensweisen wird zwischen impulsiver Aggression und instrumenteller Aggression unterschieden. Die impulsive-aggressive Unterform zeichnet sich durch Ängstlichkeit auf der einen und eine starke Impulsivität auf der anderen Seite aus. Betroffene haben Schwierigkeiten in der Selbstkontrolle, eine geringe Frustrationstoleranz und sie nehmen Handlungen anderer Menschen verzerrt wahr, nämlich verstärkt als Bedrohung oder Benachteiligung. Sie fühlen sich schnell von anderen angegriffen und reagieren mit impulsiv-feindseligem Verhalten. Der instrumentell-aggressive Typ handelt nicht aus dem Affekt heraus aggressiv, sondern um andere zu dominieren und seine eigenen Ziele zu erreichen.
2.2 Bindungsstörungen
Einige Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen Bindungsstörungen und ADHS hin. In einem Review Artikel von Storebø et al. (2016) wurde ein klarer Zusammenhang zwischen ADHS und unsicherem Bindungsverhalten festgestellt. Risikofaktoren sind dem Artikel zufolge: Probleme in der Eltern-Kind-Beziehung, ungelöste, während der Schwangerschaft erlebte Trauer, depressive Symptome der Eltern und inkonsistente oder ablehnende Erziehungsstile. Des Weiteren haben kleine Kinder mit unsicherem Bindungsverhalten eine schlechtere Aufmerksamkeit. Ob ADHS zu Bindungsstörungen oder Bindungsstörungen zu ADHS führen, ist nicht klar. Möglicherweise stellen sie gegenseitige Risikofaktoren dar. Somit kann eine reine ADHS-Therapie mitunter nur geringe Effekte erzielen, da möglicherweise eine Bindungsstörung die Ursache oder auch die Folge ist. In Therapien sollten somit beide Störungen berücksichtigt werden.
2.3 Traumatisierung
Als eine weitere komorbide Störung bei ADHS wird psychische Traumatisierung diskutiert. Umweltstressoren können bei Kindern und Jugendlichen „motorische Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, explosionsartige aggressive Ausbrüche und emotionale Konstriktion“ auslösen (Kate Szymanski et al., 2011). Es wird angenommen, dass Kinder durch traumatische Erlebnisse ihren Affekt schlechter regulieren können und sehr stark auf geringe Belastungen oder Reize reagieren (Luxenberg et al., 2001). Diese Probleme entsprechen in etwa den Symptomen einer ADHS (Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität, Impulsivität) und können die Anfälligkeit dafür erhöhen oder die Symptome verschlimmern (Weinstein et al., 2000). In einer Studie von Famularo et al. (1996) ergab sich, dass etwa ein Drittel aller stark misshandelter Kinder Anzeichen von ADHS zeigten. Ebenfalls wurde ein Zusammenhang zwischen ADHS und Traumata der Eltern (Daud & Rydelius, 2009) aufgezeigt.
Der Zusammenhang zwischen Trauma und ADHS besteht nur in eine Richtung. Das Risiko für Traumata und Posttraumatische Belastungsstörungen wird durch ADHS nicht erhöht (Wozniak et al., 1999).
Ebenso wie bei komorbiden Störungen ist eine solide Diagnostik und auf Traumatisierung ausgerichtete Behandlung wichtig.
3. Etablierte Behandlungsansätze bei ADHS
Die Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie weisen auf einen multimodalen Ansatz in der Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizitstörung hin. Das bedeutet, dass mehrere therapeutische und pädagogische Ansätze ineinandergreifen und in Kombination mit pharmakologischer Behandlung umgesetzt werden sollen. Letztere sollte nicht ohne andere Therapie- und Beratungsangebote durchgeführt werden (Warnke & Wewetzer, 2003, S. 155). Im Weiteren sollen kurz die Behandlungsansätze vorgestellt werden und für eine ausführlichere Information auf die Stellungnahme der Bundesärztekammer verwiesen werden.
3.1 Pharmakologie
In der Pharmakotherapie ist die Stimulanzientherapie (hauptsächlich Methylphenidat) von allen Therapieformen am besten belegt und diese Präparate werden am häufigsten verschrieben. Der Anteil der Kinder über fünf Jahren, die auf die Behandlung positiv ansprechen (Responder), liegt bei etwa 70% (Döpfner, Banaschewski & Sonuga-Barke, 2008).
Zu den Psychostimulanzien zählen Methylphenidat (unter den Handelsnamen Ritalin, Medikinet, Medikenet retard, Methylphenidat HEXAL, Concerta, Equasim) und DL-Amphetaminsulfat (Handelsname Dexamin). Des Weiteren kommt der Wirkstoff Atomoxetin zum Einsatz (Handelsnamen Atomoxetin, Atomoxe, Agakalin, Strattera).
Methylphenidat führt zu einer Dopaminausschüttung wodurch die Aufmerksamkeit und das Lernen positiv beeinflusst werden (Tye et al., 2010). D-L-Amphetamine wirken in ähnlicher Weise. Atomoxetin dagegen ist kein Psychostimulanz und wirkt als selektive Hemmung des Noradrenalintransporters (Newcorn et al., 2005). Dadurch wird das Noradrenalin nicht in die rückliegende Synapse wieder aufgenommen und steht für die Weiterleitung im synaptischen Spalt zur Verfügung.
Die häufigsten Nebenwirkungen der Pharmakotherapie sind leichtere Durchschlafstörungen und eine Verminderung des Appetits. Einige Kinder reagieren anfangs mit Bauch- und Kopfschmerzen, die jedoch im Laufe der Therapie verschwinden. In etwa 1-2% der Fälle treten motorische oder vokale Ticstörungen auf (Barkley, 2011).
Dem eindeutigen empirischen Nachweis über die Kurzzeit-Wirksamkeit von Methylphenidat steht eine geringere Anzahl von Untersuchungen über Langzeiteffekte gegenüber, die eine bessere Prognose von ausschließlich mit Psychostimulanzien behandelten Kindern überwiegend nicht nachweisen konnten. Schlägt eine Therapie durch Psychostimulanzien nicht an, führt zu Nebenwirkungen oder liegt eine komorbide Depression vor, kann eine Behandlung durch Antidepressiva angezeigt sein (Barkley, 2011).